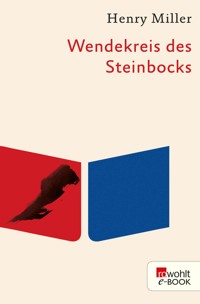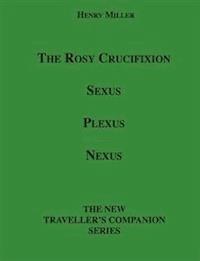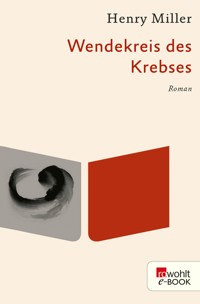
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit diesem jahrzehntelang verketzerten und verbotenen Buch fegte der einst verfemte, heute weltberühmte Autor alle Tabus hinweg. Es war der erste heftige Angriff gegen eine Gesellschaft, die den Boden bereitet, auf dem das Laster gedeiht. Es schlug die entscheidende Bresche in eine Mauer von Heuchelei und Prüderie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Henry Miller
Wendekreis des Krebses
Roman
Über dieses Buch
Mit diesem jahrzehntelang verketzerten und verbotenen Buch fegte der einst verfemte, heute weltberühmte Autor alle Tabus hinweg. Es war der erste heftige Angriff gegen eine Gesellschaft, die den Boden bereitet, auf dem das Laster gedeiht. Es schlug die entscheidende Bresche in eine Mauer von Heuchelei und Prüderie.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die Dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2019
Copyright © 1962 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Tropic of Cancer» Copyright © by Henry Miller, Big Sur, Cal., USA
Umschlag-Konzept any.way, Hamburg, Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
ISBN 978-3-644-00585-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Hier haben wir ein Buch, das, wenn es dergleichen gäbe, unser Verlangen nach den ursprünglichen Wirklichkeiten wieder wecken kann. Sein vorherrschender Ton wird ein Ton der Bitterkeit scheinen, und wirklich ist darin Bitterkeit die Fülle. Doch auch eine wilde Ausgelassenheit ist darin, eine irre Fröhlichkeit, eine Verve, ein lustvolles Behagen, zuweilen fast ein Delirium. Ein ständiges Schwanken zwischen den Extremen mit öden Zwischenstrecken, die wie Messing schmecken und den ganzen Geschmack der Leere hinterlassen. Es steht jenseits von Optimismus oder Pessimismus. Der Verfasser hat uns den letzten frisson gegeben. Geheimere Schlupfwinkel kennt der Schmerz nicht.
In eine Welt, die durch Selbstbespiegelung gelähmt ist und sich an erlesenen geistigen Speisen übernommen hat, dringt diese brutale Bloßstellung des wirklichen Körpers wie ein lebenspendender Blutstrom. Gewaltsamkeit und Obszönität werden unverfälscht gelassen als Äußerung von Geheimnis und Schmerz, den ständigen Begleiterscheinungen des Schöpfungsvorganges.
Der belebende Wert der Erfahrung, der Hauptquelle von Weisheit und Schöpfertum, wird wieder zur Geltung gebracht. Es bleiben weite Gebiete voll unvollendeter Gedanken und Taten, ein Bündel von Fetzen und Fasern, mit denen die allzu Kritischen sich selbst erdrosseln mögen. Über seinen Wilhelm Meister hat Goethe einmal gesagt: «Man sucht einen Mittelpunkt, und das ist schwer und nicht einmal gut. Ich sollte meinen, ein reiches mannigfaltiges Leben, das unseren Augen vorübergeht, wäre auch an sich etwas ohne ausgesprochene Tendenz, die doch bloß für den Begriff ist.»
Das Buch wird allein durch Fluß und Wechsel der Ereignisse auf seiner eigenen Achse gehalten. Gerade weil es keinen Mittelpunkt gibt, ist auch keine Rede von Heldentum oder Kampf, da auch keine Rede von Willen ist, sondern nur von einer Hingabe an das Strömen.
Vielleicht sind die groben Karikaturen deshalb lebensvoller, ‹naturgetreuer› als die durchgeführten Porträts des herkömmlichen Romans, weil das Individuum heute keine Mitte hat und nicht die leiseste Illusion der Ganzheit hervorbringt. Die Figuren werden in die falsche kulturelle Leere einbezogen, in der wir ertrinken; so entsteht die Illusion des Chaos, dem entgegenzutreten äußersten Mut verlangt.
Die Demütigungen und Niederlagen, die mit ursprünglicher Aufrichtigkeit dargestellt werden, führen nicht zu Enttäuschung, Verzweiflung oder Sinnlosigkeit, sondern zu einem Hunger, einem ekstatischen, verzehrenden Hunger – nach mehr Leben. Das Dichterische wird freigelegt durch ein Abstreifen des Kunstgewandes, durch eine Rückkehr zu dem, was sich als ‹vorkünstlerische Ebene› bezeichnen ließe; das dauerhafte Skelett der Form, das in den Erscheinungen der Auflösung verborgen ist, wird erneut sichtbar, um wieder in das ständig wechselnde Fleisch des Gefühls verwandelt zu werden. Die Narben werden weggebrannt, die Narben, die von den Geburtshelfern der Kultur hinterlassen worden sind. Hier haben wir einen Künstler, der die Macht der Illusion wiederherstellt, indem er die offenen Wunden anstarrt und sich der erschreckenden psychologischen Wirklichkeit annimmt, der der Mensch durch Hinwendung zur hinterhältigen Symbolik der Kunst zu entgehen versucht. Hier werden die Symbole bloßgelegt, werden von diesem überzivilisierten Individuum fast ebenso naiv und schamlos dargestellt wie von dem bodenständigen Wilden.
Die Ursprünge dieses wilden Lyrismus hegen nicht in einem falschen Primitivismus. Er ist keine rückschrittliche Tendenz, sondern ein Schritt vorwärts auf unbetretenen Boden. Ein nacktes Buch wie dieses mit demselben kritischen Blick zu betrachten, den man sogar auf so verschiedene Erscheinungen wie Lawrence, Breton, Joyce und Céline wirft, ist ein Mißverständnis. Wir wollen lieber versuchen, es mit den Augen eines Patagoniers zu betrachten, für den alles in unserer Welt Geheiligte und Tabuierte bedeutungslos ist. Denn das Abenteuer, das den Verfasser zu den geistigen Endpunkten der Erde geführt hat, ist die Geschichte jedes Künstlers, der, um sich selbst auszudrücken, das ungreifbare Netzwerk seiner Phantasiewelt durchqueren muß. Die Luftlöcher, die Alkaliwüsten, die zerfallenden Monumente, die verwesenden Leichen, der verrückte Gigue- und Madentanz, all das bildet ein großes Fresko unserer Epoche, das mit zerstörerischer Sprachgewalt und lauten, schrillen Hammerschlägen ausgeführt ist.
Wenn sich hier eine Fähigkeit offenbart, zu schockieren und die Leblosen aus ihrem tiefen Schlaf zu schrecken, so wollen wir uns dazu beglückwünschen: denn die Tragödie unserer Welt besteht gerade darin, daß nichts mehr imstande ist, sie aus ihrer Lethargie aufzuscheuchen. Es gibt keine heftigen Träume mehr, keine Erquickung, kein Erwachen. In der Betäubung, die die Selbsterkenntnis erzeugt hat, gehen Leben und Kunst dahin und entgleiten uns. Wir treiben mit der Zeit und kämpfen gegen Schatten. Wir brauchen eine Blutübertragung.
Und was uns hier geboten wird, ist Fleisch und Blut. Essen, Trinken, Lachen, Begehren, Leidenschaft und Neugier, die schlichten Wirklichkeiten, die den Wurzeln unserer höchsten und unbestimmtesten Schöpfungen Nahrung geben. Der Überbau ist weggeschlagen. Dieses Buch führt einen Wind mit sich, der die toten und hohlen Bäume umbläst, deren welke Wurzeln im unfruchtbaren Boden unserer Zeit verdorrt sind. Dieses Buch dringt bis zu den Wurzeln vor und gräbt tiefer, gräbt nach unterirdischen Quellen.
ANAÏS NIN
1934
Wendekreis des Krebses
An die Stelle von Romanen werden schließlich Tagebücher oder Autobiographien treten – faszinierende Bücher, wenn ein Mann es nur versteht, aus dem, was er für seine Erfahrungen hält, das auszuwählen, was wirklich seine Erfahrung ist, und die Wahrheit wahrheitsgemäß aufzuzeichnen.
Ralph Waldo Emerson
Ich wohne in der Villa Borghese. Hier ist nirgendwo eine Spur von Schmutz; kein Stuhl, der nicht an seinem Platz steht. Wir sind hier ganz allein und wie Tote.
Gestern abend entdeckte Boris, daß er verlaust war. Ich mußte seine Achselhöhlen ausrasieren, und selbst dann hörte das Jucken nicht auf. Wie kann man an einem so schönen Ort verlausen? Aber wie dem auch immer sei, jedenfalls wären wir wohl nie so intim geworden, Boris und ich, hätte es nicht diese Läuse gegeben.
Boris hat mir soeben eine Zusammenfassung seiner Ansichten gegeben. Er ist ein Wetterprophet. Das Wetter wird schlecht bleiben, sagt er. Es wird mehr Elend, mehr Tod, mehr Verzweiflung geben. Nirgends das geringste Anzeichen einer Änderung. Der Krebsschaden der Zeit frißt uns auf. Unsere Helden haben sich umgebracht oder bringen sich um. Der Held ist also nicht die Zeit, sondern die Zeitlosigkeit. Wir müssen im Schritt, im Stechschritt dem Gefängnis des Todes entgegenmarschieren. Es gibt kein Entrinnen. Das Wetter ändert sich nicht.
Jetzt ist es Herbst, und ich bin das zweite Jahr in Paris. Ich wurde hierhergeschickt aus einem Grunde, den ich noch nicht klar erkannt habe.
Ich habe kein Geld, keine Zuflucht, keine Hoffnungen. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Vor einem Jahr, vor sechs Monaten dachte ich noch, ich sei ein Künstler. Jetzt denke ich nicht mehr darüber nach, ich bin einer. Alles, was Literatur war, ist von mir abgefallen. Es gibt keine Bücher mehr, die geschrieben werden müßten, Gott sei Dank.
Und dies hier? Dies ist kein Buch. Dies ist Schmähung, Verleumdung, Diffamierung eines Charakters. Dies ist kein Buch im gewöhnlichen Sinn des Wortes. Nein, dies ist eine fortwährende Beleidigung, ein Maulvoll Spucke ins Gesicht der Kunst, ein Fußtritt für Gott, Menschheit, Schicksal, Zeit, Liebe, Schönheit … was man will. Ich werde für euch singen, vielleicht ein bißchen falsch, aber ich will singen. Ich will singen, während ihr verröchelt, will über eurem schmutzigen Leichnam tanzen …
Um zu singen, mußt du zuerst den Mund auftun. Du mußt zwei Lungen haben und ein bißchen was von Musik verstehen. Ein Akkordeon oder eine Gitarre sind dazu nicht nötig. Hauptsache ist, daß man singen will. Dies ist also ein Gesang. Ich singe.
Für dich, Tania, singe ich. Ich wünschte, ich könnte besser singen, melodischer, aber dann hättest du mich vielleicht niemals angehört. Du hast andere singen hören, und sie ließen dich kalt. Sie sangen zu schön – oder nicht schön genug.
Es ist der x-undzwanzigste Oktober. Ich kümmere mich nicht mehr um das Datum. Sagt man denn: mein Traum vom letzten 14. November? Es gibt Zwischenzeiten, aber sie liegen zwischen Träumen und hinterlassen nichts in unserem Bewußtsein. Die Welt um mich löst sich auf, läßt da und dort Zeitfetzen zurück. Die Welt ist ein Krebs, der sich selbst auffrißt … Ich glaube, wenn das große Schweigen sich auf alles und überall herabsenkt, wird endlich die Musik triumphieren. Wenn alles wieder in den Schoß der Zeit zurückgekehrt ist, wird das Chaos wieder hergestellt sein, und das Chaos ist die Tafel, die mit der Wirklichkeit beschrieben ist. Du, Tania, bist mein Chaos. Und darum singe ich. Ich bin es nicht einmal, es ist die sterbende Welt, die die Haut der Zeit abstreift. Ich lebe noch, rege mich in deinem Schoß, einer Wirklichkeit, die beschrieben werden kann.
Hindämmern. Die Physiologie der Liebe. Der Wal mit seinem im Ruhezustand sechs Fuß langen Penis. Die Fledermaus – penis libre. Tiere mit einem Knochen im Penis. Daher: hart wie ein Knochen. «Zum Glück», sagt Gourmont, «ist die Knochenversteifung beim Menschen weggefallen.» Zum Glück? Ja, zum Glück. Man stelle sich die Menschheit vor, wie sie mit einem Knochenharten herumläuft. Das Känguruh hat einen doppelten Penis – einen für die Woche und einen für die Feiertage. Dämmern. Ein Brief von einem Weibsbild, das anfragt, ob ich einen Titel für mein Buch gefunden habe. Titel? Sicher: «Liebliche Lesbierinnen.»
Dein anekdotisches Leben! Eine Redewendung Borowskis. Mittwochs esse ich immer bei Borowski. Seine Frau, die eine ausgetrocknete Kuh ist, führt den Vorsitz. Sie lernt jetzt Englisch – ihr Lieblingswort ist ‹filthy›. Man sieht sofort, was für Nervensägen die Borowskis sind. Aber wartet nur …
Borowski trägt Kordsamtanzüge und spielt Akkordeon. Eine unschlagbare Kombination, besonders wenn man bedenkt, daß er kein schlechter Künstler ist. Er gibt vor, Pole zu sein, aber er ist natürlich keiner. Er ist Jude, Borowski, und sein Vater war Briefmarkensammler. Tatsächlich ist fast der ganze Montparnasse jüdisch; oder halbjüdisch, was schlimmer ist. Wie Carl und Paula und Cronstadt und Boris und Tania und Sylvester und Moldorf und Lucille. Alle außer Fillmore! Henry Jordan Oswald entpuppte sich ebenfalls als Jude. Louis Nichols ist Jude. Sogar Van Norden und Chérie sind jüdisch. Frances Blake ist Jude oder vielmehr Jüdin. Titus ist Jude. Ich bin ganz eingeschneit von Juden. Dies schreibe ich für meinen Freund Carl, dessen Vater Jude ist. All das zu verstehen ist wichtig.
Die reizendste Jüdin von ihnen allen ist Tania, und ihr zuliebe würde ich selbst Jude werden. Warum nicht? Ich spreche schon wie ein Jude. Und ich bin so häßlich wie ein Jude. Außerdem, wer haßt den Juden mehr als der Jude?
Dämmerstunde. Indigoblau, gläsernes Wasser, die Bäume schimmern und zerfließen. Die Schienen verschwinden im Kanal bei Jaurès. Die lange Raupe mit ihren lackierten Flanken taucht ein wie ein Küstenschiff. Es ist nicht Paris. Es ist nicht Coney Island. Es ist eine dämmerige Mischung aller Städte Europas und Mittelamerikas. Die Rangierbahnhöfe unter mir, die schwarzen, spinnwebhaften Schienen, nicht in technischer Ordnung, sondern in wirrem Muster wie die düsteren Risse im Polareis, die die Kamera in Schattierungen von Schwarz festhält.
Essen ist eines der Dinge, die ich sehr zu schätzen weiß. Und in dieser herrlichen Villa Borghese findet sich selten eine Spur von etwas Eßbarem. Zuweilen ist es einfach schrecklich. Ich habe Boris schon so oft gebeten, Brot zum Frühstück zu bestellen, aber er vergißt es immer. Anscheinend geht er zum Frühstück aus. Und wenn er zu rückkommt, stochert er in seinen Zähnen, und in seinem Spitzbart hängt ein wenig Ei. Er ißt im Restaurant, aus Rücksicht auf mich. Er sagt, es sei ihm peinlich, eine richtige Mahlzeit zu essen, während ich zusehe.
Ich mag Van Norden, teile aber nicht seine Ansicht über sich selbst. Ich bin zum Beispiel nicht mit ihm einig, daß er ein Philosoph oder ein Denker ist. Er ist fotzennärrisch, weiter nichts. Und er wird nie ein Schriftsteller sein. Ebensowenig wird Sylvester je einer sein, wenn auch sein Name in fünftausendfacher Kerzenstärke roten Lichtes leuchten sollte. Die einzigen Schriftsteller aus meiner Umgebung, für die ich Achtung aufbringe, sind Carl und Boris. Sie sind besessen. Sie glühen innerlich mit weißer Flamme. Sie sind verrückt und unmusikalisch. Sie sind Leidende.
Moldorf dagegen, der auf seine Art auch leidet, ist nicht verrückt. Moldorf ist worttrunken. Er hat keine Adern oder Blutgefäße, weder Herz noch Nieren. Er ist ein Schrankkoffer mit unzähligen Schubfächern, und in den Schubfächern liegen Zettel, vollgeschrieben mit weißer Tinte, brauner Tinte, roter Tinte, blauer Tinte, zinnoberrot, safrangelb, malvenfarben, Sienna, Aprikose, Türkis, Onyx, Anjou, Hering, Corona, Grünspan, Gorgonzola …
Ich habe die Schreibmaschine ins Nebenzimmer gebracht, wo ich mich beim Sehreiben im Spiegel sehen kann.
Tania ist wie Irène. Sie erwartet dickes Kaliber. Aber es gibt noch eine andere Tania, eine Tania wie eine schwere Frucht, die überall Samen verstreut – oder, sagen wir frei nach Tolstoi, eine Stallszene, in der der Fötus ausgegraben wird. Tania ist auch ein Fieber – les voies urinaires, Café de la Liberté, Place des Vosges, grelle Krawatten auf dem Boulevard Montparnasse, dunkle Badezimmer, Porto Sec, Abdullah-Zigaretten, das Adagio der Sonate pathétique, Tonverstärker, anekdotenhafte Zusammenkünfte, sienabraune Brüste, dicke Strumpfbänder, wieviel Uhr ist es, goldbraune Fasanen mit Kastanien gefüllt, Taffetfinger, dunstiges Dämmer, das zu Stechpalmen wird, Elephantiasis, Krebs und Delirium, warme Schleier, Poker-chips, Teppiche aus Blut und weiche Schenkel. Tania sagt, daß es jeder hören kann: «Ich liebe ihn!» Und während Boris sich mit Whisky vollaufen läßt, sagt sie: «Setz dich her! O Boris … Rußland … was soll ich machen? Es zerreißt mich!»
Wenn ich nachts Boris' Spitzbart auf dem Kissen liegen sehe, werde ich hysterisch. O Tania, wo ist jetzt deine warme Möse, diese dicken, schweren Strumpfbänder, diese weichen, üppigen Schenkel? In meinem Pint ist ein sechs Zoll langer Knochen. Ich will jede Falte in deiner Möse aushobeln, samenträchtige Tania. Ich will dich zu deinem Sylvester heimschicken mit einem Schmerz im Bauch, den Uterus nach außen gestülpt. Dein Sylvester! Ja, er versteht ein Feuer zu machen, aber ich weiß, wie man eine Möse entflammt. Ich schieße heiße Bolzen in dich, Tania. Ich mache deine Ovarien weißglühen. Dein Sylvester ist jetzt ein bißchen eifersüchtig? Er merkt etwas, wie? Er merkt die Spuren meines großen Pints. Ich habe die Ufer ausgeweitet, die Falten ausgebügelt. Nach mir kannst du Hengste nehmen, Bullen, Widder, Drachen oder Bernhardinerhunde. Du kannst Kröten, Fledermäuse, Eidechsen in deinen Mastdarm stopfen. Du kannst Arpeggios kacken, wenn du willst, oder eine Zither über deinen Nabel spannen. Ich ficke dich, Tania, daß du gefickt bleibst. Und wenn du Angst hast, öffentlich gefickt zu werden, dann ficke ich dich heimlich. Ich will ein paar Haare an deiner Möse ausreißen und sie an Boris' Kinn kleben. Ich will in deine Klitoris beißen und Zweifrancsstücke spukken …
Indigohimmel, reingefegt von flockigen Wolken, endlos gereihte, kahle Bäume, die ihre schwarzen Äste wie Schlafwandler bewegen. Düstere, geisterhafte Bäume, deren Stämme fahl sind wie Zigarrenasche. Eine erhabene und ganz europäische Stille. Fensterladen geschlossen, Geschäfte verriegelt. Ein rotes Glühen hier und dort, Zeichen für ein Stelldichein. Die Häuserfronten schroff, fast abweisend; makellos nur die von den Bäumen geworfenen Schattenflecken. Als ich an der Orangerie vorüberkomme, werde ich an ein anderes Paris erinnert, das Paris von Maugham, von Gauguin, das Paris von George Moore. Ich denke an jenen schrecklichen Spanier, der damals mit seinen akrobatischen Sprüngen von Stil zu Stil die Welt erregte. Ich denke an Spengler und seine furchtbaren Aufrufe und frage mich, ob es Stil, Stil im großen Sinne, nicht mehr gibt. Ich sage, daß ich von diesen Gedanken erfüllt bin, aber das stimmt nicht. Erst später, nachdem ich die Seine überschritten und den Karneval der Lichter hinter mir gelassen habe, erlaube ich meinem Verstand, mit diesen Ideen zu spielen. Im Augenblick kann ich nichts denken – außer daß ich ein empfindendes Wesen bin, dem das Wunder dieses Wassers, das eine vergessene Welt widerspiegelt, einen Stich versetzt. Die ganzen Ufer entlang neigen sieh die Bäume schwer über den trüben Spiegel; wenn der Wind sich erhebt und sie mit raschelndem Murmeln füllt, werden sie ein paar Tränen vergießen und schauern, während das Wasser vorüberwirbelt. Es erstickt mich. Niemand, dem ich ein Bruchteil meiner Empfindungen mitteilen kann …
Der Kummer mit Irène ist, daß sie einen Koffer hat statt einer Möse. Sie braucht dickes Kaliber, um es in ihrem Koffer zu verstauen. Riesig, avec des choses inouïes. Llona wiederum, die hatte vielleicht eine Möse! Ich weiß es, weil sie uns ein paar Haare von dort unten geschickt hat. Llona – eine Wildeselstute, wittert aus dem Wind ihr Vergnügen. Hinter jedem Busch und Hügel spielte sie die Hure – und manchmal in Telefonzellen und auf Toiletten. Sie kaufte ein Bett für König Carol und ein Rasierbecken mit seinen Initialen. Sie lag in Tottenham Court Road mit hochgezogenem Rock und befingerte sich selbst. Sie gebrauchte Kerzen, Feuerwerkskörper und Türgriffe. Kein Pint im ganzen Land war groß genug für sie – nicht einer. Männer drangen in sie ein und erschlafften. Sie wollte ausziehbare Schwengel, selbstzündende Raketen, siedeheißes Öl aus Wachs und Kreosot. Sie würde einem den Pint abschneiden und ihn für immer drin behalten, wenn man es ihr erlaubte. Eine Möse unter Millionen, Llona! Eine Laboratoriumsmöse und kein Lackmuspapier, das ihre Farbe annehmen konnte. Sie war auch eine Lügnerin, diese Llona. Das Bett für ihren König Carol hat sie nie gekauft. Sie krönte ihn mit einer Whiskyflasche, und ihre Zunge war voll Unflat und Vertröstungen auf morgen. Armer Carol, er konnte nur in ihr zusammenfallen und sterben. Sie tat einen Atemzug, und er fiel heraus wie ein totes Muscheltier.
Ein riesiges, dickes Kaliber, avec des choses inouïes. Ein Koffer ohne Riemen. Ein Loch ohne Schlüssel. Sie hatte einen deutschen Mund, französische Ohren, einen russischen Hintern. Möse international. Wenn die Flagge gehißt war, sah man bis zum Schlund hinauf rot. Man kam am Boulevard Jules-Ferry hinein und an der Porte de la Villette heraus. Man ließ seine Kalbsbrieschen in die Mistkarre fallen – eine rote Mistkarre, mit zwei Rädern, versteht sich. Am Zusammenfluß von Ourcq und Marne, wo das Wasser durch die Dämme gurgelt und wie Glas unter den Brücken liegt. Llona liegt nun dort, und der Kanal ist voll Glas und Splitter. Die Mimosen trauern, und an den Fensterscheiben rüttelt ein feuchter, dunstiger Furz. Eine Möse unter Millionen, Llona! Ganz Möse und ein Glasarsch, in dem man die Geschichte des Mittelalters lesen kann.
Auf den ersten Blick ist Moldorf die Karikatur eines Menschen. Basedow-Augen. Lippen wie Autoreifen. Stimme wie Erbsensuppe. Seine Weste umspannt ein birnenförmiges Bäuchlein. Wie man ihn auch ansieht, es ist immer der gleiche Anblick: Netsuke, Schnupftabaksdose, Elfenbeinstockgriff, Schachfigur, Fächer, ein Tempelmotiv. Er hat nun so lange gegoren, daß er amorph ist. Ihrer Vitamine beraubte Hefe. Ein Blumentopf ohne Gummibaum.
Die Weiber waren einmal im 9. Jahrhundert vergewaltigt worden, und noch einmal während der Renaissance. In gelben und weißen Mutterleibern wurde er durch die großen Vertreibungen getragen. Lange vor dem Exodus spuckte ihm ein Tatare ins Blut.
Sein Dilemma ist das des Zwerges. Mit seinem Basedow-Auge sieht er seine Silhouette auf eine unermeßliche Leinwand projiziert. Seine dem Schatten eines Stecknadelkopfes angemessene Stimme berauscht ihn. Er hört ein Dröhnen, wo andere nur ein Quieken hören.
Und sein Denken! Es ist ein Amphitheater, in dem der Schauspieler eine proteische Vorstellung gibt. Moldorf, vielgestaltig und unfehlbar, spielt seine Rollen – Clown, Jongleur, Schlangenmensch, Priester, Wüstling, Quacksalber. Das Amphitheater ist zu klein. Er sprengt es mit Dynamit. Das Auditorium ist betäubt. Er erschlägt es.
Ich versuche erfolglos, an Moldorf heranzukommen. Es ist, als versuche man Gott zu erreichen, denn Moldorf ist Gott – war nie etwas anderes. Ich bringe nur Worte zu Papier …
Ich hatte mir Ansichten über ihn gebildet, die ich fallengelassen habe: ich hatte dann andere Ansichten, die ich nun revidiere. Ich habe ihn festgenagelt, nur um zu entdecken, daß ich keinen Mistkäfer in der Hand hielt, sondern eine Libelle. Er hat mich durch seine Grobheit beleidigt und durch sein Zartgefühl überwältigt. Er war bis zum Ersticken geschwätzig, dann wieder still wie der Jordan.
Wenn ich ihn auf mich zutrotten sehe, um mich zu begrüßen, seine kleinen Pfoten ausgestreckt, mit schwitzenden Augen, dann habe ich das Gefühl, als begegne ich … Nein, auf diese Weise geht's nicht!
«Comme un œuf dansant sur un jet d'eau.»
Er hat nur einen Spazierstock, einen zweitklassigen. In seinen Taschen Papierschnipsel mit Rezepten gegen den Weltschmerz. Er ist jetzt geheilt, und dem kleinen deutschen Mädel, das ihm die Füße wusch, bricht das Herz. Er ist wie Mister Nonentity, der überall sein indisches Wörterbuch mit herumschleppt. «Für jedermann unumgänglich», was zweifellos unentbehrlich heißen soll. Borowski würde das alles unverständlich finden. Borowski hat für jeden Tag der Woche einen anderen Spazierstock – und einen besonderen für Ostern.
Wir haben so viele Dinge gemeinsam, daß es ist, als betrachtete ich mich selber in einem gesprungenen Spiegel.
Ich habe meine Manuskripte durchgesehen, mit Verbesserungen bekritzelte Seiten. Literatur, seitenweise. Das erschreckt mich ein wenig. Es ähnelt so sehr Moldorf. Nur, ich bin ein Ungläubiger, und Ungläubige leiden auf andere Art. Sie leiden ohne Neurosen, und, wie Sylvester sagt, ein Mensch, der nie eine Neurose gehabt hat, weiß nicht, was Leiden heißt.
Ich erinnere mich deutlich, wie ich mein Leiden genoß. Es war, als nähme man ein Tierjunges mit sich ins Bett. Gelegentlich drückte es einem seine Krallen ins Fleisch – und dann bekam man es wirklich mit der Angst zu tun. Gewöhnlich hat man keine Angst – man konnte es immer freilassen oder ihm den Kopf abschlagen.
Es gibt Menschen, die der Versuchung nicht widerstehen können, in einen Käfig mit wilden Bestien hineinzugehen und sich zerfleischen zu lassen. Sie gehen sogar ohne Revolver oder Peitsche hinein. Die Furcht macht sie furchtlos … Für den Juden ist die Welt ein mit wilden Bestien gefüllter Käfig. Die Tür ist zugesperrt, und er steht da ohne Peitsche oder Revolver. Sein Mut ist so groß, daß er den Dung in der Ecke nicht einmal riecht. Die Zuschauer applaudieren, aber er hört es nicht. Das Drama, denkt er, spielt sich im Käfig ab. Der Käfig, denkt er, ist die Welt. Wie er allein und hilflos dasteht bei verschlossener Tür, findet er, daß die Löwen seine Sprache nicht verstehen. Nicht ein Löwe hat je von Spinoza gehört. Spinoza? Sie können nicht einmal ihre Zähne in ihn schlagen. «Gib uns Fleisch!» brüllen sie, während er dasteht, versteinert, seine Ideen eingefroren, seine Weltanschauung ein Trapez außer Reichweite. Ein einziger Hieb mit der Löwentatze, und sein Weltbild ist zerschmettert.
Die Löwen sind ebenfalls enttäuscht. Sie erwarteten Blut, Knochen, Knorpeln, Sehnen. Sie kauen und kauen, aber die Worte sind Chicle, und Chicle ist unverdaulich. Es ist ein Grundstoff, den man mit einer Schicht Zucker, Pepsin, Thymian, Lakritze überzieht. Chicle ist okay, wenn ihn Chicleros gesammelt haben. Die Chicleros kamen über die Landbrücke eines versunkenen Kontinents herein. Sie brachten eine algebraische Sprache mit. In der Wüste von Arizona begegneten sie den wie Auberginen glänzenden Mongolen des Nordens, kurz nachdem die Erde in ihrer Kreiselbewegung eine Neigung gemacht hatte, als die Wege des Golfstroms und der japanischen Meeresströmung sich teilten. Im Erdinnern fanden sie Tuffstein. Sie bestickten sogar noch die Eingeweide der Erde mit ihrer Sprache. Sie aßen einer des anderen Innereien, und die Wälder schlossen sich über ihnen, über ihren Gebeinen und ihren Schädeln samt ihren Tuffstein-Spitzen. Ihre Sprache ging verloren. Da und dort findet man noch die Überbleibsel einer Menagerie, eine mit Zeichen bedeckte Hirnschale.
Was hat das alles mit dir zu tun, Moldorf? Das Wort ist in deinem Munde Anarchie. Sprich es aus, Moldorf, ich warte darauf. Niemand kennt die Ströme, die durch unseren Schweiß pulsen, wenn wir uns die Hände schütteln. Während du deine Worte wählst, mit halbgeöffneten Lippen, wobei Speichel hinter deinen Wangen gurgelt, bin ich mit einem Sprung über halb Asien weg. Wenn ich deinen Stock, zweitklassig wie er ist, ergreifen und dir ein kleines Loch in die Seite stoßen würde, könnte ich genug Material sammeln, um das Britische Museum damit zu füllen. Wir stehen fünf Minuten beisammen und verschlingen Jahrhunderte. Du bist das Sieb, durch das sich meine Anarchie zwängt, sich in Worte auflöst. Hinter dem Wort steht das Chaos. Jedes Wort ist ein Band, ein Gitterstab, aber es gibt nicht genug Stäbe und wird nie genug geben, um ein Gitter zu bilden.
In meiner Abwesenheit wurden Vorhänge an die Fenster gehängt. Sie sehen aus wie in Lysol getauchte Tiroler Tischtücher. Das Zimmer funkelt. Ich sitze betäubt auf meinem Bett und denke über den Menschen vor seiner Geburt nach. Plötzlich beginnen Glocken zu läuten, eine geisterhafte, unirdische Musik, als wäre ich in die Steppen Zentralasiens versetzt. Manche klingen aus mit langem, nachhallendem Schlag, manche dröhnen trunken, rührselig. Und nun ist es wieder still, außer einem letzten Ton, der kaum die Nachtstille streift – nur eben ein ferner, heller Gong, ausgelöscht wie eine Flamme.
Ich habe mit mir einen stillschweigenden Vertrag abgeschlossen, von dem, was ich schreibe, keine Zeile zu ändern. Ich habe kein Interesse daran, meine Gedanken zu vervollkommnen, so wenig wie meine Handlungen. Der Vollkommenheit Turgenjews stelle ich die Vollkommenheit Dostojewskis gegenüber. (Gibt es etwas Vollkommeneres als Der ewige Gatte?) Hier haben wir in ein und derselben Kunstform zwei Arten von Vollkommenheit. Aber in den Briefen van Goghs ist eine über beide hinausgehende Vollkommenheit. Es ist der Triumph des Individuums über die Kunst.
Nur eines interessiert mich nun wesentlich, nämlich alles das aufzuzeichnen, was in Büchern weggelassen wird. Niemand macht, soweit ich sehen kann, Gebrauch von den in der Luft liegenden Elementen, die unserem Leben Richtung und Antrieb verleihen. Nur die Totschläger scheinen aus dem Leben in einigermaßen befriedigender Weise herauszuziehen, was sie hineinsteckten. Das Zeitalter verlangt Gewalttätigkeit, aber wir bringen es nur zu Fehlzündungen. Revolutionen werden im Keim erstickt oder gelingen zu rasch. Leidenschaft ist schnell verausgabt. Die Menschen nehmen ihre Zuflucht zu Ideen, comme d'habitude. Nichts wird vorgeschlagen, was länger als vierundzwanzig Stunden bestehen kann. Wir führen eine Million Leben im Zeitraum einer Generation. Aus dem Studium der Entomologie, des Lebens in der Tiefsee oder der Zellenbildung ziehen wir mehr Nutzen …
Das Telefon unterbricht diesen Gedanken, den ich nie imstande gewesen wäre, zu Ende zu verfolgen. Jemand kommt, um die Wohnung zu mieten …
Es sieht so aus, als sollte mein Leben in der Villa Borghese zu Ende sein. Schön, ich nehme diese Seiten mit und ziehe woandershin. Auch anderswo passiert etwas. Es passiert immer etwas. Es scheint, wohin ich auch gehe, spielt sich ein Drama ab. Die Menschen sind wie Läuse – sie krabbeln einem unter die Haut und bohren sich dort ein. Man kratzt und kratzt, bis Blut kommt, aber man kann sich nicht ständig entlausen. Wo ich auch hingehe, vergällen die Menschen sich ihr Leben. Jeder hat seine Privattragödie. Es steckt jetzt im Blut – Unglück, Überdruß, Kummer, Selbstmord. Die Atmosphäre ist mit Unheil, Unzulänglichkeit und Enttäuschung gesättigt. Kratzen und kratzen – bis keine Haut mehr da ist. Wie auch immer, es wirkt auf mich belustigend. Statt entmutigt oder bedrückt zu sein, genieße ich es. Ich schreie nach mehr und mehr Unheil, nach größeren Schicksalsschlägen, gewaltigeren Katastrophen. Ich will, daß die ganze Welt in Unordnung gerät, daß jeder sich zu Tode kratzt.
Ich bin gezwungen, jetzt so rasch und wild zu leben, daß kaum Zeit bleibt, auch nur diese fragmentarischen Notizen aufzuzeichen. Nach dem Telefonanruf erschienen ein Herr und eine Dame. Ich ging hinauf, um mich während der Verhandlung hinzulegen. Ich lag da und fragte mich, was wohl mein nächster Schritt sein würde. Jedenfalls nicht wieder in die Behausung dieses warmen Bruders zurückkehren und mir die ganze Nacht damit um die Ohren schlagen, daß ich mit den Zehenspitzen Brotkrumen wegschnippe. Dieses kleine Stinktier! Wenn es etwas Übleres gibt als einen warmen Bruder, dann ist es ein Geizhals. Ein ängstlicher, jammernder, kleiner Päderast, der in der dauernden Furcht lebt, eines Tages blank zu sein, vielleicht am 18. März, oder genau am 25. Mai. Kaffee ohne Milch und Zucker. Brot ohne Butter. Fleisch ohne Sauce oder überhaupt kein Fleisch. Ohne dies und ohne das! Dieser dreckige kleine Knicker! Eines Tages ziehe ich die Kommodenschublade auf und finde in einer Socke Geld versteckt. Über zweitausend Francs – und Schecks, die er nicht einmal eingelöst hatte. Sogar darüber hätte ich mich nicht so sehr geärgert, wenn nicht immer Kaffeesatz in meiner Baskenmütze und Küchenabfälle auf dem Fußboden gewesen wären, ganz zu schweigen von den Crèmedosen und den schmierigen Handtüchern und dem ewig verstopften Ausguß. Ich sage euch, der kleine Bastard roch übel – außer wenn er sich mit Kölnischwasser bespritzte. Seine Ohren waren schmutzig, seine Augen waren schmutzig, sein Hintern war schmutzig. Er war falsch, asthmatisch, schmierig, schäbig, morbid. Ich hätte ihm alles verzeihen können, wenn er mir wenigstens ein anständiges Frühstück hätte zukommen lassen! Aber ein Mensch, der zweitausend Francs in einer dreckigen Socke versteckt hat und es ablehnt, ein sauberes Hemd anzuziehen oder ein bißchen Butter auf sein Brot zu streichen, ein solcher Mensch ist nicht bloß ein warmer Bruder, nicht einfach bloß ein Geizhals – er ist ein Schwachkopf!
Aber es dreht sich nicht um den warmen Bruder. Ich lausche mit einem Ohr, was drunten vorgeht. Es ist ein Mister Wren und seine Frau, die die Wohnung ansehen wollen. Sie sprechen davon, sie zu nehmen. Sprechen nur davon, Gott sei Dank. Mistress Wren hat ein lockeres Lachen – Verwicklungen stehen bevor. Jetzt spricht Mister Wren. Seine Stimme ist rauh, schnarrend, dröhnend, eine schwere, ungeschliffene Waffe, die durch Fleisch, Mark und Bein dringt.
Boris ruft mich hinunter, um mich vorzustellen. Er reibt sich die Hände wie ein Pfandleiher. Sie sprechen über eine Geschichte, die Mister Wren geschrieben hat, eine Geschichte von einem lahmen Pferd.
«Aber ich dachte, Mister Wren sei Maler?»
«Natürlich», sagte Boris mit einem Augenzwinkern, «aber in den Wintermonaten schreibt er. Und er schreibt gut … bemerkenswert gut.»
Ich versuche, Mister Wren zum Sprechen zu bringen, etwas, irgend etwas zu sagen, wenn nötig über das lahme Pferd zu sprechen. Aber Mister Wren kann kaum sprechen. Wenn er von diesen trostlosen Monaten mit der Feder zu sprechen versucht, wird er unverständlich. Er braucht Monate und Monate, ehe er ein Wort zu Papier bringt. (Und es gibt doch nur drei Wintermonate!) Worüber sinnt er in all diesen Monaten im Winter nach? Gott steh mir bei, aber ich kann mir den Kerl nicht als Schriftsteller vorstellen. Mistress Wren behauptet allerdings, wenn er sich einmal hinsetzt, sprudelt es nur so hervor.
Das Gespräch schweift ab. Es ist schwierig, Mister Wrens Gedanken zu folgen, denn er sagt nichts. Er denkt im Gehen – so drückt Mistress Wren es aus. Mistress Wren stellt alles, was Mister Wren betrifft, im rosigsten Licht dar. ‹Er denkt im Gehen› – sehr nett, wirklich nett, würde Borowski sagen, aber in Wahrheit recht peinlich, besonders wenn der Denker nur ein lahmes Pferd ist.
Boris gibt mir Geld für Schnaps. Während ich hingehe, um den Schnaps zu holen, bin ich bereits betrunken. Ich weiß genau, was los sein wird, wenn ich nach Hause zurückkomme. Während ich die Straße hinuntergehe, formt sich in mir die große Ansprache, sie gurgelt wie Mistress Wrens loses Lachen. Es kommt mir so vor, als habe sie bereits einen Kleinen sitzen gehabt. Hört wundervoll zu, wenn sie benebelt ist. Wie ich aus der Weinhandlung herauskomme, höre ich es im Pissoir gurgeln. Alles ist locker und schäumend. Ich möchte, daß Mistress Wren zuhört …
Boris reibt sich wieder die Hände. Mister Wren stottert und stammelt noch immer. Ich habe eine Flasche zwischen meine Beine geklemmt und bohre den Korkenzieher hinein. Mistress Wren sperrt erwartungsvoll den Mund auf. Der Wein schäumt zwischen meinen Beinen, Sonnenlicht schäumt durchs Fenster, und in meinen Adern ist ein Prikkeln und Brausen von tausend verrückten Dingen, die jetzt wirbelnd aus mir hervorzubrechen beginnen. Ich sage ihnen alles, was mir einfällt, alles, was in mir verschlossen war und durch Mistress Wrens loses Lachen irgendwie befreit wurde. Mit dieser Flasche zwischen den Beinen und der durchs Fenster flutenden Sonne durchlebe ich noch einmal den Glanz der elenden Tage, als ich zum erstenmal nach Paris kam, ein verwirrter, von Armut heimgesuchter Mensch, der wie ein Geist auf einem Bankett in den Straßen umherirrte. Alles fällt mir blitzartig wieder ein – die Aborte, die nicht funktionieren wollten, der Fürst, der meine Schuhe putzte, das Cinéma Splendide, in dem ich auf dem Mantel des Besitzers schlief, das Gitter vor dem Fenster, das Erstickungsgefühl, die feisten Küchenschaben, die Saufereien und Festgelage, die von Zeit zu Zeit stiegen, Rose Cannaque und Neapel, die bei hellem Tageslicht starben. Mit leerem Magen durch die Straßen tanzen und dann und wann seltsame Menschen besuchen – so zum Beispiel Madame Delorme. Wie ich je zu Madame Delorme kam, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber ich kam hin, gelangte irgendwie ins Haus, vorbei an dem Butler, vorbei an dem Mädchen mit ihrem weißen Schürzchen, kam richtig hinein ins Schloß mit meiner Kordsamthose und meiner Lodenjoppe – und keinem Knopf an meinem Hosenlatz. Sogar heute noch sehe ich die glanzvolle Umgebung dieses Zimmers wieder vor mir, wo Madame Delorme in ihrer unweiblichen Aufmachung auf einem Thron saß, die Goldfische in den Rundgläsern, die Landkarten der Alten Welt, die schöngebundenen Bücher. Ich fühle wieder auf meiner Schulter ihre schwere Hand ruhen, die mich durch ihr massives lesbisches Aussehen ein wenig erschreckte. Gemütlicher war es da unten in dem dicken Menschenbrei, der in die Gare St. Lazare hineinfloß, den Huren unter den Torbogen, den Selterwasserflaschen auf jedem Tisch – ein dicker, in die Rinnsteine fließender Samenstrom. Es gibt nichts Besseres, zwischen fünf und sieben, als in diesem Gedränge mitgeschoben zu werden, einem Bein oder einem schönen Busen zu folgen, mitgerissen zu werden von der Flut, das ganze Hirn ein Wirbel. Eine seltsame Art der Befriedigung damals. Keine Verabredungen, keine Einladungen zum Essen, kein Programm, kein Geld. Die goldene Zeit, wo ich keinen einzigen Freund hatte. Jeden Morgen den langweiligen Gang zum American Express, und jeden Morgen die unvermeidliche Antwort des Angestellten. Dahin und dorthin sausen wie eine Wanze, um dann und wann, manchmal heimlich, manchmal unverhohlen, Zigarettenstummel aufzulesen. Mich auf eine Bank setzen und den Bauch einziehen, damit das Nagen des Hungers aufhörte, oder durch die Tuilerien spazieren und beim Anblick der stummen Statuen eine Erektion bekommen. Oder nachts die Seine entlang wandern, wandern und immerzu wandern und außer sich geraten über die Schönheit, die überhängenden Bäume, die gebrochenen Spiegelbilder im Wasser, das Rauschen der Strömung unter den blutroten Lichtern der Brücken, die unter den Torbogen schlafenden Weiber, hingestreckt auf Zeitungen und im Regen. Überall die modrigen Säulengänge der Kathedralen, und Bettler und Ungeziefer und alte Vetteln mit Veitstanz, In den Seitenstraßen wie Weinfässer übereinandergetürmte Handkarren, Beerengeruch auf dem Marktplatz, und die alte Kirche, umgeben von Gemüse und blauen Bogenlampen, die Rinnsteine schlüpfrig von Abfällen, und Frauen, die nach einer durchzechten Nacht in Atlasschuhen durch den Schmutz und Unrat stelzen. Die Place St. Sulpice, so still und verlassen, wo jeden Abend gegen Mitternacht die Frau mit dem zerbrochenen Schirm und dem verrückten Schleier hinkam. Jede Nacht schlief sie dort auf einer Bank unter ihrem zerfetzten Schirm, von dem die Stäbe herunterhingen, ihr Kleid grün verfärbt, mit ihren knochigen Fingern und dem von ihrem Leib ausströmenden Verwesungsgeruch. Und am Morgen saß ich selbst dort, machte ein ruhiges Nickerchen im Sonnenschein und verfluchte die überall Brosamen aufpickenden verdammten Tauben. St. Sulpice! Die dicken Glokkentürme, die grellen Anschläge über dem Portal, drinnen die strahlenden Kerzen. Der von Anatole France so geliebte Platz mit seinem Stimmengesumm und Glöckchenklingen vom Altar, dem Plätschern des Springbrunnens, dem Gurren der Tauben, den wie durch Zauber verschwindenden Krumen, von denen nur ein dumpfes Kullern in den hohlen Eingeweiden übrigbleibt.
Hier konnte ich Tag für Tag sitzen und an Germaine und die kleine schmutzige Straße unweit der Bastille denken, wo sie wohnte, und das Stimmengemurmel hinter dem Altar ging weiter, die Omnibusse sausten vorbei, die Sonne knallte auf den Asphalt herunter, und der Asphalt drang in mich ein und Germaine in den Asphalt und ganz Paris in die großen, dicken Glockentürme.
Erst ein Jahr ist es her, daß Mona und ich jede Nacht die Rue Bonaparte hinuntergingen, nachdem wir uns von Borowski verabschiedet hatten. St. Sulpice bedeutete mir damals nicht viel, auch sonst nichts in Paris. Genug des Gewäschs. Satt der Gesichter. Überdrüssig der Kathedralen, der Plätze und Menagerien und was nicht alles. Nahm im roten Schlafzimmer ein Buch zur Hand, und der Rohrstuhl war unbequem; müde, den ganzen Tag auf meinem Hintern zu sitzen, müde der roten Tapete, müde, so viele Menschen über nichts quatschen zu hören. Das rote Zimmer und der Koffer stehen immer offen; ihre Kleider liegen in einem Delirium von Unordnung umher. Das rote Schlafzimmer mit meinen Gummiüberschuhen und Spazierstöcken, den Notizbüchern, die ich nie anrührte, den kalt und tot daliegenden Manuskripten. Paris! Das bedeutete das Café Select, das Dôme, den Flohmarkt, den American Express. Paris! Das waren Borowskis Spazierstöcke, Borowskis Hüte, Borowskis Gouachen, Borowskis prähistorische Fische – und prähistorische Witze. In dem Paris von 1928 hebt sich nur eine Nacht in meiner Erinnerung ab – die Nacht vor meiner Abreise nach Amerika.
Eine ungewöhnliche Nacht, Borowski leise in Verlegenheit gebracht und ein wenig böse auf mich, weil ich mit jeder Pritsche im Lokal tanze. Aber morgen früh reisen wir ab! Das sage ich jeder Pritsche, die ich zu fassen kriege – morgen früh reise ich ab! Das sage ich der Blonden mit den achatfarbenen Augen. Und während ich es ihr sage, nimmt sie meine Hand und preßt sie zwischen ihre Beine. In der Toilette stehe ich vor dem Becken mit einem riesigen Ständer. Er kommt mir gleichzeitig leicht und schwer vor, wie ein Bleirohr mit Flügeln daran. Und während ich so dort stehe, kommen zwei Pritschen hereingesegelt – Amerikanerinnen. Ich begrüße sie herzlich, Pint in der Hand. Sie winken und gehen weiter. Wie ich in dem Waschraum meinen Latz zuknöpfe, sehe ich eine von ihnen darauf warten, daß ihre Freundin aus dem Lokus herauskommt. Die Musik spielt noch immer, und vielleicht kommt Mona oder Borowski mit seinem goldbeknopften Stock mich abholen, aber nun bin ich in ihren Armen, und sie hält mich fest, und es ist mir gleich, wer kommt oder was passiert. Wir winden uns in die Toilette, und dort stelle ich sie gegen die Wand gelehnt hin und versuche, ihn in sie hineinzukriegen, aber es will nicht gehen, also setzen wir uns auf den Sitzdeckel und versuchen es auf diese Weise, aber es will auch nicht gehen. Ganz gleich, wie wir's versuchen, es will nicht gehen. Und die ganze Zeit hält sie meinen Pint fest, klammert sich daran wie an einen Rettungsring, aber es hat keinen Zweck, wir sind zu hitzig, zu hastig. Die Musik spielt noch, und so walzen wir in den Waschraum hinaus, und wie wir so in dem Scheißhaus tanzen, ergieße ich mich über ihr ganzes schönes Kleid, und sie ist höllisch wütend darüber. Ich stolpere zum Tisch zurück, und da ist Borowski mit seinem rosigen Gesicht und Mona mit ihrem mißbilligenden Blick. Und Borowski sagt: «Fahren wir doch morgen alle nach Brüssel», und wir stimmen zu, und als wir ins Hotel zurückkommen, übergebe ich mich durchs ganze Zimmer, ins Bett, in die Waschschüssel, über die Anzüge und die Kleider und die Überschuhe und die Spazierstöcke und die Notizbücher, die ich nie anrührte, und über die kalt und tot daliegenden Manuskripte.
Ein paar Monate später. Dasselbe Hotel, dasselbe Zimmer mit Blick auf den Hof, wo die Fahrräder stehen, und über uns, unter dem Dach, ist das kleine Zimmer, in dem ein junger Klugscheißer den ganzen Tag Grammophon spielt und, so laut er kann, einzelne schwierige Stellen wiederholt. Ich sage ‹wir›, aber ich nehme die Dinge vorweg, denn Mona war lange Zeit fort, und ich soll sie erst heute an der Gare St. Lazare treffen. Gegen Abend stehe ich dort, das Gesicht zwischen die Gitterstäbe gepreßt, aber da ist keine Mona, und ich lese noch einmal das Telegramm, doch es hilft nichts. Ich gehe ins Quartier Latin zurück und vertilge trotz allem eine herzhafte Mahlzeit. Wie ich ein wenig später am Café du Dôme vorbeischlendere, sehe ich plötzlich ein blasses, ernstes Gesicht mit brennenden Augen – und das kleine Samtkleid, das ich immer verehrte, weil unter dem weichen Samt stets ihre warmen Brüste, die marmornen, kühlen, festen, muskulösen Beine waren. Sie tauchte aus einem Meer von Gesichtern auf und umarmte mich, umarmte mich leidenschaftlich – tausend Augen, Nasen, Finger, Beine, Flaschen, Fenster, Handtäschchen und Untertassen starren uns an, und wir vergessen alles, einer in des anderen Armen. Ich setze mich neben sie, und sie redet – ein Redeschwall. Wilde, verzehrende Töne der Hysterie, Verdrehtheit, Vergiftung. Ich verstehe kein Wort, weil sie schön ist und ich sie liebe und nun glücklich und bereit bin zu sterben.
Wir gehen die Rue du Château hinunter, auf der Suche nach Eugène. Gehen über die Eisenbahnbrücke, wo ich gewöhnlich zuschaute, wie die Züge hindurchfuhren, während ich mich innerlich krank fühlte und mich fragte, wo zum Teufel sie wohl sein könne. Alles ist sanft und bezaubernd, als wir über die Brücke gehen. Rauch steigt zwischen unseren Beinen hoch, die Schienen dröhnen, Lichtsignale sind in unserem Blut. Ich fühle ihren Körper nah an meinem, jetzt ganz mein – und ich höre auf, mit meinen Händen über den warmen Samt zu streicheln. Alles um uns zerbröckelt, zerfällt, und der warme Körper unter dem warmen Samt verzehrt sich nach mir.
Wieder in demselben Zimmer und dank Eugène um fünfzig Francs reicher. Ich blicke hinaus auf den Hof, aber das Grammophon schweigt. Der Koffer ist geöffnet, und ihre Sachen liegen ganz wie früher überall verstreut. Sie legt sich angezogen aufs Bett. Einmal, zweimal, dreimal, viermal … ich fürchte, sie wird verrückt … im Bett, unter den Bettdecken, wie gut, wieder ihren Körper zu fühlen! Aber für wie lange? Wird es diesmal halten? Schon habe ich ein Vorgefühl, daß es nicht von Dauer ist.
Sie spricht so fieberhaft auf mich ein – so, als gebe es kein Morgen. «Sei still, Mona! Sieh mich nur eben an … rede nicht!» Endlich schläft sie ein, und ich ziehe meinen Arm unter ihr hervor. Meine Augen fallen zu. Ihr Körper ist hier neben mir … wird jedenfalls sicher bis zum Morgen hier neben mir sein … Es war im Februar, als ich bei dichtem Schneegestöber aus dem Hafen ausfuhr. Das letzte, was ich von ihr sah, war, daß sie am Fenster stand und mir Lebewohl winkte. Ein Mann stand auf der anderen Straßenseite an der Ecke, den Hut ins Gesicht gezogen, das Kinn auf die Brust gelegt. Ein Fötus, der mich anblickt. Ein Fötus mit einer Zigarre im Mund. Mona am Fenster, sie winkt Lebewohl. Blasses, ernstes Gesicht, wild wehendes Haar. Und jetzt ist es ein ernstes Schlafzimmer, ihre Kehle atmet regelmäßig, Saft sickert noch zwischen ihren Beinen, ein warmer, katzenartiger Geruch, und ihr Haar in meinem Mund. Meine Augen sind geschlossen. Wir atmen warm einer in des anderen Mund. Eng beisammen, Amerika dreitausend Meilen entfernt. Ich will es nie wiedersehen. Sie hier neben mir im Bett zu haben, wie sie mich anatmet, ihr Haar in meinem Mund – das kommt mir wie ein Wunder vor. Bis zum Morgen kann nun nichts mehr passieren …
Ich erwache aus tiefem Schlummer, um sie anzusehen. Ein fahles Licht sickert herein. Ich betrachte ihr herrliches, wildloderndes Haar. Ich fühle etwas meinen Nakken hinunterkrabbeln. Ich sehe sie aufs neue an, ganz nah. In ihrem Haar ist es lebendig. Ich schlage das Bettuch zurück – mehr davon. Sie wimmeln übers Kopfkissen.
Es ist kurz nach Tagesanbruch. Wir packen hastig und stehlen uns aus dem Hotel. Die Cafés sind noch geschlossen. Unterwegs kratzen wir uns beim Gehen. Der Tag beginnt mit milchiger Weiße, Streifen lachsrosa Himmels, aus ihren Häusern kriechende Schnecken. Paris … Paris … Hier passiert alles. Alte, bröckelnde Mauern und das fröhliche Geräusch des in den Pissoirs rinnenden Wassers. Männer lecken in den Bars ihre Schnurrbarte ab. Laden öffnen sich mit einem Knall, und kleine Bäche rieseln in den Rinnsteinen. Amer Picon in riesigen, scharlachroten Buchstaben. Zig-Zag. Welchen Weg sollen wir nehmen und warum oder wohin oder was?
Mona ist hungrig, ihr Kleid ist dünn. Nichts als Abendfähnchen, Parfumflaschen, barbarische Ohrringe, Armbänder, Enthaarungsmittel. Wir setzen uns in einen Billardsalon in der Avenue du Maine und bestellen heißen Kaffee. Die Toilette ist nicht in Ordnung. Wir werden eine Weile hier sitzen bleiben müssen, ehe wir in ein anderes Hotel gehen können. Derweilen lesen wir einander Bettwanzen aus dem Haar. Nervös. Mona verliert die Ruhe. Sie muß ein Bad haben. Muß dies haben. Muß jenes haben. Muß, muß, muß …
«Wieviel Geld hast du noch?»
Geld? Ganz vergessen.
Hôtel des Etats-Unis. Ein ascenseur. Wir gehen bei hellem Tageslicht zu Bett. Als wir aufstehen, ist es dunkel, und das erste, was wir tun müssen, ist: genug Pinke auftreiben, um ein Telegramm nach Amerika loszulassen. Ein Telegramm an den Fötus mit der langen, würzigen Zigarre im Mund. Derweilen gibt es die Spanierin am Boulevard Raspail – sie ist immer gut für eine warme Mahlzeit. Bis zum Morgen wird schon irgendwas passieren. Schließlich gehen wir zusammen zu Bett. Jetzt keine Wanzen mehr. Die Regenzeit hat begonnen. Die Bettwäsche ist untadelig.
In der Villa Borghese beginnt für mich ein neues Leben. Erst zehn Uhr, und wir haben bereits gefrühstückt und einen Gang außer Haus gemacht. Wir haben jetzt eine Elsa bei uns. «Benimm dich ein paar Tage anständig», mahnt Boris.
Der Tag beginnt strahlend: heller Himmel, frischer Wind, die Häuser neu getüncht. Auf unserem Weg zum Postamt sprechen Boris und ich über das Buch. Das letzte Buch – das anonym geschrieben werden soll.
Ein neuer Tag beginnt. Ich fühlte es heute morgen, als wir vor einem von Dufresnes leuchtenden Bildern standen, einer Art Déjeuner intime im 13. Jahrhundert, sans vin. Ein feiner, fleischiger Akt, fest, vibrierend, rosa wie ein Fingernagel, mit strahlenden Fleischpolstern; alle sekundären und ein paar der primären Merkmale. Ein Körper, der erregt, der die Feuchtigkeit des Morgens hat. Ein Stilleben, nur ist hier nichts still, nichts tot. Der Tisch biegt sich unter Eßbarem; er ist so schwer beladen, daß er fast aus dem Rahmen rutscht. Ein 13.-Jahrhundert-Schmaus – mit all den Merkmalen des Dschungels, die er so gut aus der Erinnerung aufgezeichnet hat. Ein Gazellenrudel und Zebras, die an den Palmwedeln knabbern.
Und nun haben wir Elsa. Sie spielte uns heute morgen etwas vor, als wir noch im Bett lagen. Benimm dich ein paar Tage anständig … Gut! Elsa ist das Hausmädchen, und ich bin der Gast. Und Boris ist der dicke Boss. Ein neues Drama beginnt. Ich lache in mich hinein, während ich das schreibe. Er weiß, was passieren wird, Boris, dieser Luchs. Er hat auch eine Nase für die Dinge. Benimm dich anständig …
Boris sitzt wie auf glühenden Kohlen. Jeden Augenblick kann jetzt seine Frau auf dem Schauplatz erscheinen. Sie wiegt gut 180 Pfund, seine Frau. Und Boris ist nur eine halbe Portion. Da habt ihr die Lage. Er versucht, sie mir auf unserem nächtlichen Heimweg zu erklären. Sie ist so tragisch und gleichzeitig so lächerlich, daß ich dann und wann stehen bleiben und ihm ins Gesicht lachen muß. «Warum lachst du so?» sagt er sanft und beginnt dann selbst mit diesem jammernden, hysterischen Ton in seiner Stimme wie ein hilfloser, armer Teufel, der sich plötzlich bewußt wird, daß, gleichgültig wie viele Gehröcke er anzieht, er doch nie ein Mann sein wird. Er will davonlaufen, einen anderen Namen annehmen. «Sie kann alles haben, diese Kuh, wenn sie mich nur in Ruhe läßt», winselt er. Aber erst muß die Wohnung vermietet und der Vertrag unterschrieben sein, und tausend andere Kleinigkeiten, für die sein Gehrock zupaß kommt. Aber ihre Ausmaße! – das beunruhigt ihn wirklich. Wenn wir sie bei der Ankunft plötzlich an der Tür stehen fänden, würde er in Ohnmacht fallen – soviel Respekt hat er vor ihr!
Und deshalb mußten wir uns eine Weile Elsa gegenüber anständig benehmen. Elsa ist nur da, um das Frühstück zu machen – und die Wohnung zu zeigen.
Aber Elsa macht mich bereits mürbe. Dieses deutsche Blut. Diese melancholischen Lieder. Heute morgen ging ich die Treppe hinunter, den Duft des frischen Kaffees in der Nase. Ich summte leise: «Es wär' so schön gewesen.» Das zum Frühstück. Und bald darauf der Engländer da oben mit seinem Bach. Wie Elsa sagt: «Er braucht eine Frau.» Und Elsa braucht auch etwas. Ich sagte Boris nichts davon, aber während er sich heute morgen die Zähne putzte, erzählte mir Elsa allerhand von Berlin, den Frauen, die von hinten so reizvoll aussehen, und wenn sie sich umdrehen – puh, Syphilis!
Es kommt mir so vor, als sehe mich Elsa recht schmachtend an. Nachwehen des Frühstücks. Heute nachmittag schreiben wir, Rücken an Rücken im Atelier sitzend. Sie hatte einen Brief an ihren Liebsten angefangen, der in Italien ist. Plötzlich war die Maschine blockiert. Boris war fortgegangen, um das billige Zimmer anzusehen, das er nehmen will, sobald die Wohnung vermietet ist. Es blieb nichts anderes übrig, als Elsa herzunehmen. Sie wollte es. Und doch tat sie mir ein wenig leid. Sie hatte nur die erste Zeile an ihren Liebsten geschrieben – ich las sie aus dem Augenwinkel, während ich mich über sie beugte. Aber es ging nicht anders. Diese verdammte deutsche Musik, so melancholisch, so sentimental. Sie hatte mich fertiggemacht. Und dann ihre glänzenden kleinen Augen, so hitzig und gleichzeitig so traurig.
Nachdem es vorbei war, bat ich sie, etwas für mich zu spielen. Sie kann Klavier spielen, die Elsa, wenn es auch wie zerbrochene Töpfe und klappernde Schädel klang. Sie weinte zudem, während sie spielte. Ich mache ihr keinen Vorwurf daraus. Überall das gleiche, sagt sie. Überall ist ein Mann, und dann muß sie fort, dann eine Abtreibung und eine neue Stelle und ein neuer Mann, und niemand kümmert sich den Teufel um sie, außer um sie zu gebrauchen. Alles das, nachdem sie Schumann für mich gespielt hat – Schumann, diesen sabbernden, süßlichen deutschen Zwitter! Irgendwie tut sie mir furchtbar leid, und doch schere ich mich keinen Deut darum. Eine Pritsche, die Klavier spielen kann wie sie, sollte mehr Verstand haben, als sich mit jedem Kerl, der einen dicken Butz hat und zufällig des Weges kommt, einzulassen. Aber dieser Schumann geht mir ins Blut. Sie heult noch immer, die Elsa; aber meine Gedanken sind weit fort. Ich denke an Tania und wie sie ihr Adagio herunterklimpert. Ich denke an einen Haufen Dinge, die vorbei und begraben sind. Mir fällt ein Sommernachmittag in Greenpoint ein, als die Deutschen in Belgien einfielen und wir Amerikaner noch nicht genug Geld verloren hatten, um uns um die Vergewaltigung eines neutralen Landes zu scheren. Eine Zeit, als wir noch unschuldig genug waren, um Dichtern zu lauschen und in der Dämmerung um einen Tisch herumzusitzen und abgeschiedene Geister zu beschwören. Den ganzen Nachmittag und Abend ist die Atmosphäre von deutscher Musik gesättigt; die ganze Umgebung ist deutsch, deutscher noch als Deutschland. Wir wuchsen heran mit Schumann und Hugo Wolf, mit Sauerkraut und Kümmel und Kartoffelknödel. Gegen Abend sitzen wir bei zugezogenen Vorhängen um einen großen Tisch herum, und eine törichte, flachsköpfige Weibsperson beschwört durch Tischrücken Jesus Christus. Wir haben uns unter dem Tisch die Hände gereicht, und die Dame neben mir hat zwei Finger in meinem Hosenlatz. Und zum Schluß liegen wir hinter dem Klavier auf dem Fußboden, während jemand ein trauriges Lied singt. Die Luft ist erstickend, und ihr Atem riecht nach Alkohol. Das Pedal geht steif, automatisch auf und ab, eine verrückte, leere Bewegung wie ein turmhoher Haufen Mist, der siebenundzwanzig Jahre zum Aufbau braucht und diese Zeit genau einhält. Ich ziehe sie über mich mit dem Klang des Kastens in den Ohren; das Zimmer ist dunkel, und der Teppich ist stickig von verschüttetem Kümmel. Plötzlich scheint es, als breche die Morgendämmerung an: es ist wie über Eis rieselndes Wasser, und das Eis ist blau vom steigenden Nebeldunst, in Smaragd getauchte Gletscher, Gemsen und Antilopen, Goldbarsche, weidende Seekühe und der die arktische Kluft überspringende Gelbhecht …
Elsa sitzt auf meinem Schoß. Ihre Augen sind wie kleine Bauchnabel. Ich betrachte ihren großen, so feuchten und glänzenden Mund und bedecke ihn mit der Hand. Jetzt summt sie: «Es wär so schön gewesen …» Ach Elsa, du weißt nicht, was das für mich bedeutet, dein Trompeter von Säckingen. Deutsche Gesangvereine, die Schwabenhalle, der Turnverein … links um, rechts um … und dann ein Hieb übern Hintern mit dem Tauende.
Ach, die Deutschen! Sie überrollen einen wie ein Omnibus. Sie bereiten einem Verdauungsbeschwerden. Man kann nicht in der gleichen Nacht das Leichenschauhaus, die Klinik, den Zoo, die Zeichen des Tierkreises, die Vorhölle der Philosophie, die Höhlen der Erkenntnistheorie, die Geheimnisse von Freud und Stekel besichtigen … Auf dem Karussell gelangt man nirgendwohin, wohingegen man mit den Deutschen in einer einzigen Nacht von der Wega zu Lope de Vega gelangen kann und dann weggeht so tumb wie Parsifal.
Wie gesagt, der Tag begann strahlend. Erst heute morgen wurde ich mir dieses physischen Paris bewußt, das mich Wochen unberührt gelassen hatte. Vielleicht darum, weil das Buch in mir zu wachsen begonnen hat. Ich trage es überall mit mir herum. Ich wandle mit einem Kind unter dem Herzen durch die Straßen, und die Verkehrspolizisten geleiten mich über den Fahrdamm. Frauen stehen auf, um mir ihren Sitzplatz anzubieten. Niemand stößt mich mehr rücksichtslos. Ich bin schwanger. Ich watschle unbeholfen dahin, meinen dicken Leib dem Gewicht der Welt entgegengestemmt.
Heute morgen auf unserem Weg zum Postamt erteilten wir dem Buch sein endgültiges Imprimatur. Wir haben eine neue Kosmogonie der Literatur entwickelt, Boris und ich. Es soll eine neue Bibel werden – Das letzte Buch. Alle, die etwas zu sagen haben, werden es hier – anonym- sagen. Wir werden das Zeitalter ausschöpfen. Nach uns kein anderes Buch – wenigstens für eine Generation nicht. Bis jetzt schlürften wir im Dunkeln, von nichts als dem Instinkt geleitet. Nun werden wir ein Gefäß haben, um das Lebensfluidum dareinzugießen, eine Bombe, die, wenn wir sie werfen, die Welt in die Luft jagt. Wir werden genug hineinpacken, um den Schriftstellern von morgen ihre Fabeln, ihre Dramen, ihre Gedichte, ihre Mythen, ihre Wissenschaften zu liefern. Die Welt wird für die nächsten tausend Jahre daraus schöpfen können. Das Buch ist ungeheuer in seinem Anspruch. Der Gedanke daran zerschmettert uns fast. An die hundert Jahre war die Welt, unsere Welt, im Absterben. Und kein Mensch war in diesen letzten hundert Jahren verrückt genug, eine Bombe ins Arschloch der Schöpfung zu stecken und sie zu zünden. Die Welt verfault, verfällt stückweise. Aber sie braucht den coup de grâce, sie verlangt danach, in Stücke gesprengt zu werden. Keiner von uns ist intakt, und doch haben wir alle Kontinente in uns und die Meere zwischen den Kontinenten und die Vögel der Luft. Wir wollen das festhalten – die Entwicklung dieser Welt, die gestorben ist, aber nicht begraben wurde. Wir schwimmen an der Oberfläche der Zeit, und alles andere ist untergegangen, geht unter oder wird untergehen. Es wird unerhört werden, dieses Buch. Es wird Ozeane aus Raum enthalten, um sich darin zu bewegen, umherzuwandern, zu singen, zu tanzen, zu klettern, zu baden, Purzelbäume zu schlagen, zu wehklagen, zu vergewaltigen und zu morden. Eine Kathedrale, eine veritable Kathedrale, an deren Bau jeder mithelfen wird, der sein Ich verloren hat. Messen werden darin abgehalten werden für die Toten, Gebete, Beichten, Hymnen werden ertönen und Heulen und Zähneklappern, eine Art mörderischer Sorglosigkeit. Sie wird rosa Fenster haben und Wasserspeier, Meßdiener und Bahrtuchhalter. Man kann sein Pferd mit hereinbringen und durch die Seitenschiffe galoppieren. Man kann mit dem Kopf gegen die Mauern rennen – sie geben nicht nach. Man kann beten, in welcher Sprache man will, oder sich draußen zusammenrollen und schlafen. Sie wird wenigstens tausend Jahre Bestand haben, diese Kathedrale, und es wird keine Nachbildung geben, denn ihre Erbauer sind tot und mit ihnen die Formel. Wir werden Postkarten machen lassen und Reisen organisieren. Wir werden eine Stadt darum erbauen und eine freie Gemeinde errichten. Wir brauchen kein Genie – der Genius ist tot. Wir brauchen starke Hände, Geister, die willens sind, den Geist aufzugeben und Fleisch zu werden.
Der Tag entwickelt sich in munterem Tempo. Ich halte mich oben auf dem Balkon bei Tania auf. Das Drama spielt sich unten im Salon ab. Der Dramatiker ist krank, und von oben sieht sein Skalp abstoßender aus denn je. Sein Haar ist aus Stroh. Seine geistigen Vorstellungen sind Stroh. Auch seine Frau ist Stroh, wenn auch noch ein wenig feucht. Das ganze Haus ist aus Stroh. Hier stehe ich, oben auf dem Balkon, und warte auf die Ankunft von Boris. Mein letztes Problem – das Frühstück- ist gelöst. Ich habe alles vereinfacht. Wenn es neue Probleme gibt, kann ich sie zusammen mit meiner schmutzigen Wäsche in meinem Rucksack wegtragen. Ich verschleudere alle meine Sous. Wozu brauche ich Geld? Ich bin eine Schreibmaschine. Die letzte Schraube ist eingesetzt. Die Sache läuft. Zwischen mir und der Maschine klafft kein fremdes Element. Ich bin die Maschine …
Man hat mir noch nicht gesagt, worum sich das neue Drama dreht, aber ich kann es fühlen. Sie versuchen mich loszuwerden. Und doch sitze ich da, zum Essen bereit, sogar ein wenig früher als von ihnen erwartet. Ich habe ihnen gesagt, wo sie sich hinsetzen, was sie tun sollen. Ich frage sie höflich, ob ich sie störe, aber was ich wirklich meine, und was sie genau wissen, ist: – werdet ihr mich stören? Nein, ihr süßen Küchenschaben, ihr stört mich nicht. Ihr ernährt mich. Ich sehe euch eng beieinandersitzen und weiß, daß ein Abgrund zwischen euch klafft. Eure Nähe ist die Nähe von Planeten. Ich bin die Leere zwischen euch. Wenn ich weggehe, habt ihr keine Leere mehr, um darin zu schwimmen.
Tania ist in feindseliger Stimmung – ich spüre das. Sie ärgert sich darüber, daß ich von etwas anderem erfüllt bin als von ihr. Sie merkt an der Größe meiner Erregung, daß ihr Wert auf Null gesunken ist. Sie weiß, daß ich heute abend nicht hergekommen bin, um sie zu befruchten. Sie weiß, daß etwas in mir keimt, was sie zunichte macht. Sie braucht lange, um es zu merken, aber sie merkt es …
Sylvester sieht zufrieden aus. Er wird sie heute abend beim Eßtisch in die Arme nehmen. Gerade jetzt liest er mein Manuskript, bereitet sich darauf vor, mein Ich zu entflammen, mein Ich gegen ihres auszuspielen.
Das wird ein merkwürdiges Beisammensein heute abend. Die Bühne wird hergerichtet. Ich höre das Klingeln der Gläser. Der Wein wird geholt. So mancher Humpen wird geleert werden, und Sylvester, der krank ist, wird seine Krankheit vergessen.
Erst gestern abend, bei Cronstadt, kam der Plan zu diesem Zusammensein zustande. Es wurde beschlossen, daß die Frauen leiden müßten – daß es hinter den Kulissen mehr Schrecken und Gewalttat, mehr Katastrophen, mehr Leiden, mehr Weh und Ach geben sollte.