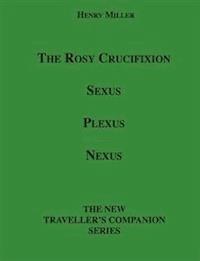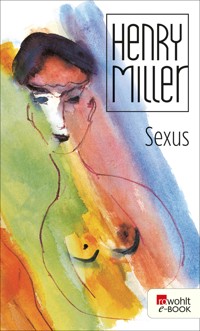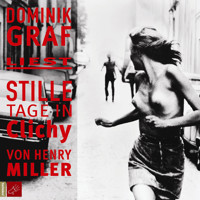
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacheles!
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch in diesem inzwischen weltberühmten und verfilmten Buch zeigt sich der unsterbliche Henry Miller als Prophet und Moralist. Jahrelang musste er auf die Veröffentlichung warten. Denn «Stille Tage in Clichy» ist nicht, wie der Titel vermuten lassen könnte, eine Idylle im Werk des "obszönsten Schriftstellers der Weltliteratur" (Sir Herbert Read). Doch sei es, dass sich sein Erzähler Joey dem Mädchen Nys nähert, das er im Café trifft, sei es Mara-Marignan, die sich auf dem Champs-Élysées nach ihm umdreht: Joeys Abenteuer sind von erstaunlicher Heiterkeit. Ganz gleich, ob eine Mutter unter dem Gekreisch ihrer Kinder entblößt wird oder ob Joey mit zwei Dirnen in der Badewanne Brot und Wein zu sich nimmt, fast immer sind seine Handlungen von Gelächter begleitet, gehen unter in wilder Ausgelassenheit. Zugleich beschwört Henry Miller das Paris der dreißiger Jahre und seiner Atmosphäre überschäumender Lebenslust.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:2 Std. 51 min
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Henry Miller
Stille Tage in Clichy
Über dieses Buch
Auch in diesem inzwischen weltberühmten und verfilmten Buch zeigt sich der unsterbliche Henry Miller als Prophet und Moralist. Jahrelang musste er auf die Veröffentlichung warten. Denn «Stille Tage in Clichy» ist nicht, wie der Titel vermuten lassen könnte, eine Idylle im Werk des „obszönsten Schriftstellers der Weltliteratur“ (Sir Herbert Read). Doch sei es, dass sich sein Erzähler Joey dem Mädchen Nys nähert, das er im Café trifft, sei es Mara-Marignan, die sich auf den Champs-Élysées nach ihm umdreht: Joeys Abenteuer sind von erstaunlicher Heiterkeit. Ganz gleich, ob eine Mutter unter dem Gekreisch ihrer Kinder entblößt wird oder ob Joey mit zwei Dirnen in der Badewanne Brot und Wein zu sich nimmt, fast immer sind seine Handlungen von Gelächter begleitet, gehen unter in wilder Ausgelassenheit. Zugleich beschwört Henry Miller das Paris der dreißiger Jahre und seine Atmosphäre überschäumender Lebenslust.
«Unter Millers größeren Büchern ohne Zweifel das fröhlichste … Nirgends in der zeitgenössischen Literatur sind Rücksichtslosigkeit und Zartheit in menschlichen Beziehungen so verschwistert wie bei Miller.» («Welt der Literatur»)
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die Dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2019
Copyright © 1968 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 1956 by Henry Miller, Big Sur, Cal., USA
Copyright © 1956 by Brassaï, Paris
Umschlag-Konzept any.way, Hamburg, Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung Gettyimages/Thoth_Adan
ISBN 978-3-644-00587-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Statt eines Vorworts
Stille Tage in Clichy
Mara-Marignan
Statt eines Vorworts
Als ich letzten Sommer in Schweden war, fiel mir zufällig das Buch meines Vaters Stille Tage in Clichy in die Hände, und ich begann sofort darin zu lesen. Ich hatte die erste Seite noch nicht zu Ende gelesen, da packte mich schon ein übermütiger Taumel von Liebe, Leidenschaft, Schönheit und Wissen – Dinge, die man so selten findet in diesen tristen und trüben Zeiten.
Es scheint, als seien die Menschen von heute äußerst schnell bei der Hand, ein literarisches Werk von dem Augenblick an zu verdammen, da sie auf ein Wort stoßen, das sie verwirrt oder verlegen macht – um so schlimmer! Ich selbst habe diesem Buch so viel Leben und Miterleben, so viel Humor und tiefes Wissen zu verdanken, daß ich einfach nicht begreife, wie jemand, ganz gleich wer, die Frechheit haben kann, zu sagen: «Mein Gott, so was von Pornographie!» – wie ich es oft genug gehört habe.
Man muß schon sehr verklemmt und böswillig sein, will man in diesem Buch, in dem Miller sein Leben in Clichy beschreibt, Obszönität oder irgend etwas Unrechtes entdecken. Ich war nicht nur gefesselt von seinen über das ganze Buch verstreuten freimütigen Urteilen über Menschen, sondern es war mir auch nie zuvor bewußt geworden, wieviel Humor dieser Mann besitzt, einen gleichermaßen satirischen und sarkastischen Humor, der noch dazu ganz natürlich ist – ein Humor, bei dem man sich fast totlachen kann, während einem gleichzeitig die Tränen über die Wangen laufen.
Clichy war für mich in mehr als einer Hinsicht eine zweite Geburt. Voller Bedenken machte ich diese Reise quer durch Europa, ohne Ziel und ohne Grund, getrieben allein von einer unerbittlichen inneren Notwendigkeit. Doch als ich «Clichy» zu Ende gelesen hatte, machte ich mich erneut auf den Weg – jubelnd, lachend, weinend, und dies alles mit einer Kraft und Lebenslust, die für meine eigene Harmonie so wichtig sind.
Das ist einfach zu erklären. «Clichy» reißt uns aus dieser Welt der Heuchelei heraus, aus diesem gris, das heute unser aller Los ist. Ein abgeklärter und beseelter Geist geht von dem gedruckten Wort aus, dringt durch das Auge des Lesers und erfüllt schließlich den ganzen Körper, gleich der Euphorie, die nach einer guten Flasche Rotwein Besitz von uns ergreift.
Alles wird leichter, und man beginnt die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Die Kriege verlieren ihren Sinn, das Geld ist nicht mehr in so hohem Maße die Voraussetzung zum Glück, während die Liebe und das Mitgefühl für das Weiterbestehen des Menschen unbedingt notwendig werden.
So rate ich denn dem Leser, halten Sie den Arm hin und lassen Sie sich eine Spritze geben, lassen Sie sich ein neues Leben injizieren. Seien Sie bereit, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen und nicht mehr durch die Brille des extremen Materialismus unserer Zeit … fangen Sie an zu singen …
Tony Miller (geb. 28. August 1948) Santa Monica/California April 1967
Stille Tage in Clichy
Während ich schreibe, bricht die Dunkelheit herein und die Leute gehen zum Abendessen. Ein grauer Tag ist zu Ende, wie man ihn in Paris oft erlebt. Als ich um den Häuserblock ging, um meine Gedanken an die frische Luft zu führen, wurde mir unwillkürlich wieder der enorme Gegensatz zwischen den beiden Städten – New York und Paris – bewußt. Es ist die gleiche Stunde, der gleiche trübe Tag, und doch hat das Wort grau, das die Assoziation hervorrief, nur wenig gemeinsam mit jenem gris, das für die Ohren eines Franzosen eine ganze Welt von Gedanken und Gefühlen einschließt. Schon vor Jahren, als ich durch die Straßen von Paris ging und die in den Schaufenstern ausgestellten Aquarelle betrachtete, war mir aufgefallen, daß das, was allgemein ‹Paynes Grau› genannt wird, hier völlig fehlte. Ich erwähne das nur, weil Paris bekanntlich vor allem eine graue Stadt ist. Ich erwähne es, weil die amerikanischen Maler beim Aquarellieren dieses spezielle Grau übermäßig und geradezu manisch verwenden. In Frankreich ist die Skala der Grautöne offenbar unbegrenzt. Bei uns dagegen verliert das Grau seine eigentliche Wirkung.
Ich dachte an diese unermeßliche Welt von Grau, die ich in Paris kannte, denn um diese Stunde, wo ich dort gewöhnlich zu den Boulevards hinschlenderte, überkommt mich hier das Verlangen, nach Hause zu gehen und zu schreiben: eine völlige Umkehrung meiner sonstigen Gewohnheiten. Dort wäre mein Tag zu Ende gewesen, und ich hätte das Verlangen gehabt, mich unter Menschen zu begeben. Hier dagegen treibt mich die Menge, die farblos, unterschiedslos, wesenlos ist, auf mich selbst zurück, treibt mich heim in mein Zimmer, wo ich im Geiste diese Elemente eines mir hier fehlenden Lebens suche, die, vermischt und assimiliert, vielleicht wieder die zarten, natürlichen Grautöne entstehen lassen, die für ein beschwingtes und harmonisches Dasein Voraussetzung sind. An einem Tag wie diesem, in einer Stunde wie dieser von einem beliebigen Punkt der rue Laffitte auf Sacré-Cœur zu blicken, würde mich schon in Ekstase versetzen. So war es jedenfalls immer gewesen, selbst wenn ich hungrig war und kein Dach über dem Kopf hatte. Hier wüßte ich, auch wenn ich tausend Dollar in der Tasche hätte, nichts, was solche Empfindungen in mir zu wecken vermöchte.
An grauen Tagen ging ich in Paris oft zur place Clichy in Montmartre. Von Clichy nach Aubervilliers zieht sich eine lange Kette von Cafés, Restaurants, Theatern, Kinos, Herrenmodeläden, Hotels und Bordellen. Das ist der Broadway von Paris und entspricht jener kurzen Strecke zwischen der 42nd und der 53rd Street. Der Broadway ist hektisch, aufreizend, verwirrend – kein Ort zum Verweilen. Der Montmartre ist gemächlich, träge, unbekümmert, ein wenig schäbig und heruntergekommen, nicht so sehr blendend als vielmehr verführerisch, nicht funkelndes Glitzern, sondern schwelende Glut. Der Broadway hat etwas Aufregendes, oft sogar etwas Magisches, aber ihm fehlt das lebendige Feuer – er ist eine strahlend illuminierte, aber feuersichere Schau, das Paradies der Werbeagenturen. Der Montmartre ist verbraucht, verblichen, verwahrlost, nacktes Laster, käuflich und vulgär. Er ist eher abstoßend als anziehend, aber so verführerisch abstoßend wie das Laster selbst. Dort gibt es kleine Bars, in denen sich fast ausschließlich Huren, Zuhälter, Halsabschneider und Glücksspieler drängen. Wenn man auch tausendmal an ihnen vorbeigeht, so kann man doch schließlich ihrem Sog nicht widerstehen und wird ihr Opfer. Dort in den Seitenstraßen, die vom Boulevard abzweigen, gibt es Hotels von so obszöner Häßlichkeit, daß einen bei dem Gedanken schaudert, sie zu betreten, und doch wird man eines Tages unvermeidlich eine Nacht, vielleicht eine Woche oder einen Monat in einem von ihnen verbringen. Ja, man wird sich dort vielleicht so eingewöhnen, daß man eines Tages meint, das ganze Leben habe sich verändert, und was man einmal greulich, schmutzig, unwürdig fand, erscheint einem nun reizvoll, liebenswert und sogar schön. Dieser hinterhältige Zauber von Montmartre ist, glaube ich, zum größten Teil dem Sex zuzuschreiben, der hier unverblümt gehandelt wird. Sex hat nichts Romantisches, besonders wenn er kommerzialisiert wird, aber er schafft ein prickelndes, melancholisches Fluidum, das viel betörender und viel verführerischer ist als der strahlend illuminierte Broadway. Zweifellos floriert das sexuelle Leben eher im trüben Dämmerlicht: es ist im Halbdunkel zu Hause und nicht in greller Neonbeleuchtung.
An einer Ecke der place Clichy befindet sich das Café Wepler, das lange Zeit mein Stammlokal war. Ich habe dort drinnen und draußen gesessen, zu allen Tageszeiten und bei jedem Wetter. Für mich war es ein aufgeschlagenes Buch. Die Gesichter der Kellner, der Geschäftsführer, der Kassiererinnen, der Huren, der Gäste, ja sogar der Toilettenfrauen haben sich mir eingeprägt wie die Illustrationen eines vertrauten Buches. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, an dem ich das Café Wepler im Jahre 1928 mit meiner Frau im Schlepptau betrat. Ich entsinne mich noch des Schocks, den es mir versetzte, als ich eine Hure sinnlos betrunken über einen kleinen Tisch auf der terrasse fallen sah und niemand herbeieilte, um ihr zu helfen. Ich war verblüfft und entsetzt über die stoische Gleichgültigkeit der Franzosen – ich bin es noch, trotz aller guten Eigenschaften, die ich seither an ihnen kennengelernt habe. «Nur keine Aufregung, ist ja bloß eine Hure … betrunken.» Ich höre noch immer diese Worte. Sogar heute noch lassen sie mich schaudern. Aber ein solches Verhalten ist sehr französisch, und wenn man sich damit nicht abfindet, wird man sich in Frankreich nicht sehr wohl fühlen.
An solchen grauen Tagen, wenn es überall sonst kalt war, außer in den großen Cafés, freute ich mich darauf, vor dem Essen ein oder zwei Stunden im Wepler zu sitzen. Der rosige Schimmer, der sich im Café verbreitete, ging von der Gruppe Huren aus, die gewöhnlich in der Nähe des Eingangs zusammensaßen. Während sie sich nach und nach unter die Gäste mischten, kam zu der Wärme und dem rosigen Schimmer noch ein berauschender Duft. Die Mädchen schwirrten in dem gedämpften Licht wie parfümierte Glühwürmchen umher. Diejenigen, die nicht das Glück hatten, einen Kunden zu finden, schlenderten langsam auf die Straße hinaus, um gewöhnlich bald darauf zurückzukommen und wieder ihre alten Plätze einzunehmen. Andere kamen, frisch und für die abendliche Arbeit gerüstet, hereinstolziert. In der Ecke, wo sie sich gewöhnlich versammelten, ging es wie auf der Börse zu – der Sex-Markt hatte dort seine Haussen und Baissen wie jede andere Börse. Ich hatte den Eindruck, daß ein regnerischer Tag im allgemeinen ein guter Tag war. Wie man so sagt, kann man an einem Regentag nur zwei Dinge tun – und die Huren verschwendeten keine Zeit ans Kartenspiel.
Am frühen Abend eines solchen regnerischen Tages entdeckte ich ein neues Gesicht im Café Wepler. Ich hatte Einkäufe gemacht und war beladen mit Büchern und Schallplatten. Ich muß damals wohl gerade eine unerwartete Geldsendung aus Amerika erhalten haben, denn trotz meiner Einkäufe hatte ich noch einige hundert Francs in der Tasche. Ich setzte mich in die Nähe der Börse, umgeben von einer Schar hungriger, lauernder Huren, denen ich nicht das geringste Interesse schenkte, denn mein Blick war auf diese berückende Schönheit gefallen, die, von den anderen abgesondert, in einer entfernten Ecke des Cafés saß. Sie schien mir eine attraktive junge Frau zu sein, die sich hier mit ihrem Liebhaber verabredet hatte und vielleicht vorzeitig gekommen war. Den Apéritif, der vor ihr stand, hatte sie kaum angerührt. Die Männer, die an ihrem Tisch vorbeigingen, sah sie mit einem offenen, festen Blick an, was jedoch nichts besagte, denn eine Französin schaut in einem solchen Fall nicht weg wie Engländerinnen oder Amerikanerinnen. Sie sah sich in aller Ruhe um, interessiert, aber ohne die Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen. Sie war zurückhaltend, nicht ohne eine gewisse Würde, durchaus selbstsicher und beherrscht. Sie wartete. Auch ich wartete. Ich war neugierig, auf wen sie wartete. Nach einer halben Stunde, in der ich mehrmals ihren Blick auffing und festhielt, kam ich zu der Überzeugung, daß sie auf jemanden wartete, der die rechten Worte fände. Gewöhnlich braucht man nur ein Zeichen mit dem Kopf oder mit der Hand zu machen, und das Mädchen verläßt seinen Tisch und setzt sich zu einem – wenn es ein solches Mädchen ist. Ich war auch jetzt noch nicht ganz sicher. Sie sah mir zu gut aus, zu gepflegt, zu wohlerzogen, möchte ich sagen.
Als der Kellner wieder vorbeikam, fragte ich ihn, ob er sie kenne. Als er verneinte, bat ich ihn, er möchte sie auffordern, an meinen Tisch zu kommen und sich zu mir zu setzen. Ich beobachtete ihr Gesicht, als er ihr das ausrichtete. Ich empfand ein angenehmes Prickeln, als ich sie lächeln und freundlich zu mir herübernicken sah. Ich hatte erwartet, daß sie sofort aufstehen und herüberkommen würde, aber statt dessen blieb sie sitzen und lächelte noch einmal, diesmal diskreter, dann wandte sie den Kopf ab und schaute verträumt zum Fenster hinaus. Ich wartete einen Augenblick, dann, als ich sah, daß sie keine Anstalten machte, zu mir herüberzukommen, stand ich auf und ging an ihren Tisch. Sie begrüßte mich durchaus herzlich, ganz wie einen Freund, aber ich bemerkte, daß sie ein wenig verwirrt, ja beinahe verlegen war. Ich war unsicher, ob ich Platz nehmen durfte oder nicht, setzte mich dann aber doch zu ihr und verwickelte sie, nachdem ich etwas zu trinken bestellt hatte, rasch in ein Gespräch. Ihre Stimme war noch bestrickender als ihr Lächeln. Sie war wohltönend, tief und kehlig. Es war die Stimme einer Frau, die sich des Lebens freut und es genießt, die sorglos und ungebunden lebt, entschlossen, sich das Quentchen Freiheit, das sie besitzt, zu bewahren. Es war die Stimme einer verschwenderisch Gebenden. Sie rührte eher ans Zwerchfell als ans Herz.
Ich muß gestehen, ich war überrascht, als sie überstürzt erklärte, es sei ein Fauxpas von mir gewesen, mich an ihren Tisch zu setzen. «Ich dachte, Sie hätten verstanden», sagte sie, «daß ich Sie draußen treffen wollte. Das jedenfalls habe ich Ihnen zu telegrafieren versucht.» Sie gab mir zu verstehen, daß sie hier nicht als Professionelle eingeschätzt werden wolle. Ich entschuldigte mich und bot an, mich zurückzuziehen, und sie honorierte diese taktvolle Geste mit einem leichten Händedruck und einem freundlichen Lächeln.
«Was haben Sie da alles?» wollte sie wissen, um rasch das Thema zu wechseln, indem sie vorgab, sich für die Päckchen zu interessieren, die ich auf den Tisch gelegt hatte.
«Nur Bücher und Schallplatten», sagte ich und ließ durchblicken, daß diese sie wohl kaum interessieren dürften.
«Französische Bücher?» fragte sie, wie mir schien mit einem Unterton ehrlicher Neugier.
«Ja», sagte ich, «aber ich fürchte, sie sind ziemlich langweilig. Proust, Céline, Élie Faure … Vermutlich geben Sie Maurice Dekobra den Vorzug, nicht wahr?»
«Darf ich sie einmal sehen? Ich möchte gern wissen, was für französische Bücher ein Amerikaner liest.»
Ich öffnete das Päckchen und gab ihr den Élie Faure. Es war der Tanz über Feuer und Wasser. Sie blätterte darin, lächelte und äußerte sich immer wieder zustimmend, während sie die eine oder andere Passage las. Dann legte sie das Buch nachdrücklich wieder auf den Tisch, klappte es zu und legte die Hand darauf, als wollte sie es geschlossen halten. «Genug davon, lassen Sie uns von etwas Interessanterem reden!» Nach kurzem Schweigen fügte sie hinzu: «Celui-là, est-il vraiment français?»
«Un vrai de vrai», erwiderte ich mit einem breiten Grinsen.
Sie schien verwirrt. «Es ist ein ausgezeichnetes Französisch», fuhr sie fort, als spreche sie mit sich selbst, «und doch ist es wiederum nicht Französisch … Comment dirais-je?»
Ich wollte gerade sagen, daß ich durchaus verstand, was sie meinte, als sie sich auf der Polsterbank zurücklehnte, meine Hand ergriff und mit einem schelmischen Lächeln, das ihre Offenheit betonen sollte, sagte: «Wissen Sie, ich bin eine durch und durch faule Person. Ich habe keine Geduld, Bücher zu lesen. Es ist zu viel für mein schwaches Hirn.»
«Man kann im Leben so viele andere Dinge tun», antwortete ich und erwiderte das Lächeln. Und damit legte ich die Hand auf ihr Knie und drückte es zärtlich. Im nächsten Augenblick lag ihre Hand auf der meinen und führte sie an eine zartere Stelle. Dann, fast ebenso rasch, schob sie meine Hand fort mit einem: «Assez, nous ne sommes pas seuls ici.»