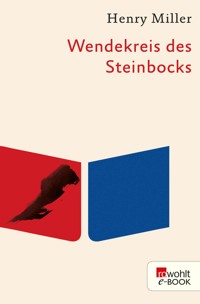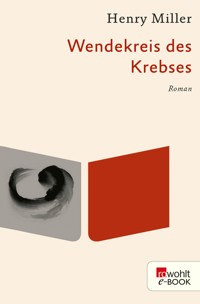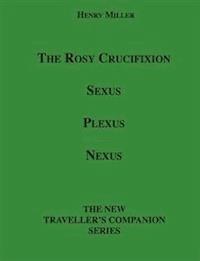3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Joey – so nannte Henry Miller seinen Freund Alfred Perlès, dem er mit diesem Buch ein liebevolles Denkmal setzte. Er erzählt von den Jahren in Paris, als er den immer strahlenden, vergnügten «Windhund» kennenlernte, und von der gemeinsamen wilden Zeit in der Villa Seurat. Es kommt nicht von ungefähr, dass ihn diese Erinnerungen inspirierten, darüber hinaus über einige Erlebnisse mit dem anderen Geschlecht nachzusinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Henry Miller
Joey
Ein Porträt von Alfred Perles sowie einige Episoden im Zusammenhang mit dem anderen Geschlecht
Biographie
Über dieses Buch
Joey – so nannte Henry Miller seinen Freund Alfred Perlès, dem er mit diesem Buch ein liebevolles Denkmal setzte. Er erzählt von den Jahren in Paris, als er den immer strahlenden, vergnügten «Windhund» kennenlernte, und von der gemeinsamen wilden Zeit in der Villa Seurat. Es kommt nicht von ungefähr, dass ihn diese Erinnerungen inspirierten, darüber hinaus über einige Erlebnisse mit dem anderen Geschlecht nachzusinnen.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die Dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien zuerst unter dem Titel «Joey» bei Capra Press, Santa Barbara/California.
«Henry Miller's Books of Friends. A Triology», bestehend aus «Books of Friends», «My Bike and Other Friends» und «Joey», erschien 1987 bei Capra Press.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2023
Copyright © 1993 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 1979 by Henry Miller
Umschlag-Konzept any.way, Hamburg
Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung Gettyimages/Thoth_Adan
ISBN 978-3-644-00625-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Joey
I.
Manchmal habe ich ihn Alf, manchmal Fred, manchmal Joey genannt. Er nannte mich gewöhnlich Joey, Henry nur selten. Wir sind uns, glaube ich, 1928 begegnet, als ich zum erstenmal in Europa war. Ich lernte ihn über meine damalige Frau June kennen, die im Jahr zuvor mit ihrer geliebten Freundin Jean Kronski in Paris gewesen war. Jean und Fred hatten sich kennengelernt, und Fred hatte sich in sie verliebt – «bis zum Wahnsinn», wie er das immer behauptete. Von June hielt er nicht viel, wie er mir später sagte; sie war für ihn «eine typische Mitteleuropäerin», was immer das bedeuten mochte.
Als ich ihn während unserer gemeinsamen Jahre in der Villa Seurat besser kennenlernte, wurde ich mir bewußt, daß er eine ganze Anzahl ungewöhnlicher Frauen kannte, die alle für ihn schwärmten. Oft wohnte er eine Zeitlang in ihrem Hotel, oder sie wohnten in dem seinen, wobei es sich gewöhnlich um ein Hotel von der schäbigen Sorte handelte, über die Paris auch heute noch reichlich verfügt.
Das Interessante an seinen Beziehungen zu Frauen ist, daß sie ihn alle liebten und verehrten. Er hat nie geheiratet oder auch nur ans Heiraten gedacht. Er redete immer, als wäre er leidenschaftlich in jede einzelne Frau verliebt, doch verriet er sich meist durch die Art, wie er seine Leidenschaft schilderte.
Es muß gleich zu Anfang festgestellt werden, daß Fred oder Alf oder Joey ein Windhund war, vielleicht sogar ein Schuft, aber ein liebenswerter. (Ich bin nie jemandem begegnet, weder Mann noch Frau, der ihn haßte.)
Er war, wie er immer sagte, in Wien geboren und schien seine Heimatstadt in der Tat sehr zu lieben. Zufälligerweise waren meine Frau und ich in dem gleichen Jahr in Wien gewesen, als wir ihn in Paris kennenlernten. Damals (1928) machte Wien einen traurigen Eindruck, den Eindruck einer Stadt, die einen großen Krieg durchgemacht hatte. Einer Stadt, die aus dem Leim ging. Der Onkel meiner Frau, der einmal Oberst bei den ungarischen Husaren gewesen war, brachte jetzt mit dem Fahrrad Filmrollen zu Kinos, eine Arbeit, für die er kaum mehr als ein Trinkgeld bekam.
Ich habe an anderer Stelle von dem Ungeziefer in Wien gesprochen. Nie in meinem Leben habe ich so viele Wanzen die Wände hinauf- und herunterkrabbeln sehen wie in dieser berühmten Stadt. Und nirgendwo anders auf der Welt habe ich so entsetzliche Armut gesehen. Zehn, fünfzehn Jahre später bin ich mit einem Wiener Freund aus Big Sur nach Wien zurückgekehrt. Diesmal sah es etwas besser aus, aber nicht viel. Es erinnerte mich sehr an die Bezirke Brooklyns, in denen ich aufgewachsen war.
Zwischendurch hatte ich einige Zeit in Deutschland verbracht. Dort erfuhr ich, daß die Wiener (und die Österreicher ganz allgemein) bei den Deutschen nicht sonderlich angesehen waren. Man bezeichnete sie immer als «treulos».
Ich komme auf Wien zu sprechen, um Joeys Charakter ein wenig zu beleuchten, seine Herkunft usw. Wie er mir sagte, stammte er aus einer großbürgerlichen Familie. Er hatte eine gute Ausbildung erhalten und war, als der fürchterliche Erste Weltkrieg ausbrach, Oberleutnant bei der Armee. Zu seinem Glück kam es an diesem frühen Punkt seiner Laufbahn zu einem höchst wichtigen Ereignis. Soviel ich weiß, verteidigte seine Kompanie eine bestimmte Frontstellung, und es war der Befehl gegeben worden, erst zu schießen, wenn man das Weiße im Auge des Feindes sehen konnte. Fred hatte zu dieser Zeit das Kommando. Als der Feind immer näher kam, verlor Fred den Mut, den Schießbefehl zu geben. Ein Feldwebel, der die Situation erfaßte, übernahm das Kommando und rettete dadurch das Regiment vor der völligen Vernichtung. Fred kam natürlich vors Kriegsgericht und wurde zum Tod durch Erschießen verurteilt. Doch seine Eltern hatten Beziehungen nach ganz oben, und so wurde er nicht an die Wand gestellt, sondern in eine Nervenheilanstalt eingeliefert. Dort verbrachte er den Krieg als Irrer. Als der Krieg aus war, gingen die Tore auf, und alle Insassen gelangten in Freiheit. Fred schlug sich nach Paris durch. Er hatte eine französische Gouvernante gehabt und brachte deshalb genügend französische Sprachkenntnisse mit. (Er sprach auch etwas Englisch.)
Bis ich 1930 nach Paris zurückkehrte, um dort ein paar Jahre zu bleiben, führte Fred das übliche prekäre Leben wie jeder, der eine künstlerische Ader hatte. In diesen recht trüben Tagen lernte er auch die verschiedenen Frauen kennen, die später aus aller Welt über ihn herfielen.
Doch die Zeit im Irrenhaus hat sich, dessen bin ich sicher, auf Joeys späteres Leben ausgewirkt. Wenn er sich auch nie verrückt benommen hat, so war er doch unbedingt ein Exzentriker. Und liebenswert. Immer, was auch immer seine Fehler sein mochten, mußte man hinzufügen: aber liebenswert. Hatte er in der Klapsmühle alle die guten Bücher gelesen, von denen er später erzählte? Jedenfalls war er, als ich ihn kennenlernte, mit der Literatur wohlvertraut – mit der deutschen, der französischen, der englischen. Unter allen Autoren, die er bewunderte, rangierte Goethe an erster Stelle. Er konnte ihn seitenlang zitieren. Auch die meisten berühmteren französischen Autoren kannte er gut. Prosaschriftsteller wie Lyriker. Er begann mit Villon, dann kamen die «dekadenten» Dichter des 19. Jahrhunderts und die Symbolisten – Villiers de L'Isle Adam, Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, alle berühmten Romanschriftsteller und Essayisten. Samuel Putnam, der so etwas wie ein Gelehrter und Übersetzer war, bezeichnete Perlès immer als einen Kenner ersten Ranges. Was die deutschen Dichter betraf, kannte er sich besonders bei Schiller, Heine, Hölderlin etc. aus. Freilich, wer Joey kannte, der weiß, daß er diese Kenntnisse abtat, sie gelegentlich sogar abstritt. Als Joey war er der Clown, der «stets lustige und fröhliche» Kumpel, der uns alle bei Laune hielt. Zitierte er eben noch, den Tränen nah, Verse von Hölderlin, so konnte er im nächsten Augenblick in schallendes Gelächter ausbrechen.
Sein Gesicht strahlte fast immer, war immer in ein spitzbübisches oder wohlwollendes Lächeln gekleidet. (Vor kurzem hat er mir ein Foto von sich geschickt – das gleiche strahlende Gesicht, keinen Tag älter geworden.) Ein einziges Mal habe ich ihn zornig gesehen, und das war in Clichy, als wir uns eine Zeitlang eine kleine Wohnung teilten: Er rasierte sich gerade, und ich sah ihm zu und hielt ihm dabei im Spaß seine kleinen Fehler vor. Doch dann muß ich angefangen haben, ihn richtig zu ärgern, denn sein Gesicht wurde auf einmal ganz rot. Offenbar hatte ich zu dick aufgetragen: Er ließ plötzlich das Rasiermesser ins Waschbecken fallen und holte zu einem Hieb aus. Ich steckte einen recht anständigen Kinnhaken ein, der mich in die (leere) Badewanne beförderte, wo ich ganz schön mit dem Schädel aufschlug. Ich kletterte sofort aus der Wanne und entschuldigte mich bei ihm. Daraufhin entschuldigte er sich bei mir, und bald war alles wieder «in Butter». Und zu so einem Zwischenfall kam es nie mehr.
Ja, wenn ich so an diese herrlichen gemeinsamen Jahre zurückdenke, sehe ich sein Gesicht immer von einem Lächeln überzogen. Man könnte es ein «Wiener» Lächeln nennen, so wie man oft von einem japanischen Lächeln spricht. Wie ich schon sagte, war Joey ein Windhund, manchmal auch ein richtiger Schuft oder, wie wir in Amerika sagen würden, a real son-of-a-bitch. (Aber, es sei noch einmal gesagt, ein liebenswerter.) An anderer Stelle habe ich berichtet (oder war er es?), wie wir unserem Freund Michael Fraenkel kleine Geldbeträge stahlen. Das waren immer gemeinschaftliche Aktionen. Während ich Fraenkel in eine Diskussion über dieses oder jenes verwickelte, zog Joey die Brieftasche aus Fraenkels Jackett (er hängte es, wenn es zu heiß war, immer über einen Stuhl). Um der Sache die Krone aufzusetzen, führten wir ihn dann zum Essen aus – sehr zu seiner Verwunderung, da er doch wußte, daß wir immer blank waren.
Als ich Anaïs Nin kennenlernte, verliebte sich Joey natürlich wie wahnsinnig in sie. Er schrieb ihr schöne Briefe, in denen er seine Leidenschaft verbarg: kunstvolle und höchst literarische Briefe, das war seine starke Seite. Zunächst ließ sie sich das gefallen und nahm ihn nie ganz ernst. Doch mit der Zeit verliebte sich Fred immer heftiger in sie. Von den vielen Frauen, die er kannte, hielt keine dem Vergleich mit Anaïs stand. Sie war ein Wesen aus einer anderen, einer ätherischen Welt. Er beschloß, ein Buch über sie zu schreiben – ich glaube, es war auf französisch. (Englisch begann er erst zu schreiben, als er in England lebte.) Zu Joeys Leidwesen mochte Anaïs den Entwurf nicht, den er ihr zeigte. Der Grund? Er war zu freimütig gewesen; er hatte Namen und Vorfälle erwähnt, die ihr Anstandsgefühl verletzten. So drückte sie es aus. Ich glaube, sie störte eher seine «Wahrheitsliebe». Anaïs war, wie jeder weiß, der ihre Tagebücher gelesen hat, sehr erfahren und geschickt darin, Tatsachen zu verdrehen. Um es freundlicher zu sagen: Sie fabulierte. Ich glaube, sie war zu mir vielleicht aufrichtiger als zu allen ihren anderen Freunden oder Bekannten. Doch so gut ich sie kannte, komme ich nicht um die Vermutung herum, daß sie auch mir manches Märchen erzählt hat.
Jedenfalls – Fred stand jetzt in Ungnade. Ich benutze diesen Ausdruck, weil man bei Anaïs nur in Gnade oder in Ungnade stehen konnte. Sie war wie eine Fürstin, die ihre Gunst entweder zeigt oder verweigert. Oft entzog sie einem wegen einer Kleinigkeit ihre Gunst. Sie wiederzuerlangen, war ungefähr so, wie den Fudschijama zu erklettern.
Fred, der unbedingt über sie schreiben wollte, ließ sich nicht erschüttern. Er verfiel auf die ungewöhnliche, salomonische Idee, sie in zwei Personen zu zerteilen – in eine Tänzerin und in eine Schriftstellerin. Er gab sich große Mühe mit diesem Werk literarischer Chirurgie und legte wiederum Anaïs das Manuskript vor. Diesmal war sie nicht nur entrüstet, sondern wütend. Der arme Fred wurde vom Hofe verbannt – unwiderruflich. (Ich sollte vielleicht hinzufügen, daß er nie wieder ihre Freundschaft erlangte.) Das sagt mehr über sie als über ihn aus. Ich sollte hier erwähnen, daß später auch Lawrence Durrell bei ihr in Ungnade fiel, doch er war entweder geschickter oder hartnäckiger als Fred, denn er erlangte ihre Gnade wieder zurück, nicht nur einmal, sondern mehrere Male.
Was Anaïs so gegen Fred einnahm, war, glaube ich, daß sie den Clown in ihm nicht mochte. Im Gegensatz zu Wallace Fowlie sah sie den Zusammenhang zwischen Clowns und Engeln nicht.
Mochte Anaïs auf den ersten Blick auch engelhaft wirken, so war sie doch alles andere. Sie war ein eher ambivalentes Wesen, um es milde auszudrücken.
Diesmal war Fred natürlich völlig zerschmettert. Er unternahm keinen Versuch mehr, ihre Gnade wiederzuerlangen, er dankte einfach ab. Ich glaube, so um diese Zeit herum kam ein Fan von mir, ein Schwede, gelegentlich zu Besuch, stets unangemeldet. Er war wahrscheinlich die schrecklichste Nervensäge meines Lebens, und was das Schlimmste war, ich wußte nicht, wie ich ihn loswerden sollte. Er blieb und blieb, bis wir den letzten Tropfen aus der letzten Flasche getrunken hatten.
Platzte er herein, während Joey da war, erhob sich dieser sofort, schnappte seine Baskenmütze und sagte: «Also dann bis morgen, Joey!» Dies geschah ein paar Male, ehe mein schwedischer Freund zu begreifen begann. Schließlich fragte er eines Abends, als Fred wieder einmal überstürzt aufgebrochen war:
«O Gott – warum geht er immer so schnell, wenn ich komme? Mag er mich nicht?»
«Von Nicht-Mögen kann keine Rede sein», sagte ich. «Er verachtet Sie. Er kann Ihren Anblick nicht ertragen.»
«Aber wieso das, o Gott? Ich habe doch noch nie mit ihm ein Wort gewechselt.»
«Nun, wenn ich es Ihnen vielleicht selber sagen muß – weil Sie ein schrecklicher emmerdeur (das französische Wort für Nervensäge) sind.»
«Ist das auch Ihre Ansicht?»
Ich antwortete, ohne zu zögern: «Unbedingt! Sie sind die schlimmste Nervensäge, die mir je begegnet ist.»
Nun hätte man meinen sollen, er haut mir entweder eine runter oder geht ohne ein weiteres Wort. Aber nichts dergleichen – er blieb noch eine halbe Stunde und wollte von mir wissen, warum er ein solcher emmerdeur war.
Ich bin in meinem Leben nur drei oder vier Schweden begegnet, und sie gingen einem alle schrecklich auf die Nerven. Einer war ein bekannter Dichter, der einige der berühmtesten Gedichte der französischen Symbolisten ins Schwedische übersetzt hatte. Wir wechselten ein paar Briefe, und dann schrieb er mir eines Tages, er wolle mich besuchen – wo wir uns treffen könnten. Ich nannte ein Lokal am Boulevard Saint-Michel, an der Ecke, wo die Straße zum Panthéon abgeht. Ich hatte dem Treffen mit gespannter Erwartung entgegengesehen, da ich schließlich um den literarischen Rang meines Gesprächspartners wußte. Doch schon nach zehn Minuten hatte ich genug von ihm. Ich fragte mich nur noch, wie ich mich am schnellsten verdrücken konnte. Schließlich sagte ich, mir sei gerade eingefallen, daß ich zur gleichen Zeit schon anderswo verabredet sei. Und mit diesen Worten stand ich auf, verabschiedete mich und ging. Ich weiß noch, daß ich um die Ecke in Richtung Panthéon bog, aber bald in eine Seitengasse flüchtete, für den Fall, daß er mir gefolgt wäre. Soviel über die Schweden …
Eines Tages, als ich schon fast ein ganzes Jahr in Paris war, bekam ich einen Anfall von Heimweh. Ich hätte ein Telegramm an meine Eltern in Brooklyn schicken mögen mit der Bitte um das Geld für die Rückfahrt. Aber ich besaß keinen Cent mehr. Ich weiß noch, ich setzte mich auf die Terrasse vom Le Dôme und kritzelte ein paar Zeilen an Fred, die ich in seinen Briefkasten steckte. Ob er jemanden kenne, der mir das Geld für die Heimfahrt leihen würde?
Nach erstaunlich kurzer Zeit erschien er im Le Dôme, setzte sich zu mir und sagte: «Joey, du fährst nicht nach Hause. Ich laß dich nicht. Trink noch ein Glas. Trink diesmal einen Pernod. Das geht vorüber. Ich hab das selber schon oft mitgemacht. Du mußt das durchstehen.»
Und so saßen wir da und tranken ein Glas und noch eins, und bald sprachen wir von ganz anderen Dingen, möglicherweise von seinem geliebten Goethe und dessen Dichtung und Wahrheit. Zum Schluß hatte er eine gute Idee: Er wollte mir einen Job beim Pariser Büro der Chicago Tribune besorgen, als Korrektor wie er selbst.
«Werd ich dafür auch bezahlt?» fragte ich sofort – ich erinnerte mich an meine jüngsten Erfahrungen als Englisch-Lehrer am Lycée Dijon.
«Na klar, Joey», entgegnete er. «Du wirst nicht viel kriegen, aber zum Leben wird's reichen.» Darauf trennten wir uns bis zum nächsten Morgen.
Kurz nach dieser Episode muß ich mit der Niederschrift des Wendekreis des Krebses angefangen haben, nachdem ich es geschafft hatte, mir eine Schreibmaschine auszuleihen.
Von da an veränderte sich mein ganzer Lebensstil. Ich sah Frankreich auf einmal mit neuen Augen. So schlimm es hier war, es war nicht so schlimm wie in Amerika. Zunächst begann ich in meiner Freizeit französische Literatur zu lesen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das hinbekam, da ich mein gesprochenes Französisch für wahrhaft grauenerregend hielt.
Jedenfalls stieß ich glücklicherweise auf Blaise Cendrars' Moravagine (deutsch: Der Moloch – Anm. d. Übers.). Ich erinnere mich noch, daß ich jeden Nachmittag im Café de la Liberté, in der Nähe des Friedhofs Montparnasse, ein bißchen darin las. Zu meiner Überraschung war Fred, der Cendrars' Werke kannte, von dem Autor nicht sonderlich angetan. Anaïs ging es nicht anders. Für mich war er ein Gigant unter den zeitgenössischen französischen Schriftstellern. Ich fragte praktisch jeden Franzosen, den ich traf, ob er Cendrars' Bücher kannte. Mit der Zeit las ich so gut wie alles, was er je geschrieben hatte. Oft glaubte ich, verrückt zu werden, wenn ich seine nicht enden wollenden Absätze mit dem geradezu enzyklopädischen Vokabular las. Das macht einen Teil des Reizes von Cendrars aus – er bediente sich, was seinen Wortschatz betraf, bei allen Berufen, bei allen Gewerben.
Doch lassen wir Cendrars fürs erste beiseite. Ich komme noch auf ihn zu sprechen, wenn ich den Wendekreis des Krebses hinter mir habe. Kehren wir zu einer anderen Nervensäge zurück, zu einem Amerikaner aus Topeka, Kansas. Er galt als ein Experte in der Welt der Werbung, zumindest in Amerika. Er war aufgeblasen, arrogant, großspurig und Gott weiß was noch. Ich war ihm nur einmal flüchtig bei einem Empfang begegnet. In der Zwischenzeit hatte ich seine Gattin kennengelernt, eine faszinierende Frau und Schriftstellerin dazu. Sie