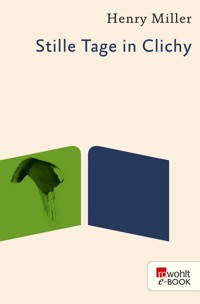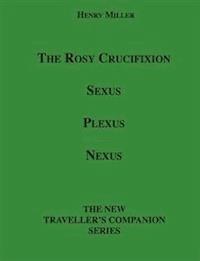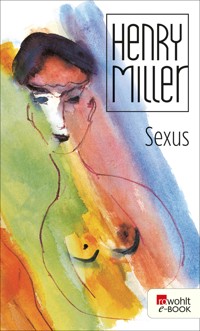2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Huldigung an Freunde aus lang vergangenen Zeiten Henry Miller, der große Tabubrecher der modernen Literatur, war zeitlebens nie bloßer Zuschauer, sondern immer Mitleidender, Mitfreudiger, Mitschuldiger. So auch in seinen Erinnerungen an die Freundschaften der frühen Jahre. "Ein Freund", sagte er, stattet einen mit tausend Augen aus. Durch seine Freunde lebt man ungezählte Leben."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Henry Miller
Jugendfreunde
Eine Huldigung an Freunde aus lang vergangenen Zeiten
Über dieses Buch
Eine Huldigung an Freunde aus lang vergangenen Zeiten
Henry Miller, der große Tabubrecher der modernen Literatur, war zeitlebens nie bloßer Zuschauer, sondern immer Mitleidender, Mitfreudiger, Mitschuldiger. So auch in seinen Erinnerungen an die Freundschaften der frühen Jahre. «Ein Freund», sagte er, «stattet einen mit tausend Augen aus. Durch seine Freunde lebt man ungezählte Leben.»
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die Dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1976 unter dem Titel «Henry Miller’s Book of Friends. A Tribute to Friends of Long Ago» im Verlag Capra Press, Santa Barbara, Kalifornien.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2020
Copyright © 1977 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Henry Miller’s Books of Friends» Copyright © 1976 by Henry Miller
Cover-Konzept any.way, Hamburg
Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung iStock/Gettyimages/subjob
ISBN 978-3-644-00645-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Ich begann dieses «Buch der Freunde» vor zwei Jahren in dem Gedanken, ihnen eine Hommage zu bereiten. Die meisten von ihnen sind der Öffentlichkeit weithin unbekannt. Die frühen Freundschaften stammen aus der Zeit im 14. Bezirk (Williamsburg, Brooklyn) und in Greenpoint. Hier geht es nur um ein paar von ihnen; ich hoffe, auch die übrigen noch beschreiben zu können, selbst wenn ich bis ans Ende meiner Tage dazu brauche. Es ist schade, daß ich keine Photos von Glendale oder von Yorkville habe, wo ich geboren wurde.
Henry Miller
8. September 1975
1.Stasiu
Fillmore Place – meine Lieblingsstraße, als ich ein Kind war. Das Altern scheint ihr gar nicht so schlecht bekommen zu sein.
Er war der allererste Freund in meinem Leben. Ein Freund aus derselben Straße, der Straße, wo wir uns auch kennenlernten, in jenem glorreichen Vierzehnten Bezirk, über den ich so glühend geschrieben habe. Wir waren beide fünf Jahre alt. Natürlich hatte ich außer Stasiu noch andere kleine Freunde in der Gegend. Es ist mir immer leichtgefallen, Freundschaften zu schließen. Aber Stasiu war sozusagen mein richtiger Freund, mein Spießgeselle, mein Kumpan, mein ständiger Gefährte.
Stasiu nannten ihn seine Eltern. Keiner von uns wagte, ihn so zu nennen, weil das ihn zum «Polacken» stempelte, und als «Polacke» wollte er nicht gelten. Er hieß Stanley, und Stasiu ist die Koseform für Stanley. Ich höre noch seine Tante mit ihrer süßen Stakkatostimme rufen: «Stasiu, Stasiu, wo bist du? Komm heim, es ist schon spät.» Bis zu meinem Sterbetag werde ich diese Stimme, diesen Namen hören.
Stanley war ein Waisenkind, das von seiner Tante und seinem Onkel adoptiert worden war. Seine Tante, eine Frau von gewaltigen Ausmaßen, mit Brüsten wie Kohlköpfen, war eine der gütigsten, freundlichsten Frauen, die ich je kennengelernt habe. Sie war Stanley eine richtige Mutter, eine sehr viel bessere wahrscheinlich, als seine eigene Mutter ihm gewesen wäre, wenn sie noch gelebt hätte. Sein Onkel dagegen war ein brutaler Trunkenbold, dem der Friseurladen im Erdgeschoß des Hauses, in dem wir wohnten, gehörte. Ich habe die lebhaftesten und schrecklichsten Erinnerungen an ihn, wie er Stanley mit einem offenen Rasiermesser in der Hand durch die Straßen jagte, ihn aus voller Lunge verfluchte und drohte, er werde ihm den Kopf abschneiden.
Obwohl Stanley nicht sein Sohn war, hatte auch er ein zügelloses Temperament, besonders wenn man ihn neckte. Er hatte anscheinend nicht den geringsten Sinn für Humor, auch später nicht, als er erwachsen war. Seltsam, wenn ich es mir jetzt überlege, daß «drollig» eines seiner Lieblingswörter war. Aber das war viel später, als er davon träumte, Schriftsteller zu werden, und mir endlos lange Briefe von Fort Oglethorpe oder aus Chickamauga schrieb. Damals diente er bei der Kavallerie.
Jedenfalls hatte er als Junge nichts Drolliges an sich. Im Gegenteil, seine Miene war meistens finster, mürrisch und manchmal geradezu fies. Wenn ich ihn ärgerte, was ich gelegentlich tat, jagte er mit geballten Fäusten hinter mir her. Glücklicherweise konnte ich ihm immer davonlaufen. Aber diese Verfolgungsjagden waren lang und voller Schrecken, denn ich hatte eine heillose Angst vor Stanley, wenn er außer sich war. Wir hatten etwa die gleiche Größe und Statur, aber er war bei weitem der stärkere. Ich wußte, wenn er mich je zu fassen bekäme, würde er mich fast zu Tode prügeln.
Also hängte ich ihn in solchen Lagen ab und versteckte mich dann irgendwo eine halbe Stunde oder so, ehe ich nach Hause schlich. Er wohnte am andern Ende des Blocks, in einem schäbigen, dreistöckigen Haus, ganz ähnlich wie unseres. Ich mußte mich sehr vorsichtig heimschleichen, denn er konnte ja immer noch nach mir Ausschau halten. Ich hatte keine Sorge, ihm am nächsten Tag zu begegnen, da diese Wutanfälle sich immer zur rechten Zeit wieder legten. Wenn wir uns wieder begegneten, lächelten wir beide, Stanley etwas schief, und schüttelten einander die Hand. Der Vorfall war vergessen und begraben – bis zum nächstenmal.
Man mag sich darüber wundern, daß ich mich so eng mit einem Jungen anfreundete, der alles in allem ein ziemlich ungeselliger Bursche war. Es fällt mir schwer, eine Erklärung dafür zu geben, und vielleicht versuche ich es am besten gar nicht erst. Mag sein, daß sogar in diesem frühen Alter Stanley mir schon leid tat, weil ich wußte, daß er ein Waisenjunge war, und weil ich wußte, daß sein Onkel ihn wie einen Hund behandelte. Arm waren seine Pflegeeltern auch, viel ärmer als meine Eltern. Ich besaß viele Dinge, Spielsachen, ein Dreirad, Pistolen und so weiter, ganz zu schweigen von den besonderen mir gewährten Privilegien, die Stanley eifersüchtig und neidisch machten. Vor allem ärgerte er sich, wie ich mich erinnere, über die schönen Sachen, die ich trug. Es zählte für ihn nicht, daß mein Vater ein für die damalige Zeit ziemlich wohlhabender Herrenschneider war, der es sich leisten konnte, seinen Marotten zu frönen. Ich selbst war eher verlegen und oft beschämt, daß ich so üppige Hüllen trug, während alle Kinder, mit denen ich verkehrte, praktisch in Lumpen gingen. In diesen Klamotten, die meine Eltern an mir so bezaubernd fanden, sah ich wie ein kleiner Lord Fauntleroy aus, was ich haßte. Ich wollte wie die übrige Bande aussehen, nicht wie so ein Fratz aus der Oberschicht. Und darum machten sich die anderen Kinder hin und wieder über mich lustig, wenn ich an der Hand meiner Mutter vorbeiging, und riefen mich Muttersöhnchen, was mich zusammenzukken ließ. Meine Mutter war gegen diese Sticheleien natürlich unempfindlich und meinen Gefühlen gegenüber auch. Sie glaubte wahrscheinlich, sie tue mir einen großen Gefallen, wenn sie überhaupt darüber nachdachte.
Schon in jenem zarten Alter hatte ich allen Respekt vor ihr verloren. Andererseits schwebte ich jedesmal, wenn ich zu Stanley nach Hause kam und seiner Tante, diesem herrlichen Nilpferd, begegnete, im siebenten Himmel. Ich erkannte es damals nicht, aber was mich so glücklich und frei machte in ihrer Gegenwart, war die Zärtlichkeit, die sie ausströmte, eine Eigenschaft, von der ich nicht wußte, daß man sie von Müttern im Umgang mit ihren Sprößlingen erwartete. Alles, was ich kannte, waren Disziplin, Kritik, Ohrfeigen, Drohungen – so jedenfalls erscheint es mir, wenn ich auf diese Phase meines Lebens zurückblicke.
Meine Mutter zum Beispiel bot Stanley niemals eine große, mit Butter und Zucker bestrichene Scheibe Roggenbrot an, wie Stanleys Tante das tat, wenn ich ihn daheim besuchte. Die Begrüßung meiner Mutter, wenn Stanley kam, hörte sich gewöhnlich so an: «Macht nicht zuviel Krach, und räumt auch wieder auf, wenn ihr mit Spielen fertig seid.» Kein Brot, kein Kuchen, kein freundlicher Klaps hintendrauf, kein «Wie geht's deiner Tante» oder irgend etwas. Fallt bloß nicht lästig, das war das einzige, was sie durch ihr Verhalten zum Ausdruck brachte.
Stanley kam nicht sehr oft zu mir nach Hause, wahrscheinlich weil er die unfreundliche Atmosphäre spürte. Wenn er einmal kam, dann gewöhnlich deshalb, weil ich gerade von irgendeiner Krankheit genas. Ich hatte, nebenbei gesagt, sämtliche Kinderkrankheiten, von Windpocken bis Diphtherie, Scharlach, Keuchhusten, Masern und was es sonst noch gibt. Stanley hatte nie eine Krankheit, von der ich erfahren hätte. Man konnte es sich in einer armen Familie wie seiner nicht leisten, krank zu sein.
Und so spielten wir oft ein Stockwerk tiefer, wo mein Großvater auf einer Bank saß und für meinen Vater, den Herrenschneider eines Geschäfts in der Fifth Avenue, Jacken anfertigte. Wir kamen gut miteinander aus, mein Großvater und ich; ich konnte mich mit ihm besser verständigen als mit meinem Vater. Vergleichsweise war mein Großvater ein gebildeter Gentleman, der ein schönes, makelloses Englisch sprach, das er während seiner zehn Lehrjahre in London gelernt hatte. An Feiertagen, wenn sich alle Verwandten versammelten, war es ein Vergnügen, meinen Großvater die Weltlage, die Politik erörtern zu hören – er war Sozialist und Gewerkschaftler – oder seinen Erzählungen von den Abenteuern zu lauschen, die er als Junge erlebt hatte, als er auf der Suche nach Arbeit durch Deutschland gewandert war. Während Stanley und ich Parchesi oder Domino spielten, oder ein einfaches Kartenspiel, summte oder pfiff mein Großvater die Melodie irgendeines deutschen Liedes vor sich hin. Von seinen Lippen hörte ich zum erstenmal. «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin … » Eines seiner Lieder hieß «Shoo-fly, don't bother me». Er sang es auf englisch und brachte uns immer zum Lachen damit.
Es gab ein Spiel, zu dem wir Spielzeugsoldaten und Kanonen brauchten und das uns in Fieber versetzte; wir brüllten und schrien vor Aufregung, während wir den Feind in Fetzen schossen. Der Radau, den wir machten, schien meinen Großvater niemals zu stören. Er nähte und bügelte einfach weiter seine Jacken, summte vor sich hin und stand ab und zu auf, um zu gähnen und sich zu strecken. Es war Knochenarbeit, den ganzen Tag auf einer Bank zu sitzen und Jacken anzufertigen für meinen Vater, den Herrenschneider. Hin und wieder unterbrach er uns beim Spielen und bat uns, ihm aus der Kneipe an der Ecke einen Krug Lagerbier zu holen. Er bot uns immer einen Schluck davon an, einen ganz kleinen Schluck, und sagte, das würde uns nicht schaden.
Wenn ich nicht gesund genug war, um mit Stanley zu spielen, las ich ihm aus einem meiner Märchenbücher vor. (Ich konnte lesen, bevor ich zur Schule ging.) Stanley hörte eine Weile zu, und dann verduftete er. Er mochte es nicht gern, wenn man ihm vorlas. In jenem Alter war er kein großer Leser; er war zu gesund für derlei Zeitvertreib, zu ruhelos, zu sehr erfüllt von animalischen Regungen. Was Stanley gefiel, und mir auch, wenn ich mich wohl fühlte, waren rauhe Straßenspiele, und davon kannten wir viele. Wäre Football damals schon die große Leidenschaft gewesen wie heute, hätte er Football-Spieler werden können. Er mochte «Kontakt»-Spiele, bei denen man den andern herumschubste oder flach auf den Arsch setzte. Er gebrauchte auch gern seine Fäuste; wenn er wütend wurde und seine Pranken hochhob, dann immer mit heraushängender Zunge, wie eine Viper. Dieser Angewohnheit wegen biß er sich oft auf die Zunge, was ihn zum Heulen und Zähneknirschen brachte. Die meisten Kinder des Blocks hatten Angst vor ihm, außer einem kleinen jüdischen Jungen, den sein großer Bruder in der mannhaften Kunst der Selbstverteidigung unterwiesen hatte.
Aber meine Gewandung – ich muß schon ein hochgestochenes Wort dafür gebrauchen. Eines Tages, als meine Mutter mit mir zum Arzt ging und mich wieder in irgendeine ausgefallene Tracht gesteckt hatte, pflanzte sich Stanley vor meiner Mutter auf und stieß hervor: «Warum muß er immer die ganzen feinen Sachen kriegen? Warum zieht nicht mal jemand mich so an?» Worauf er den Kopf wegdrehte und ausspuckte. Es war das erste Mal, daß ich meine Mutter weich werden sah. Während wir weitergingen – ich weiß noch, sie trug einen Sonnenschirm –, schaute sie zu mir hinunter und sagte hastig: «Wir werden Stanley etwas Hübsches zum Anziehen besorgen müssen. Was, meinst du, würde ihm wohl gefallen?» Ich war so verblüfft über diese Kehrtwende, daß ich nicht wußte, was ich antworten sollte. Schließlich sagte ich: «Warum besorgst du ihm nicht einen neuen Anzug? Das ist das, was er am nötigsten braucht.» Ob Stanley den Anzug je bekommen hat, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich nicht.
Es gab in der Nachbarschaft noch einen anderen Jungen, dessen Eltern es sehr gut ging, und sie putzten ihn ebenfalls immer in großem Stil heraus. Sie ließen ihn gelegentlich sogar eine Melone tragen, und ein Stöckchen dazu. Was für ein Anblick in der armen Gegend! Natürlich, er war der Sohn eines Kongressabgeordneten, und ein verwöhntes Balg obendrein. Alle Kinder machten sich über ihn lustig und verspotteten ihn gnadenlos, stellten ihm ein Bein, wenn sie nur konnten, riefen ihm Schimpfwörter nach, imitierten seinen gezierten Gang und machten ihm auf jede nur mögliche Weise das Leben schwer. Ich möchte wissen, was später aus ihm geworden ist. Es kommt mir vor, als könne aus jemandem, der so anfangen mußte, kaum etwas Gescheites werden.
Zusätzlich zu seinen sonstigen Vorzügen war Stanley auch noch ein guter Lügner und ein Dieb. Er stahl schamlos von den Obst- und Gemüseständen, und wenn er auf frischer Tat ertappt wurde, erfand er eine rührselige Geschichte über seine Familie, die so arm sei, daß er nie genug zu essen bekomme.
Eines der besonderen Privilegien, die ich genoß, und eines, das Stanley nie mit mir teilte, war der Besuch der Vaudeville-Vorstellung an jedem Samstagnachmittag in einem in der Nähe gelegenen Theater namens «The Novelty». Ich war etwa sieben Jahre alt, als meine Mutter beschloß, mich in den Genuß dieses Privilegs zu bringen. Zuvor mußte ich natürlich einige häusliche Pflichten erledigen – Geschirr spülen, den Fußboden schrubben und die Fenster putzen. Dann bekam ich zehn Cent für einen Platz auf der Galerie – «Nigger-Himmel» nannten wir sie. Gewöhnlich ging ich allein, wenn nicht gerade meine kleinen Freunde vom Land zu Besuch bei uns waren.
Obwohl Stanley nie ein Theater von innen zu sehen bekam, kosteten wir beide in der Phantasie das Geschehen auf der Bühne eines nahen Tingeltangels aus, das «The Bum» genannt wurde – ein Name, den es seinem üblen Ruf verdankte. An Samstagabenden inspizierten wir zunächst die Anschlagtafeln, auf denen die Soubretten in Trikots zu sehen waren, und bezogen dann in der Nähe der Kasse Stellung, in der Hoffnung, ein paar der schmutzigen Witze aufschnappen zu können, welche die Seeleute rissen, während sie nach Eintrittskarten anstanden. Die meisten Witze waren zu hoch für uns, aber den ungefähren Sinn bekamen wir doch mit. Wir waren maßlos neugierig auf das, was da drinnen vor sich ging, wenn die Lichter angingen. Zogen sich die Mädchen wirklich bis zur Taille aus, wie es hieß? Warfen sie ihre Strumpfbänder den Seeleuten im Publikum zu? Nahmen die Seeleute nach der Vorstellung die Mädchen in die nahe gelegene Kneipe mit und machten sie betrunken? Gingen sie mit ihnen ins Bett in den Zimmern über der Kneipe, aus denen immer so herrlich fröhliche Geräusche drangen?
Wir fragten die älteren Jungen in der Straße über diese Dinge aus, bekamen aber selten zufriedenstellende Antworten. Sie erzählten uns gewöhnlich, wir seien noch zu klein, um solche Fragen zu stellen, und dann lachten sie auf höchst bedeutsame Weise. Wir wußten über die Sache mit dem Ficken etwas Bescheid, weil da ein Mädchen namens Jenny war, nur ein winziges bißchen älter als wir, die ihren Körper einem jeden von uns für einen Cent pro Nummer feilbot. Diese Vorstellung fand gewöhnlich in Louis Pirossas Keller statt. Ich glaube nicht, daß einer von uns ihn wirklich in sie hineinbrachte. Bei der bloßen Berührung liefen uns schon Schauer den Rücken hinauf und hinab. Außerdem behielt sie immer eine stehende Position bei, welches nicht die günstigste Position für Anfänger ist. Knirpse die wir waren, bezeichneten wir sie untereinander als Hure. Was nicht bedeutete, daß wir sie schlecht behandelten. Wir bezeichneten damit einfach den Unterschied zwischen ihr und den anderen Mädchen in der Nachbarschaft. Insgeheim bewunderten wir sie für ihre Kühnheit. Sie war ein sehr liebenswertes Mädchen, das recht gut aussah und mit dem es sich leicht reden ließ.
Stanley spielte keine bedeutende Rolle bei diesem Kellerspiel. Er war schüchtern und verlegen, und als Katholik hatte er Schuldgefühle, weil er eine schwere Sünde beging. Auch als er älter wurde, war er niemals ein Frauenheld, niemals ein Schürzenjäger. Er hatte etwas Strenges, Asketisches an sich. Ich bin überzeugt, daß er niemals mit einem Mädchen ging, bis er der Frau über den Weg lief, die er dann heiratete und der er treu blieb. Selbst als er zur Kavallerie gegangen war und mir lange, vertrauliche Briefe über sein Leben in den Kasernen schrieb, sprach er niemals über Frauen. Die einzigen Fertigkeiten, die er sich in jenen vier Jahren bei Onkel Sam aneignete, waren das Würfeln und das Saufen. Ich werde niemals die Nacht vergessen, als ich ihn nach seiner Entlassung vom Militär in Coney Island traf. Aber davon später …
Sommerabende in New York oder, wie in unserem Fall, in Brooklyn können wunderbar sein, wenn man ein Kind ist und sich nach Herzenslust auf den Straßen herumtreiben kann. An sehr heißen Abenden setzten wir uns, wenn wir endlich vom, sagen wir, «Räuber- und Gendarm»-Spielen erschöpft waren, auf die unterste der Stufen vor Stanleys Haustür und aßen kaltes Sauerkraut mit kalten Frankfurtern, die er aus dem Eisschrank stibitzte. Wir konnten stundenlang dasitzen und reden, so kam es uns jedenfalls vor.
Obwohl Stanley eher der schweigsame Typ war, mit einem langen, schmalen, im Ausdruck ziemlich strengen Gesicht – etwa in der Art wie Bill Hart, das Cowboy-Idol des Stummfilms –, konnte er auch reden, wenn er in Stimmung war. Mit sieben oder acht war der Mann, der später «Romanzen», wie er sie nannte, schreiben sollte, immer schon erkennbar. Gewiß, er erzählte keine Liebesgeschichten, aber das Ambiente, in dem er seine kleinen Erzählungen ansiedelte, war poetisch, phantastisch und romantisch.
Er war nicht mehr der Straßenjunge, der ständig etwas anstellte, sondern ein Träumer, der sich danach sehnte, seiner engen Umgebung zu entfliehen. Mit Vorliebe sprach er von weit entfernten Gegenden wie China, Afrika, Spanien, Argentinien. Die See übte eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus; er wollte Seemann werden, wenn er mündig war, und diese fremden, fernen Länder besuchen. (Noch zehn Jahre, und er würde mir von Joseph Conrad schreiben, seinem Lieblingsautor, der auch Pole war, sich aber entschieden hatte, auf englisch zu schreiben.)
Bei diesen Gesprächen auf den Stufen vor der Tür war er tatsächlich ein anderer Stanley. Er war weicher und sanfter. Manchmal unterbrach er sich, um mir von der Grausamkeit seines Onkels zu erzählen und mir die Striemen auf seinem Rücken zu zeigen, wo ihn der Onkel mit dem Streichriemen für das Rasiermesser geschlagen hatte. Ich erinnere mich, daß er mir erzählte, wie wütend er seinen Onkel damit machte, daß er sich weigerte zu weinen; er biß nur die Zähne zusammen und runzelte die Stirn, ließ aber nie auch nur ein Wimmern heraus. Das war typisch für Stanley. So ging er durchs Leben – er nahm seine Strafe hin, zeigte aber niemals, was er fühlte. Es war von Anfang an ein hartes Leben, und es endete so erbärmlich, wie es begonnen hatte. Selbst seine «Romanzen» waren zum Scheitern verurteilt. Aber ich will mir nicht vorgreifen …
Stanley war in Amerika geboren, besaß aber dennoch viele Merkmale des Einwanderers. Zum Beispiel sprach er niemals Polnisch vor uns, obwohl wir wußten, daß er es daheim tat. Wenn seine Tante ihn vor uns auf polnisch ansprach, antwortete er auf englisch. Er schämte sich, in unserer Gegenwart Polnisch zu sprechen. Eine Spur unterschied sich sein Gebrauch des Englischen von unserem; er verwendete die Gossensprache, in der wir schwelgten, nicht mit der gleichen Unbefangenheit oder Geläufigkeit wie die übrigen Jungen. Er war auch höflicher als wir und zollte Erwachsenen Respekt, wogegen es uns anderen Kindern augenscheinlich Spaß machte, ordinär, respektlos und unbekümmert um unsere Redeweise zu sein. Mit anderen Worten, Stanley besaß gute Manieren, obwohl er gerade so ein Gassenflegel war wie wir. Stanley hatte diese Gewohnheiten nicht aus sich heraus, sie waren ein Ergebnis dessen, daß er von Menschen aus der Alten Welt erzogen wurde. Diesen Hauch von Raffinement an ihm fanden wir, seine Freunde, etwas komisch, aber wir wagten nie, ihn deswegen zu verspotten. Stanley konnte es nicht nur mit den besten von uns aufnehmen, er verbreitete auch, wie ich schon sagte, Furcht und Schrecken, wenn man ihn reizte oder beleidigte.
Es gab noch etwas anderes an Stanley, das ich erwähnen sollte – seine Eifersucht. Während ich noch in derselben Nachbarschaft wohnte, lernte ich zwei Jungen meines Alters kennen, die, wie wir es nannten, auf dem Lande wohnten – in Wirklichkeit war es ein Vorort von Brooklyn.
Hier und da luden meine Eltern diese Jungen zu uns ein; später besuchte ich dann auch sie – «auf dem Land». Joey und Tony hießen sie. Joey wurde bald einer meiner engen Freunde. Stanley hatte aus diesem oder jenem Grund für meine neuen Freunde nicht viel übrig. Zuerst machte er sich über sie lustig, weil sie sich anders benahmen als wir. Er behauptete, sie seien dumm und zu naiv – Bauerntölpel, mit andern Worten. In Wahrheit war er eifersüchtig, besonders auf Joey, für den ich große Zuneigung empfand, und das spürte er. Es war, als seien Stanley und ich Blutsbrüder und als habe niemand das Recht, zwischen uns zu treten. Es stimmte natürlich, daß es keinen anderen Jungen in der Nachbarschaft gab, für den ich solche Gefühle hatte wie für Stanley. Seine einzigen Rivalen waren ältere Jungen, die ich als meine Idole ansah. Ich war ein Heldenanbeter, ein geborener Heldenanbeter, ohne Zweifel. Und ich bin es noch immer, Gott sei Dank. Nicht so Stanley. Ob er zu halsstarrig war, zu stolz, sein Haupt zu beugen, oder nur schlicht eifersüchtig, ich weiß es nicht zu sagen. Er hatte einen Blick für die Fehler und Schwächen anderer und war ziemlich gut darin, lächerlich zu machen und zu verunglimpfen, wen er nicht mochte. Alle seine Bemühungen waren umsonst, wo es um meine Idole ging. Für mich waren meine Idole, einerlei was irgend jemand sagte, aus purem Gold. Ich sah nur ihre Tugenden; wenn sie Mängel besaßen, so war ich dafür blind. Es mag ziemlich lächerlich klingen, aber ich glaube, ich sehe die Dinge heute noch ganz genauso. Noch immer betrachte ich Alexander den Großen und Napoleon als außergewöhnliche Gestalten, als Männer, die man, welche Fehler sie auch hatten, bewundern muß. Ich denke noch immer voller Ehrfurcht an Gautama Buddha, Milarepa, Ramakrischna, Swami Vivekananda. Ich verehre noch immer solche Schriftsteller wie Dostojewskij, Knut Hamsun, Rimbaud, Blaise Cendrars.
Es gab einen älteren Jungen, in dem ich nicht einen «Helden» erblickte wie in den anderen, sondern eher einen Heiligen – nicht einen heiligen Augustinus oder heiligen Bernhard, sondern einen heiligen Franziskus. Das war Johnny Paul, ein in Sizilien geborener Italiener. Bis zum heutigen Tage denke ich an Johnny Paul mit der größten Zärtlichkeit, bisweilen – um aufrichtig zu sein – mit Tränen in den Augen. Er muß acht Jahre älter gewesen sein als Stanley und ich, was nach der Zeitrechnung der Kindheit eine Menge ist. Soweit ich mich erinnere, lebte er vom Kohlenaustragen. Er hatte eine dunkle Gesichtshaut, mit buschigen Brauen über zwei dunklen, glänzenden Augen, die glühten wie heiße Kohlen. Seine Kleidung war immer schmutzig und zerlumpt und sein Gesicht mit Ruß bedeckt, aber innen war er rein, rein wie ein Engel. Was mich an ihm überwältigte, war seine Zärtlichkeit, seine sanfte, melodische Stimme. Allein die Weise, wie er sagte: «Hallo, Henry, wie geht's dir heute», brachte mich zum Schmelzen. Es war die Stimme eines mitfühlenden Vaters, der alle Kinder Gottes liebte.
Selbst Stanley erlag seinem Zauber, der nichts weiter war als ein zutiefst gutes Wesen und eine Demut, die vollkommen lauter war. Stanley mochte an ihm sogar, daß er ein «Spaghetti» war, während er Louis Pirossa und einige der anderen «Spaghetti» seiner Aufmerksamkeit nicht für wert befand.
Wenn man sieben oder acht Jahre ist, kann ein älterer Junge im Leben eine wichtige Rolle spielen. Er ist ein Vater, ohne Vater zu sein; er ist ein Gefährte, ohne Spießgeselle oder Kumpan zu sein; er ist Erzieher, ohne wie ein Lehrer Verbote im Munde zu führen; er ist Beichtvater, ohne Priester zu sein. Er kann den Charakter eines Jungen formen oder ihm sozusagen den Weg weisen, ohne aufdringlich, wichtigtuerisch oder salbungsvoll zu sein. All dies war uns Johnny Paul. Wir beteten ihn an, wir hingen an seinen Lippen, wir gehorchten ihm und wir vertrauten ihm. Ich wünschte, daß wir dasselbe von unseren richtigen Vätern, unseren richtigen Lehrern, unseren richtigen Priestern und Ratgebern hätten sagen können!
Wenn wir in der Abendkühle auf den Stufen vor der Haustür saßen, zerbrachen Stanley und ich uns oft den Kopf, weil wir uns nicht erklären konnten, warum Johnny Paul so anders war als die übrigen jungen Männer seines Alters. Wir wußten, daß er keine Schulbildung genossen hatte, daß er nicht lesen und schreiben konnte, daß seine Eltern sehr bescheidener Herkunft, daß sie sozusagen niemand waren, aber auch kein Gesindel. Woher hatte er seine guten Manieren, seine Freundlichkeit, seine Vornehmheit, seine Langmut? Denn vor allem anderen war Johnny Paul ein toleranter Mensch. Er achtete den Schlechtesten unter uns genauso wie den Besten; er begünstigte niemanden. Was für eine große, große Sache das ist, besonders wenn man unter engstirnigen, voreingenommenen, bigotten Personen aufwächst, wie es die meisten unserer Eltern waren, einschließlich des scheinheiligen Evangelienpredigers, des alten Ramsey, der bei Stanley nebenan wohnte und ihn manchmal mit einer Pferdepeitsche die Straße hinunterjagte.