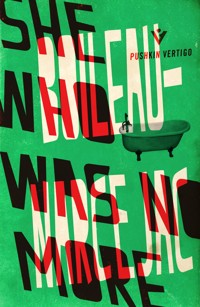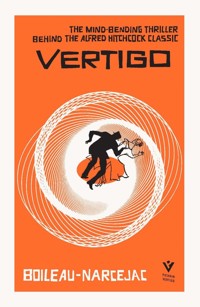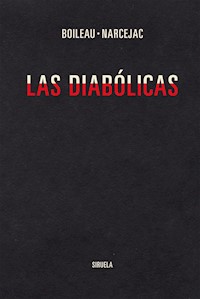3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In einem verträumten Schloß an der Loire geschieht ein Mord. Ein Raubmord? Das kostbarste Gemälde des Schloßherrn de Moncelles verschwindet, ein Verbrecher entweicht durch Mauern, ein Gefängniswagen wird vom Erdboden verschluckt – Graf de Moncelles beginnt an Zauberei zu glauben. Die Kette mysteriös-bedrohlicher Ereignisse, die sich immer enger um das Schloß legt, sprengt Privatdetektiv André Brunel. Mit eisernen Nerven, scharfer Logik und unter dem Einsatz seines Lebens durchbricht er den Trug und dringt zur Wahrheit vor. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Ähnliche
Pierre Boileau
Der ruhende Bacchus
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Ernst Sander
FISCHER Digital
Inhalt
1
Als es von der Kathedrale zu Vomoire halb zwölf schlug, bog ein graues Auto, ein starker Wagen, der aber langsam fuhr, in die Hafermarktgasse ein.
In jenem Wagen zwei Männer. Obwohl sie den Glockenschlag gehört hatten, blickten sie bei der Fahrt über den Kirchplatz unwillkürlich zur Turmuhr auf.
«Halb . Wir sind pünktlich», sagte der am Volant. «Um Viertel vor bist du am Schloß.»
«Wir hätten sogar noch Zeit, einen zu heben», sagte sein Kamerad; er hatte den Blick unmittelbar von der Kirche zu einem an dem Platz gelegenen Café hinüberwandern lassen.
Mit einer Grimasse fügte er hinzu:
«Das gäbe mir ein bißchen Mumm in die Knochen.»
Der Lenker des grauen Autos ereiferte sich:
«Das ist denn doch! Drehwerfer, du verlierst den Kopf! Du weißt doch, daß wir nicht auffallen dürfen . Ich hätte lieber nicht mal durch Vomoire fahren sollen.»
«Quatsch! Jetzt sitzt alles beim Mittagessen. Keiner Katze sind wir begegnet!»
«Ein Grund mehr, sich nicht zu zeigen.»
Am Ausgang der Hafermarktgasse bog der Wagen nach rechts ab. Kurz danach fuhr er aus der Stadt hinaus und schlug die parallel zur Loire sich erstreckende Landstraße ein.
Der Fluß war angeschwollen, das Wasser lehmig. Pariser Ferienreisende, denen nur das lachende Antlitz der sommerlichen Touraine vertraut ist, hätten die Loire nicht wiedererkannt. Ein scharfer Dezemberwind ließ die kahlen Zweige der Bäume schwanken. Das Erdreich war schwarz. Es fror.
Auf den Feldern längs der Landstraße, so weit das Auge reichte, keine Menschenseele.
«Mußt du dir tatsächlich Mumm in die Knochen trinken?» redete der Lenker des Autos weiter.
«Nein. Wenn ich von so was gesprochen habe, dann ging es mir mehr um einen Schnaps. Ich habe schon andere Dinge gedreht, das weißt du doch.»
«Ja, ja, kann ich mir denken.»
In der Ferne erschienen die Ziegeldächer eines Dorfes.
«Ich setze dich an der zweiten Kreuzung ab. Den Rest des Weges gehst du zu Fuß», sagte der Lenker.
«In Ordnung.»
Das Auto stoppte an der angegebenen Kreuzung.
«Du nimmst mich also hier wieder an Bord. Sei pünktlich», sagte der Mann mit dem absonderlichen Spitznamen «Drehwerfer».
«Was meinst du wohl!»
Der Fahrer hielt dem Kameraden die Hand hin.
«Also, Hals- und Beinbruch! Hast du alles bei dir, was du brauchst?»
Drehwerfer war ausgestiegen und stand auf der Landstraße. Er klopfte auf die Tasche seines dicken Mantels.
«Alles!»
Der andere ließ bereits den Motor anspringen. Drehwerfer wandte sich nach den ersten Schritten um.
«Hör mal!» Seine Stimme klang plötzlich ganz anders. «Wenn die Sache merkwürdigerweise schiefgehen sollte . dann sag dem Chef, er solle mich nicht vergessen.»
«Schon gut. Aber was soll denn passieren? Ist nicht alles ausbaldowert?»
«Doch, 'türlich.»
«Na, was dann?»
Drehwerfer zuckte die Achseln; dann ging er entschlossenen Schrittes dem Dorfe zu. Währenddessen steuerte Ludchen den Wagen in einen kleinen Seitenweg, den er langsam hinabfuhr. Offenbar hatte der Mann nichts anderes zu tun, als auf die Rückkehr seines Kameraden zu warten.
Schwerlich dürfte jemand das Dörfchen Chaumigny kennen, wäre nicht das Schloß, und schwerlich dürfte jemand das Schloß des Grafen de Moncelles kennen, wäre nicht die Gemäldesammlung; sie ist eine der köstlichsten und kostbarsten.
Schloß Chaumigny bietet nämlich an sich nicht das mindeste Interesse. Keine Spur von Stil, vier zum Verzweifeln banale Fassaden, Mobiliar der Jahrhundertwende; nichts in dem weitläufigen Gebäude, das der verstorbene Vater des Grafen Gilbert de Moncelles hat erbauen lassen, ist der Beachtung wert. Übrigens steht nur die Gemäldegalerie dem Publikum zur Besichtigung offen.
Aus diesen Zeilen darf indessen nicht gefolgert werden, der Schloßherr von Chaumigny sei ein Mann ohne jeden Geschmack. Graf de Moncelles ist ganz einfach gleichgültig gegen alles, was nicht Malerei ist.
«Ich hätte nichts dagegen, in einer Strohhütte zu hausen», sagte er manchmal, «vorausgesetzt, ich könnte meine Bildersammlung ganz und gar darin unterbringen!»
Denen, die da wissen, daß der Graf gewöhnlich für seine persönlichen Bedürfnisse sechs Diener braucht, dürfte die Aufrichtigkeit einer solchen Äußerung recht zweifelhaft vorkommen. Ihnen soll folgende Begebenheit berichtet werden; sie ist absolut authentisch.
Etwa drei Jahre vor den hier geschilderten Ereignissen litt Graf de Moncelles an einer akuten Blinddarmentzündung und ließ sich von einem großen Pariser Spezialisten untersuchen; dieser verlangte für die Operation dreißigtausend Francs.
«Dreißigtausend Francs», rief unser Schloßherr, «das ist gerade der Preisnachlaß, den ich für eine Miniatur aus dem sechzehnten Jahrhundert verlange und den der Händler mir nicht bewilligen will.»
Er fuhr mitsamt seinem Blinddarm wieder heim und kaufte die Miniatur. Wir wollen nicht verschweigen, daß er nie wieder Blinddarmschmerzen gehabt hat.
Wenn die Einwohner von Chaumigny untereinander von ihrem Schloßherrn sprechen, tupfen sie sich manchmal mit dem Zeigefinger auf die Stirn; aber in dieser Geste darf weniger ein Zeichen der Böswilligkeit erblickt werden als eine Sympathiebekundung, die indessen eine gelinde Bosheit nicht ausschließt. Die wackeren Leute besitzen nämlich, wie wir gleich sehen werden, gewichtige Gründe, den Herrn Grafen gern zu haben. Kurzum: sie sind nicht wenig stolz auf den Ruhm, den die kostbare Gemäldegalerie ihrem Dörfchen verleiht . Selbstverständlich haben sie nie die Neugier gehegt, sie sich einmal anzusehen.
Es ist wohl angebracht, hinzuzufügen, daß die eifrigsten Parteigänger des Grafen der Wirt des Gasthauses «Wanderers Ruh», in dem die Fahrer der Autobusse während der Besichtigungen Zuflucht suchen, und der Inhaber des Kaufladens «Reiseandenken» sind: dort werden zumal farbige Ansichtskarten und beinerne Serviettenringe und Federhalter verkauft.
Zu wiederholten Malen haben sie bei Gilbert de Moncelles auf den Busch geklopft; sie möchten ihn nämlich zum Bürgermeister des Dorfes machen. Jedesmal hat er diese Ehre höflich, aber fest abgelehnt. Der Herr Graf ist nicht auf den Kopf gefallen.
Für den, der von Vomoire kommt, wie die aus dem grauen Auto gestiegene beunruhigende Persönlichkeit, ist das Schloß das erste Haus des Dorfes Chaumigny. Wir sollten lieber genauer schreiben, es sei außerhalb des Dorfes gelegen; denn ihm gegenüber, auf der andern Seite der Landstraße, sieht man lediglich Felder. Sie sind ebenfalls Eigentum des Grafen.
Der Schloßpark wird durch eine niedrige Mauer beschirmt, die ein hohes Eisengitter trägt. Aber kann man die schmale Rasenfläche, deren Form halbwegs an die eines Hufeisens erinnert und die das Haus an drei Seiten umgibt, überhaupt als Park bezeichnen?
Vor der Fassade befindet sich ein Hof mit Kopfsteinpflaster. Hat man die Biegung der Landstraße hinter sich, so gewahrt man, schräg durch die Gitterstäbe hindurch, die Fassade sowie die Nordseite des Schlosses. Ebenso gewahrt man längs des Gitters, links vom Eingang, das einstöckige Häuschen der Pförtnersleute. Aber dem wird für gewöhnlich keine Aufmerksamkeit geschenkt.
Jenes kleine Haus indessen hielt Drehwerfers Blick lange fest. Er sagte sich, binnen kurzem, nach der Durchführung seines Auftrags, werde er über den Schloßhof und an der Pförtnerloge vorbeigehen müssen. Und dieser Gedanke war ihm höchst unbehaglich. Drehwerfer wußte, daß er ein sehr kaltblütiger Mensch war; aber er meinte, er müsse dann noch mehr Kaltblütigkeit als sonst aufbringen, um nicht, was dumm sein würde, zu laufen anzufangen.
Fast gewaltsam mußte er den Blick losreißen.
Die Loire war über die Ufer getreten; zahlreiche Bäume standen im Wasser. Die dünneren schwankten in der Strömung; sie waren unablässig in Bewegung. Die Felder hatten eine bräunliche Tönung, und der blasse Himmel schien schwer auf dieser trostlosen Landschaft zu lasten. Es war völlig still, bedrückend still, und Drehwerfer fing an, leise aufzutreten. Das war eine überflüssige Vorsichtsmaßnahme; er hatte nicht die mindeste Absicht, unbemerkt zu bleiben.
Er richtete den Blick wieder geradeaus, auf das kleine Dorf, dessen einzige Straße leer zu sein schien, und dann auf das Schloß. Aus dem Pförtnerhaus stieg Rauch auf.
Ein paar Augenblicke später stand Drehwerfer vor dem Gitter. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Es war bitter kalt, und er war langsam gegangen. Trotzdem war seine Stirn von Schweiß bedeckt.
Das Ehepaar Hauchecorne, die Pförtnersleute von Schloß Chaumigny, saß bei Tisch vor einer Schüssel Pökelfleisch mit Linsen.
«Sieh mal, ein Kenner», sagte Vincent Hauchecorne mit vollem Mund, als er den Mann vorbeigehen sah. «Wieder mal einer, der sich in einer Menschenschar nichts ansehen kann. Er. muß dieselben Ansichten haben wie unser Herr.»
«Na, wegen den paar Menschen, die zu dieser Jahreszeit auftauchen, hätte er ebensogut im Lauf des Tages kommen und sich die Zeit zum Mittagessen nehmen können», antwortete die Frau.
Mit gerecktem Hals beobachtete Vincent den Besucher, bis dieser an der Freitreppe des Schlosses angelangt war; dann richtete er mit einer gleichmütigen Bewegung den Blick wieder auf seinen Teller.
Manuel und Auguste, die beiden Aufseher der Gemäldegalerie, saßen in der Vorhalle des Schlosses beim Kartenspiel. Wie immer hatten sie gegen halb elf zu Mittag gegessen, und seitdem gewannen sie einander gegenseitig das Fünfzig-Centime-Stück ab, das bei jeder Partie den Einsatz darstellte.
Taten sie nicht ihren Dienst, so gingen die beiden den andern Dienern zur Hand; aber der Graf verlangte, daß sie von elf bis sechzehn Uhr (den Stunden, da das «Museum» geöffnet war) den Besuchern zur Verfügung stünden.
Es war bei Manuel und Auguste vor allem eine Frage der Selbstachtung; denn während der schlechten Jahreszeit fanden jene Besucher sich nur selten ein. An vielen Tagen kam sogar überhaupt niemand ins Schloß.
Manuel und Auguste spielten leidenschaftlich gern Karten. Sie waren mit ihrem Los vollauf zufrieden.
Die Vorhalle war ein großer, kreisrunder Raum mit Fliesenboden. Außer der zweiflügeligen Glastür wies sie zwei einander gegenüberliegende Türen auf; die links führte in die Privatgemächer des Grafen, die rechts in die Galerie. Hinten war eine Treppe aus imitiertem Marmor.
Die beiden Aufseher saßen an einem kleinen schwarzen Holztisch, auf dem ständig eine Büchse für Trinkgelder und eine Schachtel mit Garderobenummern standen (das Abgeben von Spazierstöcken und Schirmen war obligatorisch).
«Na ja», brummte Auguste, als er den Besucher über den Hof herankommen sah. «Der kann nicht zu Mittag essen wie alle andern Menschen.»
«Ißt du etwa zu Mittag wie alle andern Menschen?» entgegnete Manuel lachend.
Mit einer Raschheit und Abgemessenheit, die auf lange Übung schließen ließen, zogen sie das Schubfach des Tisches auf und legten in sorglich gesonderten kleinen Stapeln den Talon, ihre Karten und ihrer beider Stiche hinein. Dann schoben sie das Fach wieder zu, und zwar vorsichtig, damit die Karten nicht durcheinandergerieten. Die Partie war nur unterbrochen.
Der Mann war an der Freitreppe angelangt. Manuel beeilte sich, ihm die Tür zu öffnen. Er wußte aus Erfahrung, daß Einzelgänger im allgemeinen nicht knausrig sind.
«Möchte der Herr die Galerie besichtigen?» (Die Aufseher hatten die Gewohnheit beibehalten, in der dritten Person zu sprechen.)
«Ja, das möchte ich.»
Auguste war am Tisch sitzen geblieben. Er erhob sich leicht vom Stuhl und sagte:
«Ich darf den Herrn darauf aufmerksam machen, daß das Museum gut geheizt ist. Wenn der Herr seinen Mantel hierlassen will, weil man, wenn man wieder in die Kälte hinaustritt .»
«Danke, nicht nötig», antwortete der Besucher und fuhr sich in einer instinktiv schützenden Geste mit den Ellbogen am Körper entlang; sie entging den Aufsehern.
Auguste ließ sich wieder auf seinen Sitz fallen und holte heimlich seine Rolle Kautabak aus der Tasche. Inzwischen hatte Manuel die Tür zur Galerie geöffnet.
«Bitte hier, Monsieur.»
Der Besucher ging hinein. Der Aufseher machte die Tür zu und begann sofort:
«Oben der Zorn des Merkur von Mantegna. Das Bild wurde im Auftrag der Isabella d'Este gemalt .»
Die Gemäldegalerie des Schlosses Chaumigny ist ein großer Saal, zwanzig Meter lang und fünf Meter breit. Die Architektur ist erdenklich schlicht, ohne das geringste Schmuckwerk. Weder Rosetten noch Täfelung noch Hohlkehlen, nichts, nicht einmal eine Plinthe an den Wänden. Diese sind völlig glatt und in einem gelblichen Grau gehalten, das die Bilder prächtig zur Geltung bringt.
Die Gemälde hängen nur an einer der großen Längswände des Raumes. Die andere hat drei hohe Fenster nach dem Hof hin. Auf diese Weise erhalten sämtliche Werke gleichmäßig Licht.
Am Ende der Galerie, gegenüber der Eingangstür, befindet sich ein hoher Kamin, in dem sechs Monate des Jahres hindurch ein Holzfeuer brennt.
Daraus darf nun allerdings nicht geschlossen werden, der Graf de Moncelles sei ein Menschenfreund und darauf bedacht, es den Besuchern behaglich zu machen. Der Schloßherr ist nur um sein eigenes Wohlsein besorgt. Er geht mehrmals am Tage in seine Galerie, wenn gerade niemand sonst darin ist, und er ist ein Fröstling.
Manche Menschen verbringen ihre Abende im Theater, im Konzert, im Café oder hören Radio; andere lesen. Der Schloßherr von Chaumigny betrachtet seine Bilder.
Richtiger: er schaut sich an jedem Abend nur ein einziges an. Welches? Graf de Moncelles trifft die Entscheidung beim Abendessen.
«Henri», sagt er zu seinem Kammerdiener, «rücken Sie meinen Sessel vor die Kreuzigung von Carpaccio.»
Die Pfeife im Mund, setzt sich der Graf vor das Bild und sieht es an, manchmal stundenlang. Im Raum ist es angenehm warm. Geschickt angebrachte elektrische Lampen beleuchten die herrlichen Werke wie Tageslicht. Wer ihn in solchen Augenblicken beobachten könnte, würde glauben, der Graf sei in Ekstase. Und ist er denn das nicht tatsächlich?
Wie viele Abende hat der reiche Liebhaber nicht schon dem Studium jedes einzelnen Stückes seiner kostbaren Sammlung geweiht! Und dennoch: jedesmal, wenn er vor einem von ihnen stehenbleibt, entdeckt er neue Schönheiten. Bislang nicht wahrgenommene, winzige Einzelheiten enthüllen sich den Augen des leidenschaftlichen Sammlers, und dann unterschiebt er dem Maler eine geheime Absicht . die dieser wahrscheinlich nie gehabt hat.
Der Einsiedler von Schloß Chaumigny ist etwa sechzig Jahre alt, Witwer und kinderlos, hat nicht einmal einen wahren Freund und als einzige Gesellschaft nur köstliche, aber stumme Gestalten; aber er hält sich für den glücklichsten aller Sterblichen.
Unter der Führung des Aufsehers Manuel hatte der Unbekannte (denn auch wir kennen ihn ja nur unter seinem Spitznamen) die Hälfte der Galerie durchschritten. Manuel fuhr mit seiner monotonen Stimme fort:
«Ein Bildnis Luthers, Lorenzo Lotto zugeschrieben.»
Der Besucher hörte nicht zu, und wenn er zu den Bildern hinblickte, dann nahm er sie sicherlich nicht wahr. Einzig die Fenster schienen auf ihn Anziehungskraft auszuüben. Immer wieder wandte er sich zu ihnen hin, ohne daß seinem Begleiter sein sonderbares Verhalten auffiel.
Der Schloßhof, den Drehwerfer kurz zuvor überquert hatte, war leer. Ängstlich richtete er die Blicke auf die Fenster des kleinen Pförtnerhauses. Aber auf diese Entfernung konnte er nicht sehen, was drinnen vor sich ging. Offenbar konnte man von der Loge aus ebensowenig sehen, was in der Galerie geschah.
Auch die Landstraße vor dem Schloß und die jenseits jener Landstraße sich bis zum Horizont erstreckenden Felder waren menschenleer. Ganz entschieden war die Stunde klug gewählt worden.
«Bildnis eines Schusters, von Giambattista Moroni», sagte der Aufseher.
Der Besucher nickte billigend. Langsam gingen sie weiter. Eine dunstverhüllte Sonne lieh dem Raum weiche Helle. Das Parkett war gut gewachst. Dann und wann spiegelte sich vor dem Kamin ein roter Lichtschein. Der Unbekannte musterte seinen Begleiter.
Der Aufseher war ein unauffälliger, mittelgroßer Mann von vierzig Jahren. Er hatte einen kleinen kastanienbraunen Schnurrbart mit aufgezwirbelten Spitzen; sein Haar lichtete sich. Unwillkürlich blickte Drehwerfer auf die Hand des Mannes. Am vierten Finger gewahrte er einen Ehering.
Manuels Stimme wurde plötzlich lebhafter:
«Der Ruhende Bacchus, von Leonardo da Vinci.»
Dieses Bild stellte den Glanzpunkt der Sammlung des Grafen de Moncelles dar; es war für die Aufseher an Tagen von Besichtigungen durch Reisegesellschaften «der Knalleffekt».
Wie im Theater gewisse Repliken unvermeidlich im Zuschauerraum eine Reaktion hervorrufen, brachte die Ankündigung des Bildes von Leonardo jedesmal Bewegung in die Gruppe. Den Besuchern kam wieder zu Bewußtsein, daß sie sprechen konnten.
Alle Fachleute waren sich einig, daß der Ruhende Bacchus, für den mehrere Nationalmuseen schon beträchtliche Summen geboten hatten, eines der Meisterwerke des Künstlers sei. Was die Laien betraf, so war es vor allem die Magie des Namens Leonardo da Vinci - unter allen der einzige ihnen vertraute und auch der einzige, bei dem sie sich an irgend etwas erinnerten - was ihre Begeisterung entfesselte. Bislang waren sie schüchtern gewesen; nun aber begannen sie Bewunderung zu äußern.
Genauso machen im Louvre die braven Sonntagsbesucher, die seit dem Betreten der Großen Galerie stumm gewesen waren, vor der Mona Lisa ihre ersten Bemerkungen.
Auch diejenigen, die nicht das Glück hatten, die Galerie im Schloß des Grafen de Moncelles besuchen zu können, kennen den Ruhenden Bacchus aus den zahlreichen Wiedergaben, die Zeitungen und Illustrierte zur Zeit des Dramas veröffentlichten. Dennoch wollen wir, ehe wir mit unserer Erzählung fortfahren, eine Beschreibung dieses hochberühmten Bildes einschalten.
Im kühlen Schatten einer Höhle, auf einem moosbedeckten Felsblock, schlummert der junge Gott; sein Nacken liegt auf seinem eingewinkelten Arm.
Aus dem Halbdunkel der Stätte hebt sich das feine Gesicht des Jünglings ab; es bewahrt eine verwunderliche Helle. Die Stirn mit Reblaub bekränzt, die Schultern von wallenden Locken bedeckt - so träumt Bacchus. Ein Lächeln dehnt seine Lippen, bezaubernd, rätselhaft, unergründlich: das «leonardeske» Lächeln.
Die andere Hand hat der Jüngling auf das gefleckte Hirschkuhfell gelegt, das seine Hüften umgibt; seinen geöffneten Fingern ist der Thyrsusstab entglitten.
Die Höhle wirkt sehr tief. Hinter dem Schläfer ist die Finsternis fast undurchdringlich, aber in der Ferne dringt aus einem Felsspalt ein goldener Strahl in die Höhle, und der Hintergrund des Bildes ist in unwirkliches Licht getaucht . ein Lichtschein, in dem viele ein geheimnisvolles Symbol haben erblicken wollen.
«Das Bild wurde 1517 auf Schloß Cloux vollendet, wo Franz I. dem Künstler Wohnung gewährt hatte», leierte Manuel. «Leonardo da Vinci war damals erschöpft von dem Fieber, das er sich im Sumpfgebiet von Sologne zugezogen hatte, und es wird erzählt, daß eines Tages der König .»
Hätte der Aufseher in diesem Augenblick seinen Begleiter angesehen, so wäre er sehr erstaunt gewesen, daß dessen Unterlippe zitterte und daß auf seinen Schläfen Schweißtropfen perlten.
Der Unbekannte war ein paar Schritte zurückgetreten. Aber warum hätte das Manuel stutzig machen sollen? Er hatte es häufig erlebt, daß Besucher, die ein Reflex auf einem Bilde störte, dasselbe taten.
Drehwerfer warf einen letzten Blick auf das Fenster. Nach wie vor die gleiche unbewegte Landschaft. Langsam schob er die Hand in eine seiner tiefen Manteltaschen und zog sie sofort wieder heraus. Seine Finger umfaßten eine kurze stählerne Spiralfeder; sie lief in eine faustgroße Bleikugel aus. Blitzschnell hob er den Arm.
«. und deshalb kaufte Franz I. das Bild nicht; der Schüler des Meisters brachte es nach Florenz», sagte der Aufseher.
Der Schlag traf ihn an der Schädelbasis. Es gab ein ekelhaftes Knacken. Manuel schwankte eine Sekunde und brach zusammen.
Schon hatte der Unbekannte sein Opfer um die Mitte gefaßt, damit es nicht heftig auf den Boden aufschlug. Vorsichtig streckte er den Körper auf dem Parkett aus. Unter den Haaren begann es zu sprudeln, und aus den Nasenlöchern sickerte ein doppeltes Blutrinnsal.
Eine Weile blieb Drehwerfer reglos stehen, mit angespannten Muskeln, zum Losspringen bereit, die Hand um den Griff des Totschlägers gekrampft. So wenig Geräusch der tödliche Hieb auch gemacht hatte: hätte er nicht dennoch im Schloß gehört werden können? Würde nicht jemand hereinkommen?
Nein. Die Tür blieb geschlossen. Der in der Vorhalle sitzende Aufseher hatte nichts gemerkt.
Im Kamin prasselten fröhlich die Scheite. Auf einer der Fensterbänke wetzte sich ein Vogel den Schnabel, und auf seinem Mooslager lächelte Bacchus sein betörendes Lächeln.
Der Mörder steckte den Totschläger wieder in die Tasche und ging geradewegs auf das Bild zu.
2
Währenddessen beendete Graf de Moncelles sein einsames Mahl im Eßzimmer des Schlosses, dem Lederstühle mit hohen Rückenlehnen und ein massives Eichenbuffet ein strenges Aussehen verliehen.
Nach der dritten Orange stand er schwerfällig auf, da er an schlechter Verdauung litt, und begab sich langsam in den Salon, wohin sein Diener Henri ihm folgte.
Der Graf ließ sich in einen Sessel sinken und legte die Beine auf einen Puff. Ohne hinzusehen, mit einer bemerkenswert genau bemessenen Geste, streckte er alsdann die Hand nach dem Zigarettenetui aus, das Henri ihm hinhielt.
Der Diener erkundigte sich:
«Was wünschen Herr Graf nach dem Kaffee? Mirabelle . Prunelle . Kirsch . Cognac .»
«Bringen Sie mir Mirabelle.»
Aber der Diener rührte sich nicht. Er kannte seinen Herrn. Und tatsächlich berichtigte dieser sich gleich:
«Nein, Cognac.»
Zu der Zeit, da unsere Erzählung einsetzt, war Graf Gilbert de Moncelles siebenundfünfzig Jahre alt. Er war mittelgroß, schwer, mit dem merklichen Ansatz eines Bauches. Ein kräftiger Schnurrbart beherrschte das von mannigfachen Falten durchzogene Gesicht. Auf seinem marmorblanken Schädel bildeten seine letzten, in gleichmäßige Strähnen gelegten Haare fünf parallele Streifen, die spaßigerweise an Notenlinien erinnerten. Diese Vorstellung wurde vollendet durch den unwahrscheinlichen Baßschlüssel, den an der einen Seite eine etwas längere Strähne ringelte.
Der Graf war nach siebenjähriger Ehe ziemlich früh Witwer geworden und hatte nicht wieder geheiratet. «Warum ein Experiment wiederholen?» sagte er. «Ich war vollkommen glücklich; mein Leben lang wird diese Ehe eine herrliche Erinnerung für mich sein - warum, zum Teufel, soll ich es riskieren, diesen guten Eindruck zu zerstören?»
Für die Dienerschaft des Schlosses stand indessen fest, daß ihr Herr nie etwas anderes geliebt hatte und nie etwas anderes lieben würde als seine Bilder.
Das Leben des Grafen war auf bewundernswerte Weise geregelt. Gilbert de Moncelles stand um neun auf, frühstückte, unternahm einen Gang über die Felder, der unfehlbar mit einem Durchschlendern des Dorfes endete.
Der Graf kannte alle Bewohner von Chaumigny. Er blieb stehen und unterhielt sich mit den ihm Begegnenden, und wenn er niemanden traf, tat er, als wollte er ein paar Kleinigkeiten einkaufen, und ging in die Läden, wo er plaudernd verweilte.
Die wackeren Leute wußten das Wohlwollen ihres Schloßherrn zu schätzen; sie erzählten ihm von ihren Plänen, ihren Hoffnungen und vertrauten ihm unumwunden auch ihre Mißhelligkeiten jeder Art an. Gilbert de Moncelles billigte, tadelte, gab Ratschläge, und häufig öffnete er sogar die Brieftasche. Daher genoß er in der ganzen Gegend den Ruf eines schlichten, wohltätigen Menschen.
Um der Treue des Bildnisses willen müssen wir noch hinzufügen, daß der Schloßherr sich nicht aus Seelengüte so verhielt. Das Schicksal hatte sich ihm gegenüber verschwenderisch bezeigt, er war wunschlos; aber um völlig glücklich zu sein, bedurfte Gilbert de Moncelles des Anblicks der Not anderer Menschen. Die Geldschwierigkeiten, mit denen sich seine Mitbürger herumschlugen, machten ihm den Wert seines Vermögens bewußt, so wie Ehenöte ihn sein einzelgängerisches Dasein schätzen lehrten. Je betrüblicher die Geständnisse waren, die der Graf bei seinem Morgenspaziergang hörte, desto größer wurde sein Appetit.
Nach dem Mittagessen trank Gilbert de Moncelles seinen Kaffee, danach ein Gläschen Schnaps und rauchte eine Zigarre. Nachmittags überflog er die Zeitungen und blätterte in Kunstzeitschriften; manchmal schlug er auch einen Roman auf, den er zwar nie zu Ende las. Um fünf Uhr begab er sich abermals ins Freie, und zwar diesmal im Auto; er fuhr selber. Im allgemeinen ging es nach Vomoire, wo er mit einigen Leuten verkehrte.
Nach dem Abendessen sagte der Graf zu Henri:
«Werfen Sie ein Scheit in den Kamin, und rücken Sie den Sessel vor den Heiligen Antonius von Lippi.»
Selbstverständlich rührte Henri sich nicht vom Fleck. Es konnte nicht anders sein; der Graf fuhr fort:
«Nein . nicht vor den Heiligen Antonius, vor die Auferstehung von Vivarini.»
Gilbert de Moncelles hob zunächst das Glas an die Nase und schnupperte mit halbgeschlossenen Augen genießerisch den Duft des Cognacs. Dann senkte er das Glas bis zu den Lippen und trank langsam.
«Henri», sagte er nach einer Weile, «Sie brauchen nicht wie das letztemal zu warten, bis das Fäßchen leer ist, ehe Sie es mir mitteilen.»
«Herr Graf können beruhigt sein; es ist noch über ein Liter drin.»
Der Schloßherr nickte zufrieden und führte abermals das Glas zum Munde. Doch er stellte es wieder nieder, ohne getrunken zu haben.
Ein Schrei war erschollen: «Halt ihn fest!» Ein sonderbarer Schrei, zwar nicht sehr laut, aber er klang verzweifelt. Der ihn ausstieß, legte spürbar seine letzten Kräfte und all seine Energie hinein, und der Ruf war zugleich ein Todesschrei.
Herr und Diener stürzten gleichzeitig zur Tür und in die Vorhalle. Dort blieben sie sprachlos stehen.
Auguste, der Aufseher, stürmte aus dem Schloß hinaus und sprang die Stufen der Freitreppe hinab in den Hof. Vor ihm, die Ellbogen an die Seiten gepreßt, den Oberkörper vorgereckt, hetzte ein Mann davon, dem Gittertor zu.
Zunächst schien der Abstand der beiden Männer sich nicht zu verändern, aber nur zu bald wurde ersichtlich, daß er sich vergrößerte. Der Flüchtende schien bedeutend jünger als Auguste zu sein.
Mit überschnappender Stimme, die unter andern Umständen komisch geklungen hätte, rief der Aufseher:
«Vincent . Vincent!»
Die Tür der Loge ging auf, und der Pförtner kam zum Vorschein.
Nach kurzem Zaudern machte er rasch das Gittertor zu, dann trat er dem Unbekannten tapfer entgegen.
Drehwerfer blieb jäh stehen, dann schlug er eine andere Richtung ein und lief Auguste, der die Schwenkung des Flüchtenden geahnt hatte und sogleich schräg abgebogen war, buchstäblich in die Arme.
Der Kerl war kräftig. Schnell hatte er sich aus dem Griff des Aufsehers befreit und wollte weiterlaufen, als Vincent sich auf ihn stürzte. Wieder begann ein Ringen, heftig, aber mit ungleichen Kräften. Nach ein paar Sekunden des Kampfes fiel der Mann auf die Knie; ein tüchtiger Schlag streckte ihn vollends zu Boden.
Während das alles geschah, hatte der Kammerdiener des Grafen de Moncelles seine Kaltblütigkeit wiedergewonnen. Er ließ seinen Herrn stehen, lief aus dem Schloß und eilte seinen Kameraden zu Hilfe.