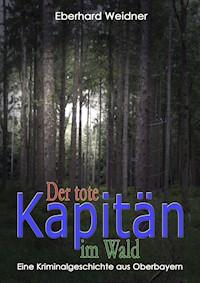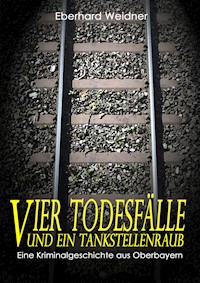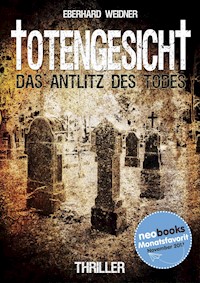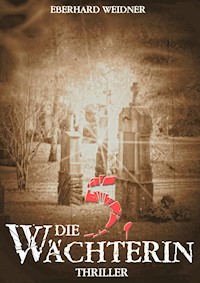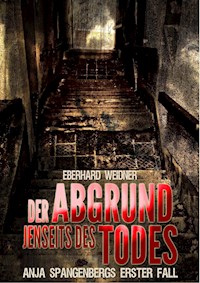1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die drei Tage von Halloween über Allerheiligen bis Allerseelen, in denen in vielen Ländern auf unterschiedlichste Art und Weise der Toten gedacht wird, sind eine schwere Zeit für die sechsundzwanzigjähre Münchnerin Melissa Hartmann. Vor genau einen Jahr reisten sie und ihr Mann Marc nach Mexiko in den beschaulichen Ort San Andrés Mixquic. Dort feierten sie gemeinsam mit den Einheimischen und zahlreichen Besuchern aus aller Welt drei Tage lang das Fest des Día de los Muertos (Tag der Toten). Seit ihrer Rückkehr lebt Melissa allein in der gemeinsamen Wohnung, die sie unverändert gelassen hat. Dabei wünscht sie sich nichts mehr, als dass Marc zu ihr zurückkehrt. Die Erinnerungen an die Ereignisse in Mixquic hat sie hingegen komplett verdrängt. Nun jähren sich jedoch die damaligen Geschehnisse zum ersten Mal. Und während Melissa ihre Vorbereitungen für den Tag der Toten und die Rückkehr ihres Ehemannes trifft, wächst in Melissa von Tag zu Tag das Gefühl, dass jemand sie beobachtet und verfolgt. Jemand, der an den unterschiedlichsten Orten kleine verzierte Totenschädel aus Zucker, sogenannte Calaveras de Azúcar, für sie hinterlässt. Gleichzeitig kehren nach und nach auch die verdrängten Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit in San Andrés Mixquic und den Día de los Muertos zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
COVER
TITEL
PROLOG
TEIL 1: 31. Oktober – Halloween
1.
2.
3.
TEIL 2: 1. November – Allerheiligen
1.
2.
3.
TEIL 3: 2. November – Allerseelen
1.
2.
3.
4.
5.
GLOSSAR
NACHWORT
WEITERE TITEL DES AUTORS
IMPRESSUM
PROLOG
Der Lärm ist ohrenbetäubend. Dröhnende Musik aus allen Richtungen, dazu lautes Gelächter, schallende Rufe und unzählige Gespräche in einer Sprache, die sie nicht verstehen kann.
Sie läuft durch die Straßen einer Stadt, die ihr zunächst noch absolut fremdartig erscheint. Niedrige Häuser mit flachen Dächern und ohne Vorgärten, bei denen der Putz von den Wänden blättert oder die komplett aus roten Ziegelsteinen bestehen.
»Marc!«
Sie bleibt stehen und sieht sich um, doch der Mann, dessen Namen sie gerufen hat, ist nirgendwo zu sehen.
Stattdessen erblickt sie überall um sich herum Symbole des Todes, die an diesem Ort geradezu allgegenwärtig erscheinen: Totenköpfe, Skelette und Särge.
Sie erschaudert.
»Marc!«
Ihr Ruf bleibt erneut unbeantwortet, und so seufzt sie tief und setzt sich wieder in Bewegung.
Die anderen Leute beachten sie nicht, machen ihr jedoch bereitwillig Platz. Unzählige Menschen bevölkern die Straßen und Gehwege dieser Stadt, die ihr allmählich immer vertrauter erscheint, obwohl sie noch immer orientierungslos ist. Die Leute lachen, tanzen und feiern ausgelassen. Viele trinken Alkohol oder essen exotische Gerichte, deren fremdartige Gerüche die Luft erfüllen. Nicht wenige von ihnen sind verkleidet, tragen Masken oder haben bemalte Gesichter: Allzu oft grausige Totenkopffratzen, die sie erneut erschaudern lassen.
Wieder bleibt sie stehen.
»Marc!«
Als sie sich suchend umsieht, entdeckt sie links von sich eine Mauer, etwa zweieinhalb bis drei Meter hoch. Sie besteht aus großen, unregelmäßig geformten Steinen, die sorgfältig aufeinandergeschichtet und deren Fugen mit Mörtel gefüllt wurden. Der obere Teil ist verputzt und endet in Zinnen, die sich mit runden, nach oben offenen Halbbögen abwechseln.
Jäh wird ihr bewusst, dass hinter der Mauer der Friedhof dieses Ortes liegt. Doch dort will sie unter keinen Umständen hin. Daher wendet sie sich schaudernd ab.
Durch eine Lücke in der Masse der ausgelassen Feiernden erhascht sie jäh einen Blick auf den Mann, den sie unbedingt finden muss. Sie sieht ihn zwar nur kurz von hinten, dennoch sind seine Statur, seine Kleidung und sein Gang für sie unverkennbar.
»Marc!«
Zu spät! Der Mann verschwindet bereits um eine Hausecke. Gleichzeitig schließt sich die Lücke in der Menschenmenge, die es ihr überhaupt erst ermöglicht hat, ihn zu entdecken.
Dennoch ist sie unendlich froh, dass sie ihn gesehen hat. Nun muss sie ihn nur noch einholen, dann wird alles wieder gut.
Sie rennt los, so schnell sie kann. Auf ihrem Weg zur Hausecke rempelt sie mehrere der Feiernden an, die ihr im Weg stehen und nicht schnell genug Platz machen. Doch die anderen Leute nehmen selbst jetzt keine Notiz von ihr, sondern fahren einfach in ihrem Tun fort, als sei überhaupt nichts geschehen und die verzweifelte Frau in ihrer Mitte nur ein Geist, den sie nicht wahrnehmen können.
Und vielleicht ist sie ja auch genau das, wird ihr in diesem Augenblick erschaudernd bewusst.
Ein Geist! Ein körperloses Wesen!
Egal!
Sie hat Wichtigeres zu tun, als sich darüber oder über das merkwürdige Verhalten der anderen Menschen den Kopf zu zerbrechen. Sie muss Marc finden. Sie weiß zwar nicht, warum sie ihn sucht, doch auch das ist ihr gleichgültig. Darüber kann sie sich immer noch Gedanken machen, wenn sie ihn gefunden hat.
Endlich – nach einer halben Ewigkeit, wie ihr scheint – erreicht sie die Hausecke, hinter der er verschwunden ist. Dahinter liegt eine enge dunkle Gasse, die im Gegensatz zu den größeren Straßen und Plätzen der Stadt verlassen und absolut menschenleer ist. Dreck und Müll liegt auf dem Boden, und ein schmales Rinnsal aus schmutzig-braunem Wasser schlängelt sich durch die Gasse. Darüber hinaus riecht es penetrant nach Fäkalien.
Sie zögert, die Gasse zu betreten, und wirft einen Blick über die Schulter. Niemand schenkt ihr auch nur die geringste Aufmerksamkeit. Die Leute schlendern unbeeindruckt dahin, feiern und sind fröhlich.
Als sie ihre Augen wieder nach vorn richtet und die Finsternis in der verlassenen Gasse mit Blicken zu durchdringen versucht, hört sie trotz des Lärms hinter ihr jäh Schritte vor sich, die sich rasch entfernen.
Ich darf seine Spur nicht verlieren!
Der drängende Gedanke sorgt dafür, dass sich ihre Füße auch ohne eine bewusste Entscheidung ihrerseits wieder in Bewegung setzen.
Schon nach wenigen Schritten wird der Lärm der fröhlich feiernden Menschen hinter ihr leiser. Dafür wird der Gestank immer intensiver. Zum Glück ist es nicht völlig dunkel hier, sondern nur sehr düster. Sie kann gut genug sehen, um ihre Umgebung und etwaige Hindernisse frühzeitig erkennen zu können. Vorsichtig setzt sie einen Fuß vor den anderen, um nicht in das stinkende Rinnsal am Boden oder auf den weggeworfenen Müll zu treten. Nicht dass sie am Ende noch in eine zerbrochene Flasche tritt und sich verletzt.
Nach der ersten Biegung, die schon nach wenigen Metern kommt, verstummt der Lärm der Menge hinter ihr wie abgeschnitten. Sofort fühlt sie sich noch einsamer als zuvor inmitten der Menge. Dennoch kommt es für sie nicht infrage, jetzt noch umzukehren. Nicht, wenn sie ihrem Ziel so nahe ist.
»Marc!«
Obwohl ihr Ruf nur noch zaghaft erklingt, hört er sich in der unnatürlichen Stille der Gasse viel lauter an. Erst jetzt wird ihr bewusst, dass die Schritte vor ihr nicht mehr zu hören sind.
Ihr Herz schlägt unwillkürlich noch schneller und heftiger als zuvor. Das rasche regelmäßige Pochen in ihrer Brust und ihre Schritte sind die einzigen Geräusche, die sie hören kann.
Vor ihr biegt die schmale Gasse um eine weitere Hausecke. Als sie um diese Ecke biegt, sieht sie, dass die Gasse nur wenige Schritte vor ihr wie abgeschnitten an einer soliden Backsteinmauer endet.
Sie fragt sich verzweifelt, wohin der Mann verschwunden ist, dem sie in diese Sackgasse gefolgt ist. Vielleicht hat er ja eine der wenigen Türen geöffnet, an denen sie auf ihrem Weg vorbeikam, und ist in einem der schäbigen Häuser verschwunden.
Wahrscheinlich hat sie sich ohnehin getäuscht, und es war gar nicht Mark, obwohl der Mann von hinten genauso aussah wie er. Aber was hätte er in dieser armseligen Gegend überhaupt verloren?
Jäh versteift sie sich.
Sie hat zwar kein verräterisches Geräusch gehört, weder einen Schritt noch ein Rascheln, dennoch spürt sie in diesem Moment instinktiv, dass jemand hinter ihr steht. Sie spürt, wie sich ihre Nackenhaare aufstellen, und erschaudert.
»Marc?«
Rasch dreht sie sich um, denn sie ist davon überzeugt, dass es sich nur um ihn handeln kann und sie ihn endlich gefunden hat.
Nur wenige Schritte von ihr entfernt steht tatsächlich jemand und versperrt ihr den Weg aus der Sackgasse.
Es ist allerdings nicht Mark, sondern jemand, dessen Gesicht sie nicht erkennen kann, weil er eine Totenkopfmaske und einen Zylinder auf dem Kopf trägt. Die aufgemalten Schädelknochen der Maske scheinen zu leuchten. Außerdem hält die vermummte Gestalt ein langes Messer mit schmaler Klinge in der Hand.
Noch bevor sie Angst empfinden kann, springt der Maskierte auf sie zu und sticht wie ein Wahnsinniger mit dem Messer auf sie ein.
Sie kann weder ausweichen noch fliehen. Alles, was ihr zu tun bleibt, ist lang und gellend zu schreien, bevor das scharfe Messer in ihr Gesicht schneidet und es zerfetzt.
TEIL 1
31. Oktober – Halloween
1.
Melissa erwachte, weil sie einen gellenden Schrei hörte, und riss erschrocken die Augen auf. Sie schloss den weit aufgerissenen Mund, worauf der Schrei wie abgeschnitten endete. Erst da realisierte sie, dass sie selbst es gewesen war, die geschrien hatte.
Wieder einmal!
Sie war verschwitzt und atmete schwer, als wäre sie um ihr Leben gerannt. Die Bilder des furchtbaren Albtraums standen ihr noch immer deutlich vor Augen, so klar und eindrücklich, als handelte es sich um Erinnerungen. Und zum Teil waren sie das ja auch, obwohl Melissa diese speziellen Erinnerungsbilder bewusst verdrängte, solange sie wach war. Im Schlaf hatte sie allerdings keinerlei Kontrolle darüber. Die Erinnerungen krochen immer wieder aus ihrem Gedächtnis an die Oberfläche ihres Bewusstseins, während sie schlief, um sich dort dann mit Schauervorstellungen aus ihrer Fantasie, die wie aus einem schlechten Horrorfilm wirkten, zu einem schrecklichen Albtraumszenario zu vermengen, das sie stets aufs Neue quälte.
Melissa schüttelte den Kopf, als könnte sie auf diese Weise vor allem die letzten, furchtbarsten Albtraumbilder loswerden. Das hatte noch nie funktioniert und tat es auch jetzt nicht. Dennoch hatte sie mittlerweile, nach beinahe einem Jahr, in dem dieser Albtraum sie bereits quälte, Übung darin, die schrecklichen Traumszenen aus ihrem Bewusstsein zu verbannen.
Als das geschafft war, tastete sie mit traumwandlerischer Sicherheit nach dem Schalter der Nachttischlampe und machte Licht. Ein rascher Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass es kurz vor sieben war und ihr Wecker in wenigen Minuten ohnehin geklingelt hätte. Sie schaltete ihn aus, schlug die klamme Decke zur Seite und stand auf.
Sobald sie wie an jedem Morgen die Kaffeemaschine aufgefüllt und angeschaltet und das Radio angemacht hatte, um die nervtötende Stille aus der Wohnung zu vertreiben, ging sie auf die Toilette und unter die Dusche. Nachdem sie ihre Haare geföhnt und frische Kleidung für den bevorstehenden Tag angezogen hatte, setzte sie sich an den Küchentisch und trank Kaffee.
Die Sonne war inzwischen aufgegangen und schien durchs Fenster in den Raum, doch Melissa nahm es kaum bewusst wahr.
Alles, was sie tat, geschah automatisch, ohne dass sie darüber nachdenken musste. Sie handelte wie eine Maschine, die ein vorprogrammiertes Programm abspulte, das von Tag zu Tag gleich blieb. Zum größten Teil lag das daran, dass ihr Tagesablauf im Wesentlichen stets derselbe war und es kaum nennenswerte Änderungen gab, denn sie mochte keine Veränderungen. Veränderungen in ihrem Leben erforderten es, dass sie genauer darüber nachdenken musste. Und sie hasste es, über Dinge nachzudenken. Denn wenn sie nachdachte, kam sie ins Grübeln. Und wenn sie ins Grübeln kam, dann kochten irgendwann unweigerlich die Erinnerungen in ihr hoch, die sie so hartnäckig verdrängte, sodass diese sich nachts ein Ventil suchten und sie in ihren Träumen heimsuchten.
Melissa seufzte, denn erneut drohten die Erinnerungen, genährt durch den nächtlichen Traum, ihr Bewusstsein zu überschwemmen. Sie stemmte sich erfolgreich dagegen, indem sie ihren gewohnten Tagesablauf stur befolgte, ihre Tasse leerte und sich wie immer eine zweite einschenkte.
Als sie danach ihren Blick durch die Küche schweifen ließ, um sich vom Nachdenken abzuhalten, fiel ihr Blick auf den Abreißkalender an der Wand. Sie hatte ihn von ihrer Arbeitskollegin Nina zum Geburtstag bekommen, und er enthielt Lebensweisheiten, die sie nie las. Dennoch riss sie jeden Tag gewissenhaft das Kalenderblatt des Vortages ab. Das hatte sie auch heute getan, automatisch und roboterartig, so wie sie alles tat. Und so sah sie nun, dass heute der 31. Oktober war.
Halloween!
Obwohl sie es bereits gewusst hatte, weil sie gestern Abend mit dem Bewusstsein ins Bett gegangen, dass heute dieser Tag war, traf sie die Erkenntnis in diesem Augenblick dennoch wie ein Schock.
31. Oktober!
Bereits das bloße Datum drohte Erinnerungen heraufzubeschwören, die schmerzhaft waren. Doch zu einer Konfrontation mit diesen Erinnerungen war sie noch nicht bereit. Zumindest nicht in diesem Augenblick, während sie am frühen Morgen am Küchentisch saß, ihren zweiten Morgenkaffee trank und sich trotz des verhängnisvollen Datums dazu zwang, ihren geordneten Tagesablauf beizubehalten, der sie davon abhielt, zu viel über die Vergangenheit nachzudenken, die sie fürchtete.
Melissa zwang sich daher dazu, den Blick vom Kalenderblatt abzuwenden. Stattdessen richteten sich ihre Augen auf das gerahmte Foto, das unmittelbar neben dem Abreißkalender hing.
Das lachende Paar auf dem Foto sah glücklich und verliebt aus. Und das waren die beiden jungen Leute damals auch gewesen, schließlich sollte es der glücklichste Tag ihres Lebens und der Beginn einer langen glücklichen Ehe sein. Nahezu vier Jahre war es jetzt her, dass dieses und eine ganze Reihe anderer, ganz ähnlicher Fotos aufgenommen worden waren. Melissa kam es jedoch wie eine Ewigkeit vor, denn auch diese Erinnerungen waren zu schmerzhaft, um sich ihnen gefahrlos zu widmen, und wurden von ihr zurückgehalten.
Sie seufzte tief, während sie sich geradezu zwingen musste, den Blick von ihrem Hochzeitsfoto abzuwenden, und sah zur Uhr an der Wand, deren stetiges Ticken das einzige Geräusch in der stillen Wohnung war. Es wurde ohnehin höchste Zeit, dass sie aufbrach, sonst kam sie noch zu spät zur Arbeit.
Nachdem sie den Kaffee ausgetrunken und die leere Tasse in die Spülmaschine gestellt hatte, zog sie im Flur ihre Schuhe und ihren Mantel an. Dann nahm sie ihre Schlüssel und ihre Handtasche und verließ die Wohnung.
Obwohl sie im dritten Stock wohnte, fuhr sie nicht mit dem Fahrstuhl nach unten, sondern nahm die Treppe. Die Vorstellung, mit einem der anderen Hausbewohner in der engen Kabine eingeschlossen zu sein, behagte ihr nicht. Im Erdgeschossflur öffnete sie wie an jedem Werktag den Briefkasten. Bis auf die heutige Tageszeitung war er leer, denn so früh am Tag war noch nicht mit Post zu rechnen. Außerdem bekam sie in letzter Zeit ohnehin kaum noch Post. Sie holte die Zeitung heraus und warf sie ungelesen in den Karton für Altpapier, der unter den Briefkästen stand. So machte sie es seit ihrer Rückkehr aus Mexiko vor annähernd einem Jahr stets. Früher – vor der Reise nach Mexiko - hatte sie die Zeitung ohnehin nur überflogen und lediglich die Artikel gelesen, die sie wirklich interessiert hatten. Ihr Ehemann Marc war derjenige gewesen, der die Tageszeitung im wahrsten Sinne des Wortes von vorn bis hinten durchgelesen hatte. Er war ein Newsjunkie gewesen und hatte sämtliche Informationen förmlich in sich aufgesagt. Doch nach ihrer Rückkehr aus Mexiko hatte sie sich nicht dazu durchringen können, das Abonnement zu kündigen. Es hätte sich zu sehr danach angefühlt, als würde sie damit einen existenziellen Teil von Marc aufgeben und ihn verraten. Und das wollte sie nicht.
Niemals!
Um nicht über ihren Mann nachdenken zu müssen, setzte sich Melissa rasch wieder in Bewegung und verließ eilig das Haus. Auf ihrem Weg zur Arbeit, der einen etwa zwanzigminütigen Spaziergang darstellte, sah sie in vielen Schaufenstern Dekorationen oder spezielle Angebote für Halloween. Sobald ihr dabei ein Skelett oder ein Totenkopf ins Auge fiel, sei es aus Kunststoff, Pappe oder einem anderen Material, wandte sie rasch den Blick ab. Der Anblick erinnerte sie zu sehr an ihren Albtraum und an …
Daran will ich nicht denken!
Vor einem dreiviertel Jahr war Melissa bei einem Psychologen namens Dr. Keller gewesen. Sie hatte gehofft, der Mann könnte ihr wegen ihres immer wiederkehrenden Albtraums und ihrer Angst vor den Symbolen des Todes wie Totenköpfen, Särgen und Skeletten helfen. Von ihrer Reise nach Mexiko drei Monate zuvor und den Ereignissen dort hatte sie dem Psychologen allerdings nichts erzählt. Sie war nicht dazu in der Lage gewesen, da es unweigerlich die Erinnerungen heraufbeschworen hätte, die sie ebenso hartnäckig wie erfolgreich verdrängte.
Dr. Keller, ein hagerer älterer Mann mit stechendem Blick und Halbglatze, hatte daraufhin bei ihr eine Samhainophobie diagnostiziert. Dabei handelt es sich um die krankhafte Angst vor Halloween. Die Kelten feierten Samhain am 31. Oktober, dem keltischen Neujahrstag und dem Tag vor Allerheiligen, der auch All Hallows’ Eve genannt wurde, woraus dann später Halloween wurde. Sie glaubten, die Seelen ihrer Verstorbenen würden in dieser Nacht in ihre Häuser zurückkehren. Bei einer Samhainophobie, so Dr. Keller, fürchteten die Betroffenen alles, was mit diesem Fest zu tun hatte, also vor allem auch seine Symbole, und mieden diese dann.
Doch Melissa glaubte nicht, dass sie an Samhainophobie litt. Nicht Halloween machte ihr Angst, sondern etwas anderes, über das sie mit niemand anderem sprechen, geschweige denn darüber nachdenken konnte oder wollte.
Da sie schon bald das Gefühl bekommen hatte, dass Dr. Keller ihr überhaupt nicht helfen konnte, war sie nach drei Terminen nicht mehr zu ihm gegangen.
Der Weg zur Arbeit verlief wie immer nahezu ereignislos. Nur einmal, als Melissa von einer Autohupe erschreckt wurde und rasch den Kopf wandte, um zu sehen, was los war, glaubte sie, für den Bruchteil eines Augenblicks aus dem Augenwinkel einen maskierten Mann zu sehen, der sie an die Gruselgestalt aus ihrem Traum erinnerte. Doch sie erhaschte nur einen kurzen Blick auf die Person, bevor diese auch schon in einem Hauseingang verschwand. Melissa schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich hatte sie sich ohnehin getäuscht, denn wieso sollte, auch wenn heute Halloween war, schon am frühen Morgen jemand maskiert durch die Straßen gehen. Oder aber die Traumbilder von letzter Nacht geisterten noch immer als Nachbilder durch ihren Kopf und hatten ihr ein Trugbild vorgegaukelt. Sie ging daher rasch weiter und dachte nicht mehr darüber nach, weil diese Gedanken unweigerlich zu bedrohlicheren Überlegungen geführt hätten.
Nach dreiundzwanzig Minuten Fußmarsch erreichte Melissa das Gebäude des Amtsgerichts München in der Pacellistraße, wo sie als Justizangestellte in der Abteilung für Zivilsachen tätig war.
Wie an jedem Arbeitstag betrat sie als Erste das Büro, das sie sich mit ihrer Kollegin Nina teilte, die am südwestlichen Rand der Stadt wohnte und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen war, weshalb sie stets etwas später kam. Melissa zog ihren Mantel aus und hängte ihn zusammen mit ihrer Handtasche an einen Wandhaken neben der Tür. Anschließend nahm sie hinter ihrem Schreibtisch Platz und schaltete den Computer an.
Da bemerkte sie, dass an ihrem Monitor ein handgroßer Knochenmann aus Papier hing. Vermutlich hatte Nina ihn gestern Abend vor Feierabend dort aufgehängt, um Melissa am Morgen aufzuheitern oder an Halloween zu erinnern. Ihre Kollegin wusste nichts von Melissas Aversion gegen alle Todessymbole. Der einzige, dem sie davon erzählt hatte, war Dr. Keller.
Melissa riss das Skelett vom Monitor und warf es in den Papierkorb unter ihrem Schreibtisch, um es nicht länger ansehen zu müssen.
Sobald der Computer hochgefahren war, loggte sie sich mit ihrem Passwort ein und vertiefte sich in die Arbeit, denn durch die Konzentration auf die Zivilprozessakten verhinderte sie, dass sie über andere Dinge nachgrübelte.
Zwanzig Minuten später kam Nina herein und setzte sich an ihren Schreibtisch. Sie unterhielten sich kurz über Belanglosigkeiten, bevor sie sich auf ihre jeweilige Arbeit konzentrierten. Falls Nina das Fehlen des papiernen Knochenmannes bemerkt hatte, so ging sie nicht darauf ein. Und auch Melissa brachte das Thema lieber nicht zur Sprache, da sie ein Gespräch oder gar eine Diskussion über dieses Thema vermeiden wollte.
Sie arbeitete wie immer ohne Pause bis mittags. Dann verließ Melissa das Justizgebäude und holte sich in einer Bäckerei am Stachus eine Kleinigkeit zu essen. Anschließend ging sie zum Maximiliansplatz, einem parkartigen Platz mit Denkmälern und Brunnen unweit der Pacellistraße. Beim Schiller-Denkmal setzte sie sich auf eine Bank und beobachtete die Leute, die vorbeikamen, während sie den mit Eiern, Gurkenscheiben, Karottenstreifen und Krautsalat belegten Laugenspitz verzehrte. Obwohl sie am Morgen nichts gegessen hatte, hatte sie dennoch keinen großen Appetit. Sie schaffte nur die Hälfte ihrer Brotzeit und packte den Rest für heute Abend ein. Danach blieb sie noch eine Weile sitzen und beobachtete weiterhin die Passanten und Spaziergänger, bevor es allmählich Zeit wurde, ins Büro zurückzukehren.
Melissa war bereits wieder in ihre Arbeit vertieft, als kurze Zeit später auch Nina von ihrer Mittagspause zurückkam und hinter ihrem Schreibtisch Platz nahm.
»Hast du heute Abend schon was vor?«, fragte Nina unvermittelt.
»Heute Abend?«, fragte Melissa und hörte irritiert zu tippen auf. Sie hob den Blick widerwillig vom Bildschirm und sah ihre Kollegin fragend an. »Wieso? Was ist denn heute Abend?«
»Na, wo lebst du denn, Melissa? Hinterm Mond? Heute ist doch Halloween.«
»Ach ja. Stimmt.« Als könnte sie das vergessen.
»Deshalb hab ich dir doch das Skelett aus Papier an deinen Monitor gehängt«, sagte Nina grinsend. »Hast du es denn nicht gefunden?«
Melissa zuckte fragend mit den Schultern und gab sich ahnungslos. »Ein Skelett? An meinem Bildschirm?«
»Ich fasse es nicht«, sagte Nina und seufzte verärgert. »Die blöde Putzfrau muss es weggeräumt haben. Aber egal, was ist denn jetzt mit heute Abend?«
»Wieso fragst du eigentlich?«
»Ich weiß nicht, ob du die Rosi aus der Strafabteilung kennst. Auf jeden Fall schmeißt die heute Abend eine Halloween-Party. Sie sagte, du kannst ruhig mitkommen, wenn du magst.«
Melissa zog eine Grimasse und schüttelte dann zaghaft den Kopf. »Sei mir nicht böse, Nina, aber ich glaub nicht, dass das was für mich ist.«
»Wieso denn nicht? Das wird bestimmt lustig. Außerdem ist Halloween!«
»Weißt du, ich …« Melissa seufzte. »Ich hab’s nicht so mit Halloween.«
»Das ist doch egal. Dann betrachte es einfach nur als Kostümparty. Wir verkleiden uns, treffen eine Menge Kollegen, trinken gemeinsam Alkohol, tanzen und feiern ausgelassen. Wenn du nichts zum Anziehen hast, dann komm ich vorher bei dir vorbei und bring ein paar Kostüme zum Anprobieren mit. Deine Wohnung liegt doch sowieso auf meinem Weg zur Rosi.«
Erneut schüttelte Melissa den Kopf, dieses Mal schon etwas entschiedener. »Tut mir echt leid, aber ich komme nicht mit.«
»Würde dir aber guttun, wenn du mal rauskommst und etwas anderes erlebst«, sagte Nina, von Melissas Abfuhr sichtlich verärgert. »Anstatt immer nur daheim zu hocken und Trübsal zu blasen. Du bist doch noch jung und hast den größten Teil deines Lebens noch vor dir. Wird Zeit, dass du dich damit abfindest, was passiert ist, und wieder zu leben anfängst und unter Leute kommst.«
Melissa wusste zunächst nicht, was sie darauf antworten sollte, so perplex war sie über die gemeinen Worte ihrer Kollegin.
Nina musste ihr angesehen haben, was sie mit ihren Worten angerichtet hatte, denn sie verzog das Gesicht zu einer Miene des Bedauerns und sagte. »Tut mir leid, Melissa. Das hätte ich wirklich nicht sagen sollen. Aber …«
»Ist schon okay«, unterbrach Melissa ihre Kollegin, bevor diese noch mehr Dinge äußern konnte, die sie partout nicht hören wollte. »Vielleicht hast du ja sogar recht. Aber …«
»Was aber?«
»Es ist einfach noch zu früh.«
»Zu früh? Nach einem Jahr soll es zu früh sein?«
»Außerdem hab ich ohnehin keine Zeit«, sagte Melissa rasch, um die Diskussion zu beenden.
Nina nickte resignierend und trat den Rückzug an. »Na schön. Wenn du keine Zeit hast, dann kann man eben nichts machen.«
»Genau. Tut mir wirklich leid, dass du allein gehen musst.«
»Mach dir da mal keinen Kopf. Auf der Party sind genügend Leute, die ich kenne. Aber was hast du denn heute Abend überhaupt vor?«
Melissa, die gedacht hatte, das Thema wäre damit erledigt, hatte bereits den Kopf abgewandt und ihren Blick wieder auf den Bildschirm gerichtet. Doch nun war sie gezwungen, ihre Kollegin erneut anzusehen.
»Ich muss noch einige Sachen einkaufen für heute Abend. Und dann muss ich auch noch die Wohnung putzen und vorbereiten.«
»Wieso musst du die Wohnung putzen und vorbereiten?«
»Ich …« Melissa senkte den Blick. »Ich erwarte in den nächsten Tagen Besuch.«
»Ach, so ist das also. Du erwartest Besuch.«
Als Melissa den Blick hob, sah sie, dass Nina anzüglich grinste.
»Wer ist es denn, der dir einen Besuch abstattet? Etwa jemand, den ich kenne?«
Melissa schüttelte den Kopf. »Nein, du kennst ihn nicht.«
»Es ist also ein Er. Na, da sieh mal einer an.«
Melissa schüttelte den Kopf. »Es ist nicht so, wie du denkst.«
»Wie ist es denn dann?«
»Ganz anders. Aber darüber möchte ich wirklich nicht reden.«
»Okay, okay.« Nina hob die Hände, als wollte sie sich ergeben. »Das respektiere ich. Vielleicht erzählst du mir ja mehr, nachdem du dich mit diesem geheimnisvollen Unbekannten getroffen hast.«
»Vielleicht«, gab Melissa ein vages Versprechen und zwang sich zu einem Lächeln, obwohl sie nicht vorhatte, ihrer Kollegin jemals mehr zu erzählen.
»Na, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Besuch.«
»Wünsche ich dir auch bei der Party«, sagte Melissa und konnte sich endlich wieder auf ihre Arbeit konzentrieren.
Nach zwei Stunden schaltete Nina ihren Computer aus und packte ihre Sachen zusammen.
Melissa sah sie fragend an.
»Ich gehe heute früher. Wegen der Party. Muss noch mein Kostüm abholen, und dann muss ich mich natürlich auch noch schminken.«
Melissa wartete, bis ihre Kollegin zur Tür gegangen war, und wünschte ihr dann ein weiteres Mal viel Spaß.
»Dir aber auch«, sagte Nina mit einem weiteren anzüglichen Grinsen und zwinkerte ihr zu. »Tu nichts, was ich nicht auch tun würde.« Sie lachte, öffnete die Tür und ging.
Melissa seufzte tief, denn sie war froh, dass sie endlich allein war. Sie wollte sich wieder ihrer Arbeit zuwenden, doch dabei fiel ihr Blick auf den Papierkorb neben ihrem Schreibtisch. Da sie nicht hingesehen hatte, als sie das Papierskelett hineingeworfen hatte, hatte sie auch nicht richtig getroffen. Deshalb hing der kleine Knochenmann nun rücklings über dem Rand des Kunststoffeimers, erzitterte im Luftzug, den die schließende Tür erzeugt hatte, sodass es aussah, als nickte er mit dem Kopf, und sah sie höhnisch grinsend an.
Sie wusste nicht, ob es letztlich allein an dem Papierskelett lag, dass die Erinnerungen an ihre Reise nach Mexiko urplötzlich die Dämme überspülten, die sie in zwölf Monaten mühsam errichtet hatte und die dem Ansturm so lange tapfer standgehalten hatten. Vielleicht lag es auch daran, weil heute Halloween war und sich an diesem und den beiden darauffolgenden Tagen – Allerheiligen und Allerseelen – alles um die Toten drehte. Auf jeden Fall konnte sie die schmerzhaften Erinnerungen nicht wie gewohnt zurückdrängen, und so wurde ihr Verstand wie von einer meterhohen Monsterwelle jäh von Erinnerungsbildern überflutet, die ihr Bewusstsein wie mit einer bösartigen Zeitmaschine exakt ein Jahr in der Vergangenheit zurückkatapultierten.
2.
Vergangenheit: Mexiko, 31. Oktober
Der Flug vom Münchner Flughafen nach Ciudad de México, wie Mexiko-Stadt in der Landessprache heißt, dauert insgesamt fünfzehn Stunden. Zunächst bringt ein Airbus A320neo der Lufthansa Marc und mich in einer Stunde und fünf Minuten nach Frankfurt. Anderthalb Stunden später hebt eine Boeing 747-8 vom dortigen Rollfeld ab und fliegt uns in zwölf Stunden und fünfundzwanzig Minuten über den Atlantik zum Benito Juárez International Airport von Mexiko-Stadt, der nach einem der wichtigsten ehemaligen Präsidenten benannt wurde. Um 19:17 Uhr Ortszeit verlassen Marc und ich schließlich die Maschine und betreten erstmals in unserem Leben mexikanischen Boden.
Was ich bislang nur in der Theorie wusste, weil ich lediglich davon gelesen habe, bekomme ich nun ganz unmittelbar zu spüren. Denn weil die Luft in dieser Höhe dünner ist als bei uns zu Hause, enthält sie weniger Sauerstoff, und ich atme unwillkürlich schneller.
Marc strahlt dessen ungeachtet übers ganze Gesicht wie das sprichwörtliche Honigkuchenpferd. Ich erwidere sein Lächeln, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich nach dem langen Flug müde und leicht gereizt bin. Marc hat wenigstens im Flugzeug ein paar Stunden Schlaf gefunden. Doch ich habe natürlich wieder einmal nicht einschlafen können. Das kann ich beim Fliegen und auf Bahn- und Autofahrten nie, während mein lieber Ehemann nur die Augen schließen muss, um sofort wegzudämmern, was ich für überaus ungerecht halte. In Deutschland ist es jetzt bereits nach zwei Uhr nachts. Kein Wunder also, dass ich so müde bin.
Wir bringen die Einreise- und Zollformalitäten hinter uns, holen unser Gepäck und gehen im Erdgeschoss von Terminal 1 zum Schalter von Sixt, um den reservierten Mietwagen abzuholen.
Als wir das Flughafengebäude verlassen, ist es noch immer angenehm warm, obwohl bereits die Nacht hereingebrochen ist. Ich erschaudere. Nicht wegen der Temperatur, sondern weil mir zum ersten Mal richtig bewusst wird, dass wir nicht nur in einem fremden Land, sondern sogar auf einem anderen Kontinent sind, auf den ich bis heute noch keinen Fuß gesetzt habe. Dennoch fühle ich mich nicht wie ein Eroberer oder Entdecker, sondern eher ängstlich. Immer noch herrscht wie an allen Großflughäfen dieser Welt enorm viel Betrieb. Die überwiegende Anzahl der Leute, die uns umgeben, sprechen nicht nur eine fremde Sprache, von der ich nur wenige Worte verstehe, sondern sehen auch fremdländisch aus. Mit meinen langen weißblonden Haaren und meiner hellen Haut steche ich deutlich heraus. Marc hingegen geht noch eher als Einheimischer durch, denn er hat dunkelbraune Haare und einen dunklen Teint. Ich halte mich eng an seiner Seite, weil ich plötzlich Angst habe, ich könnte ihn verlieren, während wir uns auf die Suche nach unserem Mietwagen machen.
Wir finden ihn genau an der Stelle, die der freundliche junge Mann am Schalter der Autovermietung uns genannt und in englischer Sprache ausführlich beschrieben hat. Es handelt sich, wie er uns erklärte, um einen grünen Chevrolet Spark mit Schaltgetriebe, vier Türen und Klimaanlage.
Nachdem wir das Gepäck im Kofferraum verstaut haben, nimmt Marc wie selbstverständlich hinter dem Steuer Platz. Mit ist das recht, denn ich bin viel zu müde zum Fahren. Wie zum Beweis muss ich gähnen, sobald ich mich neben ihn auf den Beifahrersitz gesetzt und die Tür geschlossen habe.
»Müde?«, fragt Marc überflüssigerweise, während er damit beschäftigt ist, den Sitz auf seine Körpergröße von ein Meter zweiundachtzig einzustellen, womit er gerade einmal vier Zentimeter größer ist als ich.
Ich nicke, bemerke dann, dass mein Mann mich gar nicht ansieht und sage: »Ja.«
Am liebsten wäre ich hier vor Ort in ein nahes Hotel gefahren, hätte uns eine Kleinigkeit zu essen besorgt und mich so bald wie möglich schlafen gelegt, um die nächsten zwei Tage in Mexiko-Stadt zu verbringen und die hiesigen Sehenswürdigkeiten und Souvenirläden abzuklappern. Noch lieber wäre ich allerdings von vornherein an einen Badeort an der Küste geflogen, nach Acapulco, La Paz oder Cancún beispielsweise, um unsere wenigen kostbaren Urlaubstage dort an einem der traumhaften Strände zu verbringen. Doch Marc hat ganz andere Pläne.
»Wie weit ist es bis zu unserem Motel?«
Marc ist endlich zufrieden mit der Einstellung des Sitzes und widmet sich nun dem Navigationsgerät. »Das Motel ist in Chalco de Diaz Covarrubias, das liegt südwestlich von hier«, sagt er, während er unseren Zielort eingibt. Vermutlich spricht er den Ortsnamen perfekt aus, weil er neben der englischen und französischen auch die spanische Sprache beherrscht »Die Entfernung von hier zum Motel beträgt exakt 33,3 Kilometer.«
Natürlich nennt Marc wie immer die exakte Kilometerzahl und begnügt sich nicht mit der Angabe ungefährer Werte, die auch ausgereicht hätten. Bei ihm muss immer alles ganz genau sein, am liebsten mindestens bis zur zweiten Zahl hinter dem Komma. Zusammen mit der geradezu unheimlichen Fähigkeit, alle Informationen, die er aufnimmt, zu speichern und sie ganz nach Bedarf abrufen zu können, und der Unart, sein enzyklopädisches Wissen jedem ungefragt mitzuteilen, macht ihn das in den Augen vieler zum Klugscheißer. Ich wünsche mir nicht zum ersten Mal, ich hätte auch nur einen Bruchteil seiner Begabung.
»Wie lange brauchen wir, bis wir im Motel sind?«
»Wenn’s keinen Stau und keine Umleitung gibt, sollten wir in exakt 31 Minuten dort sein.«
Ich unterdrücke ein genervtes Seufzen. Also noch mindestens eine Dreiviertelstunde, bis wir eingecheckt haben und in unserem Motelzimmer sind. Und vermutlich wird Marc dann alles andere als begeistert sein, wenn ich vorschlage, schlafen zu gehen, weil er noch an unser eigentliches Ziel fahren will, um den Rest des Tages auszunutzen. Und ich habe praktisch keine andere Wahl, als ihn zu begleiten, obwohl ich eigentlich nur schlafen will. Schließlich will ich hinterher nicht als diejenige dastehen, die ihm den Urlaub verdorben hat. Na vielen Dank auch dafür.
»Fertig«, sagt Marc und startet den Motor. Bevor er losfährt, sieht er mich freudestrahlend an. »Freust du dich auch, dass wir endlich hier sind, Baby?«
Obwohl ich im Moment eher das Gegenteil von Freude empfinde, zwinge ich ihm zuliebe ein Lächeln auf mein Gesicht und antworte: »Natürlich freue ich mich.