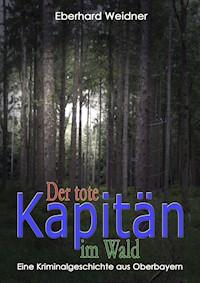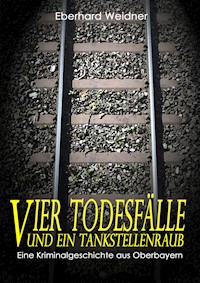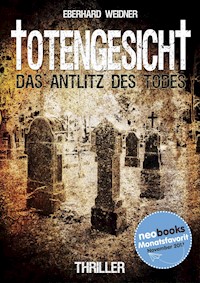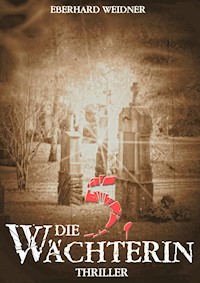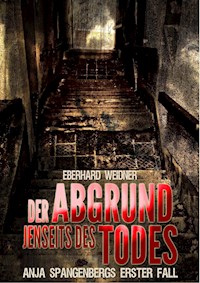2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
ZEHN TAGE IN DER HÖLLE Als Martin Gruber erwacht, fällt ihm die unnatürliche Stille auf. Auf der Straße vor dem Haus ist keine Menschenseele zu sehen. In der Nacht vor dem Zubettgehen hat er Schreie und Sirenen gehört. Und etwas, das sich wie Schüsse anhörte. Im Haus ist es ebenfalls ruhig. Nur in der Erdgeschosswohnung ist ein Poltern zu hören, das jedoch jäh verstummt, als Martin den Namen seines Nachbarn ruft. Allerdings hat er das unangenehme Gefühl, etwas in der Wohnung würde ihn belauern. Zu allem Überfluss bleibt der Fernsehschirm auf allen Kanälen schwarz, während ein Fließtext die Zuschauer darüber informiert, dass man auf aktuelle Meldungen warten solle. Martin beschließt dennoch, zum nahen Supermarkt zu gehen, da sein Kühlschrank beinahe leer ist. Vielleicht trifft er jemanden, der ihm sagen kann, was passiert ist und wo all die Menschen sind. Doch die Leute, die er Im Markt findet, sind gar keine Menschen mehr. Sie haben sich auf furchtbare Weise verändert. Von nun an ist Martin gezwungen, ums Überleben zu kämpfen ... TOTENGESICHT - DAS ANTLITZ DES TODES Der 35-jährige Richard »Rex« König ist Comiczeichner und besitzt eine unheimliche Gabe. Seit einem Unfall kann er die Totengesichter anderer sehen, sobald er sie berührt. Somit weiß er, dass sie binnen 72 Stunden sterben werden. Anfangs konnte er nicht glauben, dass er diese Fähigkeit besitzt, die er eher als Fluch ansieht, denn das Wissen um den Tod der Menschen belastet ihn sehr. Doch nachdem es immer öfter vorkam, muss er seine Gabe schließlich akzeptieren. Allerdings kann er sich nicht damit abfinden, dass er das Schicksal der todgeweihten Menschen nicht doch verändern und ihr Leben retten kann. Deshalb verfolgt er sie, sobald er das Antlitz des Todes in ihren Gesichtern gesehen hat. Allerdings gelang es ihm bisher kein einziges Mal, dem Schicksal Knüppel zwischen die Beine zu werfen und den Tod zu überlisten. Als Rex eines Tages in der U-Bahn von einer jungen Frau berührt wird und ihr Totengesicht sieht, folgt er auch ihr wider besseres Wissen bis zu ihrer Wohnung. Er entdeckt einen Mann mit einer schallgedämpften Waffe, der offenbar Böses im Sinn hat. Ohne zu überlegen, betritt Rex die Wohnung, um das Leben der Frau zu retten. Er ahnt nicht, dass er mit diesem Schritt in eine abenteuerliche und tödliche Geschichte gerät und sein Leben mehr als einmal am sprichwörtlichen seidenen Faden hängt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
COVER
TITEL
ZEHN TAGE IN DER HÖLLE
PROLOG
TAG EINS
TAG ZWEI
TAG DREI
TAG VIER BIS SECHS
TAG SIEBEN
TAG ACHT
TAG NEUN
TAG ZEHN
EPILOG
TOTENGESICHT – Das Antlitz des Todes
PROLOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
EPILOG
NACHWORT
WEITERE TITEL DES AUTORS
LESEPROBE
IMPRESSUM
PROLOG
Obwohl ein halbes Dutzend Fliegen seinen Körper umschwirrt, rührt sich der Mann auf dem Bett nicht. Seine Augen stehen weit offen und starren blicklos an die Decke. Dennoch zuckt kein einziger Muskel in seinem Gesicht, noch bewegt sich eine Hand, um die Plagegeister zu vertreiben. Bei genauerer Betrachtung ist sogar zu erkennen, dass nicht einmal Atemzüge den Brustkorb heben und senken.
Der Mann ist unzweifelhaft tot, wofür auch die leichenhafte Blässe seiner Haut spricht. Er kann allerdings erst vor wenigen Stunden gestorben sein.
Der Leichnam hat mittellanges, hellbraunes Haar, das mehrere Tage nicht gewaschen wurde und fettig glänzt. Außerdem bedecken die Stoppeln eines Siebentagebarts die untere Hälfte seines hageren, ausgemergelten Gesichts, dessen Züge im Tod entspannt sind, auch wenn sein Sterben allem Anschein nach nicht leicht und schmerzhaft war. Der Rest des Körpers ist ebenfalls ausgezehrt und abgemagert, so als habe er mehrere Tage lang nicht mehr genug zu essen bekommen. Vermutlich ist er Anfang bis Mitte dreißig, sieht jedoch aufgrund seiner mitgenommenen äußeren Erscheinung älter aus, obwohl der Tod bereits einige Falten geglättet hat. Alles, was er an seinem dürren Leib trägt, sind ein dunkelblaues T-Shirt und eine Cargo-Bermuda-Shorts, deren ursprünglich beige Farbe größtenteils nur noch zu erahnen ist.
Das linke Bein ist mit Ausnahme des Fußes zu enormer Größe angeschwollen. Am linken Unterschenkel befindet sich ein schmutzig grauer Verband, der die Blutung der darunter verborgenen Wunde nur unzureichend aufhalten konnte. Doch es ist nicht nur Blut, das den Verbandsmull durchtränkt hat, sondern auch Eiter, denn die Verletzung hat sich entzündet. Die Entzündung hat sich bis zum Tod des Mannes auf den kompletten Unterschenkel und sogar bis zum Oberschenkel ausgebreitet. Haut und Fleisch des Beins sind tiefschwarz verfärbt.
Die Verletzung, die der Mann nur notdürftig und ohne ärztliche Hilfe selbst versorgen konnte und bei der es sich vermutlich um eine Bisswunde handelt, hat letztendlich zu seinem Tod geführt.
Die Fliegen umschwirren den Leichnam nun immer hektischer, weil der Gestank der fortschreitenden Verwesung und des entzündeten, abgestorbenen Gewebes, der den Schlafraum erfüllt, ihnen ein Festmahl und einen idealen Ort für die Eiablage verspricht. Obwohl Tür und Fenster geschlossen sind, hat es das halbe Dutzend Fliegen dennoch irgendwie geschafft, durch schmale Ritzen und winzige Löcher einzudringen, angelockt vom verführerischen Duft des Todes.
Schließlich landet die erste Fliege auf der Nasenspitze des Toten. Ihr Ziel ist eins der leblosen, aber immer noch feucht glänzenden Augen. Die übrigen Tiere folgen ihrem Beispiel, als sei sie der Anführer einer kleinen Expeditionsgruppe, landen jedoch auf dem rotbraun und eitergelb verfärbten Gaze des Verbands, wo ihnen der Geruch besonders verlockend erscheint.
Die Luft, die vom Gestank nach Tod, Verwesung und entzündetem Fleisch erfüllt ist, ist erdrückend warm und stickig. Kein Luftzug dringt von draußen ins Innere des Zimmers.
Das Schlafzimmer, das nur ein breites Bett, ein Nachtkästchen, einen geschlossenen Schrank und ein mit Büchern gefülltes Regal enthält, macht einen verwahrlosten und chaotischen Eindruck. Zahlreiche Kleidungsstücke liegen auf dem Boden verstreut. Rechts neben dem Bett stehen ein Paar Turnschuhe, der linke ist voller Blut, das von der Unterschenkelwunde auf ihn getropft ist. Daneben liegt eine selbst gebastelte Krücke, die aus einem Besen besteht, dessen Borsten der Mann mit einem Handtuch gepolstert und dessen Stielende er mit Schaumstoff umwickelt hat. Auf dem Nachtkästchen liegen neben einer Taschenlampe und einer leeren Wodkaflasche mehrere leere Blisterverpackungen und Tablettenschachteln.
Nachdem die Fliegen sich auf dem Leichnam niedergelassen und ihr Festmahl begonnen haben, herrscht wieder atemlose Stille. Nicht einmal von draußen dringt ein Laut herein, obwohl helllichter Tag ist. Die Sonne scheint durch einen unterarmbreiten Spalt zwischen zwei Brettern aus Kiefernholz, die vors Fenster geschraubt wurden. Außerdem wurde der Fenstergriff entfernt. Die einzige Tür in den Raum ist ebenfalls geschlossen.
Plötzlich gibt die Leiche ein leises Stöhnen von sich.
Die Fliegen lassen sich davon allerdings nicht beirren. Durch die Zersetzung können sich in einem toten Körper Gase bilden, die dann durch diverse Körperöffnungen entweichen. Geschieht dies durch den Mund, hört es sich beinahe wie ein gespenstisches Stöhnen an.
Doch dann stöhnt der Tote ein weiteres Mal, länger und ausdauernder, und dieses Mal wird klar, dass keine infolge der Verwesung austretenden Gase die Ursache dafür sind.
In nächsten Moment beginnt der Körper des toten Mannes krampfartig zu zucken, als habe er einen Stromschlag bekommen. Die Fliegen werden durch die Bewegung aufgeschreckt und sind gezwungen, die reichhaltige Festtafel allzu früh zu verlassen. Sie erheben sich irritiert in die Luft und umschwirren den bis vor wenigen Sekunden mausetoten, nun jedoch wieder mit Leben erfüllten Mann. Währenddessen zucken sämtliche Gliedmaßen unkontrolliert, als habe er die Kontrolle über die Muskeln und Sehnen seines Körpers noch nicht vollständig wiedererlangt.
Als der rechte Fuß wie in einem Reflex ruckartig nach oben gerissen wird, strafft sich die Schnur, die um den großen Zeh gebunden wurde. Sie ist mit mehreren anderen Stücken zu einem langen Seil geknüpft worden, das über zwei Rollen, die am Bett und an der Wand befestigt wurden, umgeleitet wird und bis zum Schrank führt, wo es in einem daumendicken Loch verschwindet. Sobald sich das Seil gestrafft hat, ertönt aus dem Inneren des Schranks ein gedämpftes Klicken. Fünf Sekunden später ist aus den beiden Lautsprechern, die über dem Schrank an der Wand hängen und deren Kabel ebenfalls ins Innere des Schranks führen, ein lautes Rauschen zu hören, das sogar das wütende Brummen der Fliegen übertönt.
Das plötzliche Geräusch scheint dem reanimierten Leichnam einen Schrecken eingejagt zu haben, denn er rollt abrupt zur Seite und fällt vom Bett. Dabei löst sich die Schnur vom Zeh, doch das macht nichts, denn sie hat ihren Zweck erfüllt und ist nutzlos geworden. Der wiedererweckte Tote landet krachend auf dem Laminatboden und stößt ein lautes Stöhnen aus. Allerdings nicht vor Schmerzen, denn er verspürt keinen Schmerz. Dann verstummt er wieder und bleibt reglos liegen, als habe der Sturz ihn ein zweites Mal getötet.
Für zwei, drei weitere Sekunden sind nur das Rauschen aus den Lautsprechern und das aufgeregte Summen der Fliegen zu hören. Dann ertönt die Stimme eines Mannes, die weiterhin mit einem Rauschen unterlegt ist, ein wenig blechern klingt und unzweifelhaft von einer besprochenen Audiokassette stammt.
»Wenn diese Aufnahme zu hören ist, müsste die Kreatur wieder aufgewacht sein. Obwohl aufwachen vermutlich nicht unbedingt der korrekte Ausdruck ist. Aber wie soll man es sonst nennen, wenn jemand von den Toten wiederaufersteht und nur noch ein hirnloses Ungetüm ist, das einzig seiner Fressgier folgt?
Reanimation? Wiederbelebung? Auferstehung?
Meiner Ansicht nach ist keiner dieser Ausdrücke korrekt, denn mit dem Menschen, der er einmal war, hat dieser wandelnde Tote nicht mehr das Geringste zu tun. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist dieser Körper. Doch das, was den lebenden Menschen ausmachte, seine Persönlichkeit und sein Verstand, sind mit dem Tod unweigerlich verloren gegangen. Und vermutlich ist das auch gut so, denn so bekommt er von der ganzen Scheiße wenigstens nichts mehr mit.
Hoffe ich wenigstens!
Allerdings kann ich mir dabei nicht sicher sein, schließlich weiß niemand, was in den Köpfen der wandelnden Leichen vorgeht.
Was, wenn die Persönlichkeit des Menschen auch nach seinem Tod noch immer irgendwo im verwesenden Schädel des Zombies erhalten ist, zu dem er wurde, er allerdings keine Möglichkeit mehr hat, auf den Körper einzuwirken und ihn zu steuern? So wie ein Fahrgast in einer führerlosen U-Bahn. Er müsste all dem Grauen dann voller Entsetzen und tatenlos zusehen, ohne etwas dagegen unternehmen zu können.
Der Gedanke macht mir Angst!
Ich hoffe allerdings, dass es nicht so ist. Bislang konnte ich bei keinem einzigen der lebenden Toten, denen ich in den letzten Tagen begegnet bin, seit diese Scheiße angefangen hat – und das waren beileibe nicht wenige –, auch nur einen Funken von Intelligenz oder eine Spur seiner ursprünglichen Persönlichkeit entdecken. Ich bin mir aber trotzdem nicht hundertprozentig sicher und hoffe, dass ich nie gezwungen sein werde, es am eigenen Leib zu erfahren.«
Die Stimme aus den Lautsprechern bricht ab und seufzt laut, bevor sie eine Pause einlegt, als sei sie zu erschöpft, um sogleich fortzufahren.
Als die Stimme verstummt, kommt stattdessen wieder Leben in den reglosen Körper auf dem Boden. Er stöhnt lang gezogen, als leide er Höllenqualen, bevor er sich mit der rechten Hand vom Boden abstößt und schwerfällig auf den Rücken rollt. Für einen langen Moment starrt er mit seinen toten, milchigen Augen zur Decke, dann setzt er sich auf.
Noch bevor die Stimme erneut einsetzt, hebt und wendet sich der Kopf des lebenden Toten, als habe jemand an unsichtbaren Fäden gezogen, bis sich sein Blick auf die Lautsprecher unter der Decke richtet. Anschließend rührt er sich nicht mehr, und es sieht so aus, als würde er darauf warten, dass die Stimme des Mannes erneut ertönt.
Ein Keuchen ist zu hören, es raschelt und knirscht, dann knackt es im Lautsprecher laut, weil die Aufnahme an dieser Stelle anscheinend beendet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder neu gestartet wurde.
Als die Stimme wieder ertönt, klingt sie nicht mehr so gepresst wie zuvor. Stattdessen hört sie sich leicht verwaschen an, als sei der Sprecher erschöpft oder betrunken.
Der Zombie knurrt und fletscht die Zähne. Während die Aufnahme weiterläuft, versucht er, unbeholfen auf die Beine zu kommen.
»Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, warum ich mir überhaupt die Mühe mache, diese Kassette zu besprechen. Vermutlich wird es ohnehin nie jemand hören, der mehr als ein halbes Dutzend intakte Gehirnzellen besitzt. Und dieses Ding im Schlafzimmer wird mir wohl kaum bewusst zuhören oder gar verstehen, was ich sage.
Natürlich wird es meine Stimme hören und in irgendeiner, vermutlich aggressiven Form darauf reagieren. Genauso, wie die anderen wandelnden Toten auf Geräusche reagieren, weil sie instinktiv wissen, dass sie in der Regel von lebenden Menschen verursacht werden und daher gleichbedeutend mit Nahrung sind. Sie werden nämlich nicht länger von einem funktionierenden Verstand, sondern nur noch von ihren Instinkten gesteuert, ohne überhaupt darüber nachzudenken, was sie tun. Von ihren Instinkten und ihrer Fressgier, die so stark ausgeprägt ist, dass sie alles in Kauf und auf sich nehmen, sogar die eigene Vernichtung, um an ihre bevorzugte Nahrung zu kommen. Bei der es sich bedauerlicherweise um jeden lebenden Organismus handelt, der sich nicht zur Wehr setzen oder schnell genug aus dem Staub machen kann und den sie zu fassen bekommen.
Vermutlich bespreche ich diese Kassette hauptsächlich, um etwas zu tun zu haben und nicht dauernd an den Tod denken zu müssen. Denn der ist in dieser neuen Welt, in der die wandelnden Toten regieren und die Lebenden eine aussterbende Rasse sind, längst allgegenwärtig und vorherrschend. Es fällt daher schwer, etwas über die letzten Tage zu erzählen und dabei den Tod unerwähnt zu lassen.
Aber vielleicht ist diese Kassette auch nur als Vermächtnis gedacht. Damit nach meinem eigenen Tod nicht nur ein stinkender, vor sich hin faulender Kadaver von mir übrigbleibt, der wie ein Schlafwandler stöhnend durch die Gegend schlurft und nach frischem Fleisch giert. Möglicherweise findet ja irgendwann ein anderer Überlebender die besprochene Kassette und hört sich meine Geschichte an. In naher oder ferner Zukunft, wenn die Plage durch die lebenden Toten vielleicht von selbst endet, weil alle Körper so verfault und verrottet sind, dass sie sich mangels Muskeln, Sehnen und Bändern nicht mehr bewegen können und damit auch nicht länger eine Gefahr für die Lebenden darstellen.
Doch falls es bis dahin noch Jahre oder sogar Jahrzehnte dauert, weiß der Finder möglicherweise gar nicht, wie alles begonnen hat – zumindest aus meiner Sicht. Deshalb sollte ich mit meiner Erzählung wohl besser am Anfang beginnen.«
Der Zombie hat es endlich geschafft, auf die Beine zu kommen, indem er erst aufs Bett gekrochen ist und dann von dort die Füße auf den Boden gestellt und sich aufgerichtet hat. In einem noch halbwegs funktionierenden Teil seines Gehirns scheinen noch immer Bewegungsabläufe gespeichert und abrufbar zu sein, die der Mann vor seinem Tod unzählige Male absolviert hat.
Der lebende Leichnam stöhnt laut, als wolle er seinen Triumph über den schwerfälligen, unbeholfenen Körper auch akustisch kommentieren, allerdings fehlt ihm dafür die Bandbreite früherer Ausdrucksmöglichkeiten. Er wendet sich um und stapft mit steifen Gliedmaßen und schwankendem Gang zum Schrank. Vor allem das angeschwollene linke Bein macht ihm dabei Schwierigkeiten, doch er lässt sich davon nicht beirren. Sein Blick ist dabei ständig auf die Lautsprecher gerichtet, aus denen noch immer die menschliche Stimme kommt.
Die einzelnen Worte sind für den Zombie natürlich unverständlich. In seinem jetzigen Zustand weiß er nicht einmal, dass es sich um Worte handelt und sie so ausgewählt und aneinandergereiht wurden, damit sie einen Sinn ergeben. Er hört nur die menschliche Stimme und weiß instinktiv, dass sie Nahrung bedeutet. Dort, wo die Stimme ihren Ursprung hat, gibt es Nahrung. Nahrung, nach der er sich fast ebenso verzehrt wie ein Süchtiger nach seiner Droge.
Der wandelnde Tote erreicht den Schrank und rempelt ungestüm dagegen. Er hebt die Arme und streckt beide Hände nach den Lautsprechern aus, hat jedoch keine Chance, sie zu erreichen. Sie wurden absichtlich so weit oben angebracht, damit er sie nicht packen und herunterreißen kann, wodurch die Stimme des Mannes verstummt wäre. Der Zombie knurrt laut und fletscht erneut die Zähne, womit er möglicherweise seiner Verärgerung oder Frustration Ausdruck verleihen will, falls er zu derartigen Gefühlen überhaupt noch fähig ist.
Er rempelt ein weiteres Mal gegen den Schrank, heftiger diesmal, und taumelt zurück. Ohne innezuhalten, rennt er erneut dagegen und wird wieder zurückgeworfen. Er lässt sich davon jedoch weder entmutigen, noch erkennt er die Aussichtslosigkeit seines Unterfangens. Er hört nur die Stimme, die für Nahrung steht, und will denjenigen haben, dem die Stimme gehört, um ihn mit seinen zu Klauen gekrümmten Händen zu zerreißen und blutige Fetzen Fleisch aus seinem Körper zu beißen. Deshalb fährt er fort, gegen den Schrank anzurennen, der weder wankt, noch wackelt und dessen Türen sich auch nicht öffnen. Denn der Besitzer der Stimme hat nicht nur in weiser Voraussicht die Lautsprecher in unerreichbarer Höhe angebracht, sondern auch den Schrank an der Wand befestigt und die Türen zugeschraubt.
»Eigentlich weiß ich nicht einmal genau, wie und warum alles begann«, fährt die Stimme aus den Lautsprechern indessen fort. »Es geschah gewissermaßen von einem Tag auf den anderen. In der Nacht zuvor, als ich mich schlafen legte, schien noch alles in Ordnung zu sein, obwohl sich der Keim, Virus, oder was auch immer dafür verantwortlich war, schon auf der ganzen Welt auszubreiten begann. Und als ich am nächsten Tag, einem Samstag, aufstand, war die Welt bereits eine vollkommen andere geworden, und die Zombies begannen, die Straßen und Plätze zu beherrschen und Jagd auf die letzten Überlebenden zu machen.
Moment, ich wollte ja am Anfang beginnen. Also sollte ich mich am besten erst einmal vorstellen.«
TAG EINS
Mein Name ist Martin Gruber. Ich wuchs als viertes und letztes Kind meiner Eltern Angelika und Anton Gruber auf einem beschaulichen Bauernhof in einem oberbayerischen Dorf auf. Mir war allerdings schon früh bewusst, dass ich weder für das Dorfleben noch für die Landwirtschaft geschaffen bin. Deshalb überließ ich die Hofarbeit meinen älteren Geschwistern und studierte nach dem Abitur an der Uni in München Lehramt an Gymnasien. Nach dem Studium und dem Referendariat kam ich an ein Gymnasium im Münchner Stadtteil Maxvorstadt und unterrichte dort seit sechs Jahren in den Fächern Deutsch, Englisch und Geografie.
Zumindest tat ich das mit viel Elan und Enthusiasmus, bis die Seuche ausbrach.
Am Freitag nach Schulschluss war die Welt noch völlig in Ordnung und genau so, wie ich sie kannte und mochte. Ich hatte meine Neuntklässler an diesem Vormittag eine Erörterung schreiben lassen und nahm die Arbeiten zur Korrektur mit nach Hause. Ich lebe allein in einer kleinen Altbauwohnung in der Nähe des Gymnasiums. Meine letzte Freundin hat sich vor vier Monaten nach einem mehrwöchigen Verhältnis mit einem Kollegen aus der Bank, in der sie arbeitet, in beiderseitigem Einverständnis von mir getrennt. Da ich nichts vorhatte, spannte ich am Nachmittag aus, las auf dem Balkon im neuesten Roman von John Grisham und genoss dabei das schöne Juni-Wetter. Gegen Abend bereitete ich mir mein Lieblingsessen zu, Spaghettini Aglio e Olio con Peperoncini – schließlich konnte sich die nächsten zwei Tage niemand über den Knoblauchgeruch beschweren –, und trank zum Essen zwei Gläser Rotwein. Nach vier Monaten hatte ich mich zwar allmählich an das Alleinsein gewöhnt – vor allem meine untreue Ex vermisste ich kein bisschen –, aber beim Essen hätte ich schon gern Gesellschaft gehabt. Doch dagegen konnte ich momentan nichts machen. Außerdem wollte ich mich nicht kopfüber in die nächste Beziehung stürzen, nur um nicht allein essen zu müssen, obwohl eine Kollegin nicht abgeneigt zu sein schien, auch außerhalb der Schule mehr Zeit mit mir zu verbringen. Doch diesmal wollte ich es langsamer und bedachtsamer angehen.
Hätte ich zu diesem Zeitpunkt gewusst, was auf uns alle zukam, hätte ich vielleicht anders gehandelt. Doch als ich an diesem Freitagabend nach dem Essen begann, die ersten Erörterungen meiner Schüler zu korrigieren, ahnten vermutlich die wenigsten Menschen, welches Grauen innerhalb der nächsten zwölf Stunden über sie hereinbrechen würde.
Beim Korrigieren vergaß ich die Zeit, sodass es ruckzuck halb neun war, bis ich das nächste Mal auf die Uhr schaute. Normalerweise sah ich mir um acht die Nachrichten an, doch die hatte ich heute verpasst. Macht nichts, dachte ich und zuckte mit den Schultern, wird schon nichts Weltbewegendes passiert sein, das dich persönlich betrifft.
Tja, so kann man sich täuschen!
Ich legte den roten Stift beiseite und streckte mich, sodass meine Gelenke knackten. Dann stand ich auf und ging zur Balkontür, die ich offen gelassen hatte, weil es draußen noch immer angenehm warm war.
Als ich auf den Balkon trat, nahm ich zum ersten Mal die Schreie wahr. Sie kamen nicht aus unmittelbarer Nähe, sondern mussten ihren Ursprung mehrere Straßen entfernt haben. Außerdem konnte ich nun auch das Heulen zahlreicher Sirenen hören, die aus verschiedenen Richtungen kamen. Ich dachte sofort an randalierende Fußballfans, deren Mannschaft verloren hatte und möglicherweise bei der gerade stattfindenden Weltmeisterschaft in Brasilien aus dem Wettbewerb ausgeschieden war. Ich bin kein besonders großer Fußballfan, deshalb verfolgte ich die Spiele nur am Rande.
Ich schüttelte in stummer Empörung über ein derartiges unsoziales Verhalten den Kopf, ging in die Wohnung zurück und schloss die Balkontür, um die Schreie und Sirenen nicht länger hören zu müssen. Dann goss ich mir noch ein Glas Rotwein ein und sah mir The Wolf of Wall Street auf DVD an. Der Film dauerte fast drei Stunden, sodass ich den Fernseher erst um zwanzig vor zwölf ausmachte. Ich war todmüde und wollte nur noch ins Bett.
Bevor ich das Licht im Wohnzimmer löschte, horchte ich auf Geräusche von draußen. Ich konnte immer noch Schreie und Sirenengeheul hören. Da die Balkontür zu war, waren die Laute gedämpft, dennoch erschienen sie mir viel lauter und näher als zuvor. Dazwischen knallte es, als würde jemand Feuerwerkskörper hochgehen lassen. Oder waren das Schüsse? Aber das konnte doch nicht sein! Was war da nur los?
Egal! Was immer da draußen abging, war nicht mein Problem und ging mich nichts an. Am nächsten Morgen war bestimmt wieder alles vorbei.
Ich löschte das Licht und ging ins Bad, wo ich mich erleichterte und Zähne putzte, bevor ich mich ins Bett legte und neun Stunden durchschlief, ohne ein einziges Mal aufzuwachen.
TAG ZWEI
Es war kurz nach neun, als ich erwachte.
Während ich langsam zu mir kam, erinnerte ich mich an die Geräusche, die ich in der Nacht gehört hatte. Ich lauschte, doch jetzt war alles ruhig. Zu ruhig für meine Begriffe. Ich konnte nicht einmal den Verkehrslärm auf der Straße vor dem Haus hören, den ich sonst sofort nach dem Aufwachen registrierte, obwohl mein Schlafzimmer nach hinten hinausging, wo es nur einen Hinterhof gab.
Ich stand auf, ging zuerst ins Bad und anschließend in die Küche, um mir eine Kanne Kaffee zu kochen, damit ich richtig wach wurde. Während die Maschine den Kaffee aufbrühte und die Luft mit aromatischem Kaffeeduft erfüllte, zog ich mir eine hellgraue Jogginghose und ein schwarzes Henley-Shirt über und schlüpfte in meine Turnschuhe. Anschließend schnappte ich mir meinen Schlüsselbund und schlappte nach unten, um die Zeitung aus dem Briefkasten zu holen. Ich wohne im ersten Stock, deshalb nahm ich die Treppe. Mit dem altersschwachen Aufzug hätte ich dreimal so lange gebraucht.
Als ich das Erdgeschoss erreichte und an der Wohnungstür von Herrn Winter vorbeikam, hörte ich ein rhythmisches Klopfen. Ich blieb stehen und lauschte. Es hörte sich an, als schlüge jemand mit der Faust gegen die Wand. Ich konnte mir nicht vorstellen, wieso der alte Mann, der ein pensionierter Finanzbeamter und leidenschaftlicher Jäger war, so etwas tun sollte. Ich überlegte, ob ich mir Sorgen machen musste, schließlich war der Mann nicht mehr der Jüngste. War er gestürzt? Hatte er einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitten? Lag er nun hilflos am Boden und klopfte gegen die Wand, um jemanden auf sich aufmerksam zu machen? Die Schläge erschienen mir dafür viel zu kräftig. Und wieso rief er stattdessen nicht um Hilfe, wenn er sogar in der Lage war, so fest gegen die Wand zu hämmern?
»Herr Winter?«, rief ich, nachdem ich mich der Tür genähert hatte, und legte mein rechtes Ohr ans Holz.
Die Schläge verstummten abrupt. Wer immer für den Lärm verantwortlich war, hatte mich gehört. Sonst erfolgte allerdings keine Reaktion.
»Alles in Ordnung bei Ihnen, Herr Winter?«
Doch erneut erhielt ich keine Antwort. Wer immer geklopft hatte, verhielt sich nun mucksmäuschenstill. Ich wusste daher nicht, was ich von der Sache halten sollte. Wäre der alte Mann tatsächlich in Not gewesen, hätte er jetzt bestimmt in irgendeiner Form auf meine Rufe reagiert. Die Stille, die nun – wie übrigens im ganzen Haus – herrschte, war merkwürdig und irgendwie auch unheimlich. Ich spürte, wie sich meine Nackenhärchen aufstellten und auf meinen Armen eine Gänsehaut bildete. Ich hatte plötzlich das irrationale Gefühl, jemand oder etwas in Herrn Winters Wohnung würde mich belauern.
Was sollte ich jetzt tun?
Ich streckte bereits die Faust aus, um gegen die Tür zu klopfen, während sich mein Herzschlag beschleunigte und mir der Schweiß ausbrach. Das Gefühl, belauert zu werden, wurde immer stärker. Es kam mir vor, als wartete irgendetwas in der Wohnung nur darauf, dass ich anklopfte, um dann blitzschnell die Tür aufzureißen, mich zu packen und ins Innere zu zerren.
Bescheuert, ich weiß, aber so war es nun einmal.
Noch ehe mein Fingerknöchel das Holz berührte, schüttelte ich den Kopf und zog rasch die Hand zurück. Schließlich konnte das Geräusch, das längst verstummt war, auch genügend andere, völlig harmlose Ursachen haben, ohne dass man gleich an das Schlimmste denken musste. Ich würde einfach später, bevor ich zum Einkaufen ging, noch einmal vorbeischauen.
Ich wandte mich schulterzuckend ab und ging weiter in Richtung Haustür, wo die Briefkästen an der Wand hingen. Meine Erleichterung, einen vernünftigen Grund gefunden zu haben, um nicht an die Tür der Wohnung klopfen zu müssen, war völlig irrational, gleichwohl aber riesig. Aus diesem Grund beruhigte sich mein Herzschlag auch rasch wieder.
Als ich zu den Briefkästen kam, sah ich sofort, dass es an diesem Morgen keine Tageszeitung gegeben hatte, denn normalerweise steckten die Zeitungen nur zur Hälfte in den Schlitzen. Ich öffnete trotzdem meinen Briefkasten und stellte bedauernd fest, dass er leer war.
Ich seufzte. Zuerst die komischen Geräusche aus Herrn Winters Wohnung und jetzt auch noch die fehlende Zeitung. Der Tag ging ja gut los!
Ob das etwas mit den Geräuschen von letzter Nacht zu tun hatte?
Blödsinn!, antwortete ich mir selbst und schüttelte den Kopf.
Mir fiel erneut auf, dass es vor dem Haus für einen Samstagvormittag noch immer verdächtig still war. Unsere Straße ist zwar keine Hauptverkehrs- oder Durchgangsstraße, normalerweise aber dennoch ziemlich belebt.
Ich ging zur Tür, öffnete sie und trat auf die Türschwelle, während ich die schwere Holztür aufhielt. Dann schaute ich in beide Richtungen und konnte im ersten Moment nicht glauben, was ich sah. Sowohl die Fahrbahn als auch die beiden Bürgersteige waren leer und verlassen. Kein einziges Auto fuhr durch unsere Straße, während ich dort stand. Und ich entdeckte auch niemanden, der zu Fuß unterwegs war. Die einzigen Fahrzeuge, die ich sah, waren leer und parkten auf beiden Seiten der Fahrbahn.
»Was ist denn hier los?«, fragte ich mich laut und schüttelte erneut den Kopf. Erst als ich meine eigene Stimme hörte, fiel mir auf, wie gespenstisch still es war. Das Einzige, was ich neben dem eigenen Herzschlag hören konnte, war das Zwitschern eines Vogels in der Nähe. Ansonsten war es geradezu totenstill.
Ich wusste nicht, warum mir ausgerechnet dieses Wort eingefallen war – eine Vorahnung möchte ich es nicht unbedingt nennen –, aber meine Wortwahl behagte mir nicht, weil sie unangenehme Assoziationen nach sich zog.
Was geht hier eigentlich ab?, fragte ich mich erneut, dieses Mal allerdings nur in Gedanken, während ich mich nach einem letzten Blick in die Runde wieder ins Haus zurückzog. War heute ein Feiertag, und ich hatte nichts davon mitbekommen? Unmöglich! Fronleichnam war vor gut einer Woche gewesen, und bis August gab es keine weiteren Feiertage. Ich muss das wissen, schließlich bin ich Lehrer. Was war dann der Grund, dass die Straße vor dem Haus und das ganze Viertel wie ausgestorben wirkten?
Die Tür fiel laut knallend ins Schloss. In der Stille kam es mir lauter als sonst vor. Es klang wie ein Sargdeckel, der mit voller Wucht geschlossen wurde.
Wieso musste ich plötzlich ständig Vergleiche ziehen, die sich um den Tod und das Sterben drehten? Totenstille!Sargdeckel! Und dann noch dieses irrwitzige Gefühl, etwas in Herrn Winters Wohnung hätte mich belauert, als ich vor seiner Tür gestanden hatte.
»Idiot!«, schalt ich mich und schüttelte den Kopf, als wollte ich damit alle merkwürdigen Emotionen und irrationale Gedanken abschütteln wie ein Hund die Regentropfen in seinem Fell. Dann atmete ich einmal tief durch und setzte mich wieder in Bewegung, um nach oben zu gehen. Nach einer Tasse Kaffee sah ich die Sache vermutlich schon wieder nüchterner und sachlicher. Und vielleicht hatte ich bis dahin auch herausgefunden, was wirklich für die unnatürliche Stille verantwortlich war.
Als ich erneut an Herrn Winters Wohnungstür vorbeikam, blieb ich kurz stehen, um zu lauschen. Doch von drinnen war nichts zu hören. Weder das rhythmische Klopfen noch sonst ein Geräusch.
Während ich die Stufen nach oben ging, fragte ich mich, ob Deutschland vielleicht Fußballweltmeister geworden war und deshalb alle anderen irgendwo feierten. Doch ich verwarf diesen Gedanken sofort wieder, denn obwohl ich mich wenig für Fußball interessierte, wusste ich zumindest, dass es bis zum Finale noch ungefähr zwei Wochen waren.
Ich kehrte in meine Wohnung zurück und schloss die Tür. Obwohl die Empfindung ebenso irrational war wie manch andere, die ich an diesem merkwürdigen Morgen schon gehabt hatte, fühlte ich mich sofort sicherer. Ich verzichtete dennoch darauf, von innen abzuschließen und die Sicherheitskette vorzulegen, um mir nicht noch paranoider vorzukommen.
Ich schenkte mir eine große Tasse Kaffee ein und ging damit ins Wohnzimmer. Dort öffnete ich die Balkontür und trat nach draußen. Während ich die ersten Schlucke nahm, sah ich mich um. Doch auch von dieser erhöhten Warte sah ich nicht mehr als von unten. Es war absolut niemand zu sehen. Auch an den Fenstern der mehrstöckigen Altstadthäuser auf der anderen Seite war keine Menschenseele zu entdecken.
Wo stecken die nur alle?
Ich ging zurück in die Wohnung und schaltete das Radio an. Es kam Musik, also wartete ich darauf, dass sich ein Sprecher meldete, und tigerte dabei mit der Tasse in der Hand ruhelos im Wohnzimmer herum. Doch nach dem ersten Musikstück kam ein zweites, dann ein drittes und anschließend ein weiteres. Ich sah auf die Uhr. Bis zu den Nachrichten um zehn würde es noch über eine halbe Stunde dauern. Also schaltete ich das Radio aus und machte stattdessen den Fernseher an. Der Bildschirm blieb allerdings schwarz. Lediglich am unteren Bildrand war ein Fließtext zu sehen, der darauf hindeutete, dass es sich nicht um einen Senderausfall handelte. Der Text, der immer wieder durchlief, lautete:
Das aktuelle Programm musste unterbrochen werden. Bitte warten Sie vor den Bildschirmen auf aktuelle Meldungen.
Ich zappte durch die Kanäle, doch überall bot sich mir das gleiche Bild.
Was war da bloß los?
Wieder erinnerte ich mich an die Schreie, Sirenen und Knallgeräusche von letzter Nacht. Irgendetwas war zu diesem Zeitpunkt geschehen. Und wie es aussah, war der Vorfall größer und folgenschwerer gewesen, als ich bislang angenommen hatte. Aber worum handelte es sich? Um einen Unfall? Ich dachte natürlich sofort an einen Chemieunfall. Allerdings hatte ich, als ich draußen war, keinen ungewohnten oder unangenehmen Geruch wahrgenommen. Und wieso sollten deswegen von einem Tag auf den anderen alle Menschen in meiner Umgebung spurlos verschwinden? Waren sie etwa alle evakuiert worden, und mich hatte man vergessen, weil ich so tief und fest geschlafen hatte, sodass ich das Klingeln und Klopfen an meiner Wohnungstür nicht gehört hatte?
Sobald meine Fantasie in Gang gekommen war, fielen mir rasch hintereinander weitere Ursachen ein: ein nuklearer Unfall, ein terroristischer Anschlag oder eine Atomrakete aus irgendeinem sogenannten Schurkenstaat. Doch danach sah es draußen überhaupt nicht aus. Soweit ich gesehen hatte, war nichts zerstört worden. Und es gab auch keine Brände. Außerdem war es dafür zu ruhig.
Ich seufzte und starrte auf den Bildschirm, der sich in den letzten Minuten, während ich fortlaufend die Programme gewechselt hatte, nicht verändert hatte. Der Kaffee schmeckte mir auf einmal nicht mehr, deshalb stellte ich die halbvolle Tasse auf den Tisch. Ich hatte weder Lust noch genug Geduld, noch länger vor der Mattscheibe zu hocken und darauf zu warten, dass endlich die versprochenen aktuellen Meldungen kamen. Und bis zu den Zehn-Uhr-Nachrichten im Radio wollte ich auch nicht herumhocken und Däumchen drehen. Ich war ruhelos und angespannt und hatte das Gefühl, unbedingt etwas tun zu müssen.
Doch was?
Ich beschloss, schon jetzt zum Einkaufen zu gehen, obwohl ich das samstags immer am Nachmittag erledigte. Der Supermarkt, in dem ich meistens einkaufte und in dessen Nähe sich auch ein Bäcker befand, war nicht weit. Vielleicht traf ich dort oder auf dem Weg dorthin jemanden, der mir sagen konnte, was hier los war.
Ich ging ins Bad, verzichtete jedoch ausnahmsweise auf eine Dusche, weil ich so schnell wie möglich aus dem Haus wollte. Ich wusch mich am Waschbecken und putzte mir die Zähne. Dann zog ich mich um und nahm meinen Rucksack und meine Schlüssel. An der Tür zögerte ich, als hätte ich plötzlich doch Bedenken, meine sichere Wohnung zu verlassen. Doch dann dachte ich an die Leere in meinem Kühlschrank, der dringend gefüllt werden musste. Und egal, was über Nacht geschehen und für die Stille und die leere Straße verantwortlich war, ich musste weiterhin essen und trinken.
Allerdings fiel mir auch das Klopfen aus Herrn Winters Wohnung wieder ein und das merkwürdige Gefühl, das ich dabei gehabt hatte, und ich hatte plötzlich das irrationale Bedürfnis, mich zu bewaffnen.
Ich konnte darüber nur – wenngleich halbherzig – den Kopf schütteln und mich fragen, was eigentlich in mich gefahren war. Gestern war ich noch ein rational denkender, mit beiden Beinen fest auf dem Erdboden stehender Gymnasiallehrer gewesen. Und was war über Nacht aus mir geworden? Allem Anschein nach ein Angsthase, der sich vor Monstern und Ungeheuern aus der Nachbarwohnung fürchtete. Demnächst würde ich vermutlich schon zusammenzucken, wenn ich meinen eigenen Schatten sah.
Dennoch überlegte ich mir, was ich als Waffe benutzen konnte, denn richtige Waffen besaß ich natürlich nicht. Ich ging in die Küche, nahm das lange Tranchiermesser mit der 20 Zentimeter langen Klinge aus dem Messerblock und steckte es in meinen Rucksack. Ich sah es schon vor mir, wie ich von der Polizei kontrolliert wurde und in Erklärungsnot geriet, warum ich ein riesiges Messer zum Einkaufen mitnahm. Aber darauf ließ ich es gerne ankommen, solange ich mich sicherer und besser fühlte.
Ich verließ die Küche, um zu gehen. Doch als ich an der Abstellkammer vorbeikam, fiel mir der Schlosserhammer in der Werkzeugkiste ein. Er hatte einen 300 Gramm schweren, stählernen Hammerkopf, mit dem man, wenn man denn wollte, vermutlich auch einen Schädel einschlagen konnte. Nicht dass ich das vorhatte, um Gottes willen, aber neben dem Tranchiermesser kam es einer Waffe am nächsten. Also holte ich den Hammer und steckte ihn zu dem Messer in den Rucksack. Ich musste nur daran denken, dass ich nicht gedankenlos hineingriff, sonst würde ich mich vermutlich böse an der scharfen Klinge verletzen.
Endlich fühlte ich mich gewappnet genug, die Wohnung verlassen zu können. Ich ging ins Treppenhaus und schloss die Tür sorgsam hinter mir ab.
Im Haus war es noch immer unnatürlich still, und ich fragte mich, wo meine Nachbarn waren. Die Meyers aus dem dritten Stock waren natürlich im Urlaub. Herr Unger von gegenüber war U-Bahnfahrer und saß vermutlich längst in seinem Führerhaus. Die alte Frau Berchtold aus der Wohnung über meiner ging jeden Vormittag auf den Friedhof, um ihren vor sechs Jahren verstorbenen Ehemann zu besuchen. Und die Übrigen waren vermutlich schon unterwegs, um fürs Wochenende einzukaufen.
Und was ist mit Herrn Winter?
Diese Frage stellte ich mir, als ich erneut die Stufen nach unten stieg. Ich beschloss, nun doch an seine Tür zu klopfen, um sicherzugehen, dass mit ihm auch alles in Ordnung war. Das merkwürdige Klopfen, das verstummt war, als ich seinen Namen gerufen hatte, ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Und wenn ich vom Einkaufen zurückkam und feststellte, dass ihm etwas passiert war, würde ich mir ewig Vorwürfe machen.
Ich blieb vor seiner Tür stehen, legte erneut mein Ohr ans Holz und lauschte. Drinnen war es jedoch noch immer mucksmäuschenstill. Dennoch hatte ich wieder das komische Gefühl, dass die Wohnung nicht leer war und etwas auf der anderen Seite der Tür stand und auf Geräusche von draußen lauschte.
Ich hob die Hand, ballte sie zur Faust und klopfte zaghaft mit den Fingerknöcheln gegen die Tür. In der Stille wirkte das Klopfen lauter, als ich beabsichtigt hatte. Ich erschrak, obwohl ich das Geräusch selbst verursacht hatte, und trat mit heftig klopfendem Herzen ungewollt einen Schritt zurück. Dann horchte ich aufmerksam, ob sich innerhalb der Wohnung des alten Mannes etwas tat.
Nichts!
Ich war allerdings immer noch nicht zufrieden. Deshalb ging ich erneut zur Tür und streckte meine Hand in Richtung Türknauf aus, um einmal kräftig daran zu rütteln. Die Tür machte zwar einen verschlossenen Eindruck, aber vielleicht war die Schlossfalle nicht richtig eingeschnappt, sodass ich sie öffnen konnte.
Doch noch bevor meine Hand den Knauf berührte, krachte etwas von innen so heftig gegen die Tür, dass sich mir das Holz entgegenwölbte. Ich schrie vor Schreck auf, riss meine Hand zurück und sprang nach hinten. Ich war froh, dass die Wohnungstüren keinen Glaseinsatz hatten, denn sonst hätte das, was auch immer sich gegen Herrn Winters Tür geworfen hatte, sicherlich die Scheibe zertrümmert.
Ich hörte ein angriffslustiges Knurren und erstarrte im ersten Moment vor Schreck. Doch dann entspannte ich mich wieder, denn mir fiel die Irisch-Setter-Hündin des alten Mannes ein. Wie hatte ich bloß den Hund vergessen können? Vermutlich war Herr Winter zum Einkaufen gegangen und hatte die Hündin allein in der Wohnung zurückgelassen. Das war höchstwahrscheinlich auch die Erklärung für das Klopfen von vorhin. Der Hund musste es verursacht haben, weil er sauer oder traurig darüber war, dass er allein gelassen worden war, und seinen Frust abreagieren musste.
»Lady, bist du das?«, fragte ich und ging wieder näher zur Tür.
Das Tier ließ sich allerdings durch die Nennung seines Namens nicht besänftigen. Da musste wohl jemand mächtig sauer sein. Erneut warf es sich mit voller Wucht gegen die Tür, sodass ich schon befürchtete, sie könnte mir im nächsten Moment entgegenfliegen. Doch zum Glück ging sie nach innen auf und hielt dem Ansturm stand.
Ich trat zurück und sagte nichts mehr, um die Hündin nicht noch mehr zu reizen. Sobald ihr Herrchen vom Einkaufen zurückkam, würde sie sich schon wieder einkriegen.
Wenigstens musste ich mir keine Gedanken mehr um das Wohlergeben meines Nachbarn machen und konnte beruhigt zum Einkaufen gehen.
Zu meinem Bedauern steckte die Tageszeitung immer noch nicht im Briefkasten. Ich beschloss daher, bei der Zeitung anzurufen und mich zu beschweren, sobald ich vom Einkaufen zurück war.
Ich verließ das Haus, trat auf den Gehsteig und sah mich erst einmal um. Noch immer konnte ich nirgendwo eine Menschenseele erblicken. Ich erschauderte, denn allmählich kam ich mir vor wie Will Smith in I am Legend.
Oder war das alles nur ein Scherz? Versteckte Kamera? Haha, sehr witzig! Selten so gelacht!
Ich wandte mich nach rechts und ging auf dem Bürgersteig in Richtung Kreuzung. Dort würde ich nach rechts abbiegen und schon 400 Meter weiter zu dem kleinen Supermarkt kommen, in dem ich einkaufen ging, wenn ich keine größeren Besorgungen zu erledigen hatte. Für Großeinkäufe fuhr ich mit dem Auto zu einem der größeren Einkaufszentren.
Während ich zügig voranschritt, behielt ich meine Umgebung aufmerksam im Auge und sah mich auch mehrere Male nervös um, ohne allerdings jemanden zu entdecken. Nicht einmal hinter den Fenstern der Häuser rechts und links war jemand zu sehen. Ich kam an mehreren kleineren Geschäften im Erdgeschoss der Häuser vorbei, doch alle waren geschlossen. Das unangenehme Gefühl, das mich längst beherrschte, wurde dadurch nicht unbedingt geringer.
Als ich die Kreuzung erreichte, blieb ich kurz stehen und sah in alle Richtungen. Auch hier war niemand unterwegs, weder zu Fuß noch mit dem Auto. Ich sah allerdings in der Straße, in der auch der Supermarkt lag, zwei Autos mitten auf der Fahrbahn stehen. Die Fahrertüren standen sperrangelweit offen, von den Fahrern war jedoch nichts zu sehen. Als ich vorsichtig näher heranging, bemerkte ich, dass bei einem der Fahrzeuge sogar noch der Motor lief. Neben den Rufen der Vögel war es das einzige fremde Geräusch, das ich hörte, seit ich das Haus verlassen hatte.
Ich runzelte die Stirn, während ich mich fragte, was das nun wieder zu bedeuten hatte, und ging zu den Autos. Ich bückte mich, um hineinzusehen, doch sie waren leer. Neben der offenen Fahrertür eines der Fahrzeuge entdeckte ich dunkle Flecken auf dem Asphalt der Straße. Man hätte sie bei einem beiläufigen Blick leicht für Ölflecke halten können, wären sie nicht verräterisch rot gewesen. Ich näherte mich ihnen, ging in die Hocke und tunkte meinen rechten Zeigefinger in einen der Flecken. Es handelte sich unzweifelhaft um Blut, und so wie es aussah, war es sogar noch ziemlich frisch.
Ich erschauderte erneut, richtete mich rasch wieder auf und sah mich um, als hätte jemand die kurze Zeit, in der ich abgelenkt gewesen war, genutzt und sich von hinten an mich herangeschlichen. Doch ich war noch immer der einzige Mensch weit und breit.
Ich dachte darüber nach, was hier geschehen sein und die beiden Fahrzeuglenker dazu veranlasst haben könnte, auszusteigen und ihre Autos mitten auf der Fahrbahn stehen zu lassen. Ein derartiges Verhalten war so abnormal, dass es meine Befürchtungen über das, was letzte Nacht passiert war, noch schrecklicher werden ließ. Ich seufzte schwer. Eigentlich hatte ich durch meinen Gang zum Supermarkt und zum Bäcker Antworten finden wollen, doch stattdessen stellten sich mir nur immer neue Fragen.
Ich wandte mich von den Autos ab, kehrte auf den Gehsteig zurück und setzte meinen Weg fort. Die Haut zwischen meinen Schulterblättern kribbelte, als würde ich beobachtet werden, doch als ich mich umsah, konnte ich niemanden sehen. Ich ging unwillkürlich schneller, ohne jedoch zu rennen, da ich plötzlich das drängende Gefühl hatte, dass es besser wäre, wenn ich so schnell wie möglich wieder zurück in meine Wohnung kam, weil ich nur dort wirklich sicher war. Allerdings wollte ich auch nicht ohne Nahrungsmittel zurückkehren. Ich beschloss spontan, mehr zu kaufen, als ich ursprünglich beabsichtigt hatte, damit ich einen Vorrat hatte und für den Notfall gerüstet war. Man konnte ja nie wissen. Außerdem sah das, was ich bisher zu Gesicht bekommen hatte, für mich eindeutig nach einem Notfall aus. Während des Gehens überlegte ich, was ich außer Lebensmitteln noch benötigen könnte: Batterien, Kerzen, Streichhölzer. Was noch? Eine neue Gaskartusche für meinen alten Campingkocher wäre vermutlich auch nicht schlecht, falls irgendwann auch noch der Strom ausfiel. Allerdings bezweifelte ich, dass ich so etwa in dem kleinen Supermarkt fand.
Ich konnte ihn bereits sehen und hoffte, dass er nicht ebenfalls geschlossen hatte. Auf dem Parkplatz standen nur wenige Autos, die noch dazu nicht wie gewohnt ordentlich geparkt, sondern kreuz und quer abgestellt worden waren. Wenigstens waren ihre Türen nicht offen. Auf der Straße vor dem Supermarkt stand jedoch ein Streifenwagen quer, als hätten die Polizisten die Straße absperren wollen. Die Blaulichter blinkten, und die Türen standen offen. Die dazugehörigen Streifenbeamten waren jedoch ebenso spurlos verschwunden wie die Fahrer der anderen beiden Autos, die ich auf dem Weg hierher gesehen hatte. Es sah immer mehr danach aus, als hätten sich alle Menschen außer mir in Luft aufgelöst. Ich konnte das Rauschen des Funkgeräts im Streifenwagen hören, vernahm aber keine menschliche Stimme. Vorsichtshalber hielt ich Abstand. Vermutlich wollte ich nicht noch einmal Blutflecken auf dem Asphalt finden, was mir nur noch mehr Angst machen würde.
Es wurde immer deutlicher, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Nur was, war mir noch immer absolut schleierhaft. Wo waren nur alle? Wieso standen Autos mit offenen Türen mitten auf der Straße, als wären sie in größter Eile verlassen und aufgegeben worden? Warum hatte einer der verschwundenen Fahrer geblutet? Und aus welchem Grund war ich scheinbar als Einziger übrig geblieben?
Da meine Angst stärker wurde, nahm ich den Rucksack von der Schulter und öffnete ihn. Nach kurzem Nachdenken holte ich den Hammer heraus, denn mit ihm konnte ich mögliche Angreifer auch bewusstlos schlagen, während das Messer im Grunde nur dazu geeignet war, blutende Wunden zu verursachen. Ich wollte jedoch niemanden ernsthaft verletzen, solange ich nicht wusste, was hier los war.
Ich näherte mich dem Supermarkt und versuchte, durch die großen Glastüren ins Innere zu sehen. Da sich in ihnen allerdings nur die Straße hinter mir und meine Gestalt widerspiegelten, konnte ich lediglich erkennen, dass im Laden die Lichter an waren. Wenigstens etwas.
Als ich mich den Türen bis auf anderthalb Meter genähert hatte, glitten sie automatisch zur Seite.
Ich seufzte erleichtert, denn wie es aussah, hatte der Supermarkt tatsächlich geöffnet. Ein winziges Überbleibsel von Normalität in einer Welt, die über Nacht komplett den Verstand verloren zu haben schien. Ich umfasste den Griff des Hammers fester und trat vorsichtig ein.
An den beiden Kassen saß niemand. Auch sonst war keiner zu sehen. Ich konnte jedoch aus dem Hintergrund des Ladens – ungefähr von dort, wo sich die Fleisch- und Wursttheke befand – Geräusche hören. Also war außer mir noch jemand da.
Da ich einen größeren Einkauf tätigen wollte, nahm ich mir einen Wagen und schob ihn, ohne allerdings den Hammer wegzustecken, durch die ersten Regalreihen. Die Warenbestände sahen schon etwas geplündert aus, vor allem, was Grundnahrungsmittel und länger haltbare Lebensmittel anging. Zum Teil lagen auch Packungen und Schachteln auf dem Boden und waren aufgeplatzt oder zerdrückt worden. Anscheinend war ich nicht der Erste, der sich hier mit Vorräten eindeckte. Das gab mir neue Hoffnung, dass ich doch nicht der letzte Mensch auf Erden war. Ich packte alles in den Wagen, was mir sinnvoll und notwendig erschien, vor allem Konserven. Ein paar kleinere Dinge packte ich auch gleich in meinen Rucksack, beispielsweise Batterien, Kerzen, Milchpulver, Fischdosen und aus einer Laune heraus zwei Flaschen Wodka.
Auf meinem Zickzackkurs durch die Gänge kam ich den Geräuschen im hinteren Teil des Ladens immer näher. Bisher war mir weder ein anderer Kunde noch einer der Mitarbeiter begegnet. Sobald ich die Quelle der merkwürdigen Laute erreicht hatte, würde sich das aber vermutlich ändern. Ich war froh, endlich auf einen anderen Menschen zu treffen. Und sei es auch nur, weil der andere mir vielleicht sagen konnte, was hier los war.
Obwohl die Geräusche immer lauter und deutlicher wurden, fiel es mir dennoch zunächst schwer, sie zu identifizieren. Zuerst dachte ich, der Metzger in der Fleischabteilung würde Fleisch zerteilen. Dann erinnerten mich die Laute eher an ein Reißen und Schmatzen. War da etwa jemand gerade beim Essen, ohne auf seine Tischmanieren zu achten?
Ich bog um die Ecke und sah an diesem merkwürdigen Tag zum ersten Mal andere Menschen vor mir. Sie waren zu viert und tatsächlich gerade beim Essen. Obwohl das nicht ganz korrekt ist. Denn eigentlich aßen nur drei von ihnen. Der Vierte, der zwischen ihnen auf dem Boden lag, beteiligte sich nicht an dem Festmahl – er war das Festmahl!
Ich blieb so abrupt stehen, als wäre ich von einer Sekunde zur anderen zu Eis gefroren. Dann starrte ich fassungslos auf das makabre und ekelhafte Schauspiel nur wenige Meter vor mir, das sich mir in diesem Augenblick nicht nur in die Netzhaut, sondern auch unauslöschlich ins Gehirn einbrannte.
Bei der Person, die auf dem Boden lag und von den anderen gefressen wurde, handelte es sich um eine junge Frau. Der Riemen einer Einkaufstasche hing noch über ihrer Schulter. Außerdem stand ein voller Einkaufswagen in der Nähe. Sie war also vermutlich ebenfalls hierhergekommen, um ihren Samstagseinkauf zu erledigen, und dabei von den drei Zombies angefallen worden.
Denn dass es sich bei den anderen drei Personen um wandelnde Tote handelte, wurde mir schon auf den ersten Blick klar. Schließlich hatte ich in meiner Jugend genügend Zombie-Filme und zuletzt alle bisherigen Staffeln von The Walking Dead gesehen.
Die Typen – zwei Männer und eine Frau – sahen trotz ihrer Bewegungen mehr tot als lebendig aus. Die sichtbaren Teile ihrer Haut waren wachsbleich. Außerdem hatten sie Verletzungen, die teilweise tödlich aussahen und jeden lebenden Menschen im Nullkommanichts auf die Bretter geschickt hätten.
Bei dem rechten Zombie, der immer wieder blutige Organteile aus der Bauchhöhle der toten Frau holte und in den Mund stopfte, handelte es sich um den Filialleiter des Supermarkts. Ich kannte ihn aufgrund meiner häufigen Besuche zwar vom Sehen, wusste allerdings seinen Namen nicht. Er trug einen dunkelblauen Kittel mit dem Logo des Supermarkts auf der Brust und einer Namensplakette. Allerdings war ich – zum Glück! – nicht nah genug, um ihn lesen zu können. Nicht, dass es in dieser Situation wichtig gewesen wäre, ihn zu kennen. Der Mann war in den Hals gebissen worden, denn dort befand sich eine riesige Wunde, die heftig geblutet hatte. Seine Kleidung war dementsprechend mit Blut getränkt. Allerdings hatte die Blutung längst aufgehört. Außerdem fehlte ihm der linke Unterarm, der entweder abgebissen oder abgerissen worden war. An seiner Stelle befand sich ein blutiger Stumpf, aus dem die abgebrochenen Unterarmknochen ragten. Er ließ sich von seiner Behinderung allerdings nicht beeinträchtigen, sondern schaufelte sich weiterhin einhändig Innereien ins Maul, die er, ohne lange darauf herumzukauen, gierig hinunterschluckte.
In dem mittleren wiedererweckten Leichnam des Trios erkannte ich eine der Kassiererinnen wieder. Meines Wissens gab es drei oder vier, die Teilzeit arbeiteten und sich abwechselten, und sie war die mit Abstand unfreundlichste. Der Tod hatte sie allem Anschein nach nicht freundlicher werden lassen, denn sie benutzte ihre langen, lackierten Fingernägel dazu, große Fleischfetzen aus den Oberschenkeln der toten Frau zu reißen. Ihr Lippenstift und ihr Lidschatten waren verwischt und ließen sie, zusammen mit ihrem bleichen Mondgesicht und dem blutverschmierten Mund, wie ein Clown aussehen. Ein gefährlicher, absolut tödlicher Clown allerdings, der keinen Funken Humor in sich trug. Ihr dunkelblauer Kittel und ihre Bluse waren aufgerissen, sodass man ihren BH sehen konnte, der einmal weiß gewesen war, sich nun jedoch von all dem Blut, das aus ihrem offenen Brustkorb geflossen war, dunkelrot verfärbt hatte. Von den dreien schmatzte sie am lautesten, während sie sich große Fleischstücke in den Mund schob und darauf herumkaute, ohne ein einziges Mal den Blick von ihrer Mahlzeit zu nehmen.
Der linke Zombie, ein älterer Mann mit schütterem, grauem Haar, war mir unbekannt. Ihm fehlten ein Ohr, die Nase und ein großer Teil der Wange, sodass man die Zähne und die Kieferknochen sehen konnte, während er kaute. Ständig fielen ihm Fleischbrocken aus dem Loch in der Backe. Irgendwie war es ihm gelungen, den Schädel der toten Frau zu knacken. Er griff immer wieder in das faustgroße Loch und pulte Teile ihres Gehirns heraus. Vermutlich war das der Grund, warum sie nicht ebenfalls längst zu einer lebenden Leiche geworden war.
Nach ein paar Augenblicken, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen und in denen ich all diese visuellen Eindrücke registrierte, spürte ich, dass ich mich wieder rühren konnte. Ich tat es jedoch nur langsam und vorsichtig, um die drei Zombies, die meine Anwesenheit in ihrer Fressorgie noch nicht bemerkt hatten, nicht auf mich aufmerksam zu machen.
Erst jetzt wurde ich auch auf den Geruch aufmerksam, der mich, wäre ich zuvor wachsamer gewesen, sicherlich vorgewarnt hätte. Der Verwesungsgeruch war noch nicht sehr ausgeprägt, denn dafür waren diese Leute noch nicht lange genug tot. Der Gestank nach frisch vergossenem Blut war allerdings umso intensiver, und es roch wie in einem Schlachthaus. Mir wurde sofort speiübel. Ich schluckte und versuchte verzweifelt, den Würgereiz zu unterdrücken.
Ich musste sofort weg von hier! Doch dabei musste ich mich möglichst lautlos bewegen und behutsam vorgehen. Den Einkaufswagen würde ich zurücklassen, denn zu leicht konnte das Ding einen verräterischen Laut verursachen, der mein Ende besiegeln würde. Und ich wollte gewiss nicht so enden wie die bedauernswerte junge Frau, die das Pech gehabt hatte, vor mir den Laden zu betreten. Was andererseits mein Glück war, denn durch sie waren die hungrigen Zombies abgelenkt genug, um mich nicht zu bemerken.
Mein Kampf gegen die Übelkeit war erfolgreich, und der Drang, mich übergeben zu müssen, wich. Behutsam löste ich meine Hände vom Griff des Einkaufswagens. Bedauerlicherweise verstummten die Schmatzgeräusche der wandelnden Toten im gleichen Moment, als sich meine Hände ihrerseits mit einem Schmatzen vom Griff lösten, da mir mittlerweile am ganzen Leib der Schweiß ausgebrochen war.
Ich erstarrte erneut zur Salzsäule und hoffte, dass die Zombies den Laut nicht bemerkt hatten oder, falls doch, das Schmatzen einem ihrer Kameraden zuschrieben.
Doch meine Hoffnung zerstob, als die unfreundliche Kassiererin abrupt den Kopf hob und mich ansah. Ich hatte die blöde Ziege ohnehin noch nie leiden können. Und meiner Meinung nach hatte das auf Gegenseitigkeit beruht. Erstaunlicherweise fehlte ihrem Gesicht nun der unfreundliche, geradezu feindselige Ausdruck, den sie als lebender Mensch im Umgang mit den Kunden ständig durch die Gegend getragen hatte. Mir fiel ein, dass ich sie nie hatte lachen sehen. Und auch jetzt lachte sie natürlich nicht. Ihre Miene war stattdessen ausdruckslos. Wenn überhaupt, dann erweckte sie einen konzentrierten Eindruck, so als wäre die Tätigkeit des Essens für sie ein hochkomplexer Vorgang, der ihre ganze Aufmerksamkeit erforderte. Zu meiner Überraschung reagierte sie überhaupt nicht auf meine Anwesenheit. Im Gegenteil. Sie senkte den Blick wieder auf den Oberschenkel der toten Frau, um mit ihren spitz zugefeilten Fingernägeln den nächsten Fleischbrocken abzureißen.
Ich hätte vor Erleichterung beinahe aufgeseufzt, unterdrückte es jedoch gerade noch rechtzeitig. Ein Teil der Anspannung wich aus meinem Körper, und ich konnte endlich die Hände vom Einkaufswagen nehmen.
Doch ich hatte mich zu früh gefreut, denn plötzlich knurrte die ehemalige Kassiererin und hob so ruckartig den Kopf, dass ihre Nackenmuskeln bedenklich knackten. Meiner Meinung nach hatte sie schon immer eine lange Leitung gehabt, und auch daran hatte der Tod nichts geändert. Sie verzog das Gesicht, fletschte ihre blutigen Zähne, zwischen denen Fleischfetzen hingen, und knurrte mich wie ein tollwütiger Hund an. So unfreundlich hatte ich sie zum Glück noch nie erlebt.
Die beiden anderen Zombies hoben nun ebenfalls die Köpfe und sahen in meine Richtung. Nach einem Moment des Unverständnisses, das sich deutlich auf ihren Gesichtern abzeichnete, erkannten sie, dass soeben ihre nächste Mahlzeit eingetroffen war – Lieferservice für Zombies sozusagen –, knurrten laut und zeigten mir ebenfalls ihre Beißer.
Während ich vor Schreck noch immer erstarrt war, kamen die drei wiedererweckten Toten erstaunlich rasch auf die Füße, auch wenn sie dabei einen ungelenken und unsicheren Eindruck erweckten. Sie streckten gleichzeitig die Hände in meine Richtung und kamen stöhnend auf mich zugewankt.
Das Bild kannte ich natürlich schon aus diversen Zombie-Filmen. Ich hätte allerdings nie gedacht, es selbst einmal leibhaftig zu erleben.
Die wandelnden Leichen hatten bereits die Hälfte der Strecke zurückgelegt, als ich endlich reagierte. Ich versetzte dem vollgeladenen Einkaufswagen einen heftigen Stoß, sodass er auf die drei Schreckgestalten zuraste. Er streifte den alten Mann mit den freiliegenden Zähnen, sodass er zur Seite taumelte und umkippte. Das Miststück von Zombie-Kassiererin wurde hingegen frontal erwischt und nach hinten geschleudert. Der Einkaufswagen kippte um, fiel auf sie und begrub sie mitsamt seiner Ladung unter sich.
Der Einzige, der völlig ungeschoren davonkam, war der Filialleiter. Er hatte mich schon fast erreicht, als ich blitzschnell zur Seite auswich, sodass sein ausgestreckter rechter Arm mit den blutüberströmten, zupackenden Fingern und der Armstumpf ins Leere stießen. Ich hob den Hammer und ließ ihn mit voller Wucht auf den Schädel des Zombies herabsausen. Zurückhaltung war hier bestimmt nicht angebracht. Im Gegenteil. Ich musste diesen Kerl so schnell und effektiv wie möglich aus dem Spiel nehmen. Denn wenn ich zu lange mit ihm beschäftigt wäre, hätten die beiden anderen lebenden Toten genügend Zeit, sich aufzurappeln und erneut auf mich loszugehen.
Der Hammer prallte auf den Kopf des Filialleiters, sodass er ins Taumeln geriet, richtete zu meinem Bedauern jedoch keinen ernsthaften Schaden an. Der Kerl hatte einen verdammt harten Schädel. Bevor er sich in meine Richtung drehen konnte, hob ich den Hammer ein zweites Mal, drehte dabei den Griff in meiner Hand, sodass dieses Mal das spitze Ende nach unten zeigte, und schlug noch kräftiger zu. Es knackte, als würde man eine Kokosnuss aufbrechen, als der Hammer die Schädeldecke durchschlug. Der Zombie stöhnte ein letztes Mal, bevor er abrupt zusammenbrach und zu Boden fiel.
Ich schnaufte heftig, als wäre ich gerannt, und sah mich nach den anderen lebenden Toten um. Der alte Mann war schon wieder auf den Beinen, während die Kassiererin Schwierigkeiten hatte, den Einkaufswagen loszuwerden. Irgendwie hatte sich ein Teil ihrer pummeligen Gliedmaßen in den Gitterstäben verfangen.
Mir war das nur recht. Ich beschloss, endlich das Weite zu suchen, anstatt mich auf einen weiteren Nahkampf Mensch gegen Zombie einzulassen. Dabei konnte zu viel schiefgehen. Ein einziger Moment der Unachtsamkeit genügte, und sie würden mich kriegen. Im Gegensatz zu mir mussten die wandelnden Leichname nämlich keine Rücksicht auf sich selbst nehmen, während ich verletzlicher war. Mein einziger Vorteil war meine Schnelligkeit. Und die wollte ich jetzt dazu benutzen, um abzuhauen, solange ich es noch konnte.
Als der alte Mann den ersten Schritt in meine Richtung machte, lief ich bereits los in Richtung Ausgang. Ich bedauerte nur, die Waren im Einkaufswagen verloren zu haben. Doch besser die als mein Leben. Außerdem hatte ich ja noch die Dinge in meinem Rucksack. Bei meiner Flucht nahm ich willkürlich noch ein paar Lebensmittel aus den Regalen und stopfte sie in meine Taschen und unter mein Shirt.
Zum Glück funktionierte die automatische Tür noch immer tadellos und öffnete sich, als ich sie erreichte. Nicht auszudenken, wenn zwischenzeitlich der Strom ausgefallen wäre. Aber das hätte ich bemerkt, denn dann wären auch die Lichter ausgegangen. Ich erschauderte bei der Vorstellung, mit zwei gierigen Zombies in einem finsteren Supermarkt eingeschlossen zu sein. Auf der Leinwand oder Mattscheibe waren solche Szenen ja ganz spannend, im wirklichen Leben konnte ich jedoch gut darauf verzichten.
Ich verließ den Supermarkt und rannte den Weg zurück, den ich zuvor gekommen war. Ich hatte Angst, ich könnte die beiden Zombies zum Haus führen, in dem ich wohnte, wenn ich langsamer ging. An der Kreuzung, an der ich links abbiegen musste, um in meine Straße zu kommen, verharrte ich kurz und sah mich um. Doch keiner der beiden lebenden Leichen folgte mir. Ich atmete erleichtert auf, ging um die Ecke, damit mich keiner der Zombies sehen konnte, falls er doch noch aus dem Supermarkt kam, und lehnte mich mit dem Rücken an die Hauswand, um kurz zu verschnaufen. Dabei sah ich mich aufmerksam um, konnte jedoch noch immer niemanden sehen – weder einen lebenden Menschen noch einen lebenden Toten.
Doch da hörte ich Motorenlärm. Ich wandte im selben Augenblick den Kopf, als ein Motorroller an der nächsten Kreuzung in die Straße einbog und in meine Richtung fuhr. Ich war von dem Anblick viel zu perplex, um zu reagieren. Ich hatte in meinem Leben bestimmt schon mindestens tausend Motorroller gesehen, doch in dieser neuen, veränderten Welt kam es mir vor wie ein Wunder.
Auf dem Roller saßen zwei Personen. Sie trugen keinen Helm. Wer sich in einer Welt, in der man sich vor lebenden Toten in Acht nehmen musste, noch über Verkehrsvorschriften Gedanken machte, war vermutlich fehl am Platz. Daher erkannte ich, dass es sich um einen Jungen und ein Mädchen handelte, beide noch Teenager. Sie johlten und lachten, als sie an mir vorbeifuhren, und hoben grüßend die Hände. Das Mädchen hatte einen Baseballschläger in der Hand, der blutverschmiert war. Sie fuhren vorbei, ohne langsamer zu werden oder anzuhalten, passierten das Haus, in dem ich wohnte, und bogen an der nächsten Querstraße nach rechts ab.
Der einzige Körperteil, der sich von ihrem überraschenden Auftauchen bis zu ihrem Verschwinden bewegt hatte, war mein Kopf, denn ich war ihrer Fahrt mit den Augen gefolgt. Als sie weg waren und der Motorenlärm in der Ferne verklang, schnappte ich nach Luft, denn vor Staunen hatte ich vergessen zu atmen. Ich schüttelte den Kopf und grinste, als ich die Szene noch einmal vor meinem geistigen Auge ablaufen ließ.
Doch das Grinsen verging mir, als ich erneut in die Richtung sah, in der die beiden Rollerfahrer aufgetaucht waren. Denn in diesem Moment kam eine riesige Meute Zombies laut stöhnend um die Ecke, die allem Anschein nach dem lärmenden Roller gefolgt waren. Als sie meiner ansichtig wurden, blieben sie stehen und verstummten. Für ein paar Sekunden sahen wir uns nur an. Die wandelnden Toten waren allem Anschein nach ebenso verblüfft wie ich.
Dieses Mal war ich es, der zuerst reagierte. Ich stieß mich von der Wand ab und rannte los. Den Bruchteil einer Sekunde später kam auch in die lebenden Toten wieder Leben – was genau genommen natürlich ein Widerspruch in sich ist. Sie folgten mir wie eine Herde stumpfsinniger Schafe dem Leittier oder, um ein zutreffenderes Bild zu benutzen, wie eine Hundemeute dem Hasen und stießen ihre Stöhnlaute aus, die sich in dieser Konzentration und Lautstärke noch bedrohlicher und erschreckender anhörten.
Zum Glück hatte ich es nicht mehr weit, erreichte schon bald das Haus und stieß die Tür auf, die tagsüber nie verschlossen war. Auf der Schwelle warf ich einen Blick zurück. Die Zombiehorde – ich schätzte sie auf dreißig bis vierzig Leichen – kam auf mich zugewankt und zugetorkelt. Allerdings war sie noch weit genug weg, weil ich schneller war und meinen Vorsprung vergrößert hatte. Dennoch hatte ich nicht vor, länger als nötig zu warten. Denn wenn die lebenden Leichen die Tür erreichten, unmittelbar nachdem ich dahinter verschwunden war, würden sie diese allein durch ihre schiere Masse möglicherweise eindrücken. Und genau das wollte ich verhindern. Deshalb schlüpfte ich so schnell wie möglich ins Haus, schlug die Tür hinter mir zu und sperrte dann ab. Anschließend zog ich eilig den Schlüssel ab, trat mehrere Schritte zurück und horchte auf die Geräusche der Toten.
Die Schritte und das Stöhnen kamen beständig näher. Doch dann hörte es sich allmählich so an, als zerstreute sich die Menge, weil sie kein lebendes Opfer mehr vor Augen hatte.
Ich atmete erleichtert auf, denn eine Belagerung durch eine Armee von Zombies hätte mir zu meinem Glück gerade noch gefehlt. Dann wandte ich mich um und kehrte in meine Wohnung zurück.
So fing für mich alles an.
Und so verlief meine erste Begegnung mit den neuen Herrschern dieser Welt, den lebenden Toten.
Als die Stimme für mehrere Augenblicke verstummt und einzig das Rauschen der Kassette zu hören ist, stellt der Zombie seine sinnlosen Versuche, an die Lautsprecher zu gelangen, schließlich ein. Er knurrt, wendet sich ab und stapft in seiner unsicheren, stark hin und her schaukelnden Gehweise zum Fenster.
Vor der zum größten Teil von Brettern verdeckten Fensterscheibe bleibt er stehen und sieht durch den Spalt nach draußen. Als ein gelber Vogel, der durch sein Erscheinen aufgeschreckt wurde, davonfliegt, reißt der wiedererwachte Leichnam den Kopf herum und folgt dem Tier mit den Augen, bis es aus seinem Blickfeld verschwindet.