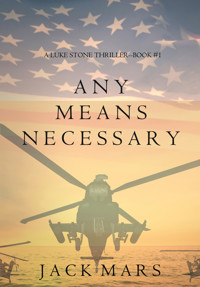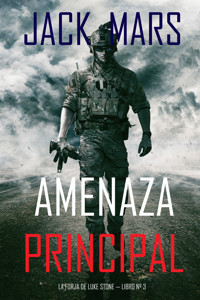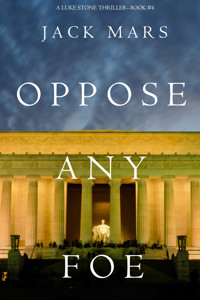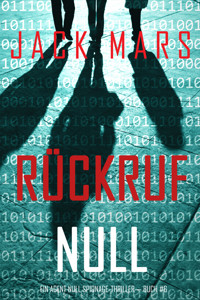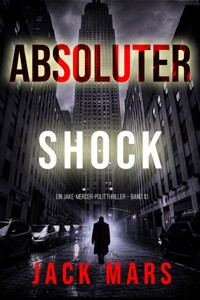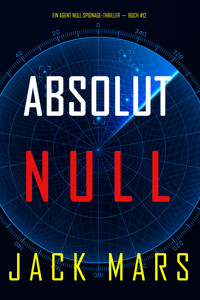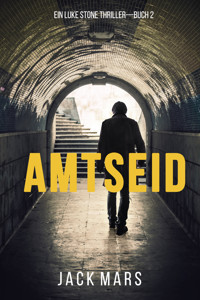4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lukeman Literary Management
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Werdegang von Luke Stone
- Sprache: Deutsch
"Einer der besten Thriller, die ich dieses Jahr gelesen habe." -- Books and Movie Reviews (über Koste Es Was Es Wolle) In DIE HÖCHSTE EHRE (Der Werdegang von Luke Stone – Buch 4), einem bahnbrechenden Action Thriller vom Bestseller-Autoren Jack Mars, wird der Präsident an Bord der Air Force One Geisel genommen. Ein alptraumhafter Flug entfaltet sich und Delta Force Veteran Luke Stone, 29, und sein Special Response Team vom FBI sind vielleicht die Einzigen, die ihn sicher zurückholen können. Doch in diesem actionreichen Thriller voller schockierender Wendungen ist das Ziel – und der Weg nach Hause – vielleicht noch dramatischer als der Flug selbst. DIE HÖCHSTE EHRE ist ein Militärthriller, den man einfach nicht aus den Händen legen kann. Eine wilde Achterbahnfahrt, bei der man bis tief in die Nacht Seite um Seite verschlingt. Als Vorgänger der Bestseller-Reihe über Luke Stone zeigt uns diese Serie von Jack Mars, der als "einer der besten Thriller-Autoren unserer Zeit" bezeichnet wird, wie alles anfing. "Ein Thriller auf ganz hohem Niveau." -- Midwest Book Review (über Koste Es Was Es Wolle) Außerdem verfügbar: Jack Mars' Bestseller Reihe über Luke Stone (7 Bücher), angefangen mit Koste Es Was Es Wolle (Buch 1), verfügbar als kostenloser Download und mit über 800 5-Sterne Bewertungen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DIE HÖCHSTE EHRE
(DER WERDEGANG VON LUKE STONE—BUCH 4)
Jack Mars
Jack Mars ist der USA Today Bestseller Autor der LUKE STONE Thriller Serie, welche sieben Bücher umfasst (und weitere in Arbeit). Er ist außerdem der Autor der neuen WERDEGANG VON LUKE STONE Vorgeschichten Serie und der AGENT NULL Spionage-Thriller Serie.
Jack würde sich freuen, von Ihnen zu hören. Besuchen Sie seine Webseite www.jackmarsauthor.com und registrieren Sie sich auf seiner Email-Liste, erhalten Sie ein kostenloses Buch und gratis Kundengeschenke. Sie können ihn ebenfalls auf Facebook und Twitter finden und in Verbindung bleiben!
Copyright © 2020 von Jack Mars. Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der Bestimmungen des U.S. Copyright Act von 1976 darf kein Teil dieser Publikation ohne vorherige Genehmigung des Autors in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, verbreitet oder übertragen oder in einer Datenbank oder einem Datenabfragesystem gespeichert werden. Dieses eBook ist nur für Ihren persönlichen Gebrauch lizenziert. Dieses eBook darf nicht weiterverkauft oder an andere Personen verschenkt werden. Wenn Sie dieses Buch mit einer anderen Person teilen möchten, erwerben Sie bitte für jeden Empfänger ein zusätzliches Exemplar. Wenn Sie dieses Buch lesen und es nicht gekauft haben, oder es nicht nur für Ihren Gebrauch gekauft wurde, dann geben Sie es bitte zurück und kaufen Sie Ihr eigenes Exemplar. Danke, dass Sie die harte Arbeit dieses Autors respektieren. Dies ist ein Werk der Belletristik. Namen, Charaktere, Unternehmen, Organisationen, Orte, Ereignisse und Vorfälle sind entweder das Produkt der Phantasie des Autors oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, ob lebendig oder tot, ist völlig zufällig. Jackenbild Copyright Getmilitaryphotos
BÜCHER VON JACK MARS
LUKE STONE THRILLER SERIE
KOSTE ES WAS ES WOLLE (Buch #1)
AMTSEID (Buch #2)
LAGEZENTRUM (Buch #3)
UMGEBEN VON FEINDEN (Buch #4)
DER KANDIDAT (Buch #5)
UNSERE HEILIGE EHRE (Buch #6)
DER WERDEGANG VON LUKE STONE
PRIMÄRZIEL (Buch #1)
DER HÖCHSTE BEFEHL (Buch #2)
DIE GRÖSSTE BEDROHUNG (Buch #3)
DIE HÖCHSTE EHRE (Buch #4)
EINE AGENT NULL SPIONAGE-THRILLER SERIE
AGENT NULL (Buch #1)
ZIELOBJEKT NULL (Buch #2)
JAGD AUF NULL (Buch #3)
EINE FALLE FÜR NULL (Buch #4)
AKTE NULL (Buch #5)
RÜCKRUF NULL (Buch #6)
ATTENTÄTER NULL (Buch #7)
KÖDER NULL (Buch #8)
INHALT
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
KAPITEL SECHZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
KAPITEL ZWANZIG
KAPITEL EINUNDZWANZIG
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
KAPITEL DREIUNDZWANZIG
KAPITEL VIERUNDZWANZIG
KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG
KAPITEL SECHSUNDZWANZIG
KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG
KAPITEL ACHTUNDZWANZIG
KAPITEL NEUNUNDZWANZIG
KAPITEL DREISSIG
KAPITEL EINUNDDREISSIG
KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG
KAPITEL DREIUNDDREISSIG
KAPITEL VIERUNDDREISSIG
KAPITEL FÜNFUNDDREISSIG
KAPITEL SECHSUNDDREISSIG
KAPITEL SIEBENUNDDREISSIG
KAPITEL ACHTUNDDREISSIG
KAPITEL NEUNUNDDREISSIG
KAPITEL VIERZIG
KAPITEL EINUNDVIERZIG
KAPITEL ZWEIUNDVIERZIG
KAPITEL EINS
14. Oktober 2005
18:11 Uhr Lebanon Daylight Time
(11:11 Uhr Eastern Daylight Time)
Tripoli
Nördlicher Libanon
»Was sagt er?«
Der große, dünne Schütze mit den blonden Haaren starrte durch das Zielfernrohr des in China hergestellten QBU-88 Gewehrs. Der Mann hatte die letzten vierundzwanzig Stunden damit verbracht, sich mit diesem Gewehr vertraut zu machen. Es war ein Nachbau des alten russischen Scharfschützengewehrs, der Dragunov. Der Mann hatte in der Vergangenheit schon mal mit einer Dragunov geschossen. Dieses Gerät hier war besser.
Der Schüler hatte den Lehrer übertroffen. Die Chinesen waren die größten Nachahmer auf der Erde. Sie kopierten – und dann verbesserten sie es.
Der Mann lag auf dem Bauch im dichten Blattwerk eines Plateaus mit Blick auf die Stadt Tripolis, das Gewehr vor ihm aufgestützt. Vor seinem geistigen Auge konnte er sich die dunkle Schnauze dieses Dings vorstellen, die gerade so aus dem Gebüsch ragte. Er war sich sicher, dass er hier so gut wie unsichtbar war.
Zu seiner Linken und unter ihm standen uralte Steingebäude in vielen abblätternden und verblichenen Farben stramm wie Soldaten auf dem steilen Hang hinunter bis zum tiefblauen Meer.
Der Name des Schützen war nicht Kevin Murphy. Sein kanadischer Pass suggerierte, dass sein Name Sean Casey war. Sein Führerschein aus Ontario deutete dasselbe an. Ein Kanadier namens Sean Casey zu sein war eine sehr gute Sache. Und vor allem weitaus weniger gefährlich.
Er war einfach ein abenteuerlustiger, kanadischer Weltenbummler der sich Ziele abseits der ausgetretenen Pfade suchte. Wie diese heruntergekommene, zerfledderte, aber immer noch wunderschöne zweitgrößte Stadt des Libanon, die wie ein Juwel an der Mittelmeerküste thronte.
Hier gab es nichts zu sehen.
Noch vor einer Minute war die Sonne in einem spektakulären Feuerwerk aus Gelb und Orange unter das Meer geschlüpft – mit einem kurzen Aufblitzen von Grün am Ende. Der Schütze, der nicht Murphy hieß, hielt immer Ausschau nach diesem grünen Blitz. Er hatte ihn an so vielen Orten gesehen, dass er schon lange den Überblick verloren hatte.
Im Kreis von Nicht-Murphys Zielfernrohr befand sich ein Mann mit einem schwarzen Bart mit weißen Sprenkeln. Der Mann trug eine rot-weiß-karierte Kopfbedeckung. Sein Name war Abdel Aahad. Er war Mitte fünfzig, ein radikaler sunnitischer Kriegsherr und Milizenführer, der in den letzten zwanzig Jahren von dieser heruntergekommenen Stadt aus operiert hatte. Aber nicht mehr lange.
Aahad saß auf einer Terrasse, die etwa neunhundert Meter entfernt war – etwa neun Fußballfelder – und vielleicht drei Stockwerke tiefer. Es war ein schwieriger Schuss, genau an der Grenze der effektiven Reichweite dieser Waffe. Der Höhenunterschied machte es noch schwieriger. Die leichte Brise, die vom Meer kam, half auch nicht unbedingt.
Die Sonne war verschwunden. Die Dämmerung würde bald kommen. Wenn dieser Schuss passieren sollte, dann genau jetzt.
»Er hat gesagt: ›Töte den Kopf und der Körper wird sterben.‹«
Nicht-Murphy schaute seinen Späher an, einen Jungen namens Ferjal.
Ferjal war ein Rekrut der Hisbollah. Noch nicht achtzehn, hatte er verrückte, gefährliche Dinge getan, seit er vierzehn oder fünfzehn war. Er sah nicht einen Tag älter als zwölf aus. Er hockte tief kauernd neben Nicht-Murphy im Gebüsch – eine Sitzposition, die so viele Menschen in so vielen Teilen der Welt noch immer einnahmen.
Die Amerikaner hatten keine Verwendung für solche Kauerpositionen. Die Amerikaner hatten eine geniale kleine Erfindung namens »Stuhl«.
Nicht-Murphy wusste, dass Ferjal einen Kopfhörer in einem Ohr hatte und dem arabischen Gespräch auf der weit entfernten Steinterrasse zuhörte. Abdel Aahad hatte viele Freunde in dieser Welt, aber der Mann, der mit ihm auf der Terrasse saß, gehörte nicht dazu.
»Wirklich? Das hat er gesagt?«
»Ja. Kennst du diese Redewendung?«
Nicht-Murphy zuckte leicht mit den Schultern. Er nahm den Blick nicht vom Fernrohr.
»Ich habe sie auch schon andersherum gehört. Töte den Körper und der Kopf wird sterben, was genauer ist. Je nach Kontext ist es offensichtlich und nachweislich falsch, zu sagen, dass der Kopf getötet werden muss, um den Körper zum Sterben zu bringen. Es ist sehr schwer, an den Kopf heranzukommen, und ein neuer wächst sowieso sofort nach. Aber der Körper …«
»Der Kontext ist der amerikanische Präsident«, sagte Ferjal.
Nicht-Murphy beobachtete, wie sich Abdel Aahads Kiefer bewegte, während er sprach. Sehr, sehr langsam platzierte er das Zentrum seines Visiers genau über Aahads Schläfe und ein wenig nach links. Aahad war weit weg. Das schwere Geschoss, das diese Waffe abfeuerte, war panzerbrechend, also bestand da keine Sorge. Ein menschlicher Schädel war alles andere als eine Panzerung. Er musste Aahads Kopf lediglich treffen, dann würde er platzen wie eine Kirschtomate.
Aber die Flugbahn des Geschosses war notorisch flach und es würde auf dem Weg dorthin etwas an Schwung verlieren, also musste er ein wenig höher zielen. Die Brise auf dem Wasser würde die Flugbahn des Geschosses auch ein klein wenig verändern und es etwas … nach … rechts … schieben.
»Eine Fantasie, in diesem Fall«, sagte er.
Nicht-Murphy sah nicht, dass Ferjal nickte. Er fühlte es.
»Ja. Eine ganz erstaunliche Fantasie. Sie stellen sich vor, den amerikanischen Präsidenten gefangenzunehmen und ihn an einen Ort zu bringen, an dem die wahhabitische Scharia gilt. Dann werden sie ihn vor die Richter stellen und ihn wegen Mordes, Spionage gegen einen muslimischen Staat und religiöser Entartung vor den Augen der Welt und vor Allah verurteilen. Sie sind von dieser Idee sehr angetan.«
Nicht-Murphy kaufte ihm das nicht ab. »Er ist kein Muslim, also glaube ich nicht, dass der Maßstab für ihn gilt.«
»Nein, vielleicht nicht«, sagte Ferjal. »Aber er ist ein Hurenbock, ein Abtreiber und ein jahrelanger Förderer von entartetem Verhalten unter Männern. Er ist der Zirkusdirektor des amerikanischen Entartungszirkus. Natürlich ist er auch des Mordes und der Spionage schuldig.«
Nicht-Murphy musste fast lachen. Der Junge hörte sich an, als hätte er den amerikanischen Präsidenten schon selbst vor Gericht gestellt. »Aha. Wo würde ein solcher Prozess stattfinden?«
»In Mogadischu, Somalia. Die Union islamischer Gerichte hat die Stadt eingenommen, vielleicht vorübergehend. Sie sind sehr konservative Gläubige. Andere Orte sind möglich, aber nicht wahrscheinlich. Die Stammesgebiete im Westen Pakistans. Der sunnitisch kontrollierte Jemen, vielleicht. Ganz sicher nicht Saudi-Arabien. Die verräterischen Saudis würden den Mann einfach zurückgeben. Sie wissen, welcher Seite sie Honig ums Maul schmieren müssen.«
»Hat er das alles gesagt oder sind das deine Meinungen?«
»Er sagte Somalia. Der Rest ist meine Meinung. Aber gut recherchiert.«
Nicht-Murphy lächelte. Er mochte Ferjal. Er hatte Gefallen an dem Jungen gefunden.
Ferjals Aufgabe war es, ihn zu diesem Abschussplatz zu führen, ihm das grüne Licht zu geben und ihn dann wieder hier rauszubringen, ohne dass es jemand bemerkte. Ferjal sollte auch die Waffe zu einem späteren Zeitpunkt abholen, sie zerlegen und verschwinden lassen.
Nicht-Murphy trug dünne Einsatzhandschuhe für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand anderes die Waffe zuerst finden würde. Nicht-Murphy existierte nicht. Aber er hatte Fingerabdrücke und er hatte DNA. Das Militär der Vereinigten Staaten hatte Aufzeichnungen über diese Dinge und das bedeutete, dass andere das auch taten. Er hatte diese Waffe nie mit bloßen Händen angefasst.
Nicht, dass es eine Rolle spielte. Keiner würde die Waffe finden. Ferjal war gut in seinem Job.
Ferjal war auch gut darin, unterhaltsame Kommentare abzugeben. Er spickte sie mit pseudoamerikanischen Sprüchen und Mottos, von denen er behauptete, die Leute hätten sie auf Arabisch gesagt.
Ferjals Chefs in Beirut, die Schiiten waren, mochten keine Sunniten. Sie bereiteten sich auf einen Krieg gegen Israel entlang der südlichen Grenze vor und sie mochten es nicht, wenn militanter sunnitischer Abschaum wie Abdel Aahad frei herumlief und tun konnte, was er wollte. Wie zum Beispiel ihnen in den Rücken zu fallen, während sie anderweitig beschäftigt waren.
Also räumten sie in ihrem Hinterhof ein wenig auf.
Erst vor zwei Tagen hatten sie Nicht-Murphy in ein weiß getünchtes, von Maschinengewehrfeuer durchlöchertes Haus gebracht. Ein bärtiger Gelehrter mit Brille und einem Hängebauch saß in einem einfachen Klappstuhl, während Nicht-Murphy stand.
Der Gelehrte hatte den Anschlag auf Aahad vorgetragen. Aahad bedeutete schlechte Nachrichten. Aahad war ein Problem und das schon seit vielen Jahren. Er war ein Unruhestifter und unter anderem ein Verräter an seinem eigenen Land. Sie hatten Aahad wiederholt gewarnt, aber ohne Erfolg.
Es war Zeit für Aahad zu gehen.
»Zwanzigtausend amerikanische Dollar«, erklärte Nicht-Murphy dem Gelehrten. »Fünfzehn für mich, fünf für den Jungen.« Fünfzehntausend Dollar waren nichts für Nicht-Murphy, praktisch weniger als Null – fast nicht wert, dafür aufzustehen.
Fünftausend würden der größte Zahltag sein, den der junge Ferjal je in seinem Leben gesehen hatte. Es war wahrscheinlich das, was sein Vater in sechs Monaten verdiente.
Alles an einem Tag.
»Weißt du«, hatte der bärtige Gelehrte gesagt, »welches Opfer die Brüder an der Südgrenze jeden Tag bringen? Sie leben in Löchern unter der Erde. Sie kämpfen mutig gegen zionistische Patrouillen, während sie vom Himmel aus von zionistischen Hubschraubern gejagt werden.«
»Sie sind sehr mutig«, hatte Nicht-Murphy geantwortet. »Und ich bin sicher, dass dein Freund Allah sie belohnen wird, wenn sie in das große …«
»Weißt du, wie viel Essen, Waffen und Komfort wir diesen Brüdern für zwanzigtausend Dollar geben könnten?«
»Ist das eine Spendenaktion?«, fragte Nicht-Murphy. »Denn ich sage dir, ich werde ein wenig trübsinnig. Wenn es zu viel Geld ist, soll es einer der Brüder von der Südgrenze machen. Ich bin mir sicher, sie würden es allein wegen des Ruhmes tun.«
Der Gelehrte schüttelte den Kopf. »Das ist eine Aufgabe für einen erfahrenen Scharfschützen. Es ist ein Schuss, der über eine sehr große Entfernung abgegeben werden muss. Wir brauchen den Besten.«
Nicht-Murphy zuckte mit den Schultern. »Dann bezahle dafür.«
Auf dem Hügel brach nun die Dunkelheit herein. Es war fast keine Zeit mehr. Das chinesische Gewehr hatte einen guten Mündungsfeuerdämpfer, an dem ein langer Schalldämpfer montiert war. Nicht-Murphy hatte die Vorrichtung gestern getestet. Sie war sehr gut – kein Blitz, sehr wenig Schall. Es würde jedoch eine Rauchsignatur geben. Nur ein Hauch, der aus den Büschen aufstieg. Aber es würde reichen, um sowohl ihn als auch Ferjal das Leben zu kosten.
Aber nicht, wenn der Schuss in der Dunkelheit fiel.
»Wirst du den Schuss abgeben?«, fragte Ferjal. Es war keine Ungeduld. Es war Neugierde.
Nicht-Murphy hatte das Gefühl, dass Ferjal wegen des Geldes ausgeflippt war. Fünftausend Dollar. Es war zu viel Geld. Er schien fast zu hoffen, dass dieser Job nicht zustande kommen würde. Wahrscheinlich wollte er seinen Anteil zurückgeben.
Nicht-Murphy für seinen Teil dachte, dass er sich danach eine Weile ausruhen würde. Der Libanon war ein wunderschönes Land, aber er begann zu denken, dass er bei den Verantwortlichen nicht mehr willkommen war.
Er holt tief Luft und atmete dann langsam aus.
Abdel Aahad saß da, im letzten Licht des Tages. Die Haut gegerbt wie Leder, die Augen eines Jägers, der dichte Bart. Hinter ihm und zu seiner Rechten zündete einer seiner Männer eine Fackel an. Der Strom in Tripoli war im Moment ausgefallen. Das tat der Strom in Tripoli oft. Offenbar war er in diesen Tagen öfter aus als an.
Die Fackel war keine Ablenkung. Wenn überhaupt, dann war sie eine kleine Hilfe. Das Licht der Fackel schimmerte auf Aahads Gesicht.
Die Brise wurde schwächer. Das tat sie oft, wenn die Sonne unterging. Die Hitze breitete sich aus, als hätte jemand einen Schalter umgelegt.
Nicht-Murphy lenkte den Blick wieder ein wenig nach links.
Du musst es Stone sagen.
Der Gedanke kam unaufgefordert, aus irgendeiner düsteren, unlesbaren Tiefe seines Kopfes. Stone was sagen? Dass ein lebender Toter in den letzten Minuten seines Lebens dem Wunschdenken nachgegeben hatte, den Präsidenten der Vereinigten Staaten vor ein fundamentalistisches islamisches Femegericht zu stellen? Lächerlich.
Er brauchte Luke Stone nichts davon zu erzählen. Luke Stone hielt Nicht-Murphy für tot. Jeder tat das. Und das war auch gut so.
Nicht-Murphy schüttelte den Gedanken ab. Es gab nichts zu erzählen. Nicht mehr als müßiges Geplauder.
Er konzentrierte sich wieder auf die Terrasse.
Da drüben würden sie nichts sehen. Sie würden nichts hören. Sie würden nicht wissen, woher der Schuss kam. Im ersten Moment würden sie denken, dass er aus der Nähe gekommen war. Aber dem war nicht so. Sein Verstand machte eine schnelle Berechnung.
Mündungsgeschwindigkeit, ungefähr 930 Meter pro Sekunde. Entfernung, schätzungsweise 800 Meter. Schwungverlust … verdammt, er war kein Raketenwissenschaftler. Sagen wir einfach, dass es eine volle Sekunde, nachdem er den Abzug betätigt hatte, Angst, Verwirrung und Chaos geben würde.
Dann, einen Moment später, würde die Jagd beginnen.
»Bist du bereit, Junge?«, fragte Nicht-Murphy. »Bist du bereit, mich hier rauszubringen?«
»Ja«, sagte Ferjal, der jetzt sehr ernsthaft war. Nicht-Murphy konnte spüren, wie sich der Körper des Jungen anspannte.
»Habe ich grünes Licht?«
»Ich hatte von Anfang an die Befugnis, dir grünes Licht zu geben. Du darfst feuern, wenn du bereit bist.«
Jetzt gab es nur noch Aahad. Sein Gesicht füllte das Visier der Waffe. Aahad sprach. Er erzählte jemandem vom Ablauf des Deals.
Aahad war klug und ein echter Killer. Er kannte sein Geschäft. Er war gerissen. Er war rücksichtslos. Er hatte all die Jahre überlebt und war seinen Feinden immer einen Schritt voraus gewesen.
Das Fackellicht flackerte orange gegen Aahads Gesicht.
Sie hätten Nicht-Murphy keine bessere Sicht geben können, wenn er sie vorher gerufen und um einen gebeten hätte.
»Peng«, sagte Nicht-Murphy ganz leise.
Er atmete wieder ein. Ein …, dann aus.
Er drückte den Abzug. Die Waffe schlug gegen seine Schulter.
Es gab ein Geräusch, nicht viel. Phuuut!
Die verschossene Patrone wurde in die Luft geschleudert.
Abdel Aahad war ein kluger Mann und ein einfallsreicher Gegner gewesen.
Aber das war vorbei.
KAPITEL ZWEI
17:55 Uhr Eastern Daylight Time
Queen Anne’s County, Maryland
Ostufer der Chesapeake Bay
»Freitagabend«, sagte Luke Stone.
Luke und Becca saßen am Verandatisch. Die Sonne ging über der Bucht unter – es war eine Farbexplosion aus Rot, Orange und Gelb. Der Abend war klar und kühl. Die Bäume begannen sich zu färben. Luke liebte diese Zeit des Jahres. Er trug ein dünnes T-Shirt mit Jeans und genoss die Gänsehaut, die der Wind mit sich brachte. Becca trug einen gelben Fleece-Pullover.
Becca seufzte zufrieden. »Freitagabend«, sagte sie zustimmend. Sie stießen mit den Gläsern an, als wäre das Konzept von Freitagabend ein gemeinsamer Trinkspruch.
Sie hatten gerade zu Abend gegessen, Pizza zum Mitnehmen aus einem ziemlich guten Lokal. Luke trank gerade sein drittes Glas Rotwein.
Das Baby schlief in Beccas Schoß, eingewickelt in seinem eigenen hellblauen Fleece, eine Strickmütze und eine Decke.
Ah, das Baby.
Gunner war mittlerweile fünf Monate alt. Er wuchs wie verrückt. Sein Kopf war riesig und mit dicken blonden Locken bedeckt. Er hatte stechend blaue Augen, war sehr stark und konnte diesen riesigen Kopf nun aus eigener Kraft hochhalten.
Er gluckste und gackerte jetzt die ganze Zeit in einer Babyversion des Sprechens. Und er liebte es, Guck-Guck zu spielen. Er konnte es stundenlang spielen und lachte dabei jedes Mal vor Freude.
Alles entfaltete sich auf geheimnisvolle und bezaubernde Weise. Erst neulich hatte Luke laut »Gunner« gesagt und er könnte schwören, dass das Baby sich umdrehte und ihn ansah, als würde es seinen eigenen Namen erkennen.
Das Leben war gut.
»Ich sollte ihn reinbringen«, sagte Becca. »Es wird kühl.«
Luke nickte. »Ich räume auf und bleibe noch ein bisschen draußen.«
Becca kam um den Tisch herum, küsste ihn auf die Stirn und ging dann den Hügel hinauf zur Hütte, das Baby im Arm. Luke sah ihr hinterher.
Es war idyllisch, hier zu sein. Er war traurig, dass es zu Ende ging.
Er hatte den letzten Monat suspendiert verbracht – mit Bezahlung. Es war ein Geschenk von Don Morris gewesen. Don hatte die Untersuchung der Ereignisse auf der arktischen Bohrinsel Martin Frobisher absichtlich in die Länge gezogen.
Am Ende, erst letzte Woche, war Luke von allen Anschuldigungen entlastet worden, erhielt eine Auszeichnung der Agency und würde wahrscheinlich eine weitere für die Entschärfung der Uncle-Joe-Atombombe erhalten – natürlich im Geheimen. Der ›Uncle-Joe-Incident‹, wie die Geschichte ihn eines Tages nennen würde, war für die nächsten fünfundsiebzig Jahre als streng geheim eingestuft worden.
Aber alle guten Dinge gingen einmal zu Ende, auch diese Suspendierung. Luke war wieder im Dienst und wurde am Montagmorgen in aller Frühe im Hauptquartier des Special Response Teams zurückerwartet. Und das bedeutete, dass dies ihr letztes Wochenende hier in der Hütte war; ein wunderschönes altes Haus, das seit mehr als einem Jahrhundert im Besitz von Beccas Familie war.
Das Haus war rustikal. Es war klein, gebaut für winzige Menschen des späten neunzehnten Jahrhunderts – nicht für große Menschen des einundzwanzigsten Jahrhunderts wie Luke Stone es einer war. Die Decken waren niedrig, die Treppe in den zweiten Stock schmal. Die Dielen knarrten. Die Küchentür hatte eine zu starre Feder und wenn man sie losließ, KNALLTE sie jedes Mal zu.
Luke liebte es hier. Es war vielleicht sein Lieblingsort auf der Welt.
Besonders liebte er es, am Wasser zu sitzen und den weiten 180-Grad-Blick auf die Chesapeake Bay von dieser Klippe aus zu genießen. Nichts konnte das übertreffen.
Er seufzte. Zurück an die Arbeit. Nun, das war auch in Ordnung.
Sein Handy klingelte.
Er schaute es an, das kleine Fenster auf der Vorderseite leuchtete auf, während es summte. Die Meldung auf dem Display lautete »Nicht verfügbar«.
Es gab nicht viele Menschen auf dieser Welt, die diese Nummer hatten. Nur bei sehr seltenen Gelegenheiten kam ein Anruf von jemandem, den er nicht kannte.
Es widerstrebte ihm, den Anruf entgegenzunehmen, aber vielleicht waren es gute Nachrichten. Vielleicht war er wieder suspendiert worden. Er nahm das Handy in die Hand und klappte es auf.
»Luke Stone«, sagte er.
»Weißt du, wer dran ist?«, fragte eine Stimme. »Wenn ja, dann sag den Namen nicht.«
Es war eine Männerstimme und natürlich wusste Luke sofort, wer es war. Trotzdem hielt er kurz inne, während er die Information verarbeitete. Ein Geist rief ihn aus dem Jenseits an.
Vor drei Wochen waren Luke und Ed nach New York City gefahren und hatten die Beerdigung eines Mannes namens Kevin Murphy besucht. Sie fand in einer alten katholischen Kirche in der Bronx statt. Danach besuchten sie die Beisetzung auf einem nahegelegenen Friedhof.
Ein Mann in einem Kilt spielte den Zapfenstreich auf dem Dudelsack. Es gab eine Ehrengarde, die jemand zusammengetrommelt hatte, aber keine Beerdigung auf dem Arlington National Cemetery für Murphy – er war zwar ein mehrfacher Kriegsheld, hatte sich aber unerlaubt entfernt, war wegen Desertion angeklagt worden und hatte seine militärische Karriere mit einer unehrenhaften Entlassung beendet.
Luke und Ed hatten sich am äußersten Rand der Menge aufgehalten. Ganz vorne saß eine Frau, wahrscheinlich Mitte sechzig, ganz in Schwarz gekleidet. Sie blieb stoisch, als ein Mitglied der Ehrengarde ihr die dreifach gefaltete amerikanische Flagge reichte.
Jetzt, auf seiner Terrasse, fand Luke endlich seine Sprache wieder. Er war für einen langen Moment sprachlos gewesen.
»Deine Mutter denkt, du bist tot.«
»Ich rufe sie an«, sagte die Stimme.
»Es ist zu spät. Sie hat dich bereits begraben.«
»Das muss jemand anderes gewesen sein. Es passt zu meiner Mom, jemanden zu töten, nur um eine Leiche zum Begraben zu haben.«
Murphys Mutter hatte einen leeren Sarg beerdigt. Die Moschee in Beirut, in der Murphy gestorben war, hatte zwei Wochen lang gebrannt. Chemikalien im Keller hatten bei der Bombardierung Feuer gefangen, das nicht mehr zu löschen gewesen war. Dutzende von Leichen waren in der Moschee gewesen, aber nicht eine einzige wurde geborgen.
»Wo bist du?«, fragte Luke.
»Unterwegs«, sagte die Stimme. »Hast du heute die Nachrichten aus dem Nahen Osten verfolgt?«
»Vielleicht.«
»Ein Mann wurde in den Kopf geschossen. Er hatte mächtige Gegner, die vor dem großen Spiel ihren Kalender aufräumen. Der Mann war ein bisschen berühmt, aber mehr ein Schädling als alles andere. Es war ein Schädlingsbekämpfungsjob. Sie haben einen Kammerjäger hinzugezogen.«
Luke hatte es gesehen. Der Name des Mannes war Abdel Aahad. Er hatte eine lange Karriere als unbedeutender Akteur in den endlosen Bürgerkriegen des Libanon genossen. Diese Karriere hatte heute Morgen ein jähes Ende gefunden, mit einem Scharfschützenschuss aus der Ferne in den Kopf. Seine mächtigen Gegner wären natürlich die Hisbollah. Und das große Spiel, auf das sie sich vorbereiteten, war Israel.
Natürlich hatte das Ganze Luke aufhorchen lassen. Luke selbst war vor einem Monat im Libanon gewesen. Und Murphy war dort gestorben, bei einem Einsatz im Dienste Lukes. Luke hatte sich deswegen schrecklich gefühlt, bis vor etwa zwei Minuten.
Murphy war nicht gestorben. Murphy würde niemals sterben.
»Was kann ich für dich tun?«, fragte Luke.
»Nada. Ich brauche nichts. Ich habe ein paar Informationen, das ist alles. Es könnte etwas sein, es könnte nichts sein. Ich wollte es schon auf sich beruhen lassen, aber dann dachte ich mir, dass das nicht ganz richtig wäre. Ich bin immer noch einer der Guten. Ich sollte es jemandem erzählen. Also habe ich beschlossen, dich anzurufen.«
»Ich bin ganz Ohr«, sagte Luke. Murphy verstand sich selbst als einer der Guten. Er hatte seinen eigenen Tod vorgetäuscht und schien anzudeuten, dass er gerade einen Auftragsmord im Namen einer terroristischen Organisation durchgeführt hatte. Trotzdem …
»Weißt du, du kannst immer noch zurück in die Herde kommen.«
»Das ist toll und ich weiß das Angebot zu schätzen. Aber hör mir doch mal kurz zu, okay? Der Schädling? Er plapperte bis zur letzten Sekunde. Er hat seinen Satz nicht einmal ganz beendet.«
Es gab eine Pause in der Leitung. Es schien ein Geräusch zu sein, eine laute Stimme, die im Hintergrund widerhallte.
»Worüber hat er geplappert?«, fragte Luke.
»Er hat darüber geredet, El Numero Uno zu fangen, den großen Kerl persönlich. Und ihn dann irgendwohin zu bringen, wo die Scharia gilt, und ihn vor Gericht zu stellen.«
»Der große Kerl, hm?«
»Und ob«, sagte die Stimme. »Der große alte Mann, der Yankee Doodle Dandy, das große liberale Experiment.«
Murphy sprach über den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Der neueste Präsident, Clement Dixon, war der älteste in der amerikanischen Geschichte und galt als der liberalste seit Jahrzehnten. Murphy mochte keine Liberalen. Und es war ein historischer Unfall, der Dixon ins Amt gebracht hatte. Er hatte die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens damit verbracht, verschiedene Präsidenten aus den Hallen des Kongresses heraus anzuschreien und zu beschimpfen.
»Das Beste daran ist, dass es sich bei dem Ort mit dem Scharia-Gesetz um Mog handelt.«
»Mogadischu?«, hakte Luke nach.
»Kennst du noch ein Mog?«
Mogadischu. Oktober 1993. Es war vor Lukes Zeit gewesen – er hatte es um etwas mehr als ein Jahr verpasst. Aber jeder Army Ranger und jedes Mitglied der Delta Force kannte die Geschichte der nächtlichen Schlacht, die dort stattgefunden hatte. Die Rangers, Delta, das 160th Special Operations Aviation Regiment (Night Stalkers) und die 10th Mountain Division hatten zusammen neunzehn Männer verloren.
»Scheint ein bisschen weit hergeholt zu sein«, meinte Luke.
»Genau das denke ich auch. Aber ich dachte, ich sollte es trotzdem weitergeben.«
»Ich glaube nicht, dass der betreffende Schädling jemals so eine Reichweite hatte.«
»Die hat vielleicht niemand«, sagte die Stimme. »Vielleicht denkt jemand, dass er sie hat. Manchmal übernehmen sich die Leute und am Ende richten sie ein Chaos an.«
Luke dachte einen langen Moment darüber nach.
Die schallende Stimme meldete sich wieder im Hintergrund zu Wort. Diesmal lauter. Es klang wie eine Durchsage, die auf einem Flughafen gemacht wurde. Luke schaute auf seine Uhr. Es war schon nach achtzehn Uhr. Wenn Murphy etwas mit dem Aahad-Attentat zu tun hatte, bedeutete das, dass er vielleicht noch im Libanon war, sieben Stunden voraus.
»Hör zu, ich muss los«, sagte die Stimme.
»Wo bist du?«, fragte Luke zum zweiten Mal.
»Kann ich nicht sagen.«
»Ein bisschen spät für einen Linienflug, oder?«
»Ich habe keine Ahnung von solchen Dingen. Aber gute Arbeit bei dieser anderen Sache oben im Norden. Ich habe davon gehört. Die Leute reden. Und es war schön, mit dir zu plaudern.«
»Hör mal, Murph …«
Doch die Leitung war bereits tot.
Luke starrte einen Moment lang auf das Handy. Zu seiner Linken war die Sonne gerade hinterm Meer versunken. Ein breiter gelber Fleck saß noch am Horizont. Das war alles, was vom Tag übrig war. Bald würde es eine schöne, gemütliche Herbstnacht werden.
Der Präsident? Entführt und vor ein islamisches Gericht gestellt? Das war keine leicht zu schluckende Vorstellung. Und es war auch nicht einfach, diese Information weiterzugeben.
Wer hatte ihm davon erzählt? Woher hatte diese Person es erfahren?
»Oh, Murphy. Du weißt schon, der Tote? Er hat davon gehört, als er einen sunnitischen Milizenführer ermordet hat. Ja, er beschloss, nach seinem Tod im Libanon zu bleiben. Ich schätze, er arbeitet jetzt als Söldner.«
Das würde nicht funktionieren.
Wie auch immer, der Präsident der Vereinigten Staaten war in diesem Moment zufällig in Begleitung von Don Morris, auf einer offiziellen Reise nach Puerto Rico. Don Morris – legendärer Krieger, Mitbegründer der Delta Force, sowie Gründer und Direktor des FBI Special Response Teams – hatte einen ziemlichen Eindruck auf den neuen liberal gesinnten Präsidenten gemacht.
Könnte der Präsident sicherer sein als mit Don Morris an seiner Seite? Luke bezweifelte es. Er lächelte bei dem Gedanken an dieses seltsame Paar.
Er stand auf und begann, die Teller vom Abendessen abzuräumen.
Dann hielt er inne. Er wurde ganz still in der zunehmenden Dunkelheit. Er sah wieder auf sein Handy hinunter. Nicht verfügbar. Das brachte Murphy auf den Punkt.
Luke hatte versucht, ihn an Bord des Special Response Teams zu holen, und tatsächlich war Murphys Leistung außergewöhnlich gewesen. Mehr als außergewöhnlich. Er war nicht per se ein Ermittler, aber wenn man ihn in einer Kampfsituation losließ, konnte man nur staunen. Seine Leistung war nicht das Problem.
Sein Engagement – sein fehlendes Engagement – war das Problem. Seine Tendenz zu verschwinden. Seine mysteriöse Art.
Aber er war immer noch am Leben und wenn er sich zurückmeldete, bedeutete das, dass er noch nicht ganz weg war.
Und die Informationen selbst …
Luke seufzte. Es war weit hergeholt. Es konnte nicht real sein. Und doch …
Er wählte eine Nummer, die er auf Kurzwahl hatte. Das Handy klingelte dreimal, dann meldete sich eine tiefe Frauenstimme.
»Was machst du, Stone? Du sollst doch erst am Montag wieder kommen. Kannst wohl keine zwei Tage mehr warten, was?«
Trudy Wellington.
Luke lächelte. »Hast du geschlafen? Du klingst schläfrig.«
»Wohl kaum. Warum belästigst du mich?«
»Wie sieht es da draußen aus? Irgendetwas, das ich wissen sollte?«
Luke konnte fast hören, wie sie am anderen Ende der Leitung zusammenzuckte. »Alles normal. Nordkorea hat heute Morgen einen gefälschten Raketenalarm durchgeführt und Boten mit Dummy-Abschusscodes durch ihre Kommunikationstunnel geschickt. Seoul hätte innerhalb von fünfzehn Minuten mit einem Sperrfeuer von dreißigtausend konventionellen Waffen getroffen werden können, mit Millionen Toten. Aber es ist nichts passiert.«
»Sonst noch etwas?«
»Wird das ein Quiz, Stone?«
»Irgendetwas über den Präsidenten?«
»Nur das Übliche, soweit ich weiß. Einsame Spinner, die nie näher als fünfzehn Kilometer auf ihn rankommen werden, laden Manifeste ins Internet hoch. Hinterwäldler-Milizen, voll mit asthmatischen Diabetikern mittleren Alters und hundertprozentig von Spitzeln unterwandert, üben für den nächsten Bürgerkrieg, der kurz nach seiner Ermordung beginnen wird. Außerdem flehen islamische Kleriker Allah an, ihn mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erschlagen. Er hat eine Menge Bewunderer. Ich würde sagen, Irre aller Schattierungen hassen ihn.«
»Trudy …«
»Stone, der Präsident ist mit Don zusammen. Dein typischer Terrorist würde bei dem Gedanken umkippen, sich mit Don Morris anzulegen. Vor allem, wenn er sich gerade sonnt.«
Luke schüttelte den Kopf und lächelte. »Okay, Wellington.«
»Okay, Stone.«
»Mach weiter.«
Luke legte auf. Er blickte hinauf zu ihrer Hütte auf dem Hügel, die Lichter leuchteten gegen die Dunkelheit an. Seine Familie war dort oben, die Menschen, die er liebte.
KAPITEL DREI
20:35 Uhr Atlantic Standard Time (20:25 Uhr Eastern Daylight Time)
San Juan Viejo (Altstadt San Juans)
San Juan, Puerto Rico
»Oh, Allah!«, sagte der Mann leise. »Lass mich leben, solange das Leben für mich besser ist, und nimm mein Leben, wenn der Tod für mich besser ist.«
Er ging über das blaue Kopfsteinpflaster der Altstadt, inmitten der farbenfrohen spanischen Kolonialbauten aus Backstein, die in festlich leuchtenden Rot-, Gelb-, Orange- und Pastellblautönen gestrichen waren. Es regnete leicht, doch das schien die Nachtschwärmer an diesem Freitagabend nicht zu stören. Sie strömten in lachenden Gruppen von jungen Frauen und Männern aus den Restaurants, gut gekleidet, aufgeregt, am Leben zu sein, vielleicht auch betrunken. Sie alle redeten gleichzeitig und genossen die irdischen Freuden dieser Welt.
Auch er war jung. Aber die Freuden dieser Welt waren nichts für ihn. Sein Schicksal lag in den Händen des Weisen.
Er hielt seine Hände etwa hüfthoch, die Handfläche zum Himmel und den Handrücken zum Boden gerichtet, so wie es angemessen war, wenn man das islamische Du'a – das Bitten um Allahs Gunst – ausführte.
»Oh, Allah«, sagte er und seine Lippen bewegten sich kaum. Kein hörbarer Ton verließ seinen Mund. »Gewähre uns Gutes in dieser Welt und Gutes im Jenseits und bewahre uns vor der Pein des Feuers.«
Jeder, der ihn beobachtete, würde vermutlich annehmen, dass er ein Tourist aus dem Ausland oder sogar ein Besucher aus einem anderen Teil der Insel war. Seine Haut war dunkel, aber nicht dunkler als die der meisten Inselbewohner selbst. Er war gut gekleidet, mit einer blauen Windjacke, damit er nicht vom warmen Regen durchnässt wurde, einer hellbraunen Chino-Hose und teuren Wanderschuhen. Er trug eine Umhängetasche über die Schulter geschlungen. Ein Beobachter könnte denken, dass sich seine Kamera darin befand – und so war es auch.
Der Countdown war fast abgelaufen. Er hatte ein Abschiedsvideo gemacht, als er hier angekommen war. Seine Einreise von Griechenland nach Puerto Rico war erstaunlich einfach gewesen, zumindest für ihn. Er stammte nicht aus Griechenland, aber seine Dokumente behaupteten, dass er ein griechischer Mann namens Anthony war, und niemand stellte dies infrage.
Jetzt war sein Leben verwirkt. Was kommen würde, würde kommen. Es war Allahs Entscheidung und Allahs allein.
Er ging bergab bis zu einer Kreuzung. An dieser Ecke befand sich ein kleiner Gemüseladen, dessen Besitzer gerade dabei war, den Laden für die Nacht zu schließen. Auf der Straße befand sich eine Auslage mit Obst und Gemüse, die der Besitzer nach drinnen brachte.
Anthony beobachtete den Besitzer einen Moment lang. Der Lebensmittelhändler war ein älterer Mann mit einem ordentlich gestutzten weißen Bart. Er war aus Jordanien, einer von Tausenden Jordaniern, die in den vergangenen Jahrzehnten hier eingewandert waren. Der Mann war ein Freund der Sache. Niemand würde das je erfahren, aber Anthony wusste es.
Dieser Mann hatte den Weg für das Eintreffen der Soldaten Allahs vorbereitet. Orte, an denen sie sich aufhalten, und Menschen, mit denen sie in Kontakt treten konnten, Zugang zu sicheren Gebieten, Methoden, um Männer und Material ungesehen und ungehindert zu transportieren … der Mann hatte all das und mehr bereitgestellt.
Anthony trat an den Verkaufsstand im Freien heran.
»Disculpame, amigo«, sagte der Krämer und blickte kaum auf. »Está cerrado.«
Verzeih mir, mein Freund. Der Laden ist geschlossen.
»Es gibt keinen Gott außer Allah«, sagte Anthony ganz leise.
Der alte Mann blieb stehen und schaute die Straße auf und ab. Er musterte Anthony genau, kniff ein Auge zu und hätte fast gelächelt. Aber er lächelte nicht.
»Und Mohammed ist sein Prophet«, sagte er und vollendete die Schahāda.
Anthony streckte die Hand aus und nahm einen der Äpfel des Mannes. Er biss hinein. Er war süß, saftig und köstlich. In einem tropischen Klima wie Puerto Rico wurden Äpfel zum Verkauf angeboten. Die Wunder Allahs würden nie versiegen.
»Allahu Akbar«, sagte er. Allah ist der Größte.
Nun griff er in seine Tasche und holte einen Geldschein heraus. Es war ein amerikanischer 100 Dollarschein. Er hatte keine Verwendung mehr dafür. Er überreichte ihn, aber der Krämer wollte abwinken.
»Der Apfel wird nicht in Rechnung gestellt.«
»Bitte«, sagte Anthony. »Nimm ihn. Es ist ein kleines Geschenk zum Dank, keine Bezahlung.«
»Die Gaben Allahs sind nicht von dieser Welt«, sagte der Krämer.
»Es ist ein Geschenk von mir an dich.«
Schweigend nahm der Krämer den Schein und steckte ihn in seine Tasche. Er reichte Anthony im Gegenzug einige Münzen und vervollständigte so die Illusion, dass ein Mann gerade einen Apfel von einem anderen gekauft hatte. Sollte irgendjemand zusehen – eine Person in einem Fenster, eine Videokamera – so war nichts weiter als eine einfache Transaktion vonstattengegangen.
»Möge Er dein Opfer annehmen und Seine Tore für dich öffnen.«
Anthony nickte und steckte die Münzen in seine eigene Tasche. »Ich danke dir.«
Er war nicht bereit gewesen, dies für sich selbst zu erbitten, da er es für egoistisch hielt. Aber er musste zugeben, dass es das war, was ihn am meisten beunruhigte. Es hatte tagelang an ihm genagt und er erkannte jetzt, dass all seine Gebete und Bitten darum gefleht hatten, ohne es jemals auszusprechen. Würde seine Opfergabe gut genug sein? Würde sie aufrichtig genug sein? War sie unbefleckt von seinem Ego und seinen Begierden?
Sein Körper zitterte nur ganz leicht. Er würde sterben und er hatte Angst.
Der Krämer war mehr als nur gerissen und vorsichtig, er war weise und schien auch die Dinge zu verstehen, die unausgesprochen waren. »Mögen Allahs Gnaden auf Seiner besten Schöpfung Mohammed und all Seiner reinen Nachkommenschaft ruhen«, sagte er.
Anthony nickte wieder. Genau das musste er hören. Wenn sein Opfer aus purem Herzen stammte, würde es angenommen werden. Er nahm einen weiteren Bissen des Apfels, lächelte und hob ihn in Richtung des Lebensmittelhändlers, als wolle er sagen: »Sehr gut.«
Dann drehte er sich um und ging die Straße hinunter. Er hatte den Krämer bereits in größere Gefahr gebracht als nötig.
KAPITEL VIER
21:20 Uhr Atlantic Standard Time (21:20 Uhr Eastern Daylight Time)
La Fortaleza
San Juan Viejo (Altstadt San Juans)
San Juan, Puerto Rico
»Also erzählen Sie, Don«, sagte Luis Montcalvo, der amtierende Gouverneur von Puerto Rico, »waren Sie jemals an der School of the Americas?«
Eine kleine Gruppe von Menschen hatte sich in einem Salon im dritten Stock der Fortaleza versammelt, dem spanischen Herrenhaus aus der Kolonialzeit, das seit 1540 als Residenz des Gouverneurs von Puerto Rico diente. Mehr als zweihundert Jahre bevor die Vereinigten Staaten entstanden, lebten bereits puerto-ricanische Gouverneure in diesem Haus.
Das hatte Clement Dixon befürchtet. Er hatte Don Morris, den Leiter des FBI Special Response Teams, eingeladen, ihn zu einem Staatsbesuch hierherzubegleiten. Und es war ein Staatsbesuch, ganz ähnlich wie der Besuch eines komplett anderen Landes. Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und ihrem Vasallen Puerto Rico war voller Misstrauen, Bedenken und Fehlern epischen Ausmaßes.
Die Ermordung des puerto-ricanischen Nationalisten Alfonso Cruz Castro durch das FBI im letzten Jahr, die jahrzehntelange Bombardierung der puerto-ricanischen Insel Vieques durch die US Navy und das Versäumnis der Navy, die giftige Müllhalde, die sie hinterlassen hatte, zu beseitigen, waren nur eine kleine Auswahl der Fehler, die ihm in den Sinn kamen.
Don hierherzubringen, könnte ein weiterer sein.
Die Eliteeinheit des Mannes war weit in den Polarkreis gereist, um eine russische Atomwaffe zu entschärfen, die explodieren und eine weltweite Katastrophe auslösen sollte. Dabei hatten sie ein Maß an Heldentum an den Tag gelegt, das Dixon dazu veranlasste, an ihrer mentalen Gesundheit zu zweifeln. Abgesehen von der physischen Gefahr, hatten sie die Mission entgegen den Anweisungen ihrer Vorgesetzten beim FBI und im Weißen Haus übernommen.
Don Morris hatte seine legendäre Karriere auf die von seinen eigenen Leuten gesammelten Informationen gesetzt – und auf ihre Fähigkeit, eine Mission mit zusammengeschusterten Ressourcen und trotz aller Widrigkeiten an einem der unwirtlichsten Orte der Erde durchzuführen.
Und er hatte das Wagnis gewonnen.
Clement Dixon bewunderte das. Also hatte Dixon Don nach Puerto Rico gebracht. Er wollte den Mann besser kennenlernen. Er wollte ihm auf den Zahn fühlen und sehen, ob es mehr Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen ihnen geben könnte. Und er mochte es, Leute zusammenzubringen, die eigentlich nicht zusammenpassten.
Don Morris, der alte Black-Ops-Krieger, traf sich mit Luis Montcalvo, dem jungen liberalen Verwalter Puerto Ricos, der in die Rolle gedrängt wurde, als die alte Garde in den Flammen eines Korruptionsskandals untergegangen war. Sein Aufstieg vom Umweltminister ging blitzschnell, vor allem, weil die scheidende Regierung ihn auf Distanz gehalten hatte und jeder, der über ihm stand, belastet war.
Montcalvo war einunddreißig Jahre alt, in Clement Dixons Augen (und wahrscheinlich auch in Dons), kaum alt genug, um sich selbst die Schuhe zu binden. Er war sehr gutaussehend, unverheiratet, hatte keine Kinder und es gab Gerüchte, dass er sogar schwul sein könnte.
Nach einem formellen Abendessen und ein paar Drinks hatte Don Morris sie mehr als eine Stunde lang mit etwas unterhalten, von dem Dixon vermutete, dass es sich um eine entschärfte Version von Spezialoperationen aus vergangenen Tagen handelte.
Jetzt tat Montcalvo das, was er sich vermutlich darunter vorstellte, ihm an die Gurgel zu gehen. Bis zu diesem Moment war er der freundlichste Gastgeber gewesen, den man sich vorstellen konnte.
»Wir in Puerto Rico haben sehr unter den Händen des amerikanischen Militärs gelitten. Wir haben die Demütigung erlebt, unsere Küsten von der amerikanischen Marine zu Übungszwecken bombardieren zu lassen. Die 2400 Menschen auf unserer Insel Vieques haben unter den gesundheitlichen Folgen der Bombardierung gelitten; sie waren dem Kreischen der Überschallflugzeuge und den giftigen Chemikalien, die dort abgeladen wurden, ausgesetzt. Es war die Aktion von Besatzern, nicht von Landsleuten. Und unsere Brüder in ganz Lateinamerika und der Karibik haben sich von der ach so sanften Überredungskunst derer leiten lassen, die ihr Handwerk in der School of the Americas gelernt haben.«
Einen Moment lang herrschte Stille in dem verschnörkelten spanischen Kolonialsalon mit seiner hohen Decke mit den sich sanft drehenden Deckenventilatoren und den Stühlen samt ihren hohen Lehnen.
Montcalvo stand da, einen Drink in der Hand. Vielleicht war er betrunken. Vier Leute saßen. Da waren Clement Dixon und seine engste Mitarbeiterin, Tracey Reynolds. Und da waren Don Morris und seine Frau Margaret.
Don war den ganzen Abend unterhaltsam und charmant gewesen. Margaret gab sich geradliniger neben Dons ausschweifender Comedy-Show, aber es funktionierte. Sie hatte eindeutig viel Übung darin.
»School of the Americas?«, sagte Don und wiederholte den Namen, als hätte er ihn noch nie gehört.
»Ja, Sir«, sagte Montcalvo. »Haben Sie dort studiert?«
Es war eine peinliche Frage, vor allem, weil Montcalvo die Antwort wahrscheinlich kannte, ohne fragen zu müssen. Er wusste wahrscheinlich auch, dass Clement Dixon während seiner Zeit im Repräsentantenhaus oft zu den Menschenmassen bei den jährlichen Protestversammlungen vor den Toren von Fort Benning, wo sich die Schule befand, gesprochen hatte. Manche dieser Proteste hatten 15.000 Menschen versammelt.
»Luis«, sagte Dixon, »ich bin dankbar für Ihre Gastfreundschaft, aber jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für Fragen dieser Art.«
»Es ist eine einfache Frage«, sagte Montcalvo. Er schaute Don an. »Ist sie das nicht?«
Don nickte. »Es ist eine einfache Frage. Und ich bin gern bereit, sie zu beantworten.«
Montcalvo zuckte mit den Schultern. »Dann tun Sie das bitte.«
Dixon stöhnte innerlich auf. Die School of the Americas, die jetzt in einer absurden, gesichtswahrenden Namensänderung als Western Hemisphere Institute for Security Cooperation bekannt ist, war die berüchtigte Folterschule des Pentagons, die sich besonders auf Lateinamerika und die Karibik konzentriert hatte. Einige der schlimmsten Menschenrechtsverletzer in der westlichen Hemisphäre, die für eine lange Liste von Gräueltaten verantwortlich sind, waren Absolventen dieser Schule.
Die Zivilbevölkerung an Orten wie Haiti, Peru, Bolivien, Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasilien, Argentinien und Chile hatte unter Leuten gelitten, die ihr Handwerk an der SOA gelernt hatten.
»Ich war nie in der US Navy«, sagte Don. »Also wüsste ich nicht, warum sie eure Insel bombardiert haben. Ich hatte damit nichts zu tun. Aber was die School of the Americas angeht, war ich dort, ja. Als ich jung war und die Schule sich noch in Panama befand, waren die hohen Tiere der Meinung, dass ich dort viel lernen könnte.«
»Und haben Sie das?«
»Alles, was ich Ihnen sagen kann«, sagte Don, »ist, dass es der Schule mehr als nur um Folter geht. Ich habe in meiner Zeit dort einige seriöse Verhandlungstechniken gelernt und einen Einblick bekommen, wie Staatskunst betrieben wird.«
Montcalvo hob eine Augenbraue. »Staatskunst?«
»Ja.«
»Und haben Sie auch gelernt, wie man Menschen zum Reden bringt? Und wie man sie zur Kooperation bewegt?«
Don Morris sah zuerst zu seiner Frau Margaret, die die Frage zu schmerzen schien. Dann schaute er zu Dixon. Dixon bemerkte, dass Don und Margaret Händchen hielten.
Wenn Montcalvo versuchte, einen Keil zwischen Clement Dixon und Don Morris zu treiben, hatte das fast funktioniert, aber nicht ganz. Dixon hatte eine Menge Respekt vor Don Morris – was auch immer er getan hatte und wo auch immer er ausgebildet worden war.
Trotzdem hasste Dixon die School of the Americas. Er hasste die Vorstellung, dass sie nach Jahrzehnten der Proteste und Kontroversen immer noch existierte, unter einem neuen Namen, der vorsätzlich schwer zu merken war. Dieses Gespräch hatte ihn an sein Versprechen erinnert, den Laden eines Tages zu schließen.
Er war jetzt Präsident. Natürlich sollten wir nicht so tun, als stünde es einem Präsidenten völlig frei, zu tun, was er wollte. David Barrett hatte das auf die harte Tour gelernt. Die Schließung der SOA könnte Clement Dixon einen ziemlich abrupten Ruhestand einbringen.
Don nickte. »Ja, das habe ich.«
* * *
»Gute Nacht, Mr. President«, sagte Tracey Reynolds. Ihre Stimme hallte den langen Marmorflur hinunter.
Clement Dixon stand direkt vor seinem Schlafzimmer. Zwei große Secret Service Männer befanden sich schweigend an beiden Enden des Flurs und taten so, als wären sie steinerne Statuen, die nichts sahen und hörten. In Wirklichkeit hörten sie alles und sahen alles.
Und damit auch Dutzende andere Menschen.
Dixon schaute auf seine neue Assistentin hinunter. Tracey, so jung wie sie war, hatte sich heute Abend wacker geschlagen. Sie hatte ein Glas Wein angenommen, es den ganzen Abend über genossen und nur gesprochen, wenn sie gefragt wurde. Ihre Antworten waren scharf, sachkundig und auf den Punkt gebracht. Als es unangenehm wurde, sagte sie kein Wort über die School of the Americas – sie ließ sich überhaupt nicht in die Sache mit reinziehen. Dixon war sich nicht einmal sicher, ob sie wusste, um was es bei der Schule ging.
Ihre Jugend und die Möglichkeiten, die sich ihr boten, erinnerten Dixon an sein eigenes hohes Alter. Vierundsiebzig Jahre alt. All die Jahrzehnte, all die Schlachten, all das Wasser, das den Bach hinuntergeflossen war, vieles davon verseucht.
Ich bin langsam zu alt für so etwas.
Diese Aussage war nicht falsch. Clement Dixon war ein alter Mann und die Anforderungen der Präsidentschaft schienen oft über ihn hinauszuwachsen, als ob sie mehr verlangten, als er zu bieten hatte. Es war ein Job für einen jüngeren Mann.
»Tracey, um Himmels willen, nennen Sie mich Clem. Oder Clement. Oder Mr. Magoo. Aber hören Sie auf, mich Mr. President zu nennen. Sie sind achtzehn Stunden am Tag mit mir zusammen und ich habe einen Namen. Benutzen Sie ihn, bitte.«
Sie war eine wunderschöne Blondine. Sie trug ihre Haare in einem flotten, konservativen Bob. Clement Dixon hätte sie gerne mit langen Haaren gesehen, die ihr in Kaskaden über die Schultern fielen, aber diese Tage waren vorbei und was er wollte, war sowieso egal.
Er hatte sie vor Wochen bei einem Treffen im Weißen Haus kennengelernt. Sie war eine Adjutantin gewesen und hatte etwas Dummes gesagt, vielleicht sogar etwas Blödsinniges, aber er wusste nicht mehr, was. Es ging darum, dass sie die offiziellen Erklärungen der russischen Regierung für bare Münze nahm. Er hatte sie deswegen vor einer Gruppe von Leuten ermahnt.
Aber das spielte keine Rolle. Sie hatte sein Interesse geweckt. Also hatte er die Fühler ausgestreckt.
Sie war jung, Mitte zwanzig, und stammte aus einer prominenten Familie Rhode Islands. Sie besaßen Hotels in Newport oder so etwas. Vielleicht gehörte ihnen auch das Newport Jazz Festival – besaß jemand das Newport Jazz Festival? Wie auch immer, sie waren große Spender der Partei, also konnte man davon ausgehen, dass sie einige Fäden für sie gezogen hatten.
Wie sie dazu kam, im Weißen Haus zu arbeiten, spielte für ihn auch keine Rolle. Fast niemand im Weißen Haus kam aufgrund von Verdiensten dorthin, am allerwenigsten Clement Dixon. Das Ideal der »Besten und Klügsten« war schon vor langer Zeit auf der Strecke geblieben.
Wenn du heutzutage aus einer angesehenen Familie stammst (vorzugsweise einer, die gerne spendet), du mit deinem Atem einen Spiegel beschlagen kannst (sprich, wenn du am Leben bist) und nicht auf den Papierkram sabberst, bist du Weißes Haus Material.
Doch Tracey war sehr klug, hatte viel Energie und war gut darin, den Überblick zu behalten. Sie hatte einen Blick für die Details und sie verlieh Clement Dixons Schritten ein bisschen Schwung. Ein hübsches Mädchen brachte das zustande.
Waren die Leute irritiert, dass diese schöne junge Frau alle anderen übersprungen hatte, um die persönliche Assistentin des Präsidenten zu werden? Und ob sie das waren. Clement Dixon kümmerte sich auch nicht darum. Er war zu alt, um sich über die wütenden Blicke von vorbeigehenden Streithähnen Gedanken zu machen.
Er mochte Tracey und sympathisch zu sein war einundfünfzig Prozent des Jobs.
Er beobachtete sie belustigt, als sich die Haut an ihrem Hals rot färbte.
»Okay«, sagte sie. »Mr. … Magoo?«
Dixon lachte. »Gute Nacht, Tracey.«
Er drehte sich in Richtung seines Zimmers.
Plötzlich kam Tracey auf ihn zu und küsste ihn auf die Wange.
»Gute Nacht, Mr. Magoo.«
Jetzt war Clement Dixon an der Reihe, rot zu werden.
Sie hatten einen kurzen Moment. Da war ein Funke. Oder doch nicht? Er starrte in ihre blauen Augen und hätte fast etwas sehr Dummes getan. Fast hätte er sie in sein Zimmer eingeladen. Aber er tat es nicht.
»Gute Nacht«, sagte er wieder.
Er ging in sein Schlafzimmer und schloss die Tür hinter sich.
Er holte tief Luft. Er befand sich auf einem gefährlichen Kurs. Wahnsinn lag in dieser Richtung – und Unheil. Er war dabei, sich in eine viel jüngere Frau zu verlieben, eine Frau, die jung genug war, um seine Enkelin zu sein.
Es durfte nicht passieren. Es würde nicht passieren.
Es war das Beste, sich das Ganze aus dem Kopf zu schlagen.
Stattdessen sah er sich im Raum um und nahm alles in sich auf. Dieses Zimmer war im gleichen Stil wie der Rest des Hauses gehalten – glänzende Marmorböden, zwei Stockwerke hohe Decken mit sich sanft drehenden Deckenventilatoren, hohe Fenster mit schweren Vorhängen, die fest geschlossen waren. Das Bett war riesig und auf einem Tisch an der Seite standen gekühlte Wasserflaschen und ein Eiskübel. Auf der Bettdecke lagen Pralinen. Es war totenstill hier drinnen.
John und Jackie Kennedy hatten in diesem Schlafzimmer geschlafen. Papst Paul VI. hatte hier geschlafen. Winston Churchill hatte hier geschlafen, nachdem seine Pflichten als Premierminister von England beendet waren. Der große kolumbianische Schriftsteller Gabriel Garcia Marquez und der Rocksänger Bono hatten übrigens beide schon einmal hier geschlafen.
Und jetzt war Clement Dixon hier. Präsident Clement Dixon.
Er hatte seine besten Jahre hinter sich, das war sicher. Aber trotzdem war er Präsident. Er war wie ein alternder Baseballspieler am Ende einer langen Karriere, der plötzlich in einem Team auf dem Weg zur World Series landete, obwohl er das Team nicht mehr wirklich weiterbringen konnte.
Wenn …
Wenn er nur jedem Amerikaner eine anständige und bezahlbare Gesundheitsversorgung garantieren könnte …
Wenn zwanzig Prozent der amerikanischen Kinder nachts nicht hungern müssten …
Wenn nicht fast eine Million Amerikaner obdachlos wären …
Er spielte das »Wenn«-Spiel sehr oft. Aber er erkannte auch, dass es eine Gewohnheit war, und zwar eine schlechte. Wenn er doch nur vor zwanzig Jahren in diese missliche Lage gestolpert wäre, als er Mitte fünfzig war und noch die Energie eines Mannes in den Dreißigern hatte. Wenn nur seine Frau noch am Leben wäre, um das alles mitzuerleben und an seiner Seite zu stehen. Wenn nur einige der großen Staatsmänner der 1950er und 1960er-Jahre noch am Leben wären, um ihn zu beraten und als seine Verbündeten zu agieren.
Wenn nur der Rechtsruck der 1980er-Jahre nie stattgefunden hätte, als sich das Spiel von der Sicherung des Wohlergehens des Landes zur Beschwichtigung der Konzerne und der Wall Street wandelte.
Das waren die Lügen, die er sich selbst erzählte, und er musste sie loslassen. Die Umstände waren, wie sie waren. Er war Präsident der Vereinigten Staaten und das war ein großes Privileg. Es war auch eine Gelegenheit, Teil der Geschichte zu sein, und eine Chance, vielleicht etwas wirklich Gutes zu tun.
Nehmen wir zum Beispiel diesen Besuch in Puerto Rico. Dixon war der erste Präsident seit John Kennedy im Jahr 1960, der diese Insel besuchte. Fünfundvierzig Jahre lang hatte kein Präsident einen Fuß hierher gesetzt. Puerto Rico war technisch gesehen ein amerikanisches Protektorat – eine umständliche Art zu sagen, dass die USA es in einem Krieg mit Spanien vor mehr als hundert Jahren gewonnen hatten. Und seitdem war die Insel wie eine Kriegsbeute behandelt worden.
Puerto Rico war größer und hatte mehr Einwohner als viele andere amerikanische Staaten, aber die Staatlichkeit war ihm nie angeboten worden. Es hatte enge Verbindungen zu New York City und Miami, mit einer ständigen Parade von Menschen, die hin und her pendelten. Puerto Ricaner waren amerikanische Staatsbürger und zahlten Bundessteuern, aber sie hatten keine Vertretung im US-Senat oder im Repräsentantenhaus.
Ende letzten Jahres hatte das FBI den Aufenthaltsort des puerto-ricanischen Unabhängigkeitsradikalen Alfonso Cruz Castro entdeckt, der in einem Safe House in einem Dschungelgebiet weniger als eine Stunde von diesem Ort entfernt lebte. Der Mann war dreiundsechzig Jahre alt und in einen Geldtransport-Überfall und den Tod eines Wächters des Transports in Manhattan im Jahr 1981 verwickelt gewesen.
FBI-Agenten umstellten die Holzhütte und als Castro sich weigerte, sich zu ergeben, feuerten sie über zweitausend Schuss in und durch die Hütte. Glücklicherweise war Castro der Einzige, der sich darin befand. Andernfalls wäre der Albtraum der Öffentlichkeitsarbeit nicht enden wollend gewesen. Dixon erschauderte bei dem Gedanken, dass eine Frau oder Kinder mit Castro im Haus gewesen hätten sein können.
Wie auch immer, Castros Familie veranstaltete eine öffentliche Prozession für seinen Sarg und Zehntausende von Menschen säumten die Straßen von San Juan, um ihn vorbeiziehen zu sehen. Seine Beerdigung war größer als die meisten nationalen Beerdigungen für Premierminister und bei Weitem größer als die Beerdigung für jeden Gouverneur von Puerto Rico.
Es herrschte antiamerikanische Stimmung in Puerto Rico – so viel war klar.
Dixon setzte sich auf das Bett, streckte die Hand aus und nahm sich eine der Wasserflaschen. Die Glasflasche war glitschig vom Kondenswasser.
»Morgen«, sagte er laut.
Seine Stimme hallte leise im Raum wider.