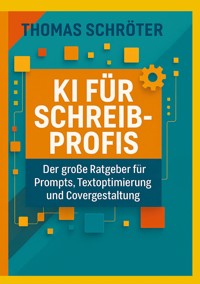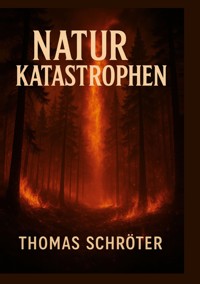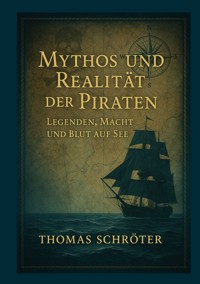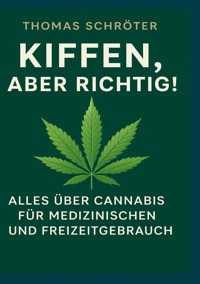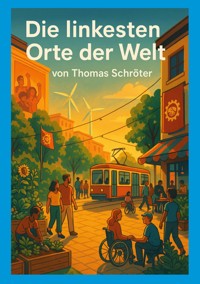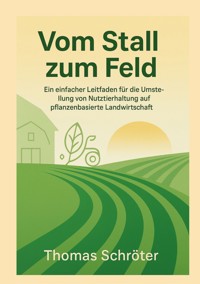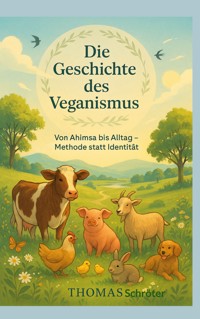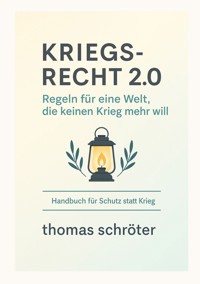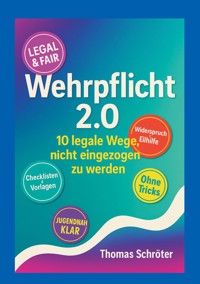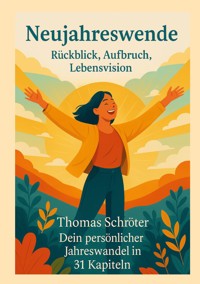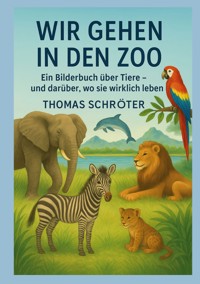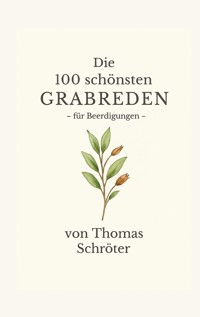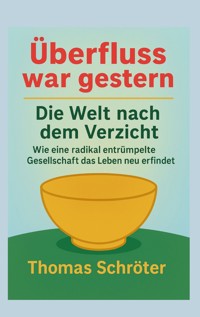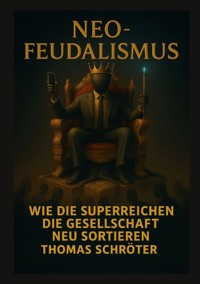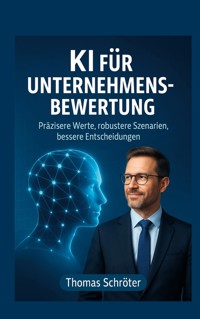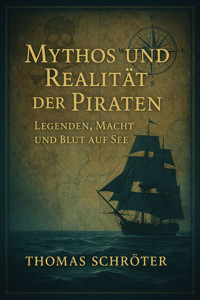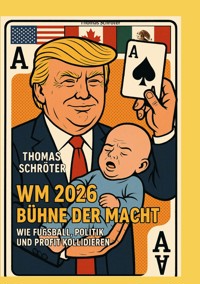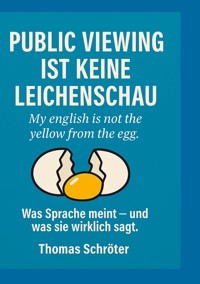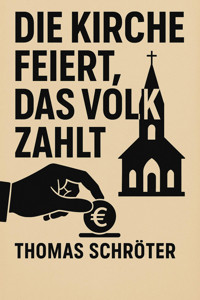
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Warum bestimmt eine religiöse Minderheit über die Feiertage einer zunehmend säkularen Gesellschaft? Dieses Buch stellt eine radikale Frage: Wem gehört die Zeit? Während immer weniger Menschen Mitglieder der Kirchen sind, bleiben deren Feiertage politisch und wirtschaftlich unangetastet – vom Karfreitag bis zu Allerheiligen. In Die Kirche feiert, das Volk zahlt analysiert Thomas Schröter, wie tief die Verflechtung von Religion, Staat und Arbeitszeit reicht. Mit historischen Fakten, gesellschaftlichen Stimmen und visionären Ideen fordert das Buch eine neue Zeitordnung – demokratisch, inklusiv, gerecht. Es zeigt auf, wie Feiertage reformiert werden können, ohne Tradition zu zerstören, und entwirft eine Zukunft, in der kollektive Pausen nicht länger einem Glauben gehören, sondern der gesamten Gesellschaft. Provokant, fundiert und notwendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Kirche feiert, das Volk zahlt
Ein Aufruf zur Entkirchlichung
unserer Feiertagskultur
geschrieben von
Thomas Schröter
Rechtlicher Hinweis
Alle Personen und Handlungen in diesem Werk sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie existierenden Organisationen, Orten oder Begebenheiten ist rein zufällig und unbeabsichtigt.
Dieses Werk ist ein Produkt der Fiktion. Es dient ausschließlich der Unterhaltung und Information und stellt keine Form der Rechtsberatung, medizinischen Beratung, psychologischen Beratung oder einer anderen professionellen Beratung dar. Die in diesem Buch dargestellten Technologien, wissenschaftlichen Konzepte oder gesellschaftlichen Entwicklungen sind spekulativ und dienen der Erzählung.
Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der in diesem Werk enthaltenen Informationen entstehen könnten.
Vorwort
Deutschland ist ein Land voller Feiertage – aber wer feiert da eigentlich noch, und aus welchem Grund? Diese Frage drängte sich mir auf, als ich an einem sonnigen Fronleichnam durch menschenleere Straßen schlenderte. Die Läden geschlossen, die Arbeitswelt stillgelegt, der Alltag auf Pause gestellt – wegen eines katholischen Feiertags, den viele nicht mehr kennen, geschweige denn verstehen. Und doch gilt er für Millionen von Menschen – unabhängig davon, ob sie an die Realpräsenz Christi glauben oder nicht. Was wie eine unscheinbare Selbstverständlichkeit erscheint, offenbart bei genauerem Hinsehen eine tiefgreifende strukturelle Schieflage im Verhältnis von Staat, Religion und Gesellschaft.
Dieses Buch ist kein Angriff auf den Glauben. Es ist auch keine Polemik gegen Spiritualität oder religiöse Praxis. Vielmehr ist es eine Auseinandersetzung mit der Frage: Wie neutral ist ein Staat, der seine gesetzliche Zeitordnung an die Festkalender zweier Kirchen koppelt, denen längst weniger als die Hälfte der Bevölkerung angehört?Denn das religiöse Deutschland der Vergangenheit ist ein pluralistisches Deutschland der Gegenwart geworden – und doch hängt unser Feiertagskalender weiterhin am Tropf des Christentums. Mit jeder Sonntagsruhe, mit jeder Feiertagsregelung, mit jeder liturgischen Ausnahme wird ein Erbe konserviert, das längst nicht mehr die gelebte Wirklichkeit vieler Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt.
Was bedeutet es, wenn in Berlin der Reformationstag verpflichtend ist, aber kaum jemand weiß, was genau am 31. Oktober eigentlich gefeiert wird? Warum ist der Karfreitag ein stiller Feiertag, während andere weltanschauliche oder kulturelle Gedenktage keinerlei gesetzliche Anerkennung finden? Und was sagt es über unsere Demokratie aus, wenn muslimische, jüdische, säkulare oder agnostische Lebensrealitäten kalenderrechtlich schlicht ignoriert werden?
Dieses Buch will aufrütteln. Es will infrage stellen, was lange als selbstverständlich galt. Es will bewusst provozieren – nicht, um zu verletzen, sondern um zum Denken anzuregen. Feiertage sind keine bloßen Ruhetage. Sie sind politische, soziale und kulturelle Marker einer Gesellschaft. Sie zeigen, was wir für schützenswert halten, wofür wir innehalten und worauf wir stolz sind. Und genau deshalb gehört der Feiertagskalender in den Fokus gesellschaftlicher Debatte – nicht als heiliges Relikt, sondern als demokratische Gestaltungsaufgabe.
Wenn die Kirche feiert und das Volk zahlt, dann ist es Zeit, neu zu fragen: Wer sind wir heute – und wie wollen wir gemeinsam leben?Mögen die kommenden Seiten nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Mitgestalten anregen.
Thomas SchröterAalen, im Juni 2025
Kapitel 1 – Was ist ein Feiertag?
Ein Feiertag ist mehr als nur ein arbeitsfreier Tag. Er ist ein gesellschaftliches Signal. Ein Zeichen, das in unsere Kalender eingeschrieben ist und gleichzeitig tief in unser kulturelles Selbstverständnis eingreift. Feiertage ordnen das Jahr, strukturieren den Alltag, schaffen Pausen, markieren Rituale – und stiften damit Gemeinschaft oder grenzen aus. Doch so alltäglich sie erscheinen, so politisch sind sie in ihrer Funktion.
Die rechtliche Definition eines Feiertags ist zunächst unspektakulär. In Deutschland sind Feiertage staatlich festgelegte Tage, an denen bestimmte gesetzliche Regelungen gelten – insbesondere in Bezug auf Arbeit, Lärm, Veranstaltungen und Ladenöffnungszeiten. Ihre Wirkung ist jedoch alles andere als neutral: Feiertage heben Tage aus dem Fluss der Woche heraus, erklären sie zu besonderen Momenten. Das hat Folgen – für das Zusammenleben, für die Wirtschaft, für das religiöse und kulturelle Selbstverständnis eines Landes.
In der Bundesrepublik Deutschland sind Feiertage – mit Ausnahme des 1. Mai (Tag der Arbeit) und des 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) – Ländersache. Das bedeutet: Jedes Bundesland legt selbst fest, welche Tage als gesetzliche Feiertage gelten. Diese föderale Ordnung führt zu einer regional höchst unterschiedlichen Feiertagslandschaft. Während man in Bayern und Baden-Württemberg an bis zu 13 Feiertagen pro Jahr nicht arbeiten muss, sind es in Berlin nur 10. Doch trotz dieser Unterschiede zeigt sich ein klares Muster: Die allermeisten gesetzlichen Feiertage in Deutschland sind christlich geprägt – und nicht nur das: Viele stammen aus kirchlicher Tradition, mit teils sehr spezifisch konfessionellen Ursprüngen.
Doch was genau meint man, wenn man sagt, ein Tag sei ein „Feiertag“? Der Begriff an sich suggeriert eine allgemeine Feierlichkeit – doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Viele Feiertage sind mit religiösen Dogmen verbunden, deren Inhalte heute nur noch eine Minderheit kennt oder nachvollziehen kann. Die Karfreitagsruhe etwa verbietet Tanzveranstaltungen in fast allen Bundesländern – eine Einschränkung, die sich direkt aus einem christlich-liturgischen Verständnis von „Stille“ ableitet. Für konfessionsfreie Menschen oder Angehörige anderer Religionen bedeutet das: Sie müssen sich an Vorschriften halten, die nicht aus ihrer eigenen Weltanschauung stammen. Und zwar nicht aus Rücksichtnahme, sondern gesetzlich verpflichtend.
Feiertage sind also nicht bloß „freie Tage“. Sie sind Zeichen gesellschaftlicher Wertehierarchien. Wer einen Feiertag gewährt bekommt – und wer nicht –, sagt viel über das Selbstverständnis des Staates und seiner Institutionen. Wer wird gehört? Wessen Glauben wird berücksichtigt? Wessen Erinnerungskultur gilt als schützenswert? Und wessen Lebensweise wird ignoriert?
In einem Land, in dem mehr als 47 % der Menschen keiner Kirche mehr angehören, muss diese Frage neu gestellt werden. Denn während die Kirchen Mitglieder verlieren, behalten ihre Feiertage ihren Sonderstatus. Damit stehen sie sinnbildlich für eine tiefe Asymmetrie: Die Institutionen der Religion verlieren faktisch an gesellschaftlicher Relevanz, doch ihr Einfluss auf Kalender, Zeitordnung und Gesetzgebung bleibt bestehen.
Feiertage sind Ausdruck von Macht – der Macht zu definieren, was als bedeutend gilt. In der Antike waren es Göttertage und Kaisertage. Im Mittelalter ordnete die Kirche den Jahreslauf. Die Reformation schuf ihre eigenen Kalender, ebenso wie später die säkularen Revolutionen. Der Tag der Arbeit entstand aus der Arbeiterbewegung. Der Tag der Deutschen Einheit wurde zur Erinnerung an die Wiedervereinigung gesetzlich verankert. Jeder Feiertag ist damit auch eine Erzählung über das Selbstverständnis eines Gemeinwesens.
Die zentrale Frage dieses Buches lautet also nicht: Welche Feiertage wollen wir streichen?, sondern:Welche Geschichten wollen wir heute – in einer pluralen, säkularen, demokratischen Gesellschaft – erzählen?Und: Wer darf entscheiden, was gefeiert wird – und was nicht?
Ein Feiertag ist nie nur ein freier Tag. Er ist ein Statement. Es ist Zeit, genauer hinzusehen.
Kapitel 2 – Die Wurzeln der deutschen Feiertage
Wenn wir verstehen wollen, warum der deutsche Kalender aussieht, wie er aussieht, müssen wir in die Geschichte blicken. Denn Feiertage sind keine naturgegebenen Erscheinungen. Sie sind historische Konstrukte, oft das Ergebnis von Machtverhältnissen, religiösem Einfluss, sozialen Bewegungen und politischen Entscheidungen. Was heute als „normaler“ Feiertag erscheint, war früher ein Instrument der Kontrolle, der Erziehung oder der Gemeinschaftsbindung – je nach Epoche, Religion und Herrschaftsform.
Die Ursprünge der heutigen deutschen Feiertage reichen bis tief ins Mittelalter zurück – in eine Zeit, in der die Kirche nicht nur die Seelen, sondern auch die Zeit beherrschte. Das Kirchenjahr strukturierte das Leben der Menschen. Es bestimmte nicht nur, wann gefastet oder gebetet wurde, sondern auch, wann gearbeitet werden durfte – oder eben nicht. Schon früh führte die Kirche sogenannte „Festtage“ ein, um das liturgische Gedächtnis der Gläubigen zu stärken. An diesen Tagen ruhte die Arbeit, es wurde gepredigt, gebetet und gefeiert. Das Ziel war eindeutig: Religiöse Disziplin durch zeitliche Ordnung.
Die wichtigsten dieser Feiertage waren Geburt und Tod Christi, Pfingsten, Himmelfahrt, Allerheiligen, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt – Festtage, die teils bis heute gesetzlich geschützt sind. Der Sonntag – ursprünglich der „Tag des Herrn“ – wurde zum Ruhetag erklärt, zunächst kirchlich, später auch staatlich. In der Karolingerzeit wurde das Missachten des Sonntags sogar mit drakonischen Strafen geahndet. Zeit war Heilssache.
Doch die Kirche war nicht die einzige Instanz, die über Feiertage entschied. Auch Landesherren, Fürsten und Monarchen griffen im Laufe der Jahrhunderte in die Zeitordnung ein. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gab es überregionale und lokale Feiertage, die teils politisch motiviert waren – zur Erinnerung an Herrscher, Schlachten oder dynastische Ereignisse. Der Kalender wurde zum Spiegel feudaler Macht.
Mit der Reformation kam Bewegung ins System. Martin Luther sprach sich gegen übermäßige Heiligenverehrung und gegen die Vielzahl an kirchlichen Feiertagen aus. Die evangelischen Kirchen behielten nur eine Auswahl an Hochfesten bei – etwa Weihnachten, Ostern und Pfingsten –, während katholische Regionen weiterhin den vollen Heiligenkalender pflegten. So entstanden die konfessionellen Unterschiede, die wir bis heute in Deutschland sehen: Ein Tag wie Fronleichnam ist in katholischen Bundesländern ein Feiertag, in evangelischen jedoch nicht. Umgekehrt ist der Reformationstag nur in evangelisch geprägten Ländern ein gesetzlicher Feiertag.