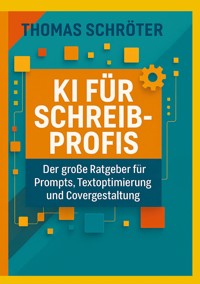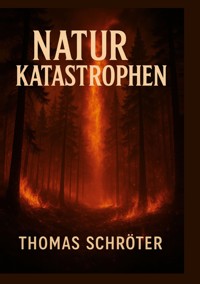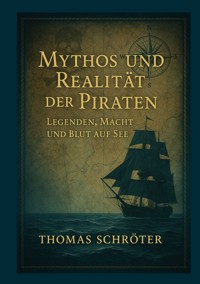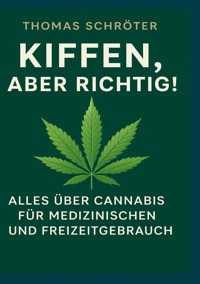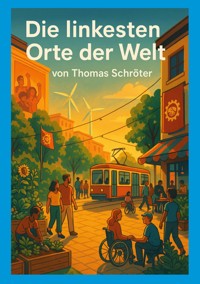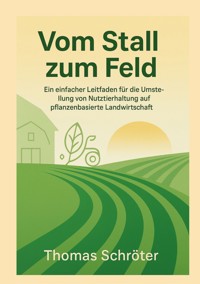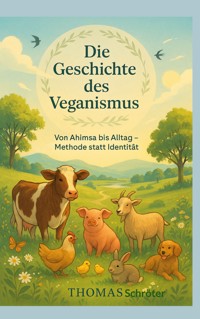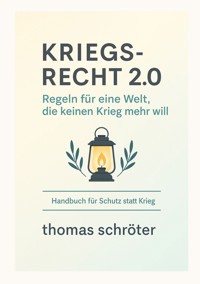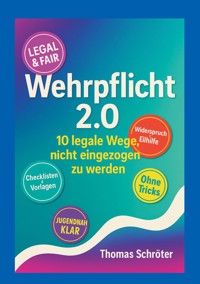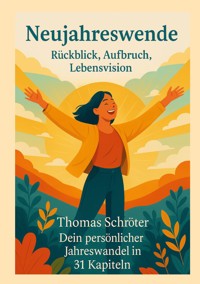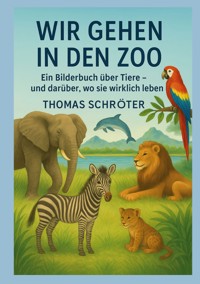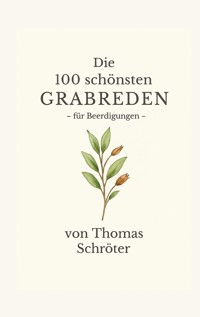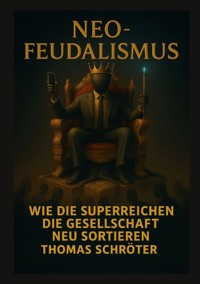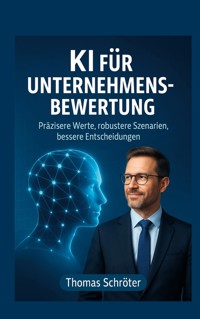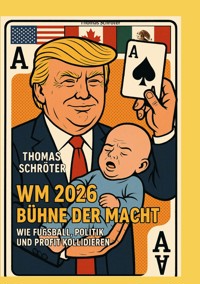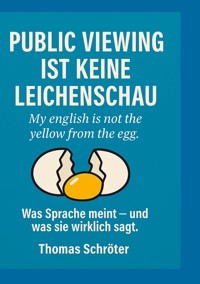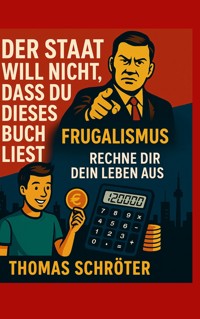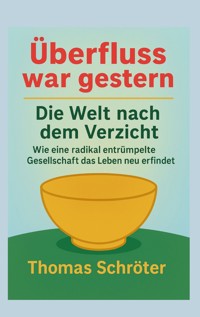
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was bleibt, wenn das Überflüssige verschwindet? In einer Welt, die von Konsum, Geschwindigkeit und ständiger Verfügbarkeit geprägt ist, stellt dieses Buch eine radikale, aber befreiende Frage: Brauchen wir das alles wirklich? Thomas Schröter nimmt die Leser:innen mit auf eine eindrucksvolle Reise durch eine Zukunft, in der alles Unnötige abgeschafft wurde; vom überflüssigen Besitz bis zur gedankenlosen Verschwendung. Anschaulich und aufrüttelnd beschreibt er, wie EBooks das gedruckte Buch ersetzen, wie Minimalismus, Kreislaufwirtschaft und Suffizienz unsere Lebensweise verändern und wie ein neues Denken jenseits des Immer-mehr möglich ist. Mit 25 Kapiteln voller konkreter Beispiele, philosophischer Tiefe und alltagsnaher Reflexionen ist dieses Werk ein Weckruf und eine Vision zugleich. Es fordert uns heraus, unsere Gewohnheiten zu überdenken und zeigt, wie wenig wir brauchen, um erfüllt zu leben. Ein Buch für alle, die nicht nur verzichten wollen, sondern gewinnen: Raum, Zeit, Sinn und Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort – Warum weniger mehr ist und weshalb diese Idee unsere Welt retten könnte
Kapitel 1 – Das Zeitalter des Immermehr Vom Mangel zur Maßlosigkeit: Wie wir lernten, das Zuviel zu lieben
Kapitel 2 – Der Preis der Dinge Was wir wirklich zahlen, wenn wir glauben, günstig zu kaufen
Kapitel 3 – Der digitale Schatten Warum nicht alles, was leicht wirkt, auch leicht ist
Kapitel 4 – Besitz macht nicht glücklich – aber abhängig Warum wir Dinge horten, die wir nicht brauchen, und wie wir uns davon befreien können
Kapitel 5 – Die Erziehung zur Verschwendung Wie Schule, Werbung und Gesellschaft das Übermaß normalisierten
Kapitel 6 – Der große Schnitt: Wie alles begann Von der Erkenntnis zur Entscheidung – eine Welt entfernt das Überflüssige
Kapitel 7 – Die stille Revolution Wie der Wandel in der Tiefe begann, lange bevor er sichtbar wurde
Kapitel 8 – Suffizienz statt Substitution Warum es nicht reicht, Dinge einfach zu ersetzen
Kapitel 9 – Von der Werbung zum Dialog Wie sich Märkte verändern, wenn Menschen beginnen, selbst zu denken.
Kapitel 10 – Was wir zurücklassen Eine stille Liste der Dinge, die wir nicht mehr brauchen
Kapitel 11 – Wohnen neu gedacht Die Rückeroberung des Raumes als Lebensraum
Kapitel 12 – Ernährung ohne Abfall Wie unser Essen nachhaltiger wurde, weil wir aufhörten, gedankenlos zu konsumieren
Kapitel 13 – Mode mit Würde Wie Kleidung wieder Ausdruck von Persönlichkeit wurde – nicht von Verschwendung
Kapitel 14 – Lernen ohne Last Wie Bildung leichter wurde, als wir begannen, das Wesentliche zu lehren
Kapitel 15 – Kinder ohne Plastik Warum die nächste Generation nicht mehr mit Dingen aufwachsen muss, die morgen schon Müll sind
Kapitel 16 – Mobilität in Bewegung Warum der Weg wichtiger wurde als das Fahrzeug
Kapitel 17 – Arbeit, Besitz und Einkommen im neuen System Wie sich unser Verhältnis zu Leistung veränderte, als wir aufhörten, Dinge um ihrer selbst willen zu produzieren
Kapitel 18 – Der geopolitische Blick Warum unser Überfluss nicht nur ein individuelles, sondern ein globales Problem ist
Kapitel 19 – Das Ende des Wegwerfzeitalters Wie Reparatur, Langlebigkeit und Wiederverwendung eine neue Kultur schufen
Kapitel 20 – Digitale Räume statt physische Lasten Wie sich Kultur, Bildung und Kommunikation vom Materiellen emanzipierten
Kapitel 21 – Die neuen Generationen: Aufgewachsen ohne Überfluss
Kapitel 22 – Die stille Revolution der Räume
Kapitel 23 – Der neue Luxus: Zeit, Ruhe und Bedeutung
Kapitel 24 – Die Welt nach dem Überfluss: Ein Blick in die Zukunft
Kapitel 25 – Eine Welt der Möglichkeiten: Das Ende des Überflüssigen ist der Anfang von Sinn
Nachwort
Anhang 1 – Übersicht: Was ist überflüssig geworden?
Anhang 2 – Begriffserklärungen: Orientierung im Denken einer neuen Zeit
Anhang 3 – Zehn Impulse für ein Leben mit weniger Überfluss
Vorwort – Warum weniger mehr ist und weshalb diese Idee unsere Welt retten könnte
Es beginnt mit einem Gefühl. Nicht mit einem Gesetz, nicht mit einem Skandal, nicht mit einem neuen Produkt, sondern mit einem dumpfen, unangenehmen Gefühl – als würde man in einem Raum stehen, der immer enger wird, obwohl niemand ihn betritt. Ein Schrank, der sich nicht mehr schließen lässt. Ein Kalender, der keinen freien Tag mehr kennt. Eine Wohnung, vollgestellt mit Dingen, die einst Freude versprachen und heute bloß Raum kosten. Ein Leben, das immer schneller wird, obwohl wir längst außer Atem sind.
Es ist das Gefühl des Zuviels.
Wir leben in einer Welt, in der es von allem zu viel gibt – zu viel Auswahl, zu viel Werbung, zu viel Besitz, zu viel Abfall. Die Straßen sind verstopft von Autos, die Supermärkte überfüllt mit Verpackungen, die Cloud-Server kollabieren fast unter der Last von Fotos, Serien und Dokumenten, die niemand mehr ansieht. Und doch kaufen wir weiter. Bestellen, sammeln, sichern, speichern – als wollten wir ein Loch in uns selbst stopfen, das längst nicht mehr mit Dingen zu füllen ist.
Der Überfluss hat sich als Mangel getarnt.
Ein Mangel an Ruhe, Tiefe, Klarheit. Ein Mangel an Sinn.
Dabei ist das Wissen längst da. Wir wissen, dass für jedes bedruckte Buch Bäume gefällt werden, dass Verpackungen aus Plastik jahrhundertelang in den Ozeanen treiben, dass Kleidung für ein paar Euro oft mit Ausbeutung bezahlt wird. Wir wissen, dass diese Art zu leben nicht nur uns selbst, sondern den gesamten Planeten überfordert – ökologisch, sozial, psychisch. Und doch fällt es schwer, etwas zu ändern. Denn Konsum ist mehr als Einkauf – er ist Kultur, Gewohnheit, Identität. Er ist Teil unseres Denkens geworden. Aber: genau dieses Denken lässt sich verändern. Und dieser Wandel beginnt nicht in der Politik, nicht in der Industrie, sondern in unserem Blick auf das, was wir wirklich brauchen.
Dieses Buch ist eine Einladung zum Blickwechsel.
Es stellt die Frage: Was wäre, wenn wir alles Überflüssige weglassen?
Nicht aus Askese. Nicht aus Strenge. Sondern aus Klarheit.
Was bleibt, wenn das Übermaß verschwindet? Was entsteht, wenn Räume leer, Kalender frei und Konsum leise werden?
Du wirst in diesem Buch keine Dogmen finden. Kein moralisches Zwingen, keine Weltflucht, keine Utopie in Pastell. Sondern Gedanken, Geschichten, Analysen – und eine Spur Hoffnung.
Hoffnung, dass wir nicht mehr besitzen müssen, um mehr zu sein. Hoffnung, dass die Welt nicht untergeht, wenn wir verzichten, sondern vielleicht zum ersten Mal zu atmen beginnt.
Denn am Ende geht es nicht nur darum, Produkte zu ersetzen oder Dinge zu entrümpeln. Es geht darum, neu zu denken. Anders zu leben. Und vielleicht – zum ersten Mal – bewusst zu wählen, was wir nicht mehr brauchen.
Willkommen in einer Welt nach dem Überfluss.
Sie beginnt nicht irgendwann.
Sie beginnt hier. Jetzt. In dir.
Thomas Schröter
Kapitel 1 – Das Zeitalter des Immermehr
Vom Mangel zur Maßlosigkeit: Wie wir lernten, das Zuviel zu lieben
Es gab eine Zeit, in der Besitz mit Überleben gleichgesetzt wurde. Ein Paar Schuhe, ein Sack Mehl, ein zweites Hemd – das waren keine Annehmlichkeiten, sondern Lebensversicherung. Die Generationen, die Krieg, Hunger und Mangel erlebten, entwickelten ein tiefes, existenzielles Verhältnis zu Dingen. Sie sammelten, bewahrten, flickten. Sie hielten an dem fest, was war, weil nichts sicher war. Besitz war Stabilität.
Doch irgendwann drehte sich etwas. Aus dem Überleben wurde Überfluss. Und aus der Sorge ums Morgen wurde das Streben nach Mehr.
Die Nachkriegsjahre schufen das Fundament einer neuen Welt. Fabriken, die einst Waffen herstellten, produzierten Kühlschränke. Statt Bomben regneten nun Konsumgüter vom Himmel der Werbeplakate. Die Wirtschaft wurde zum Motor des Wohlstands, und Wachstum war das Dogma, dem sich alles unterordnete. Kaufen bedeutete: dazugehören. Wer konsumierte, war Teil des Fortschritts.
Konsum wurde zur Sprache der Zugehörigkeit.
Mit dem Wirtschaftswunder in Deutschland, dem American Dream in den USA und dem Wiederaufbau weltweit entstand nicht nur eine neue materielle Realität, sondern auch eine neue Vorstellung davon, was ein „gutes Leben“ ist: ein Eigenheim mit Garage, ein Fernseher, ein Auto, ein Kleiderschrank für jede Jahreszeit. Besitz wurde nicht mehr nur praktischer Nutzen – er wurde Ausdruck von Identität, sozialem Aufstieg, Selbstverwirklichung.
Doch während Generationen damit beschäftigt waren, sich das zu leisten, was ihre Eltern nie hatten, begannen Konzerne, Medien und Marketingexperten, einen simplen, aber radikalen Gedanken zu verbreiten: Nicht das Notwendige ist erstrebenswert – sondern das Neue.
Die Geburt des Immermehr
In den 1950er- und 1960er-Jahren veränderte sich das Verhältnis zu Dingen fundamental. Produkte wurden nicht mehr gebaut, um zu halten, sondern um ersetzt zu werden. Die sogenannte geplante Obsoleszenz – die absichtliche Begrenzung der Lebensdauer eines Produkts – wurde salonfähig. Ein Staubsauger, der 30 Jahre funktionierte, war plötzlich kein Qualitätsmerkmal mehr, sondern ein wirtschaftliches Problem. Gleichzeitig professionalisierte sich die Werbeindustrie. Sie versprach nicht länger nur praktische Lösungen, sondern emotionale Erfüllung: Das richtige Parfüm versprach Liebe. Das richtige Auto Anerkennung. Die richtige Zahnpasta Erfolg. In einem System, das Wachstum braucht, muss jeder Mensch sich als unvollständig fühlen – und glauben, dass das nächste Produkt diese Leerstelle füllt.
Was einst als Mittel zum Zweck diente, wurde Selbstzweck. Niemand brauchte zehn Jeans – aber es fühlte sich gut an, sie zu besitzen. Niemand musste jedes Jahr ein neues Handy – aber es schien modern, es zu wechseln. Der Besitz wurde zur Bewegung, das Kaufen zur Freizeitbeschäftigung.
Wir hörten auf zu fragen, was wir wirklich brauchten.
Stattdessen fragten wir: Was ist gerade angesagt?
Die unsichtbaren Kosten des Mehr
Doch das Immermehr hatte einen Preis – auch wenn er auf dem Kassenzettel nicht zu finden war. Es war der Preis der Rohstoffe, der Energie, der Arbeitskraft. Der Preis der Umweltzerstörung, des Mülls, der sozialen Ungleichheit.
Für all die Dinge, die in Regalen lagen, in Schubladen verschwanden oder nach wenigen Wochen kaputtgingen, wurden Wälder gerodet, Flüsse verschmutzt, Menschen unterbezahlt.
Ein einziges Smartphone enthält rund 60 verschiedene Metalle, darunter seltene Erden, die unter oft menschenunwürdigen Bedingungen in Ländern wie Kongo oder China abgebaut werden. Die Herstellung eines T-Shirts benötigt rund 2.700 Liter Wasser – so viel, wie ein Mensch in zweieinhalb Jahren trinkt. Jedes Jahr werden weltweit rund 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert – viele davon landen nie im Verkauf, sondern direkt im Müll.
Der Überfluss war nie kostenlos – wir haben nur nie gelernt, richtig zu rechnen.
Der psychologische Wandel
Doch warum fiel es so leicht, so viel zu wollen?
Die Antwort liegt in unserem Innersten.
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er vergleicht sich, ordnet sich ein, definiert sich über andere. In einer Welt, die Individualität predigt, aber Vergleichbarkeit belohnt, wird Besitz zur Bühne. Wer das neuste Gerät besitzt, zeigt, dass er mithalten kann. Wer viel hat, gilt als erfolgreich – selbst wenn das „Viel“ keinen realen Nutzen mehr bringt.
Konsum wurde zur Religion der Moderne: Er verspricht Erlösung, Gemeinschaft, Identität. Und wie jede Religion kennt er Rituale (Black Friday), Heilige (Marken), Sünden (Verzicht) und Dogmen (Wachstum um jeden Preis). Er bietet Halt in einer Welt, die sich ständig wandelt.
Doch diese Religion beginnt zu wanken. Denn die Versprechen erfüllen sich nicht mehr. Dinge machen nicht glücklicher, nicht ruhiger, nicht freier. Sie machen abhängig, gestresst, orientierungslos. Die Leere, die sie füllen sollen, bleibt bestehen – oder wird größer.
Was, wenn es anders geht?
Immer mehr Menschen stellen sich eine andere Frage: Was brauche ich wirklich? Nicht: Was kann ich mir leisten? Nicht: Was haben die anderen? Nicht: Was ist neu?
Sondern: Was ist wesentlich?
Es ist eine stille Frage. Eine, die man sich nicht laut stellt in der Fußgängerzone. Aber sie breitet sich aus – in Wohnzimmern, in Freundeskreisen, in Gedanken. Es ist die erste Frage, die sich stellt, wenn man beginnt, Dinge loszulassen.
Dieses Kapitel war der Blick zurück. Die Diagnose einer Krankheit, die sich lange nicht so nannte.
Doch nun beginnt etwas Neues. Nicht als Verzicht, sondern als Befreiung. Nicht als Rückzug, sondern als Neuanfang.
Denn manchmal zeigt sich Fortschritt nicht im Mehr – sondern in der Kunst, das Überflüssige gehen zu lassen.
Kapitel 2 – Der Preis der Dinge
Was wir wirklich zahlen, wenn wir glauben, günstig zu kaufen
Ein T-Shirt für fünf Euro. Ein Buch für achtzig Cent im Online-Deal. Ein dreiteiliges Küchenmesser-Set, eingeschweißt in Plastik, für weniger als eine warme Mahlzeit. Die Moderne hat es geschafft, Dinge in Massen zu produzieren und dabei den Eindruck zu erwecken, sie seien beinahe kostenlos. Aber das ist eine Illusion. Die wahren Kosten des Konsums stehen nicht auf dem Preisschild. Sie sind unsichtbar, verteilt über globale Lieferketten, ausgelagert in Böden, Luftschichten, Flüsse und fremde Leben.
Jeder Gegenstand, den wir besitzen, erzählt eine Geschichte. Nicht die Geschichte von Werbung oder Design, sondern eine materielle Biografie. Wo kam das Material her, wie wurde es transportiert, unter welchen Bedingungen wurde es verarbeitet, wie lange wird es genutzt, wohin wird es danach entsorgt? Die wenigsten Menschen stellen sich diese Fragen. Doch wer sie stellt, erkennt: Nichts ist wirklich billig. Nur die Rechnung wird oft anderen gestellt – der Umwelt, den zukünftigen Generationen, jenen Menschen, die keine Stimme haben in der globalen Produktionskette.
Nehmen wir das Beispiel des Buches. Ein Symbol der Bildung, des Wissens, der