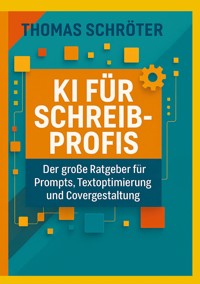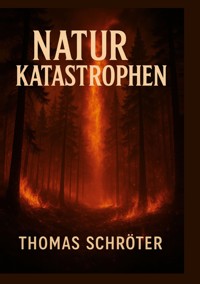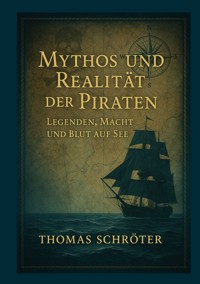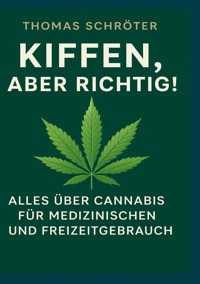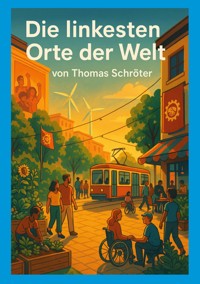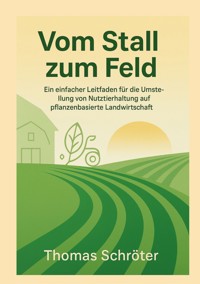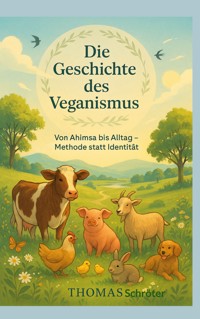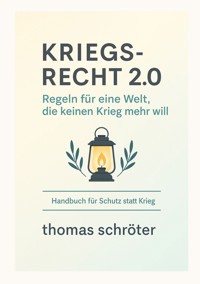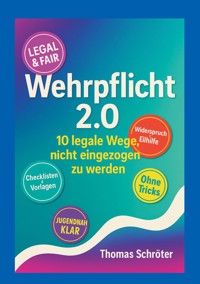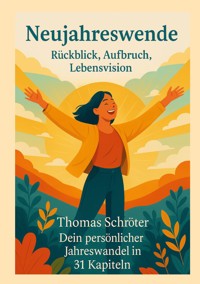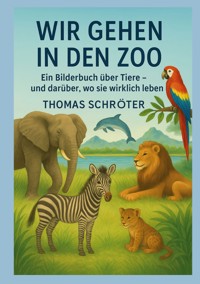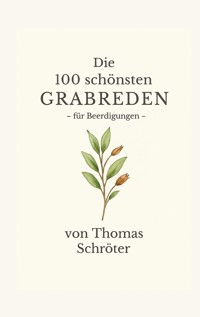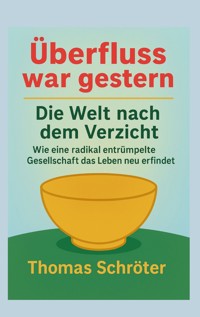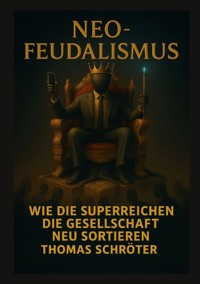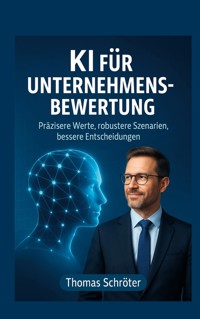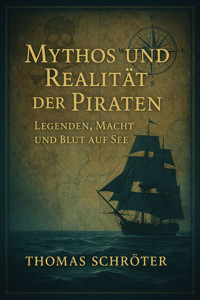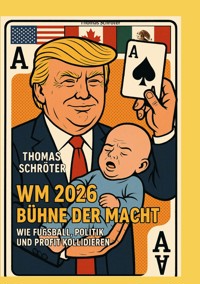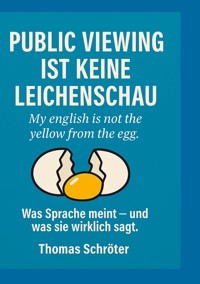
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Public Viewing ist keine Leichenschau, My English is not the yellow from the egg ist ein sprachlich verspielter, dabei fundierter Ausflug in die Welt der falschen Freunde, Sprachfallen und Bedeutungsverschiebungen. Das Buch deckt mehr als 50 klassische Stolpersteine zwischen Deutsch, Englisch, Französisch und Latein auf, mit anschaulichen Beispielen, historischen Hintergründen und kulturgeschichtlichen Einordnungen. Ob Chef, Beamer, Sympathy oder Smoking, wer hier liest, versteht nicht nur seine eigenen Sprachfehler besser, sondern lernt dabei auch eine Menge über die Eigenheiten, Entwicklungen und Abwege von Sprache. Ideal für: Schüler:innen ab 12 Jahren beim Einstieg in Fremdsprachen Übersetzer:innen und Sprachlehrkräfte Texter:innen, Werbeprofis und Dolmetscher:innen Sprachliebhaber, Sprachwissenschaftler, Eltern und Weltreisende Mit umfassendem Glossar, Zeitleiste und Vergleichstabellen und einer klaren Botschaft: Sprache ist lebendig, lustig, lernenswert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung – Falsche Freunde, echte Missverständnisse
Kapitel 1: Gift – Wenn das Geschenk tödlich ist
Kapitel 2: Chef – Wer ist hier der Boss?
Kapitel 3: Handy – Eine deutsche Worterfindung mit globaler Verwechslungsgefahr
Kapitel 4: Brav – Vom artigen Kind zum mutigen Helden
Kapitel 5: Kurios – Wenn Neugier seltsam wird
Kapitel 6: Eventuell – Warum „eventually“ so viel später kommt als gedacht.
Kapitel 7: Sympathisch – Warum „sympathetic“ nicht dasselbe meint
Kapitel 8: Sensibel – Der feine Unterschied zwischen Gefühl und Vernunft
Kapitel 9: Bekommen – Warum „to become“ nicht das ist, was es scheint
Kapitel 10: Rente und Rent – Wenn Ruhestand plötzlich teuer wird
Kapitel 11: Oldtimer – Der alte Mensch auf vier Rädern
Kapitel 12: Public Viewing – Wenn der öffentliche Leichnam zum Fußballabend wird
Kapitel 13: Ordinär – Vom Ordnungsgemäßen zum Anstößigen
Kapitel 14: Sensibel vs. sensible – Zwischen Empfindung und Einsicht
Kapitel 15: Empathie – Ein Wort auf Wanderschaft
Kapitel 16: Brief – Vom Kurztext zur Lebensnachricht
Kapitel 17: Aktuell und actual – Was gerade und was wirklich ist
Kapitel 18: Sympathy – Der Kummer der englischen Sprache
Kapitel 19: Konkurs und concourse – Vom Bankrott zur Bahnhofshalle
Kapitel 20: Tablett und tablet – Servierhilfe oder Smartgerät?
Kapitel 21: Smoking – Der deutsche Frack in englischer Übersetzung
Kapitel 22: Beamer – Wenn Projektoren Autos heißen
Kapitel 23: Chefetage – Führungsetage und Küchenleitung
Kapitel 24: Prospekt und prospect – Werbung oder Aussicht?
Kapitel 25: Präservativ und preservative – Verhütung oder Konservierung?
Kapitel 26: Salmonellen – Warum der Lachs nichts dafür kann
Kapitel 27: Legionellen – Ein Hotel, ein Treffen, eine Epidemie
Kapitel 28: Alzheimer – Die Geschichte hinter dem Vergessen
Kapitel 29: Parkinson – Der Arzt, der das Zittern benannte
Kapitel 30: Morbus Crohn – Die Krankheit eines Namens
Kapitel 31: Guillain Barré – Zwei Ärzte, ein Weltkrieg, eine Lähmung
Kapitel 32: Listerien – Antiseptik trifft Lebensmittelgefahr
Kapitel 33: Borrellien – Zecken, Forschung und amerikanische Städte
Kapitel 34: Asperger – Ein diagnostischer Name unter Kritik
Kapitel 35: Ebola – Die Geografie eines Virus
Kapitel 36: Kaiserschnitt – Der Mythos vom römischen Ursprung
Kapitel 37: Caesarean – Die lateinische Wurzel im modernen Krankenhaus
Kapitel 38: Sandwich – Der Adelige, der nicht essen wollte
Kapitel 39: Fabrik und fabric – Wo Dinge entstehen und andere zerreißen
Kapitel 40: Gymnasium und gym – Bildung versus Bewegung
Kapitel 41: Chefkoch und head chef – Der Spagat zwischen Sprache und Hierarchie
Kapitel 42: Smoking und Tuxedo – Wenn Kleidung übersetzt wird
Kapitel 43: Bald und bald – Haarausfall oder baldiges Erscheinen?
Kapitel 44: Falsche Freunde im Bewerbungsgespräch
Kapitel 45: Reise durch ein sprachliches Minenfeld
Kapitel 46: Peinliche Missverständnisse aus Presse, Politik und Werbung
Kapitel 47: Denglisch in der Werbung – Absurd oder genial?
Kapitel 48: Übersetzungsfehler mit Folgen – Berühmte Beispiele
Kapitel 49: Wie KI falsche Freunde erkennt – oder selbst erschafft
Anhang
Kapitel 50: Glossar der 100 wichtigsten falschen Freunde
Anhang
Kapitel 51: Zeitleiste – Bedeutungswandel in der Sprachgeschichte
Einleitung – Falsche Freunde, echte Missverständnisse
Sprache ist ein faszinierendes System: Sie verbindet Menschen, formt Gedanken und prägt unsere Sicht auf die Welt. Doch genau darin liegt auch ihre Tücke. Denn Sprache ist kein festes, universales System. Sie ist lebendig, dehnbar, unzuverlässig – vor allem dort, wo sich Sprachen begegnen. Und genau an dieser Grenze entstehen sie: die falschen Freunde.
Falsche Freunde sind Wörter, die in zwei Sprachen gleich oder ähnlich aussehen, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Sie verführen durch vertrauten Klang oder Schreibweise – und führen dann in die Irre. Wer etwa glaubt, das englische „gift“ sei ein deutsches „Gift“, verschenkt im schlimmsten Fall etwas Tödliches. Wer denkt, ein „Chef“ sei ein „Koch“, steht beim Bewerbungsgespräch schnell auf dem sprachlichen Schlauch.
Solche sprachlichen Fallen wirken auf den ersten Blick wie harmlose Stolpersteine im Lernprozess. Doch sie sind mehr als das: Sie sind Fenster in die Geschichte der Wörter, in den Wandel von Bedeutungen und in die kulturelle Logik von Kommunikation. Jedes dieser Wörter trägt eine Geschichte in sich – manchmal eine medizinische Tragödie, manchmal ein kolonialer Schatten, manchmal eine kleine linguistische Ironie.
Dieses Buch lädt dich ein, diesen Geschichten nachzugehen. Es untersucht über 40 Wörter, die wir zu kennen glauben – und die uns dennoch täuschen. Manche sind klassische Schulbuchbeispiele wie „sympathetic“ oder „sensible“. Andere stammen aus dem Bereich der Medizin und Wissenschaft, wie „Salmonellen“ oder „Morbus Crohn“. Und wieder andere entlarven den Alltag: das „Handy“, das „Smoking“, das „Public Viewing“.
Dabei geht es nicht nur um Korrektheit, sondern um Verständnis für Sprache als Prozess: Wie entstehen Bedeutungsverschiebungen? Warum entwickeln sich gleiche Wörter in verschiedenen Sprachen so unterschiedlich? Und wie sehr beeinflussen Gesellschaft, Technik und Kultur das, was wir mit einem Wort verbinden?
Die Kapitel sind so aufgebaut, dass sie einzeln lesbar, aber auch aufeinander aufbauend sind. Jedes Wort steht im Zentrum eines Kapitels, wird etymologisch untersucht, historisch eingeordnet und mit Beispielen aus dem Alltag illustriert. Du wirst erleben, wie Wörter wandern, sich verwandeln und mitunter ganze Kulturen in sich tragen.
Dieses Buch ist keine trockene Sprachkunde, sondern eine Reise durch den Sprachraum zwischen Missverständnis und Aha-Erlebnis. Es richtet sich an alle, die Sprache nicht nur benutzen, sondern verstehen wollen: Übersetzer:innen, Sprachlernende, Lehrer:innen, Wortliebhaber:innen – und all jene, die schon einmal auf die Nase gefallen sind, weil ein Wort nicht das war, was es zu sein schien.
Denn Worte täuschen – aber in dieser Täuschung steckt oft die tiefste Wahrheit über unsere Welt.
Teil I: Verhängnisvolle Ähnlichkeit – Falsche Freunde im Alltag
Kapitel 2: Chef – Wer ist hier der Boss?
Wenn Deutsche im englischsprachigen Raum sagen, dass sie „für einen Chef gearbeitet haben“, kann das zu einem irritierten Lächeln führen – oder sogar zu einem grundlegend falschen Bild ihrer beruflichen Laufbahn. Denn das Wort „Chef“ bedeutet im Englischen etwas völlig anderes als im Deutschen. Während im Deutschen der Chef die höchste Instanz im Unternehmen oder die direkte Führungskraft bezeichnet, denkt man im Englischen bei chef vor allem an eines: Kochmütze, Schürze und Küche.
Ein klassischer falscher Freund also – doch wie kam es dazu, dass sich die Bedeutungen so stark auseinanderentwickelten? Die Antwort liegt in der sprachlichen Migration eines französischen Wortes – und in der gesellschaftlichen Differenzierung zwischen Küche und Büro.
Ursprung: Das französische „chef“
Das Wort „Chef“ stammt ursprünglich vom französischen „chef“, das seinerseits auf das lateinische „caput“ (Kopf) zurückgeht. Im Französischen war chef schon im Mittelalter die Bezeichnung für Anführer, Oberhaupt oder Leiter – unabhängig vom Kontext. Das konnte ein Militärführer sein (chef de guerre), ein Kommandant (chef de bataillon) oder der Leiter einer Institution (chef de cabinet).
Auch im Französischen war es also ein generischer Begriff für Autorität und Führungsposition.
Entwicklung im Deutschen
Im Deutschen wurde das Wort „Chef“ gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus dem Französischen übernommen, vor allem im Zusammenhang mit Militär und Verwaltung – wie viele andere französische Lehnwörter in dieser Zeit. In monarchischen und später bürgerlichen Strukturen etablierte sich Chef als Bezeichnung für denjenigen, der das Sagen hatte, vor allem im beruflichen Kontext.
Heute ist Chef im Deutschen ein fester Bestandteil der Alltagssprache. Er steht für:
Vorgesetzte im Beruf (z. B.
mein Chef, meine Chefin
)
Unternehmer oder Inhaber einer Firma
informell auch als Synonym für „der Boss“ oder „die Leitung“
Die weibliche Form „Chefin“ ist im Deutschen ebenfalls geläufig – ein Hinweis auf die Flexibilität des Begriffs im modernen Sprachgebrauch.
Entwicklung im Englischen
Im Englischen nahm das Wort „chef“ eine ganz andere Entwicklung. Dort spezialisierte sich der Begriff bereits im 19. Jahrhundert auf den Bereich der Gastronomie – konkret: auf den „chef de cuisine“, also den Küchenchef.
Englisch übernahm zwar das französische chef, beließ es jedoch im kulinarischen Kontext. Der Chef ist dort:
Head chef
: der oberste Koch im Restaurant
Sous chef
: der Stellvertreter
Pastry chef
: für Süßspeisen und Backwaren zuständig
Executive chef
: Gesamtverantwortlicher über mehrere Küchen
Das englische Synonym für den deutschen „Chef“ ist hingegen:
Boss
(allgemein, umgangssprachlich)
Manager
(für leitende Angestellte)
Supervisor
(für direkte Vorgesetzte)
Executive
(für obere Führungskräfte)
CEO, director, head of department
(für spezifische Rollen)
Missverständnisse im Alltag
Die Ähnlichkeit zwischen „Chef“ und chef führt in Gesprächen, Bewerbungen oder Texten oft zu Verwechslungen:
„I was working for a chef.“
→ Klingt im Englischen, als hätte man in einem Restaurant gearbeitet.
„She’s my chef.“
→ Bedeutet auf Englisch nicht: Sie ist meine Chefin, sondern: Sie ist meine Köchin.
Der Ausdruck „head of department“ wäre die korrekte Bezeichnung für eine deutsche „Chefin einer Abteilung“.
Kulinarischer Nebeneffekt: Prestige durch französischen Klang
Kurioserweise wird im Englischen gerade durch den französischen Ursprung des Wortes chef ein gewisser Prestigeeffekt erzeugt. Ein „cook“ ist einfach jemand, der kocht – ein chef dagegen ist ein ausgebildeter, professioneller Koch, meist mit Erfahrung in der gehobenen Gastronomie. Das Wort chef wirkt im Englischen edler, spezialisierter, anspruchsvoller.
Der Begriff hat sich also nicht abgewertet, sondern lediglich semantisch verengt und stilistisch aufgewertet – eine interessante Form der Bedeutungsverschiebung.
Sprachgeschichtlicher Exkurs: Der Boss im Wandel
Der englische Begriff „boss“ hat übrigens einen ganz anderen Ursprung als „Chef“. Er geht zurück auf das niederländische baas, was so viel bedeutet wie „Vorgesetzter“ oder „Meister“. In den frühen Kolonien der Niederlande wurde der Begriff im 17. Jahrhundert auch in englischsprachige Regionen Nordamerikas übernommen – insbesondere, um eine neutralere Bezeichnung für weiße Plantagenleiter zu etablieren, ohne das Wort „master“ zu verwenden.
So entstand im Amerikanischen der heute geläufige Begriff boss, der inzwischen global verwendet wird – auch von vielen Deutschsprachigen in internationalen Firmen.
Fazit
Das Wort „Chef“ zeigt eindrucksvoll, wie ein ursprünglich gemeinsames Wort durch Spezialisierung, Kulturkontakt und semantische Verschiebung zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen entwickeln kann. Im Deutschen blieb „Chef“ eine Führungsfigur – im Englischen wanderte er in die Küche.
Wer also glaubt, er arbeite „für einen Chef“, sollte sich fragen, ob er damit seinen Vorgesetzten meint – oder seinen Küchenmeister. Sprache verlangt nicht nur Präzision, sondern auch ein Bewusstsein für ihre historischen Pfade.
Kapitel 3: Handy – Eine deutsche Worterfindung mit globaler Verwechslungsgefahr
Wohl kein technisches Alltagswort sorgt im internationalen Sprachvergleich für so viel Verwirrung wie das deutsche „Handy“. Was in Deutschland und Österreich als selbstverständliche Bezeichnung für ein Mobiltelefon gilt, wirkt auf Muttersprachler:innen des Englischen zunächst entweder rätselhaft oder schlicht falsch. Denn: Im Englischen gibt es das Wort „Handy“ durchaus – nur bedeutet es dort etwas ganz anderes.
Ein klassischer Fall von „Pseudolehnwort“ – also ein Wort, das nach Fremdsprache klingt, aber nur in der ausleihenden Sprache existiert. In diesem Fall handelt es sich um eine rein deutsche Worterfindung, die weder im britischen noch im amerikanischen Englisch als Bezeichnung für ein Mobiltelefon verwendet wird.
Was heißt „handy“ im Englischen?
Im Englischen ist „handy“ ein Adjektiv mit der Bedeutung:
praktisch
nützlich
leicht erreichbar
geschickt / handwerklich begabt
(
he’s handy with tools
)
Beispiele:
This tool is really handy.
→ „Dieses Werkzeug ist sehr praktisch.“
Keep the phone handy.
→ „Halt das Telefon griffbereit.“
Ein „handy“ im Sinne eines Geräts gibt es jedoch nicht. Wer einem Engländer sagt „I forgot my handy at home“, erntet fragende Blicke. Im Englischen sagt man schlicht:
mobile phone
(britisches Englisch)
cell phone
(amerikanisches Englisch)
oder einfach
phone
Der deutsche Begriff „Handy“ ist in der englischen Welt nicht existent – und wirkt daher wie ein absurder Neologismus, den niemand wirklich einordnen kann.
Wie entstand der Begriff „Handy“ im Deutschen?
Die Herkunft des Wortes „Handy“ im Deutschen ist kurios, aber gut dokumentiert. Als sich Anfang der 1990er Jahre Mobiltelefone langsam durchzusetzen begannen, suchte man in Deutschland nach einer griffigen Bezeichnung für diese neuen Geräte.
Es gab mehrere Einflussfaktoren:
Werbung und Assoziation:
Die Mobiltelefone waren klein, leicht, „handlich“ – also im wahrsten Sinne des Wortes „handy“.
Klangliche Nähe zu englischen Begriffen:
Firmen wie Motorola, Siemens und Bosch verwendeten Modellbezeichnungen wie „Handy-Tel“ oder „HandyTrac“, die eine englisch anmutende Modernität ausstrahlen sollten.
Fehlübersetzung durch Laien oder PR-Leute:
Es wurde angenommen, dass „handy“ im Englischen tatsächlich das Gerät bezeichne – was aber ein Irrtum war. Der Begriff wurde dennoch übernommen und setzte sich durch.
So entstand in Deutschland ein Scheinanglizismus – ein Wort, das aussieht, als stamme es aus dem Englischen, dort aber nie in dieser Weise verwendet wird.
Linguistische Einordnung: Scheinanglizismus
„Handy“ gehört zur Gruppe der sogenannten Scheinanglizismen oder Pseudolehnwörter. Weitere Beispiele im Deutschen sind:
Beamer
→ im Englischen:
projector
Smoking
→ im Englischen:
tuxedo
Public Viewing
→ im Englischen:
Leichenschau
Oldtimer
→ im Englischen:
veteran
oder
classic car
Sie wirken international, sind aber nur in der deutschen Sprache verbreitet – oft durch Werbung, Marketing oder Mediennutzung geprägt. Das Phänomen ist typisch für Sprachräume mit starker anglophoner Beeinflussung, aber zugleich einem Drang zur Eigenkreation.
Einfluss auf andere Sprachen
Interessanterweise wurde „Handy“ nicht in andere Sprachen übernommen, obwohl es sich international durchsetzen könnte – der Begriff ist kurz, leicht merkbar und phonetisch einprägsam. Dennoch behielten andere Sprachen ihre eigenen Lösungen:
Spanisch:
móvil
Französisch:
portable
Italienisch:
cellulare
Japanisch:
keitai
Türkisch:
cep telefonu
Niederländisch:
mobiel
Schwedisch:
mobiltelefon
Nur im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, vereinzelt Schweiz) ist „Handy“ die dominierende Bezeichnung.
Technologiewandel: Vom „Handy“ zum „Smartphone“
Mit dem Aufkommen internetfähiger Telefone ab etwa 2007 (iPhone, Android) wandelte sich auch die Begriffswelt:
Die Geräte wurden nicht nur zum Telefonieren genutzt, sondern auch für E-Mail, Navigation, Musik, Social Media, Banking und mehr.
Im globalen Sprachgebrauch setzte sich daher der Begriff
„Smartphone“
durch – auch im Deutschen.
Und doch: In der Alltagssprache vieler Deutscher lebt das „Handy“ fort – selbst wenn es längst ein Smartphone ist. Besonders bei älteren Generationen ist der Begriff nach wie vor üblich. Der Begriff hat sich also semantisch erweitert, obwohl er technisch überholt scheint.
Fazit
Das deutsche Wort „Handy“ ist ein linguistisches Chamäleon: Es klingt international, ist aber ein nationaler Alleingang. Es zeigt, wie Marketing, Technik und Sprache zusammenspielen – und wie leicht eine Fehlannahme zur Norm werden kann.
Wer im englischsprachigen Ausland von seinem „Handy“ spricht, wird damit kein funktionierendes Kommunikationsgerät bezeichnen – sondern eher ein Missverständnis produzieren. Und gerade deshalb ist es ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Sprache sich selbst erfindet.
Kapitel 4: Brav – Vom artigen Kind zum mutigen Helden
Manche Wörter entfalten ihre ganze Mehrdeutigkeit erst im internationalen Vergleich. Eines dieser Wörter ist das scheinbar harmlose Adjektiv „brav“. In deutschen Kinderbüchern bedeutet es, dass ein Kind sich ruhig, freundlich und gehorsam verhält. Im Englischen jedoch steht das ähnlich klingende Wort „brave“ für etwas ganz anderes: für Mut, Tapferkeit und Furchtlosigkeit. Wer die beiden Begriffe gleichsetzt, verpasst nicht nur die richtige Übersetzung, sondern auch einen Einblick in zwei unterschiedliche Erziehungsbilder und kulturelle Werte.
Das deutsche Wort „brav“ gehört zu jenen Begriffen, deren Bedeutung stark situations- und kontextabhängig ist. Es kann liebevoll oder herablassend gemeint sein, lobend oder auch ironisch. Das englische „brave“ hingegen ist ein eindeutig positives Wort – es beschreibt Menschen, die heldenhaft handeln, sich Gefahren stellen und anderen Mut machen. Dass sich zwei so ähnliche Wörter in zwei europäischen Sprachen so unterschiedlich entwickelt haben, ist kein Zufall, sondern Ausdruck kultureller Prioritäten, gesellschaftlicher Entwicklungen und sprachlicher Evolution.
Die Bedeutung von „brav“ im Deutschen
Im heutigen Hochdeutsch wird „brav“ vor allem in zwei Bedeutungsnuancen verwendet:
als Bezeichnung für ein gut erzogenes oder angepasstes Verhalten, etwa bei Kindern Beispiel: „Sei schön brav, wenn Oma kommt“ Bedeutung: ruhig, gehorsam, folgsam
im Sinne von ordentlich, zuverlässig oder fleißig bei Erwachsenen
Beispiel: „Sie hat brav ihre Aufgaben erledigt“ Bedeutung: pflichtbewusst, korrekt, zuverlässig
Darüber hinaus gibt es auch ironische oder abwertende Kontexte, in denen das Wort benutzt wird:
„Na, du bist ja ein ganz Braver“ kann auch spöttisch gemeint sein
„Die braven Bürger“ beschreibt oft spießige, unkritische oder angepasste Menschen
Der Begriff „brav“ ist also kein starkes Wort, sondern eher ein beschreibendes, oft konservativ konnotiertes Attribut. Es ist mit Gehorsam, Regelbefolgung und sozialer Anpassung verbunden. In der deutschen Sprache ist „brav“ vor allem in der Kindererziehung verwurzelt – als Idealverhalten eines Kindes im Sinne der Erwachsenenwelt.
Die Bedeutung von „brave“ im Englischen
Ganz anders verhält es sich mit dem englischen „brave“. Es ist ein aktives, starkes und emotional aufgeladenes Wort. Wer im Englischen als „brave“ gilt, ist jemand, der sich trotz Angst oder Gefahr entschließt, zu handeln. Mut ist keine passive Eigenschaft, sondern eine bewusste Entscheidung. Beispiele:
„She was very brave during the surgery“
„A brave firefighter rescued the children“
„It takes a brave person to stand up to injustice“
Englische Muttersprachler würden nie ein Kind als „brave“ bezeichnen, nur weil es still sitzt oder artig die Schuhe auszieht. Im Gegenteil: brave Kinder sind diejenigen, die sich trauen, etwas zu sagen, zu tun oder sich gegen etwas zu stellen. Die Bedeutung hat daher eine deutlich aktivere und heroischere Färbung als das deutsche „brav“.
Etymologische Ursprünge
Beide Wörter – „brav“ und „brave“ – haben ihren Ursprung im romanischen Sprachraum. Das französische Wort „brave“ und das italienische „bravo“ haben dieselbe lateinische Wurzel: bravus oder brabus, was im Altlateinischen so viel bedeutete wie „wild“, „wagemutig“ oder auch „tüchtig“.
Im Mittelalter wurden diese Begriffe je nach Region und Sprachentwicklung unterschiedlich verwendet:
Im Italienischen war „bravo“ ursprünglich ein Ausdruck für einen fähigen oder mutigen Mann.
Im Französischen hatte „brave“ zunächst die Bedeutung „tapfer“ oder „edel“.
Im Deutschen wurde das Wort über das Französische und Italienische übernommen, verlor jedoch mit der Zeit seine heroische Komponente und wurde auf Verhaltensnormen reduziert.
Interessanterweise hat das italienische „bravo“ bis heute zwei Bedeutungen behalten: Es kann sowohl „gut gemacht“ heißen als auch „tüchtig“ oder „mutig“ meinen – je nach Kontext.
Kulturelle Hintergründe
Die unterschiedlichen Bedeutungen von „brav“ und „brave“ lassen sich auch kultursoziologisch deuten. In der deutschen Erziehungstradition, besonders im 19. und 20. Jahrhundert, war Gehorsam eine zentrale Tugend. Kinder sollten angepasst, ordentlich und unauffällig sein. Das Wort „brav“ wurde so zu einem Ausdruck des sozial erwünschten Verhaltens, nicht des persönlichen Mutes.
Im angloamerikanischen Raum dagegen wird der Mut zur Individualität stärker betont. Wer „brave“ ist, zeigt Haltung, verteidigt Werte, steht für etwas ein – auch gegen Widerstand. In vielen Kinderbüchern oder Filmen aus dem englischen Sprachraum ist der tapfere Junge oder das mutige Mädchen eine wiederkehrende Figur. Der Begriff ist positiv besetzt und Teil eines idealisierten Persönlichkeitsbildes.
Typische Missverständnisse
Gerade im Kontext von Übersetzungen kann das Wortpaar „brav“ und „brave“ zu völlig falschen Bildern führen. Ein deutscher Satz wie „Sie war ein braves Mädchen“ wird im Englischen leicht zu „She was a brave girl“, was im Zieltext jedoch völlig andere Vorstellungen auslöst. Statt eines folgsamen Mädchens sieht man nun eine Heldin.