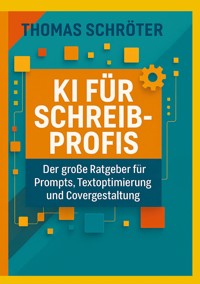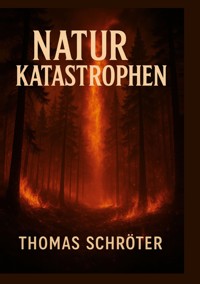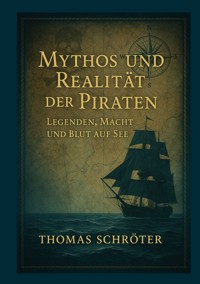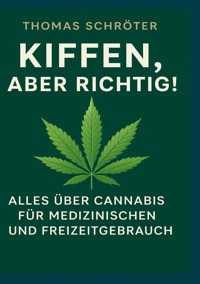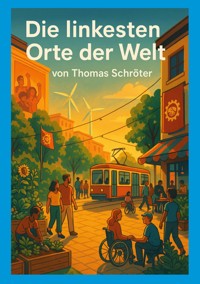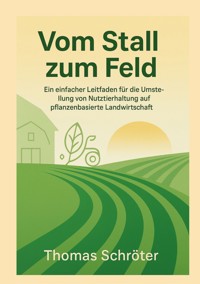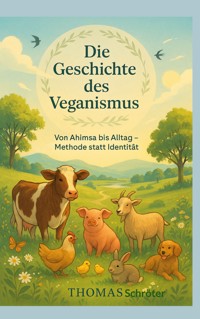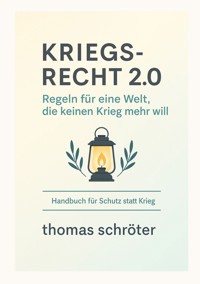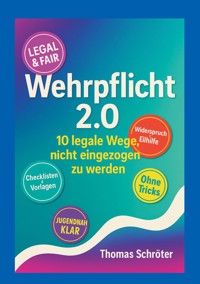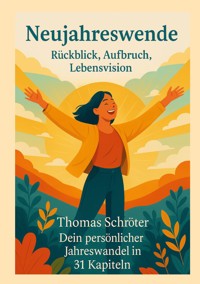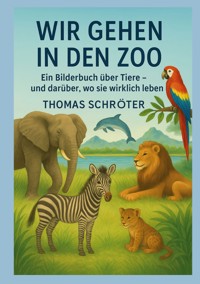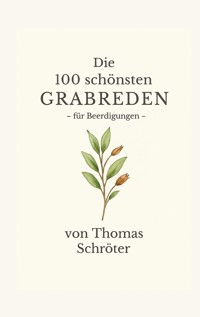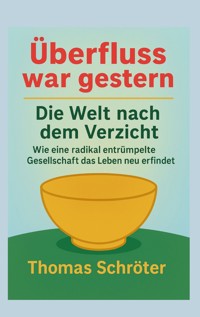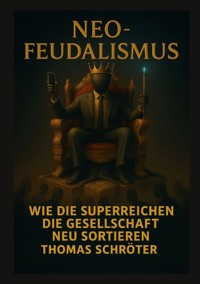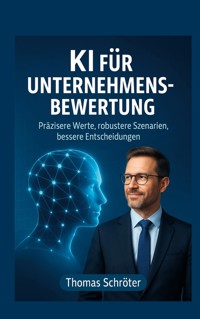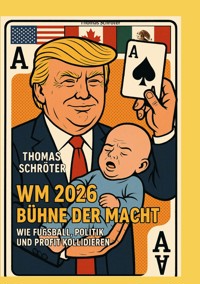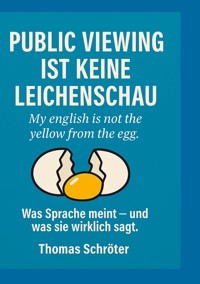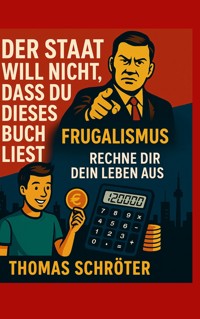Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Brexit war eines der folgenreichsten politischen Ereignisse des 21. Jahrhunderts mit tiefen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und außenpolitischen Auswirkungen. Vier Jahre nach dem EU Austritt zieht Rebrexit eine faktenbasierte Zwischenbilanz und zeigt auf, wie Großbritannien wirtschaftlich, politisch und kulturell seitdem zurückgefallen ist. Auf Grundlage aktueller Studien, Analysen und Daten verfolgt das Buch nicht nur die Spuren der Trennung, sondern diskutiert auch konkrete Wege zurück: von sektoralen Kooperationen über neue Allianzen bis zur möglichen EU Vollmitgliedschaft. Ein hochaktuelles, wissenschaftlich fundiertes und verständlich geschriebenes Buch für alle, die verstehen wollen, wie es zum Brexit kam und warum seine Korrektur realistischer ist, als viele glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rechtlicher Hinweis
Alle Personen und Handlungen in diesem Werk sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie existierenden Organisationen, Orten oder Begebenheiten ist rein zufällig und unbeabsichtigt.
Dieses Werk ist ein Produkt der Fiktion. Es dient ausschließlich der Unterhaltung und Information und stellt keine Form der Rechtsberatung, medizinischen Beratung, psychologischen Beratung oder einer anderen professionellen Beratung dar. Die in diesem Buch dargestellten Technologien, wissenschaftlichen Konzepte oder gesellschaftlichen Entwicklungen sind spekulativ und dienen der Erzählung.
Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der in diesem Werk enthaltenen Informationen entstehen könnten.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Einführung – Das britische Experiment
Kapitel 2: Der Weg zum Brexit – Ursachen, Akteure, Dynamiken
Kapitel 3: Der 31. Januar 2020 – Der formelle Austritt
Kapitel 4: Die ökonomische Bilanz I – Makroökonomische Entwicklung
Kapitel 5: Die ökonomische Bilanz II – Branchen im Wandel
Kapitel 6: Der Preis des Alleingangs – Außenhandel und Zölle
Kapitel 7: Gesellschaft unter Druck – Migration, Identität, Polarisierung
Kapitel 8: Schottland und Nordirland – Geteilte Nation
Kapitel 9: Die neue Außenpolitik – Global Britain oder Isolation?
Kapitel 10: Die innenpolitische Entwicklung – Führungskrise und Legitimationsverlust
Kapitel 11: Wissenschaft, Forschung, Bildung – Abgehängt vom Kontinent?
Kapitel 12: Die kulturelle Dimension – Europäische Entfremdung?
Kapitel 13: Die Sicht der EU – Bedauern, Genugtuung oder Gleichgültigkeit?
Kapitel 14: Politische Stimmungswende – Der Rebrexit in Umfragen und Medien
Kapitel 15: Die Labour-Strategie – Rückkehr durch die Hintertür?
Kapitel 16: Rechtliche Optionen – Von Assoziierung bis Vollmitgliedschaft
Kapitel 17: Szenario I – Großbritannien bleibt draußen
Kapitel 18: Szenario II – Schrittweise Rückkehr
Kapitel 19: Szenario III – Vollmitgliedschaft 20
Kapitel 20: Schlussbetrachtung – Lehren aus dem Brexit
Vorwort
Am 31. Januar 2020 trat das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union aus – ein historischer Moment, dessen Tragweite sich erst mit zeitlichem Abstand ermessen lässt. Der Brexit war mehr als ein politischer Richtungswechsel: Er war ein gesellschaftlicher Einschnitt, ein wirtschaftliches Experiment und ein diplomatischer Tabubruch. Selten zuvor wurde ein modernes Gemeinwesen so grundlegend umorientiert – nicht durch Krieg oder Krise, sondern durch eine demokratische Entscheidung.
Dieses Buch ist eine Bestandsaufnahme. Es fragt, was der Brexit bewirkt hat – für Großbritannien selbst, für die Europäische Union und für das fragile Gleichgewicht zwischen nationaler Souveränität und internationaler Kooperation. Es beleuchtet die wirtschaftlichen Verluste, die politischen Verwerfungen, die kulturelle Entfremdung – und es zeigt zugleich die Szenarien auf, die für die Zukunft denkbar sind: von der pragmatischen Stabilisierung über schrittweise Annäherung bis hin zur vollständigen Rückkehr in die EU.
Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen oder ideologische Bewertungen. Es geht um Verstehen. Um die Mechanismen politischer Polarisierung. Um die Realitäten wirtschaftlicher Abkopplung. Um die Spannungen zwischen Identität und Globalisierung. Und um die Frage, ob und wie sich getroffene Entscheidungen korrigieren lassen – demokratisch legitimiert, institutionell tragfähig, gesellschaftlich verantwortbar.
Dieses Buch wurde nicht aus der Distanz geschrieben, sondern aus dem Wunsch, Entwicklungen einzuordnen, Dynamiken zu analysieren und Optionen sichtbar zu machen. Es richtet sich an politisch Interessierte, an Entscheidungsträger, an Bürgerinnen und Bürger, die begreifen wollen, was der Brexit wirklich verändert hat – und was er über uns alle aussagt.
Denn der Brexit ist kein isoliertes britisches Phänomen. Er ist Ausdruck eines größeren Ringens um Richtung, Zugehörigkeit und Zukunft in einer Zeit fundamentaler Umbrüche. In diesem Sinne ist Rebrexit auch eine Einladung zur Selbstvergewisserung – für ein Großbritannien, das sich neu erfinden muss, und für ein Europa, das seine eigene Anziehungskraft beweisen will.
Kapitel 1: Einführung – Das britische Experiment
Als das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 die Europäische Union verließ, ging ein politisches Drama zu Ende – und ein historisches Experiment begann. Zum ersten Mal trat ein Mitgliedsstaat aus einer zunehmend integrierten Union aus, die seit Jahrzehnten als Garant für Frieden, Wohlstand und internationale Kooperation galt. Für viele schien der Brexit ein Befreiungsschlag, ein Akt nationaler Selbstbehauptung gegen vermeintliche Überregulierung und supranationale Entmündigung. Für andere war er ein tragischer Irrweg, getrieben von populistischen Verheißungen und identitätspolitischer Nostalgie.
Fünf Jahre nach dem Referendum und mehr als vier Jahre nach dem formellen Austritt ist es Zeit für eine erste fundierte Zwischenbilanz: Welche wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Folgen hat das britische EU-Abenteuer tatsächlich nach sich gezogen? Was wurde aus den Versprechen der Brexit-Befürworter? Und wie realistisch sind die Überlegungen, das Rad der Geschichte womöglich wieder zurückzudrehen – sei es in Form einer engeren Anbindung oder gar einer Rückkehr zur Union?
Dieses Buch versteht sich als analytische Bestandsaufnahme des britischen Sonderwegs in Europa. Es geht nicht um parteipolitische Bewertungen oder ideologische Einordnung, sondern um eine nüchterne, wissenschaftlich gestützte Betrachtung der Faktenlage. Im Zentrum steht die Frage: Was hat der Brexit dem Vereinigten Königreich konkret gebracht – und was gekostet?
Die Antwort darauf fällt vielschichtig aus. Ökonomisch zeigen sich mittlerweile klare Bremsspuren: Das Wachstum blieb hinter dem anderer Industrienationen zurück, der Außenhandel mit der EU stagniert oder schrumpft, Investitionen blieben aus, und der Staatshaushalt leidet unter geringeren Einnahmen. Gleichzeitig erwies sich die vielbeschworene „Kontrolle über Migration“ als komplexer als erwartet – die Nettozuwanderung erreichte Rekordwerte, aber in veränderter Zusammensetzung. Auch die gesellschaftliche Stimmung hat sich gewandelt: Eine wachsende Mehrheit der Briten beurteilt den Brexit kritisch. Die Hoffnung auf nationale Erneuerung wich vielfach der Ernüchterung.
Politisch hat der Brexit das Vereinigte Königreich destabilisiert: wechselnde Regierungen, parteiinterne Machtkämpfe und ungelöste Verfassungskrisen in Nordirland und Schottland zeigen, wie fragil der innere Zusammenhalt geworden ist. Außenpolitisch sucht London seither nach einer neuen Rolle – als „Global Britain“, mit Handelsabkommen jenseits der EU und einer betonten Rolle in Sicherheitsfragen. Doch ob diese Strategie die Verluste im EU-Raum kompensieren kann, bleibt umstritten.
Inmitten dieser Entwicklungen stellt sich eine neue Frage: Könnte es einen „Rebrexit“ geben – eine Rückkehr oder Wiederannäherung an die EU? Erste Signale sind erkennbar: Programme wie Horizon Europe wurden wieder aufgenommen, Umfragen zeigen wachsende EU-Sympathien, und auch in Brüssel scheint man prinzipiell offen für einen neuen Dialog. Doch die Hürden sind hoch: rechtlich, politisch und gesellschaftlich. Ein einfacher Rückweg ist ausgeschlossen.
Dieses Buch will nicht nur analysieren, was war, sondern auch fragen, was sein könnte. Es beschreibt die Ausgangslage, bewertet die bisherigen Entwicklungen und entwickelt Szenarien für die europäische Zukunft Großbritanniens. Damit ist es zugleich ein Beitrag zur Selbstverständigung über die Zukunft Europas – mit oder ohne das Vereinigte Königreich.
Kapitel 2: Der Weg zum Brexit – Ursachen, Akteure, Dynamiken
Der Brexit war kein plötzlicher Bruch, sondern das Ergebnis einer langjährigen Entwicklung, in der sich politische Entfremdung, wirtschaftliche Unsicherheit und kulturelle Identitätskrisen überlagerten. Um die Dynamik des britischen EU-Austritts zu verstehen, ist ein Blick auf die vielschichtigen Ursachen, zentralen politischen Akteure und gesellschaftlichen Strömungen notwendig, die das Land letztlich zum Verlassen der Union bewogen.
Die europäische Integration war im Vereinigten Königreich seit jeher umstritten. Schon der Beitritt 1973 erfolgte unter innenpolitischem Druck und war von Beginn an von Skepsis begleitet. Anders als viele kontinentaleuropäische Staaten sah Großbritannien die Europäische Union nicht primär als Friedens- oder Einigungsprojekt, sondern als ökonomische Zweckgemeinschaft. Diese utilitaristische Haltung bildete die Grundlage für spätere Spannungen. Schon 1975 stimmte die britische Bevölkerung in einem ersten Referendum über den Verbleib in der Europäischen Gemeinschaft ab – mit einer deutlichen, aber nicht enthusiastischen Mehrheit für den Verbleib.
In den folgenden Jahrzehnten verschärfte sich die europäische Debatte vor allem innerhalb der Konservativen Partei. Während Labour zeitweise auf einem europaskeptischen Kurs wandelte, entwickelte sich der Tory-Internismus zu einem ideologischen Kampfplatz. Besonders während der 1990er Jahre – unter dem Eindruck des Vertrags von Maastricht und der zunehmenden supranationalen Integration – gewann die EU-Kritik an Schärfe. Prominente konservative Politiker wie John Redwood oder Bill Cash propagierten eine Rückbesinnung auf nationale Souveränität, während pragmatischere Kräfte wie John Major versuchten, einen konstruktiven Kurs zu halten.
Mit dem Aufstieg der UK Independence Party (UKIP) unter Nigel Farage gewann die europafeindliche Rhetorik zusätzlich an Dynamik. UKIP verstand es, die Sorgen vieler Bürger über Migration, ökonomische Globalisierung und demokratische Mitbestimmung in ein starkes Narrativ zu gießen: die Rückeroberung der Kontrolle. Der Slogan „Take back control“ wurde später zum zentralen emotionalen Hebel der Leave-Kampagne – und zur politischen Sprengkraft für das etablierte Parteiensystem.
David Cameron, Premierminister von 2010 bis 2016, glaubte, diesen Kräften durch ein Referendum den Wind aus den Segeln nehmen zu können. Seine Strategie: Die EU-Frage durch ein demokratisches Votum klären und anschließend mit gestärkter Hand weiterregieren. Doch er