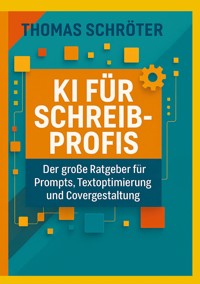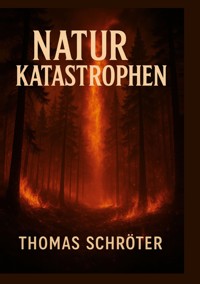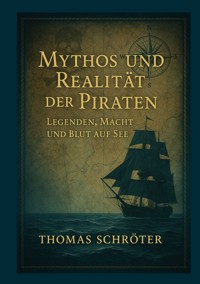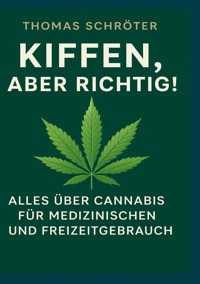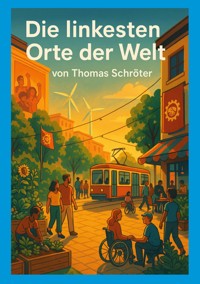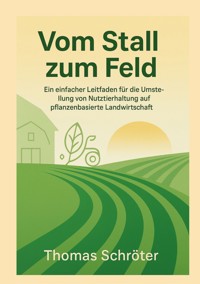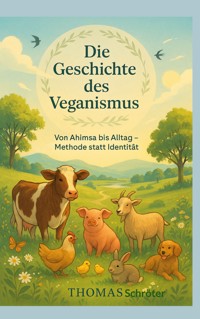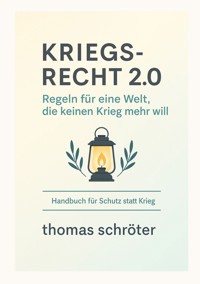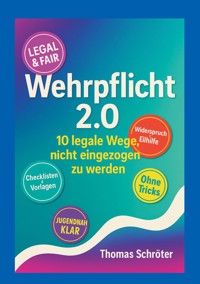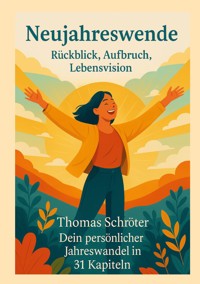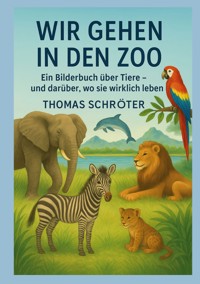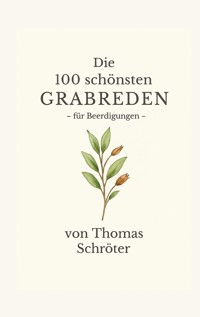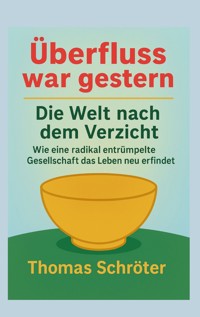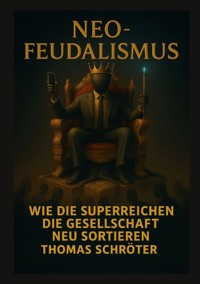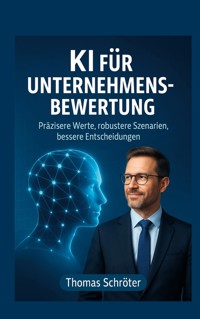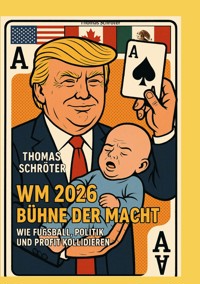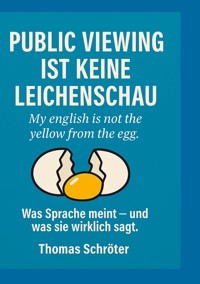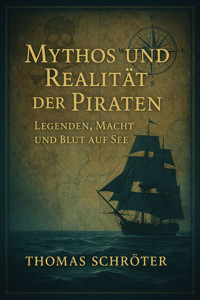
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Mythos und Realität der Piraten – Legenden, Macht und Blut auf See“ erzählt zwei Jahrtausende Seegeschichte als erzählendes Sachbuch: vom ersten Raub in den Buchten der Bronzezeit über die kilikischen Piraten und Pompeius’ Feldzug, Wikinger, slawische und arabische Seeräuber, mittelalterliche und osmanische Korsaren, Kaperbriefe und die Goldene Zeit in Karibik und Indischem Ozean bis zum Ende der Barbaresken und den Hotspots moderner Piraterie in Somalia, dem Golf von Guinea und Südostasien. Das Buch verbindet historische Präzision mit literarischer Spannung: Schlachten stehen neben Logbüchern, Hafengerüchten und den „Articles of Agreement“ an Bord. Es zeigt, wie Piraterie als Gegenwelt aus Regeln, Märkten und Ritualen funktionierte – ein temporärer Gesellschaftsversuch mit Beuteanteilen, Wahlkapitänen und brutaler Außenwirkung. Zugleich erklärt es den Gegenschlag der Mächte: Admiralitätsgerichte, Konvois, Patrouillen – die unscheinbare Verwaltung, die die Goldene Zeit beendete. Der Blick in die Gegenwart macht deutlich, warum Piraterie nicht verschwindet: Wo Handel schneller wächst als Ordnung, entstehen neue Lücken. Ergebnis ist ein Panorama aus Legenden und Akten – dicht erzählt, faktensicher, nah an Menschen, Technik und Ökonomie der See.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mythos und Realität der Piraten –
Legenden, Macht und Blut auf See
geschrieben von
Thomas Schröter
Deutsche Erstausgabe September 2025
© 2025 Thomas Schröter
Alle Rechte vorbehalten
Impressum:
Thomas Schröter
Mühlweg 7
73460 Hüttlingen
Verantwortlich für den Inhalt: Thomas Schröter
In diesem Buch können Textpassagen Chat GPT
und Bilder Dall-E KI-generiert sein
Rechtlicher Hinweis
Alle Personen und Handlungen in diesem Werk sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie existierenden Organisationen, Orten oder Begebenheiten ist rein zufällig und unbeabsichtigt.
Dieses Werk ist ein Produkt der Fiktion. Es dient ausschließlich der Unterhaltung und Information und stellt keine Form der Rechtsberatung, medizinischen Beratung, psychologischen Beratung oder einer anderen professionellen Beratung dar. Die in diesem Buch dargestellten Technologien, wissenschaftlichen Konzepte oder gesellschaftlichen Entwicklungen sind spekulativ und dienen der Erzählung.
Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der in diesem Werk enthaltenen Informationen entstehen könnten.
Prolog
Das Meer war immer beides: Verheißung und Gefahr. Es verband Kontinente, ermöglichte Handel und kulturellen Austausch – und es gebar jene Schattenfiguren, die aus dem Nebel auftauchten, um mit blankem Stahl und schwarzer Flagge den Lauf der Geschichte zu stören. Piraten. Kaum ein anderes Wort weckt so viele Bilder: Kanonen, Totenkopfflaggen, finstere Gestalten mit Augenklappen, Schiffe voller Gold und Silber. Doch hinter dem Mythos, der bis heute Filme, Romane und Kinderträume prägt, verbirgt sich eine vielschichtige Realität.
Die Geschichte der Piraterie ist keine Randnotiz, sondern ein roter Faden durch die Weltgeschichte. Schon die ersten Hochkulturen am Mittelmeer sahen ihre Händler bedroht, lange bevor Namen wie Blackbeard oder Henry Morgan in die Chroniken eingingen. Von den Seevölkern, die Städte im östlichen Mittelmeer verwüsteten, über die Wikinger, die Europas Küsten verheerten, bis hin zu den Barbaresken-Korsaren, die Millionen Menschen in die Sklaverei verschleppten – Piraten waren nicht bloß Gesetzlose. Sie waren Produkte ihrer Zeit, getrieben von Armut, Machtgier, politischem Kalkül oder schlicht von der Notwendigkeit, das eigene Überleben zu sichern.
Ihre Schiffe waren schwimmende Mikrokosmen, Orte der Angst, aber auch Orte der Freiheit. Auf den Decks der Piraten entstand ein paradoxes Stück Demokratie, in einer Epoche, in der Könige unumschränkt herrschten. Kapitäne wurden gewählt und abgesetzt, Beute wurde geteilt, Verwundete erhielten Entschädigung. Doch diese Gleichheit stand im Schatten der Gewalt. Piraten raubten, plünderten, mordeten – und schrieben damit blutige Kapitel in die Annalen der Menschheit.
Piraterie ist mehr als Abenteuerromantik. Sie ist ein Spiegel der Geschichte: Dort, wo Handel blühte und Staaten schwach waren, erhoben sich Piraten. Dort, wo Imperien sich dehnten und neue Märkte entstanden, folgten sie den Routen der Schätze. Und dort, wo die Mächtigen ihre Flotten entsandten, endeten die Karrieren der Gesetzlosen oft am Galgen oder im Kugelhagel.
Dieses Buch begibt sich auf eine Reise durch Jahrtausende. Es erzählt von den frühesten Spuren der Piraterie im Mittelmeer, von den mysteriösen Angriffen der Seevölker, von der Brutalität der Wikinger, von den Korsaren, die im Auftrag von Sultanen und Königen segelten, und von der goldenen Zeit der Karibikpiraten, die bis heute den Kern unseres Piratenmythos prägt. Es endet nicht im 18. Jahrhundert, sondern führt bis in die Gegenwart, wo moderne Piraten mit Schnellbooten, Maschinengewehren und Satellitentelefonen Frachter entführen – und zeigt damit, dass die alte Erkenntnis bis heute gilt:
Überall dort, wo Reichtum auf See transportiert wird, lauern Menschen, die bereit sind, ihn mit Gewalt an sich zu reißen.
Dies ist die Geschichte jener Männer und Frauen, die als Fluch der Meere galten – zwischen Mythos und Realität, zwischen Legenden, Macht und Blut auf See.
Kapitel 1 – Früheste Piraterie im Mittelmeer
Die Geschichte der Piraterie beginnt nicht mit den bunten Gestalten der Karibik, sondern in einer viel älteren Welt. Lange bevor Segel die Weltmeere durchkreuzten, war das Mittelmeer bereits eine Lebensader für Handel, Macht und Kultur. Es war ein Raum des Austauschs – und zugleich ein Raum der Gefahr. Denn dort, wo Reichtum floss, war auch immer jemand bereit, ihn mit Gewalt an sich zu reißen.
Schon im dritten Jahrtausend vor Christus, als in Ägypten die Pyramiden entstanden und auf Kreta die minoische Kultur blühte, sind erste Spuren jener Menschen erkennbar, die das Meer nicht zum Handel, sondern zur Plünderung nutzten. Archäologische Funde zeigen, dass selbst einfache Handelsschiffe jener Zeit Waffen mitführten – Speere, Bögen, manchmal sogar primitive Katapulte. Sie waren nicht nur Transportmittel, sondern zugleich schwimmende Bastionen, die sich gegen Angriffe wehren mussten.
Die ersten Piraten waren keine romantischen Außenseiter. Oft handelte es sich um rivalisierende Gruppen, die selbst Handel trieben und zugleich ihre Nachbarn überfielen. Ein kleines Fürstentum konnte an einem Tag Waren nach Zypern schicken und am nächsten mit denselben Schiffen eine Siedlung an der Levanteküste plündern. Die Grenze zwischen Händler und Räuber war fließend.
Besonders im östlichen Mittelmeer, wo die Handelswege dicht wie Spinnennetze verliefen, kam es früh zu systematischen Überfällen. Kupfer und Zinn, die Grundlage der Bronzezeit, waren begehrte Güter – und damit lohnende Beute. Wer ein beladenes Schiff aufbrachte, konnte mit einem Schlag mehr Reichtum erlangen, als Monate ehrlicher Arbeit eingebracht hätten.
Ägyptische Inschriften berichten von „Seevölkern“ und „Meeresräubern“, die das Nildelta heimsuchten. Sie kamen in schnellen Booten, landeten überraschend, plünderten und verschwanden wieder in den Weiten des Mittelmeers, bevor die Wächter reagieren konnten. Für die Bewohner der Küstenorte muss jeder Horizont zum Alptraum geworden sein: Jedes Segel, das sich näherte, konnte Händler – oder Feinde – bringen.
Doch Piraterie war nicht nur ein kriminelles Phänomen. Für viele kleine Inselgesellschaften war sie eine ökonomische Notwendigkeit. Ackerland war knapp, Ressourcen begrenzt. Der Überfall auf fremde Schiffe war manchmal die einzige Möglichkeit, Nahrung, Metall oder Werkzeuge zu erlangen. Aus dieser Perspektive waren die Piraten nicht nur Räuber, sondern Versorger, die ihren Gemeinschaften Reichtum und Prestige brachten.
Die Reaktionen der großen Reiche ließen nicht lange auf sich warten. Ägypten begann Flotten aufzubauen, die nicht nur Händler begleiteten, sondern gezielt die Seewege sicherten. Häfen wurden befestigt, Siedlungen an der Küste erhielten Mauern und Wachtürme. Doch der Feind war wendig und schwer zu fassen. Immer wieder gelang es Piratengruppen, durch kleine Buchten und versteckte Strände anzugreifen.
Ein faszinierender Aspekt dieser frühen Piraterie ist ihre internationale Dimension. Schon damals war es egal, ob ein Schiff aus Ägypten, Kreta oder Zypern kam – für die Piraten war es schlicht Beute. Die Gewalt auf See kannte keine Nationalität. Bereits in der Bronzezeit entstand damit ein Muster, das die gesamte Geschichte der Piraterie prägen sollte: grenzenlose Chancen für die Angreifer, grenzenlose Angst für die Opfer.
So begann die Geschichte der Piraterie nicht mit den goldenen Flaggen der Karibik, sondern mit kleinen Booten auf den Wellen des Mittelmeers. Hier, im blauen Herz der Alten Welt, wurden die Spielregeln geschrieben: Geschwindigkeit, Überraschung, Skrupellosigkeit. Und ebenso wie später galt auch damals: Für die einen waren Piraten Verbrecher – für die anderen Helden, Krieger und Ernährer.
Kapitel 2 – Die Seevölker
Um das Jahr 1200 vor Christus verwandelte sich das östliche Mittelmeer in eine Zone der Angst. Städte, die über Jahrhunderte geblüht hatten, lagen plötzlich in Schutt und Asche. Paläste brannten, ganze Häfen wurden verlassen, und Handelsnetze, die Generationen getragen hatten, brachen über Nacht zusammen. Zeitgenössische Berichte – allen voran ägyptische Inschriften – sprechen von geheimnisvollen Eindringlingen: den Seevölkern.
Bis heute ist rätselhaft, wer diese Gruppen waren. Archäologen und Historiker haben verschiedene Hypothesen entwickelt. Manche sehen in ihnen die letzten Ausläufer der mykenischen Krieger, deren Welt im Niedergang begriffen war. Andere deuten sie als Völker aus Kleinasien, Zypern oder den Inseln des zentralen Mittelmeers – vielleicht aus Sardinien oder Sizilien. Wahrscheinlich aber waren die Seevölker keine homogene Nation, sondern eine Koalition entwurzelter Gruppen: Flüchtlinge, Krieger, gescheiterte Händler, entwurzelte Stämme. Gemeinsam verband sie das Bedürfnis nach Land, Nahrung und Beute.
Ihre Taktik war neu und beängstigend. Die Seevölker griffen nicht nur einzelne Handelsschiffe an, wie es bis dahin üblich gewesen war, sondern führten groß angelegte Landungen durch. In schnellen Booten, von kräftigen Ruderern angetrieben, stürmten sie Küstenstädte, plünderten Vorräte, verschleppten Menschen und ließen nichts als verkohlte Ruinen zurück. Sie waren mehr als Piraten – sie wirkten wie wandernde Kriegergesellschaften, halb Eroberer, halb Seeräuber.
Besonders Ägypten war von dieser Bedrohung betroffen. Unter Pharao Merneptah wird erstmals von Angriffen berichtet. Doch die eigentliche Bewährungsprobe kam eine Generation später, während der Regierungszeit Ramses’ III. Um 1177 v. Chr. landeten die Seevölker in Massen an der Küste des Nildeltas. Reliefs im Tempel von Medinet Habu zeigen dramatische Szenen: Schiffe stoßen ineinander, Pfeile sausen durch die Luft, Krieger stürzen ins Wasser, während ägyptische Bogenschützen vom Ufer aus Feuer eröffnen.
Ramses’ Flotte siegte, die Seevölker wurden zurückgedrängt. Doch der Preis war hoch. Weite Teile Syriens und Palästinas waren verwüstet, das Hetiterreich in Anatolien brach zusammen, die mykenische Kultur in Griechenland zerfiel. Ganze Zivilisationen verschwanden – und die Seevölker waren ein wesentlicher Teil dieser Zäsur.
In manchen Regionen ließen sie sich nieder und wurden Teil der neuen Ordnung. Am bekanntesten sind die Philister, die sich an der südlichen Küste Kanaans ansiedelten und in biblischen Erzählungen eine bedeutende Rolle spielen. Andere Gruppen verschwanden wieder im Nebel der Geschichte, hinterließen aber Spuren, die bis heute nachwirken.
Das Vermächtnis der Seevölker ist ambivalent. Einerseits gelten sie als Zerstörer, die eine Ära der Hochkulturen beendeten. Andererseits brachten sie Bewegung, vermischten Völker, Kulturen und Traditionen und ebneten so den Weg für neue Strukturen. In ihnen zeigt sich, dass Piraterie mehr sein konnte als ein Überfall am Rande des Handels – sie konnte eine Massenbewegung werden, die selbst Reiche ins Wanken brachte.
Die Seevölker waren keine romantischen Abenteurer. Sie waren der Inbegriff der Unsicherheit einer Zeit, in der Hunger, Klimawandel und politische Krisen alte Ordnungen zerschlugen. Doch gerade deshalb stehen sie am Anfang einer langen Tradition: Sie zeigen, wie das Meer selbst zum Katalysator von Gewalt werden konnte. Und sie prägen ein Motiv, das die Geschichte der Piraterie für Jahrtausende begleiten sollte – das Meer als Schwelle zwischen Kultur und Chaos.
Kapitel 3 – Piraten in der Antike
Mit dem Ende der Bronzezeit begann für das Mittelmeer eine neue Epoche – und mit ihr eine neue Blüte der Piraterie. Die Antike, die wir oft mit Philosophie, Kunst und Handel verbinden, war auch eine Zeit, in der Seeräuber allgegenwärtig waren.
Für die frühen Griechen war Piraterie nichts Ungewöhnliches, sondern beinahe selbstverständlich. In den Epen Homers wird sie beiläufig erwähnt, als wäre sie ein normaler Bestandteil des Lebens. Wenn Fremde an Land gingen, fragte man sie nicht nur nach ihrer Herkunft, sondern auch: „Seid ihr Händler – oder Piraten?“ Diese Frage zeigt, wie fließend die Grenzen damals waren. Der Seehandel war jung, die Schiffe schwer beladen, die Routen ungesichert. Wer bewaffnet war und über ein schnelles Boot verfügte, konnte leicht Beute machen.
Olivenöl, Wein, Metalle und Getreide – all das war begehrte Ware. Ein einziger Überfall konnte eine Mannschaft reich machen. Doch es ging nicht nur um Güter. Menschen selbst wurden zur wertvollsten Fracht. Gefangene Männer, Frauen und Kinder wurden als Sklaven verkauft, und die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften war in der Antike enorm. Ohne Piraten hätte es viele Sklavenmärkte in dieser Größenordnung wohl gar nicht gegeben. Piraterie war damit kein Randphänomen, sondern ein Motor eines ganzen Wirtschaftszweiges.
Besonders gefürchtet waren die Illyrer, die an der rauen Ostküste der Adria lebten. Ihr Land war arm, aber ihre Küste ein idealer Hafen für schnelle Boote. Mit ihren schmalen, von Ruderern angetriebenen Schiffen – den Lembi – konnten sie blitzartig zuschlagen. Ein Handelsschiff, das mit schwerem Getreide beladen und vom Wind abhängig war, hatte kaum eine Chance, rechtzeitig zu fliehen. Händler mieden deshalb die adriatischen Gewässer, so sehr war die Furcht vor den Illyrern verankert.
Für die Illyrer selbst war Piraterie keine Schande. Im Gegenteil: Sie war Teil ihrer Kultur, ein Mittel zum Überleben, ja zur Macht. Manche Fürsten förderten die Überfälle gezielt, teilten die Beute mit ihren Kriegern und machten den Seeraub zu einem politischen Werkzeug. Sie lebten in einer Grauzone, in der Piraterie, Krieg und Herrschaft fast ununterscheidbar waren.
Auch die großen Stadtstaaten Griechenlands sahen Piraten mit zwiespältigem Blick. Einerseits bedrohten sie den Handel, auf den Athen oder Korinth dringend angewiesen waren. Andererseits machten sie sich dieselben Methoden zunutze, wenn sie im Krieg feindliche Schiffe kaperten oder fremde Küsten überfielen. Der Unterschied zwischen Pirat und offizieller Kriegsflotte bestand oft nur in einem Siegel oder einem Banner.
Für die Opfer aber war dieser Unterschied bedeutungslos. Für sie waren es Angriffe, Plünderungen und der Verlust von Freiheit. Küstenbewohner lebten in ständiger Angst vor plötzlichen Überfällen, Händler bangten um ihre Existenz, und unzählige Menschen verschwanden in den Tiefen der Sklavenmärkte.
So entstand in der Antike ein Muster, das die Geschichte der Piraterie für Jahrhunderte prägen sollte: Piraten waren zugleich verachtet und gebraucht, gefürchtet und doch geduldet. Sie standen am Rand der Ordnung – und waren dennoch Teil des Systems. Ihre Existenz machte deutlich, dass das Meer nicht nur Raum des Handels war, sondern immer auch ein Raum der Gewalt.
Kapitel 4 – Die Kilikischen Piraten
Wenn es in der Antike eine Region gab, die wie aus Stein und Sturm für die Seeräuberei geschaffen schien, dann war es die Südküste Kleinasiens. Kilikien, jener zerklüftete Gürtel zwischen Taurusgebirge und Mittelmeer, bot alles, was Piraten brauchten. Auf wenige Meilen folgten aufeinander: schroffe Klippen, enge Buchten, sandige Einschnitte, hinter denen das Gebirge sofort emporstieg. Flache Strände, auf denen Patrouillen hätten landen können, waren selten. Wer hier in einer Mondnacht ein leichtes Boot in eine Rinne aus Felsen lenkte, verschwand unmittelbar hinter einer Wand aus schwarzem Gestein. Jenseits der schäumenden Brandung begannen Ziegenpfade und Schluchten, die die Küstenlinie mit verborgenen Lagern verbanden. Kilikien Tracheia, das raue Kilikien, war nicht nur ein Name der Geografie, sondern ein Programm.
Aus den verstreuten Schlupfwinkeln wurden im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus Machtzentren. Namen wie Korakesion, das heutige Alanya, tauchen in den Quellen als Hochburgen auf. Kleinere Häfen, unscheinbar und ohne große Kaimauern, wurden zu Werkstätten des Seeraubs. Auf improvisierten Helgen entstanden leichte, schnelle Schiffe, die man bei ruhiger See über die kiesigen Strände wieder in die Wellen drücken konnte. Der Bau folgte der Logik des Handwerks und des Krieges: wenig Tiefgang, große Ruderleistung, ein Mast für Fahrt vor dem Wind, und unter Deck Platz für Waffen, Ketten und Fässer. Diese Fahrzeuge waren keine seetüchtigen Kolosse, die den Ozean vor sich her schoben. Sie waren Nadelstiche aus Holz und Eisen, geschlagen in die Arterien des Mittelmeers.
Die Piraten Kilikiens unterschieden sich von den lose organisierten Banden früherer Zeiten. Sie entwickelten Strukturen, die an staatliche Ordnung erinnerten. Beute wurde systematisch geteilt, Routen geplant, Verstecke koordiniert. Hinter küstennahen Orten lagen befestigte Höfe, zu denen Ziegen und Olivenhaine gehörten. In tieferen Tälern wurden Gefangene bewacht, bis die Lösegelder eintrafen. Wer Geld hatte, kam frei. Wer niemanden hatte, der zahlte, wurde verkauft. Sklavenmärkte an den Küsten des östlichen Mittelmeers lebten seit langem von diesem Nachschub, doch mit dem Aufstieg der kilikischen Piraten erreichte der Handel eine kalte Effizienz. Selbst wohlgeborene Reisende, Senatoren und reiche Kaufleute fand man plötzlich in engen Verschlägen, wo die Nägel der Wachen in Fackellicht glitzerten und das Seil in der Hand mehr wog als jedes Gesetz.
Das Umfeld war bereit. Die hellenistische Welt befand sich im langgezogenen Nachbeben der Diadochenreiche, die Grenzen waren porös, Bündnisse fragil, und im Schatten rieben sich Kleinkönige, Stadträte und Warlords aneinander. Wer Schiffe, Männer und Mut besaß, fand Spielräume. Die römische Republik, im Westen zur Ordnungsmacht aufgestiegen, blickte weit und zugleich zu selten in die verwitterten Winkel der kilikischen Küste. Rom profitierte zudem nicht immer nur als Opfer. Der Handel verlangte Hände, die ruderten, und Märkte, die kauften. Mancher römische Unternehmer schloss die Augen, wenn die Quelle der Ware überflüssig peinliche Fragen aufwarf. So wuchs in den Schluchten und Buchten eine Ökonomie, die aus Plünderung, Lösegeld und Zwangsarbeit ein belastbares System machte.
Die Taktik der kilikischen Piraten war der Raum selbst. In kleinen Flotten traten sie plötzlich aus dem Schatten einer Landzunge, setzten in Windnähe schräg an und zwangen mit einer kurzen Salve aus Pfeilen und Steinschleudern die Mannschaft der Händler zu Fehlern. Ein schwerbeladenes Getreideschiff, das für Stabilität gebaut war, drehte träge, knarrte unter dem Druck der Ruder, und ehe die Matrosen die Segel bändigten, waren die Angreifer längsseits. Es kam vor, dass ein Kapitän sofort die Flagge strich, um das Schlimmste zu vermeiden, denn die Alternative war oft das gleiche Ergebnis mit mehr Blut. Nach dem Entern zählte nicht die Pose, sondern die Geschwindigkeit. Ladungsverzeichnisse, Handschriften, Amulette, Schmuck, Kisten mit Münzen, und besonders die lebende Fracht wurden gesichtet, verteilt, fortgeschafft. Was sich nicht tragen oder rudern ließ, ging über Bord.
Mit der Zeit trauten sich die Piraten weiter. Sie begriffen, dass die See nicht nur aus Linien bestand, die man kreuzte, sondern aus Knotenpunkten, an denen Ströme zusammenflossen. Sie überfielen nicht mehr nur isolierte Schiffe, sondern legten sich an Flaschenhälsen auf die Lauer, an Kaps und vor Hafenmündungen, wo selbst wendige Rümpfe kurz zur Zielscheibe wurden. Berichte der Antike erzählen in erschrockenen Sätzen, dass sie bis an die italienische Halbinsel vorstießen, entlang kalabrischer Küsten, ja einzelne Siedlungen ausraubten und im Morgengrauen wieder verschwanden. Diese Geschichten hatten einen Zweck: Sie färbten die Angst, aber sie entsprachen auch einem Kern der Wahrheit. Wenn die Routen der Versorgung ins Wanken geraten, beginnt Rom zu hören.