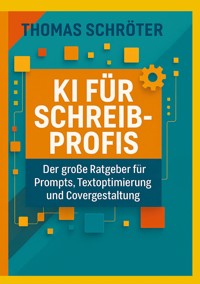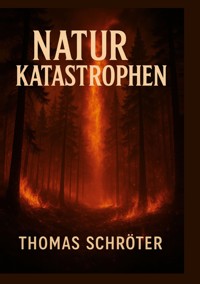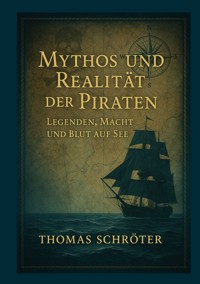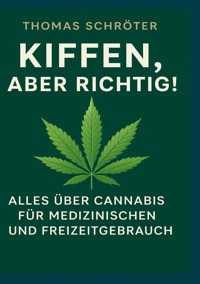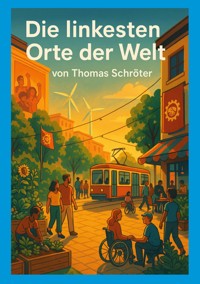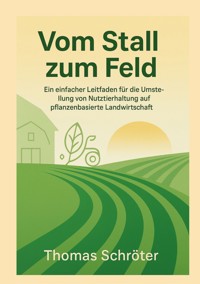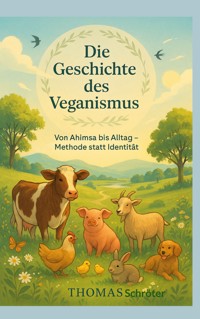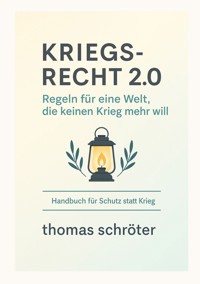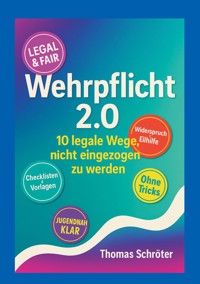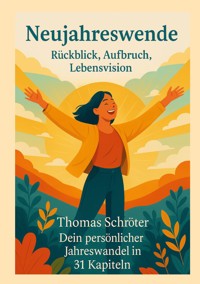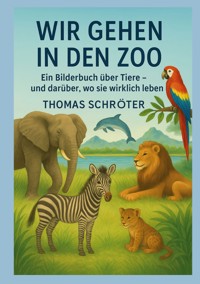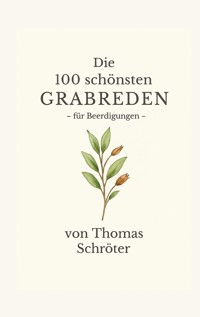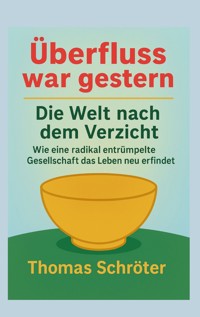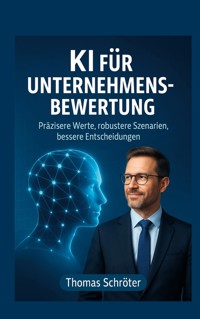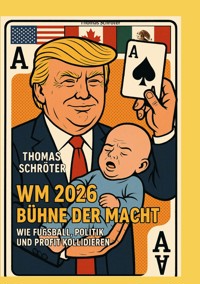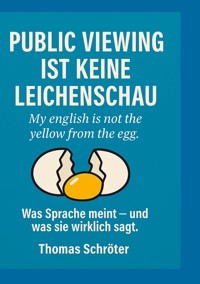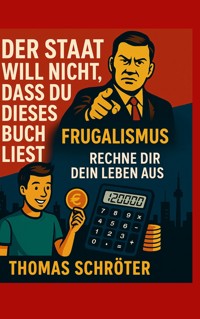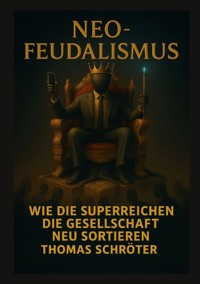
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einer Welt, die sich als modern, aufgeklärt und frei versteht und doch erleben wir einen Rückfall in vormoderne Strukturen: Eine kleine, global vernetzte Elite verfügt über ein Maß an Reichtum und Einfluss, das Demokratien untergräbt, Märkte dominiert und Gesellschaften spaltet. Dieses Buch zeigt: Der Feudalismus ist zurück; nur in neuer Form. Die neuen Herren tragen keine Kronen, sondern Konzerntitel. Ihre Burgen sind Datenzentren, ihre Waffen sind Algorithmen. Wer heute besitzt, regiert; durch Kapital, Plattformmacht und politische Einflussnahme. Während Superreiche sich in abgeschottete Parallelgesellschaften zurückziehen, kämpft die Mehrheit mit Mietsteigerungen, digitaler Überwachung und einem Arbeitsmarkt, der Autonomie verspricht, aber Abhängigkeit produziert. Thomas Schröter nimmt die Leser:innen mit auf eine klarsichtige, tiefgründige und erschütternde Reise durch die Mechanismen des neuen Feudalismus: von der Romantisierung von Milliardären bis zu den dunklen Seiten von Künstlicher Intelligenz, von der Legende des Selfmade Erfolgs bis zu konkreten Alternativen für eine gerechtere Zukunft. Dieses Buch ist ein Aufruf zur neuen Aufklärung. Es beleuchtet die verborgenen Strukturen moderner Herrschaft, stellt unbequeme Fragen und zeigt, warum gerechte Gesellschaften kein utopischer Traum bleiben müssen; wenn wir bereit sind, uns dem Spiel der Mächtigen zu entziehen. Für alle, die verstehen wollen, wie die Reichen nicht nur das Geld, sondern auch das Narrativ besitzen. Und wie wir uns davon befreien können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Wir gehören den Milliardären
Kapitel 2: Feudalismus reloaded – Die Rückkehr der Stände
Kapitel 3: Wer ist der neue Adel?
Kapitel 4: Die unsichtbare Parallelgesellschaft
Kapitel 5: Von Bauern und Besitzlosen – Die neue Unfreiheit
Kapitel 6: Wachstum durch Katastrophen – Warum Krisen manchmal helfen
Kapitel 7: Warum soziale Mobilität eine Lüge geworden ist
Kapitel 8: Die Ideologie der Reichen
Kapitel 9: Die wirtschaftliche Realität – Von Zinsen, Aktien und Monopolen
Kapitel 10: Warum der Kapitalismus keinen Wettbewerb mehr kennt
Kapitel 11: Plattformarbeiter und Algorithmus-Herren – Die neuen digitalen Leibeigenen
Kapitel 12: Wenn der Staat sich für Reiche verbiegt
Kapitel 13: Der Mythos vom Selfmade-Millionär
Kapitel 14: Was Bildung bewirken kann – und was nicht
Kapitel 15: Medienmacht – Wie Meinung gemacht wird
Kapitel 16: Der Mythos vom Selfmade-Millionär
Kapitel 17: Der stille Putsch – Wie Lobbyismus unsere Demokratie formt
Kapitel 18: Kapitalismus als Religion – Der Markt als Gott
Kapitel 19: Die Normalisierung des Unvorstellbaren – Armut als Naturzustand
Kapitel 20: Klima und Klasse – Wer zahlt für die Katastrophe?
Kapitel 21: Die Vermessung des Menschen – Wie Datenherrschaft zur neuen Leibeigenschaft führt
Kapitel 22: Der algorithmische Adel – Wie künstliche Intelligenz Macht zementiert
Kapitel 23: Widerstand im Schatten – Bewegungen gegen die neue Ordnung
Kapitel 24: Aufklärung 2.0 – Der Weg in eine gerechte Zukunft
Nachwort: Ein Blick zurück – ein Aufruf nach vorn
Vorwort
Was, wenn wir längst wieder in einem Zeitalter der
Herrschaft leben –
nur ohne Kronen, Burgen und Ritter?
Was, wenn sich die alten Muster von Macht und
Ohnmacht
nicht aufgelöst, sondern transformiert haben?
Unsichtbarer geworden, digitaler, algorithmischer – aber nicht weniger durchdringend?
Dieses Buch ist aus einer Unruhe entstanden.
Aus dem Gefühl, dass etwas nicht stimmt mit der Welt,
die sich so modern, so innovativ, so gerecht gibt –
und doch immer ungleicher wird.
Es ist ein Versuch, einen klaren Blick auf jene zu werfen,
die so viel besitzen, dass sie nicht mehr auffallen.
Die so präsent sind, dass sie schon wieder verschwinden.
Die so viel Einfluss haben, dass sie nicht mehr regieren müssen –
weil ihre Interessen längst System geworden sind.
Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um zu skandalisieren.
Nicht, um zu moralisieren.
Und schon gar nicht, um Neid zu schüren.
Sondern, um sichtbar zu machen,
was so gerne unsichtbar bleibt:
Die neue Form des Feudalismus.
Ein Feudalismus ohne Zwang, aber mit
Alternativlosigkeit.
Ohne Adelstitel, aber mit Milliardenvermögen.
Ohne Leibeigene, aber mit digitalen Abhängigkeiten.
Ohne Fronarbeit, aber mit dem Zwang, sich jederzeit
selbst zu vermarkten.
Wenn du dieses Buch liest,
wirst du den Supermarkt anders sehen.
Das Internet. Deine Wohnung.
Deine Arbeit. Deine Daten.
Deinen Alltag.
Denn überall dort wirkt er:
Der neue Feudalismus.
Leise. Elegant. Systemisch.
Doch wer erkennt, wie Herrschaft funktioniert,
kann sie auch hinterfragen.
Wer sieht, wie Ungleichheit zementiert wird,
kann nach Werkzeugen der Befreiung suchen.
Und wer weiß, dass Geschichte keine Einbahnstraße
ist,
kann anfangen, sie neu zu schreiben.
Dieses Buch will keine endgültigen Antworten geben.
Aber es will Fragen stellen,
die uns in Bewegung bringen.
Es ist ein Buch über Macht.
Aber auch über die Hoffnung,
dass sie sich teilen lässt.
Thomas Schröter
Juli 2025
Kapitel 1: Wir gehören den Milliardären
Was ist Macht?
Ist es der Zugriff auf Ressourcen, der Einfluss auf politische Entscheidungen oder die Fähigkeit, Narrative zu gestalten, die ganze Gesellschaften formen?
In einer Zeit, in der einzelne Menschen über mehr Kapital verfügen als ganze Staaten, wird diese Frage neu verhandelt. Wir leben in einem Zeitalter, in dem sich Reichtum nicht nur durch Zahlen auf Bankkonten ausdrückt, sondern durch Macht über Daten, digitale Plattformen, Infrastruktur, Märkte – und über uns.
Die Geschichte von Luigi Mangione, dem sogenannten „Robin Hood von New York“, ging viral. Ein reicher Jüngling mit Bootsschuhen erschießt einen Mann aus der Mittelschicht – und wird gefeiert. Als Held. Als mutiger Rächer gegen das System. Und niemand scheint zu stören, dass Luigi Teil der Elite ist, nicht etwa ihr Gegner. Er ist keine Stimme des Volkes – er ist der Nachwuchs des Adels. Nur eben in modernen Sneakern.
Es ist kein Einzelfall. Immer häufiger erleben wir, wie Personen, die objektiv zur Klasse der Vermögenden zählen, als Repräsentanten des Widerstands stilisiert werden. Sie betreiben Podcasts, finanzieren Stiftungen, gründen Medienunternehmen. Sie wirken zugänglich, humorvoll, selbstkritisch. Doch hinter den Fassaden offenbart sich ein Muster: Die Reichen haben gelernt, sich als „normal“ zu inszenieren. Und wir haben aufgehört, uns zu wehren.
Was wäre, wenn wir uns eingestehen müssten, dass wir längst nicht mehr in einem demokratischen Kapitalismus leben, sondern in einem neuen Feudalsystem? Eines, in dem Macht nicht gewählt, sondern geerbt wird. In dem Besitz nicht verteilt, sondern zementiert ist. Und in dem Wohlstand nicht durch Arbeit, sondern durch Verwertung wächst.
Der Feudalismus ist zurück. Und wir sind wieder die Bauern.
Natürlich fahren wir heute mit Bahncard statt mit Ochsenkarren. Wir bestellen online, statt zum Markt zu laufen. Aber was sich geändert hat, ist nicht das Prinzip, sondern nur die Verpackung.
Wir sind wieder im Dienst eines Standes, den wir nicht sehen, aber täglich spüren. Einen Stand, der über Städte, Plattformen, Serverzentren und künstliche Intelligenzen verfügt. Wir sind nicht mehr Leibeigene auf dem Feld – wir sind digitale Tagelöhner in einem globalen Netz aus Clicks, Likes und Datenströmen.
Früher lebten Bauern im Schatten der Burg, heute im Schatten von Rechenzentren. Und genauso wie einst die Ritter das Land abschritten, durchforsten heute Algorithmen unsere Gedanken, Sehnsüchte, Käufe.
Und ja: unsere Loyalitäten.
Wie viel Reichtum können wir überhaupt noch begreifen?
Nehmen wir eine Summe von 1.000 Euro. Für viele Menschen ist das ein Monatsgehalt, das mühsam verdient, oft zu knapp kalkuliert ist.
Das mittlere Jahreseinkommen eines Haushalts in Deutschland liegt bei rund 44.000 Euro.
Eine Million? Bereits schwer vorstellbar. Eine Milliarde? Für das menschliche Gehirn kaum noch fassbar. Und doch: In Deutschland gibt es mindestens 249 Menschen, die über ein Vermögen in Milliardenhöhe verfügen. Weltweit ist diese Zahl noch wesentlich höher.
Jeff Bezos, Gründer von Amazon, besitzt über 200 Milliarden Dollar. Er könnte mehrere Staaten aufkaufen – mit einem Federstrich. Elon Musk, Kind eines südafrikanischen Minenbesitzers, wird trotz fragwürdiger Aussagen und unberechenbaren Geschäftsgebarens als Genie gefeiert – und das nicht etwa von Randgruppen, sondern von Leitmedien, Investor:innen und Politiker:innen.
Die Schere zwischen „uns“ und „denen“ ist nicht nur größer geworden als je zuvor – sie hat eine neue Qualität erreicht.
Wir erleben nicht mehr nur soziale Ungleichheit, sondern strukturelle Entkopplung.
Der Unterschied ist nicht mehr graduell. Er ist systemisch.
Denn es geht längst nicht mehr um Einkommen, sondern um Vermögen. Einkommen erlaubt das Überleben. Vermögen ermöglicht Macht. Es schützt, vermehrt sich selbst, und es reproduziert sich durch Erbschaften, durch Aktiengewinne, durch globales Steuerdumping und durch politische Einflussnahme.
Es ist kein Zufall, dass in vielen Demokratien Superreiche heute massiven Einfluss auf die Gesetzgebung haben – entweder direkt, über Lobbyisten, Thinktanks und Parteispenden, oder indirekt, über Medienbesitz, Algorithmen und Datensätze. Sie bestimmen, was wir sehen, hören, glauben sollen. Und sie tun es ohne Mandat, ohne Kontrolle, ohne Rechenschaft.
Wo ist die Gegenwehr geblieben?
In früheren Jahrhunderten reagierten Gesellschaften auf extreme Ungleichheit mit Rebellion.
Die französische Revolution von 1789 brach mit dem Adel. Die Bauernaufstände des Mittelalters, die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert – sie alle waren Ausdruck des kollektiven Willens, sich zu emanzipieren.
Heute? Debattieren wir über Bürgergeld-Empfänger, darüber, ob 502 Euro im Monat zu viel sind.
Wir treten nach unten, nicht nach oben. Wir misstrauen denen, die wenig haben, und idealisieren jene, die alles besitzen.
Dabei sind die wirklichen Parasiten nicht unter denen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.
Die wirkliche Leistungsverweigerung findet dort statt, wo Geld ohne Arbeit wächst.
Dort, wo Zinsen, Dividenden und Renditen Einkommen erzeugen, ohne dass je ein Wert geschaffen wird.
Willkommen im Zeitalter des Neo-Feudalismus.
Das Wort klingt groß, beinahe literarisch. Aber es trifft die Realität: Eine neue Ständeordnung hat sich etabliert – nicht durch Gesetze, sondern durch Strukturen. Nicht durch Gewalt, sondern durch Zustimmung. Und nicht durch Gott, sondern durch Algorithmen.
Wir glauben, wir seien frei – dabei bewegen wir uns in digitalen Lehen, deren Regeln wir nicht verstehen und deren Herren wir nie gewählt haben.
Wir glauben, Leistung werde belohnt – dabei wird Besitz belohnt.
Wir glauben, wir könnten es schaffen – dabei startet ein Teil der Bevölkerung mit einem Rückstand von Generationen.
Und doch bleibt die Frage:
Wie konnten wir das zulassen?
Warum verteidigen so viele Menschen ein System, das sie selbst ausbeutet?
Warum bewundern wir Milliardäre, anstatt ihre Macht zu hinterfragen?
Vielleicht, weil uns der Glaube an Aufstieg genommen wurde, aber der Glaube an das Märchen blieb.
Vielleicht, weil wir nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt, wirklich aufzubegehren.
Vielleicht, weil wir vergessen haben, dass Geschichte veränderbar ist.
Doch eines ist klar: Der neue Adel wartet nicht darauf, dass wir ihn stürzen.
Er glaubt, dass wir ihm weiter zujubeln.
Die Frage ist, wie lange noch.
Kapitel 2: Feudalismus reloaded – Die Rückkehr der Stände
Die Vorstellung, wir lebten in einer offenen, mobilen und chancengerechten Gesellschaft, gehört zu den zentralen Selbstbildern der westlichen Demokratien.
Der Gedanke, dass jeder es schaffen kann – vom Tellerwäscher zum Millionär, von der Plattenbauwohnung ins Penthouse –, ist tief verankert in unserem kollektiven Bewusstsein. Und doch: Je länger man sich die gesellschaftliche Realität ansieht, desto deutlicher wird – dieser Traum ist nicht nur verblasst. Er ist vielfach zur Farce verkommen.
Ein Blick zurück: Die Pyramide des Feudalismus
Um zu verstehen, was sich heute wiederholt, muss man die Grundstruktur des klassischen Feudalismus begreifen.
Im mittelalterlichen Europa war die Gesellschaft streng hierarchisch organisiert.
An der Spitze stand der König oder Kaiser – nicht als repräsentatives Symbol, sondern als Eigentümer allen Landes. Alles unterstand ihm, und alles wurde von ihm weitervergeben.
Dieses Land wurde in Lehen aufgeteilt und an den Hochadel vergeben, als Belohnung für Treue und militärischen Beistand.
Die Lehnsherren wiederum vergaben kleinere Stücke Land an Vasallen, Ritter und niederen Adel, ebenfalls gegen Treueid, Abgaben und Dienst.
Ganz unten standen die Bauern, Tagelöhner, Handwerker, Leibeigenen.
Sie hatten kaum Rechte, oft kein Eigentum, und mussten für die oberen Stände schuften – im Austausch für Schutz, den sie selten bekamen.
Dieses System hielt sich über Jahrhunderte – nicht, weil es effizient war, sondern weil es durch Religion, Gewalt und Gewohnheit stabilisiert wurde. Der Stand, in den man hineingeboren wurde, bestimmte den Rest des Lebens. Mobilität war die Ausnahme. Besitz war gottgegeben. Rebellion bedeutete Tod.
Und heute?
Heute heißt es, wir seien alle frei. Jeder könne studieren, gründen, aufsteigen.
Doch sehen wir genauer hin, wird klar: Die Muster des Feudalismus haben sich in neuer Gestalt erhalten.
Auch heute ist das Leben vieler Menschen von Geburt an strukturiert – durch Herkunft, durch Bildung, durch Zugang zu Kapital, durch soziale Netzwerke.
Auch heute gibt es Klassen – nur heißen sie nun nicht mehr „Stand“, sondern „Haushaltseinkommensgruppe“, „Vermögensquantil“ oder „Bildungsschicht“.
Die neue Lehenvergabe: Erbschaften und Eigentum
Im klassischen Feudalismus wurde Land vom König an seine Vasallen vergeben.
Heute wird Besitz durch Erbschaften übertragen – meist steuerlich begünstigt, selten öffentlich thematisiert.
Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 400 Milliarden Euro vererbt – das entspricht fast dem gesamten Bundeshaushalt.
Doch das meiste davon bleibt unter sich: Die oberen zehn Prozent der Bevölkerung erben etwa 60 Prozent dieses Vermögens. Das unterste Drittel fast nichts.
Die Folge: Wer in eine wohlhabende Familie geboren wird, startet mit einem massiven Vorsprung ins Leben – sei es durch Eigentum, durch Netzwerke, durch Zugang zu besserer Bildung, gesündere Ernährung, bessere Rechtsberatung.
Wer nichts erbt, muss kaufen, mieten, Schulden aufnehmen. Muss sich „hocharbeiten“ – in einem System, das Aufstieg längst zur Ausnahme gemacht hat.
Moderne Ritter: Die Superreichen und ihre Dienstverhältnisse
Die mittelalterlichen Ritter dienten ihrem Lehnsherrn.