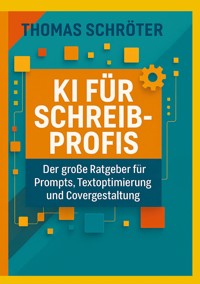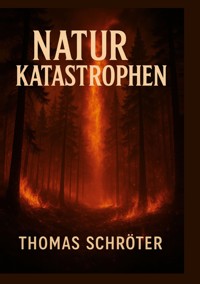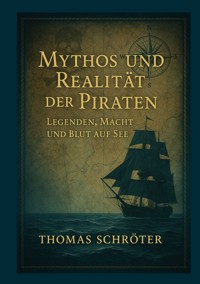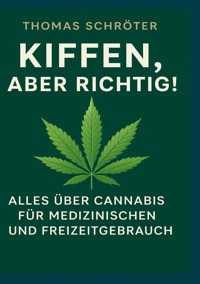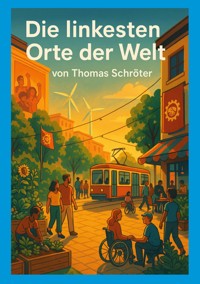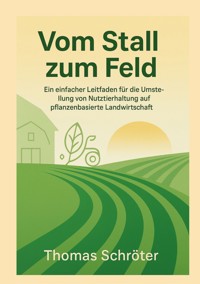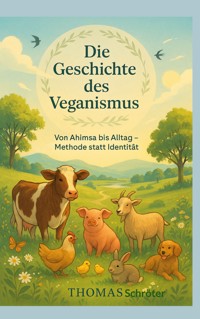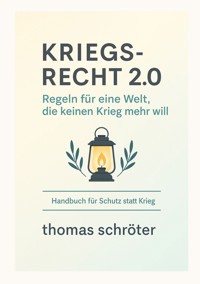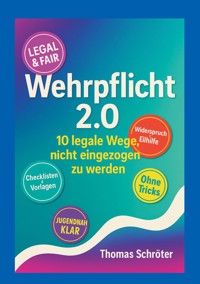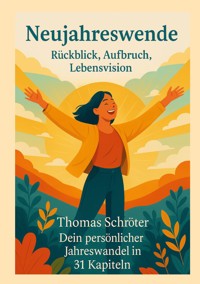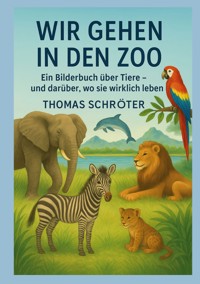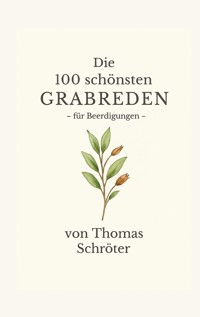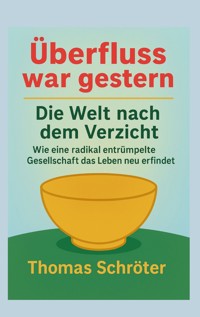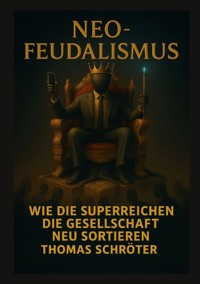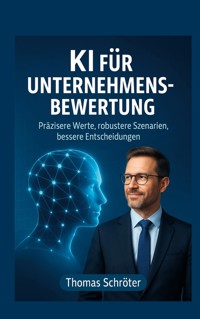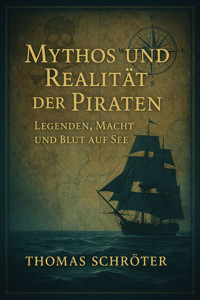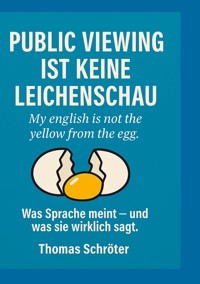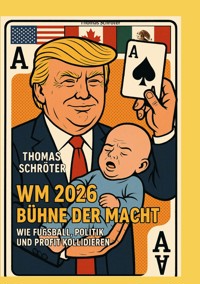
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird als das größte Turnier aller Zeiten angekündigt, mit 48 Nationen, 104 Spielen und erstmals drei Gastgeberstaaten: den USA, Mexiko und Kanada. Doch hinter dem Glanz der Stadien und dem Jubel der FIFA verbirgt sich eine ganz andere Realität. WM 2026, Bühne der Macht ist eine tiefgreifende journalistische Analyse über ein Sportereignis, das längst kein bloßes Spiel mehr ist. Es zeigt, wie politische Ambitionen, wirtschaftliche Interessen und globale Machtkämpfe das Spiel durchdringen: Wie Donald Trump als wiedergewählter US-Präsident die WM zur Bühne seiner America First-Rhetorik macht Wie FIFA-Präsident Gianni Infantino den Fußball als globales Machtinstrument instrumentalisiert Warum der neue Turniermodus sportlich fragwürdig, ökologisch verheerend und logistisch desaströs ist Weshalb Fans ausgeschlossen, Medien instrumentalisiert und Spieler überlastet werden Und was bleibt, von einem Spiel, das einst der Welt gehörte und nun zur Ware wurde Dieses Buch richtet sich an Fußballfans, Journalist:innen, Kritiker:innen und alle, die erkennen wollen, wie eng Sport und Macht heute verflochten sind. Schonungslos, fundiert und unbequem, eine notwendige Lektüre in einer Zeit, in der der Fußball zur Bühne der Weltpolitik geworden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung Von der schönsten Nebensache zur politischen Großbühne
Kapitel 1: Die größte WM aller Zeiten – und was dabei verloren geht Aufblähung, Rekorde und die Illusion vom Fortschritt
Kapitel 2: Komplexität statt Klarheit – der neue Turniermodus Warum kaum jemand durchblickt – und viele nur noch taktieren
Kapitel 3: Zwischen Zeitzonen und Zwangspausen – Spieler am Limit Reisebelastung, Verletzungsgefahr und entgrenzte Turnierpläne
Kapitel 4: Trumps zweite Bühne – Wie ein Präsident die WM vereinnahmt Nationalismus, Visa, Überwachung – die Vereinigten Staaten im Ausnahmezustand
Kapitel 5: Infantino – Der Architekt der Gigantomanie Ein FIFA-Präsident zwischen Allmacht, Machtpolitik und Realitätsverweigerung
Kapitel 6: Fans unerwünscht – Ein Fußballfest für die Reichen Kosten, Grenzen und soziale Ausgrenzung auf dem Weg ins Stadion
Kapitel 7: Der ökologische Wahnsinn – Fußball gegen den Planeten Was passiert, wenn CO
2
-Ausstoß egal ist – Hauptsache global
Kapitel 8: Kunstrasen, Kuppeln, Katastrophen – Stadien mit Nebenwirkungen Was passiert, wenn Fußball in Arenen stattfindet, die für andere Spiele gebaut wurden
Kapitel 9: Klima der Extreme – Hitze, Luftfeuchtigkeit und ihre tödlichen Nebenwirkungen
Kapitel 10: Die FIFA als Staat im Staate – Macht, Geld und moralische Bankrotterklärungen
Kapitel 11: Wer darf mitspielen – Visa, Grenzen und globale Ungleichheit
Kapitel 12: Greenwashing und Gigantismus – Die ökologische Verantwortungslosigkeit der WM 2026
Kapitel 13: Fußball in der Krise – Was bleibt vom Spiel?
Schlusswort: Wenn das Spiel zur Wahrheit wird
Einleitung
Von der schönsten Nebensache zur politischen Großbühne
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird die größte in der Geschichte des Sports. 48 Nationen, drei Gastgeberländer, über 100 Spiele und ein globales Millionenpublikum – die FIFA verspricht nicht weniger als das „größte Fußballfest aller Zeiten“. Austragungsorte sind Kanada, Mexiko und vor allem die Vereinigten Staaten, in denen die Mehrheit der Spiele stattfinden wird. Doch hinter dieser gigantischen Fassade beginnt ein komplexes und oft verstörendes Panorama aus politischen Spannungen, ökologischen Risiken, sozialer Ausgrenzung und wirtschaftlicher Selbstbedienung. Was uns als Fest verkauft wird, offenbart sich bei genauerem Hinsehen als ein Spiegel unserer Zeit – mit all ihren Bruchlinien, Widersprüchen und Machtverschiebungen.
Denn die WM 2026 ist mehr als ein Sportturnier. Sie ist politisches Symbol, wirtschaftlicher Hebel und ideologische Bühne zugleich. Sie findet in einem historischen Moment statt: In einem gespaltenen Amerika, das seit Januar 2025 erneut von Donald J. Trump regiert wird. Ein Präsident, der nicht nur polarisiert, sondern seine Macht gezielt über populäre Großereignisse inszeniert. Ein Mann, der nationale Interessen über internationale Offenheit stellt – auch im Kontext eines globalen Sportevents. Bereits jetzt beeinflussen seine Einreisepolitik, seine Rhetorik und sein Sicherheitsapparat die Vorbereitung dieser WM – und werden ihre Durchführung maßgeblich prägen.
Doch nicht nur Trump trägt zur politischen Aufladung des Turniers bei. Auch die FIFA selbst, unter der Führung ihres Präsidenten Gianni Infantino, steht in der Kritik. Statt als neutraler Weltverband aufzutreten, agiert die FIFA zunehmend wie eine supranationale Institution mit eigenen Machtinteressen. Die Aufstockung des Turniers auf 48 Mannschaften, die Aufblähung des Spielplans und das Ignorieren von Klima- und Gerechtigkeitsfragen zeigen deutlich: Es geht nicht mehr nur um Fußball. Es geht um Kontrolle, Einfluss und Gewinnmaximierung.
Dieses Buch ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – aus sportlicher, politischer, gesellschaftlicher und ökologischer Sicht. Es wirft Fragen auf, die in der offiziellen Berichterstattung oft ausgeklammert werden:
Warum wird ein Turnier in einem Land ausgetragen, das große Teile der Weltbevölkerung durch Visa-Hürden ausschließt?
Warum duldet die FIFA autoritäre Strukturen – solange sie Einnahmen garantieren?
Warum wird der Klimawandel ignoriert, wenn es um internationale Großveranstaltungen geht?
Und vor allem: Was bleibt vom Fußball, wenn sich die politische Wirklichkeit in die Stadien hineinschiebt?
In dreizehn Kapiteln werden wir die verschiedenen Ebenen dieser Weltmeisterschaft durchdringen. Wir analysieren die strukturellen Probleme des neuen Turniermodus, die Rolle der Gastgeberländer, die politische Instrumentalisierung durch Trump, die FIFA als wirtschaftlich getriebene Machtzentrale, die Verdrängung von Fans durch Eliten, die ökologischen Folgekosten – und schließlich den Sport selbst. Denn trotz aller Kritik ist es am Ende immer noch das Spiel, das Menschen begeistert, verbindet und Hoffnung weckt. Die Frage ist nur: Wem gehört dieses Spiel noch?
Die WM 2026 steht an einem Scheideweg. Sie kann als Wendepunkt in die Geschichte eingehen – entweder als Symbol für einen entgrenzten, entfremdeten Profifußball, der sich endgültig von seinen Wurzeln entfernt hat. Oder als Moment des Aufwachens, in dem klar wird: Sport ist nicht unpolitisch. Er ist Teil unserer Welt – und damit auch verantwortlich für das, was diese Welt ausmacht.
Dieses Buch ist ein Versuch, hinzusehen. Es möchte erklären, was verschwiegen wird, und einordnen, was oft verzerrt dargestellt wird. Es richtet sich an Fußballfans, die ihr Spiel lieben, aber nicht blind sind. An Journalistinnen und Kritiker, die Zusammenhänge erkennen wollen. An alle, die spüren, dass diese WM mehr bedeutet als Tore und Titel.
Willkommen zur WM 2026 – der politischsten, teuersten, komplexesten und vielleicht gefährlichsten Weltmeisterschaft aller Zeiten.
Kapitel 1: Die größte WM aller Zeiten – und was dabei verloren geht
Aufblähung, Rekorde und die Illusion vom Fortschritt
Als die FIFA im Jahr 2017 verkündete, dass die Fußball-Weltmeisterschaft ab 2026 mit 48 statt bislang 32 Nationen ausgetragen werde, war die Euphorie in vielen kleineren Fußballnationen groß. Endlich sollte das globale Turnier seinem Namen gerecht werden. Länder aus Asien, Afrika, der Karibik und dem pazifischen Raum sahen neue Chancen auf die größte Bühne des Weltfußballs. Doch schon kurz darauf wurden auch die warnenden Stimmen lauter. Fachleute, Trainer, ehemalige Spieler und Funktionäre warnten: Diese Reform sei nicht sportlich motiviert, sondern vor allem ein Machtinstrument der FIFA – und ein ökonomisches Manöver.
Was bleibt vom sportlichen Ideal, wenn ein Turnier künstlich aufgebläht, inhaltlich verdünnt und geografisch zersplittert wird? Dieses Kapitel analysiert die tiefgreifenden Veränderungen durch die WM-Aufstockung, die Folgen für die Spielqualität, die strukturellen Interessen der FIFA und die Frage, ob größer wirklich besser ist.
1.1 Die Zahlen des Gigantismus
48 Teams, 12 Vierergruppen, 104 Spiele – das sind die Eckdaten der neuen Weltmeisterschaft. Damit wird das Turnier 2026 nicht nur die größte, sondern auch die längste WM der Geschichte. Die Anzahl der Spiele steigt im Vergleich zu früheren Turnieren um satte 40. Die Dauer des Turniers wird voraussichtlich fast sechs Wochen betragen – mit entsprechend größerer Belastung für Spieler, Medien, Personal, Infrastruktur und Umwelt.
Was die FIFA als "inklusiven Fortschritt" verkauft, ist auf den zweiten Blick eine Strategie zur Gewinnmaximierung. Durch mehr Spiele entstehen mehr TV-Verträge, mehr Ticketverkäufe, mehr Werbefläche, mehr Merchandising – mehr Umsatz. Experten schätzen, dass die FIFA mit der WM 2026 zwischen 1 und 1,5 Milliarden US-Dollar mehr einnehmen wird als bei den vorangegangenen Turnieren. Diese wirtschaftliche Logik erklärt auch, warum der neue Modus so entschieden umgesetzt wurde – trotz großer sportlicher Bedenken.
1.2 Die sportliche Qualität unter Druck
Die Aufstockung bringt nicht nur mehr Spiele, sondern auch mehr Teams, die sich sportlich bislang kaum auf höchstem Niveau behaupten konnten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Vorrunde zu einseitigen Partien kommt, steigt. Statt Duellen wie Brasilien gegen Deutschland oder Frankreich gegen Argentinien könnte es in der Vorrunde häufiger Spiele wie Kanada gegen Burkina Faso oder Vietnam gegen Albanien geben. Das mag global gerecht erscheinen – aber es verwässert die sportliche Substanz.
Hinzu kommt: Durch die Zulassung von 16 zusätzlichen Teams werden die kontinentalen Qualifikationsphasen weniger relevant. In Europa etwa ist davon auszugehen, dass künftig selbst mittelklassige Nationalmannschaften problemlos das Ticket zur WM lösen. Die Folge: Ein Turnier, das einst für Exzellenz und Spitzenleistungen stand, wird zunehmend von politischen und ökonomischen Überlegungen geprägt – nicht von sportlicher Brillanz.
1.3 Wer profitiert – und wer verliert?
Klar ist: Kleine und mittlere Fußballnationen profitieren nominell von der neuen Struktur. Für viele Länder aus Afrika, Asien und Ozeanien war die Qualifikation zur WM bislang nahezu unerreichbar. 2026 hingegen werden voraussichtlich erstmals Länder dabei sein, die zuvor nie an einem WM-Turnier teilgenommen haben – etwa Indien, Kasachstan oder ein Team aus dem pazifischen Raum wie Neukaledonien oder Tahiti. Das kann das internationale Interesse am Turnier erhöhen und für emotionale Momente sorgen – etwa, wenn ein krasser Außenseiter gegen einen Titelaspiranten überraschend punktet.