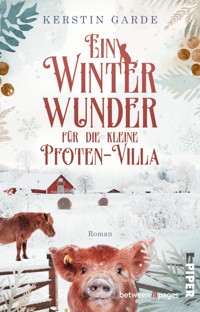6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Herzklopfen im Sanddornweg
- Sprache: Deutsch
Eine kleine Straße, in der die Herzen höher schlagen.
Louisa reist an die Ostsee, um in der Schneiderei ihrer Oma auszuhelfen. Doch das Geschäft im Sanddornweg steckt in finanziellen Schwierigkeiten, und es droht das Aus. Das will Louisa auf jeden Fall verhindern. Und sie hat auch schon eine zündende Idee: Die Schneiderei soll eine kleine Strandboutique werden. Mit Feuereifer stürzen Louisa und ihre Oma sich in den Umbau - natürlich mit der tatkräftigen Unterstützung der Sanddornweg-Bewohner und nicht ohne kleinere und größere Probleme. Und als wäre das nicht schon Aufregung genug, lernt Louisa auch noch den sympathischen Henrik kennen, der ihr Herz zum Hüpfen bringt ...
Liebeschaos, Renovierungschaos und mittendrin Louisa mit ihrem Traum vom eigenen Geschäft. Ein warmherziger Feel-Good-Roman an der Ostsee zum Wegträumen - der Auftakt zur Sanddornweg-Reihe von Kerstin Garde.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Über dieses Buch
Louisa reist an die Ostsee, um in der Schneiderei ihrer Oma auszuhelfen. Doch das Geschäft im Sanddornweg steckt in finanziellen Schwierigkeiten, und es droht das Aus. Das will Louisa auf jeden Fall verhindern. Und sie hat auch schon eine zündende Idee: Die Schneiderei soll eine kleine Strandboutique werden. Mit Feuereifer stürzen Louisa und ihre Oma sich in den Umbau – natürlich mit der tatkräftigen Unterstützung der Sanddornweg-Bewohner und nicht ohne kleinere und größere Probleme. Und als wäre das nicht schon Aufregung genug, lernt Louisa auch noch den sympathischen Henrik kennen, der ihr Herz zum Hüpfen bringt ...
Über die Autorin
Kerstin Garde schreibt über liebenswerte Heldinnen mit kleinen Schwächen und gefühlvolle Helden, die ihr Herz nicht verstecken. Wichtig ist ihr ein Augenzwinkern zwischen den Zeilen und eine ordentliche Portion Romantik. Die Autorin lebt mit Freund und Katzen in Berlin. Sie hat studiert und eine kaufmännische Ausbildung absolviert.
Kerstin Garde
Die kleine Strandboutique im Sanddornweg
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Clarissa Czöppan
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.deunter Verwendung von Motiven © iStockphoto.com: unpict | Say Cheese | Nerthuz
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0338-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Kapitel
... müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir uns für einen anderen Bewerber entschieden haben ...
Mit voller Wucht drückte mir jemand seine Schulter ins Gesicht. Ich taumelte einen Schritt zurück, dabei fiel mir fast das Handy aus der Hand.
»Au«, zischte ich und rieb meine Wange, schaute zu dem Hünen auf, der sich an der Stange über seinem Kopf festhielt und mich verständnislos ansah, während die Straßenbahn ruckelnd zum Halten kam.
Mit einem mechanischen Laut öffneten sich die Türen, und noch mehr Leute stiegen ein. Wie Sardinen quetschten sie sich in der übervollen Tram aneinander, und ich mit meinen eins sechzig kam mir vor wie ein besonders kleiner Fisch. Wenigstens musste ich an der nächsten Station raus. Langsam fuhr die Bahn wieder an, beschleunigte dann und warf uns alle zur Seite. Saß da vorne ein Fahranfänger?
Ich rappelte mich ächzend auf, wartete noch einen Moment, bis alle standen, und klickte auf das Display meines Handys, das mir wie durch ein Wunder immer noch nicht runtergefallen war, um die E-Mail zu schließen und die nächste zu öffnen. Eine weitere Absage, wie frustrierend.
In zweieinhalb Wochen lief mein Vertrag am Theater aus. Unser Intendant hatte ihn nicht verlängert, und trotz zahlreicher Bewerbungen, die ich seit Wochen verschickte, hatte ich bisher nichts Neues gefunden. Allmählich machte ich mir Sorgen. Doch ich sah es auch als Neubeginn, denn nach der Zeit beim Theater wollte ich mich neu orientieren. Deswegen hatte ich mich als Schneiderin bei verschiedenen Modedesignern beworben. Mein Plan war es, so viel Erfahrung wie möglich in diesem Bereich zu sammeln und meine Ersparnisse gut anzulegen, um mir mit Anfang dreißig meinen Traum vom eigenen Mode-Geschäft zu erfüllen. Meine Mutter, die Gründer beriet, war begeistert, hatte mir bereits jetzt Unterstützung zugesagt, obwohl das ja noch alles Zukunftsmusik war. Allerdings eine, die nicht mehr ganz so fern klang. Daher hatte ich mich auch unglaublich gefreut, als ich die Stellenausschreibung der aufstrebenden Designerin Francesca Giuliani entdeckt hatte, deren Stil ich abgöttisch liebte. Der Fransenrock aus ihrer letzten Kollektion war mein ganzer Stolz. Sie war mein Vorbild, verkaufte sie doch eigene Mode in der eigenen Boutique. Wo sie war, wollte ich eines Tages auch hin. Natürlich hatte ich mich prompt beworben. Die Ausschreibung hatte zu verführerisch geklungen: kreatives Arbeiten, Einblicke in die Modewelt, gutes Betriebsklima. Doch noch hatte Francesca Giuliani nicht auf mein Bewerbungsschreiben reagiert. Was in diesen Zeiten wohl kein gutes Zeichen war. Aber die Hoffnung wollte ich nicht so schnell aufgeben. Ich warf noch einen Blick in mein Postfach, das nun keine ungelesenen Nachrichten mehr enthielt, und ließ das Smartphone seufzend in meiner gestrickten Umhängetasche verschwinden. Wie sagte man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich änderte meine Position, weil wieder jemand drängelte, in dem Moment hielt die M15 abermals abrupt, und ich verlor erneut das Gleichgewicht. Wäre es nicht so voll gewesen, wäre ich wohl hingeschlagen, doch so federte mich das üppige Dekolleté einer gutmütig lächelnden Dame ab.
»Tschuldigung«, murmelte ich und schob mich an ihr vorbei, da ich hier aussteigen musste, als sich die automatische Tür auch schon wieder schließen wollte. Himmel, dieser Tramfahrer stand wirklich unter Strom.
Ich schaffte es gerade noch raus und war froh, die stickige Luft und das laute Getöse hinter mir zu lassen. Ein ganz normaler Morgen in Berlin, wenn sich Louisa Baumeister auf den Weg zur Arbeit machte.
Ich war ein bisschen spät dran, also atmete ich tief durch und zog meine Lieblings-Strickjacke eng um mich, um dann eilig dem kleinen Pfad zu folgen, an dessen Wegesrand es um diese Jahreszeit herrlich blühte, bis ich das alte Backsteingebäude erreichte.
Mein Blick wanderte hoch zu den großen Buchstaben über dem Eingang des Gemäuers, die den Namen Schaupalast bildeten. Ein in die Jahre gekommenes Theater mitten im Grünen, fern der City. Ich hatte es immer gemocht. Aber schon bald würde ich nicht mehr jeden Morgen hierherkommen, was mich traurig stimmte.
Ich ging über den Hof. Auf dem kleinen Parkplatz im Innenhof entdeckte ich Maxims silbernen Mercedes, der gerade einparkte. Instinktiv hielt ich inne. Ich wollte Begegnungen mit meinem Ex-Freund soweit es ging vermeiden. Aber das war leichter gesagt als getan. Er war der Stellvertreter unseres Intendanten und somit einer meiner Chefs. Ein bisschen fühlte ich mich wie das Kaninchen vor der Schlange, als sich die Tür seines glänzenden Wagens öffnete und Maxim ausstieg. Er blinzelte erst in die Sonne, ehe er mir zunickte – ich nickte zurück. Was hätte ich auch sonst tun sollen?
Seine blauen Augen wirkten leer, jede Zärtlichkeit war aus ihnen gewichen. Ich ließ mir nicht anmerken, wie sehr mich das verletzte. Sie verschwanden hinter einer getönten Brille, die er aus seinen hellbraunen Haaren zog.
Auf der Beifahrerseite stieg Valentina Estos aus, Star unseres Hauses und der Grund, weshalb Maxim mich verlassen hatte. Ein triumphierendes Lächeln umspielte ihre feuerroten Lippen, als sie mich sah. Mit schwingenden Hüften lief sie um den Wagen herum und küsste Maxim innig vor meinen Augen, als wollte sie mir die Show ihres Lebens bieten – und irgendwie tat sie das ja auch.
Aber ansehen wollte ich es mir nicht, wie sie ihn fast auffraß. Rechtzeitig fiel mir ein, dass ich endgültig zu spät kommen würde, wenn ich mich jetzt nicht sputete. Ich ließ die beiden stehen, bog rasch nach links und lief die kleine Außentreppe in den Keller hinunter, wo sich seit einem Umbau vier Nähstuben und der Kostümfundus befanden. Das ratternde Geräusch der Nähmaschinen hallte durch den Gang, während ich versuchte, dieses gehässige Grinsen der Estos aus meinem Kopf zu kriegen. Und diesen Kuss!
Bestürzt wurde mir klar: Ich fühlte mich nicht mehr wirklich wohl an diesem Theater, an dem ich seit meiner Ausbildung war. Vielleicht war es also gut, dass man mich nicht länger als Kostümschneiderin beschäftigen wollte. Ich brauchte einen Tapetenwechsel.
»Alles auf Anfang!«, hallte es über mir.
Die Tontechnik im großen Saal zwei Etagen über uns testete die Lautsprecheranlage. Die wöchentliche Soundprobe fand statt. Schon bald fiel der Vorhang zum letzten Mal für unser aktuelles Stück. Wie es danach weiterging, wusste im Moment niemand so recht. Außer meinem wurden auch andere Saisonverträge nicht verlängert.
Ich betrat die kleine Kammer, die ich mir mit unserer Auszubildenden Kim teilte. Genau wie sie jetzt hatte auch ich meine Schneiderinnenkarriere hier gestartet, war irgendwann für die nächste, dann die übernächste Spielzeit übernommen worden und hatte einige Intendanten kommen und gehen sehen. Dann waren Jakob Oberding und Maxim Helling aufgetaucht, mit neuen Konzepten und frischen Ideen, mit denen sie das Theaterleben umgekrempelt hatten.
Und nicht nur dieses, auch mein Leben war aus den Fugen geraten. Zuerst hatte sich Maxim mir gegenüber sehr charmant verhalten, ich war sehr schnell auf Wolke sieben gelandet und genauso schnell abgestürzt. Denn kaum waren wir zusammengekommen, hatten ihn Dinge gestört, die ihm zuvor nicht mal aufgefallen waren. Kleinigkeiten, die sich hochgeschaukelt hatten.
Als wäre das nicht genug gewesen, hatte er angefangen, von unserer Diva Valentina zu schwärmen, wie anmutig sie sei, wie viel Präsenz sie auf der Bühne habe und dieses besondere Etwas, das sie stets umgebe ... Nein, daran wollte ich jetzt nicht denken. Denn schon sah ich wieder diesen Kuss im Innenhof vor mir ...
Ich hatte keine Lust mehr auf das Theater, auf alles hier, wollte etwas Neues machen. Modedesign – davon habe ich als Mädchen schon geträumt. Missmutig beobachtete ich Kim. Gerade zog sie zwei Stoffrollen aus dem Regal, breitete sie nebeneinander auf ihrem Arbeitstisch aus und fotografierte sie mit ihrem Handy für ihren Instagram-Account, wo sie einer nicht gerade kleinen Followerzahl Einblicke in unsere Arbeitswelt gewährte.
»Gut, dass du kommst, Lou«, sagte sie und steckte ihr Handy in ihre Hosentasche. »Welchen Stoff soll ich für das Ferdinand-Kostüm nehmen?«
»Braucht der ein neues?«, wunderte ich mich.
Kim nickte.
»Was machen die Schauspieler nur immer mit den Kostümen?« War es wirklich so schwer, etwas behutsamer mit ihnen umzugehen? In der Spielzeit war es bisher mindestens drei Mal vorgekommen, dass ein Kostüm komplett neu angefertigt werden musste.
Ich ließ meine Tasche neben meinen Stuhl gleiten und ging rüber zu Kim, um die Auswahl zu mustern.
»Jetzt haben sie dir also ein Kostüm anvertraut, Glückwunsch.« Bisher hatte Kim nur Zuarbeiten machen sollen. Aber sie war wirklich gut und verdiente diese Anerkennung.
»Ja, total aufregend.«
»Nimm die Gabardine für die Jacke. Am Infobrett steht, dass alle Herrenkostüme Gabardine als Basis haben sollen.«
»Wirklich? Ist Jersey nicht besser?«, fragte Kim und befühlte ihren bevorzugten Stoff mit Daumen und Zeigefinger. »Er ist weicher und schmiegt sich besser an.«
»Genau, deswegen ist Gabardine vorzuziehen. Die hat einen besseren Sitz und knittert nicht so schnell. Gerade wenn es um Jacken geht.«
»Ja, gut, dann nehme ich die.« Eifrig rollte Kim den Jerseystoff wieder auf und legte ihn ins Regal zurück, als mir noch etwas einfiel.
»Warte noch!« Ich ging zu meinem Arbeitsplatz und zog die obere Schublade des kleinen Werkzeugcontainers auf, um meine Farbpalette herauszunehmen.
»Deine Gabardine ist in Burgunderrot«, war ich mir sicher.
»Burgunder ist doch dunkler mit einem violetten Unterton«, wunderte sich Kim und runzelte die Stirn unter ihrem Strähnchenpony.
»Ferdinand braucht ein warmes Scharlachrot. Außerdem muss der Farbton zu den goldenen Knöpfen passen, aber Gold und ein kühles Burgunderrot beißen sich.« Ich hielt die verschiedenen Rottöne meiner Palette an den Gabardinestoff, bis ich eine übereinstimmende Farbgebung erkannte. »Wie ich es mir dachte, ein helles Burgunder.«
»Wo habe ich nur meinen Kopf? Darauf hätte ich selbst kommen können.«
»Du bist in der Ausbildung, da macht man Fehler und lernt daraus.« Ich strich ihr tröstend über die Schulter, denn ich wusste, wie perfektionistisch Kim war und wie übel sie sich jeden noch so kleinen Fehler nahm. Dann gab ich ihr die Palette für die Farbbestimmung zur Hilfe.
»Mann, Lou, ich werde dich echt vermissen, wenn du hier aufhörst«, sagte Kim traurig. »Ich meine, wie soll das ohne dich werden? Ist nicht fair, dass sie dich nicht in die nächste Spielzeit übernehmen. Wenn da mal nicht die blöde Estos ihre Finger im Spiel hatte. Was die und Maxim abgezogen haben, geht gar nicht.«
Ob sie recht hatte? Zuzutrauen wäre es Valentina, sie konnte mich noch nie leiden. Aber jetzt hatte sie ja, was sie wollte: Maxim. Ich war wohl kaum mehr eine Bedrohung für sie.
»Du bist eine gute Schneiderin, du kriegst das schon ohne mich hin. Außerdem bin ich nicht aus der Welt. Du hast ja meine Nummer und kannst mich immer anrufen, wenn was ist.«
Kim atmete leise auf. »Danke, Lou.«
Mit ihren süßen neunzehn war sie für mich die kleine Schwester, die ich mir immer gewünscht, aber nie bekommen hatte. Meine Mutter war aufgrund ihres Kontrollzwangs bereits mit mir überfordert gewesen. Ein weiteres Kind war für sie nicht infrage gekommen. Und vielleicht war das auch ganz gut so.
Da keine Scharlach-Gabardine in unserem Regal lag, musste Kim raus ins Lager, um sie zu besorgen. Derweil schnappte ich mir das Kostüm des Ariel von meinem To-do-Stapel, um mit dem Flickwerk zu beginnen. Die Fasern schimmerten sanft und fühlten sich herrlich weich unter meinen Fingern an. Wehmütig untersuchte ich das Gewand nach Rissen, vielleicht das letzte Mal, dass ich mich um unseren Luftgeist kümmerte. Dabei fühlte es sich an, als hätten wir das Projekt gerade erst begonnen. Mein Blick wanderte vom Stoff zu dem Wandspiegel gegenüber, der sich hinter Kims Nähtisch befand. Ein Überbleibsel der Maske, die vor dem Umbau hier unten gewesen war.
Zeitungsartikel von der Premiere im Januar dieses Jahres hingen mit Magneten befestigt an dem Spiegel. Das Theater-Highlight 2016 lautete eine der Schlagzeilen. Und: Shakespeares Sturm feiert Erfolg in Berlin. Darunter fanden sich etliche Fotos von dem Großereignis, alle hatten sich in Schale geworfen, ob Premierengast oder Mitarbeiter, sie hielten Champagnergläser in der Hand, lachten und feierten. Auch ich wirkte glücklich, die roten Haare hochgesteckt, in ein schönes Kleid gehüllt, das sogar Maxim an mir gemocht hatte.
»Du siehst sexy aus«, hatte er gesagt. Arm in Arm lächelten er und ich in die Kamera. Die Welt war da noch in Ordnung gewesen. Wie hatte ich ahnen sollen, dass sie bereits einige Monate später gänzlich in Scherben liegen würde?
Jetzt blickte mir eine ganz andere Lou im Spiegel entgegen als die auf den Premierenfotos. Es war die echte Lou, die sich nicht wie ein It-Girl aufbrezelte und lieber in Strickstulpen als High Heels herumlief, die ihren eigenen Stil hatte, zu dem sie stand. Ich hatte lange wellige Haare, die in einem geflochtenen Zopf über meine Schultern glitten, trug nur dezentes Make-up, und unter einer erdfarbenen Strickjacke lugte ein grüner, knöchellanger Rock mit Fransen hervor. Wie aus einem Katalog von Francesca Giuliani. Maxim mochte Boho nicht. Und er mochte kein Grämmchen zu viel auf den Rippen – bei seinen Frauen.
»Hast du zugenommen? Vielleicht gehst du ja doch mal ins Studio«, hallten Maxims Worte in meiner Erinnerung nach. Wieder und wieder hatte er etwas gefunden, das er an mir ausgesetzt hatte. Meine Figur, obwohl ich normalgewichtig war, meine zu langen zu roten Haare. Es hatte mich stets getroffen, an meinem Selbstbewusstsein gerüttelt, und verfehlte selbst jetzt, zwei Monate später, seine Wirkung nicht. Ich betrachtete mich genauer, ich war keine Schönheit, aber vor Maxim war ich immer zufrieden mit mir gewesen. Mir wurde schwer ums Herz, weil mir klar wurde: Er hatte immer schon eine ganz andere Lou gewollt. Eine, die mehr wie die Estos war, eine Schauspielerin, die gern mit ihm im Rampenlicht stand. Aber ich hatte auch etwas aus der Zeit mit Maxim für mich mitnehmen können: Ich würde nicht noch mal erlauben, dass mich jemand kleinmachte.
»Meine Güte, die proben heute wirklich laut, da hat wohl der Neue vom Sound die Anlage auf volle Pulle gedreht und die Mikros der Darsteller übersteuert«, erschreckte sich Kim, als sie plötzlich in unsere Nähkammer zurückkehrte, eine riesige Rolle scharlachroter Gabardine vor sich hertragend, die mit einem Knall auf ihrem Arbeitstisch landete. Erst als unsere Tür ins Schloss fiel, verstummten die kraftvollen Stimmen der Schauspieler und das Fiepen ihrer Headsets, die durch das ganze Theater schallten. Die Freitage im Theater waren in der Tat immer laut und hektisch.
In dem Moment erklang ein Signalton meines Handys, der mich über das Eintreffen einer neuen Mail informierte. Ich sah rasch nach, ließ aber schon beim Lesen des Betreffs die Schultern hängen.
»Wieder eine Absage?«, fragte Kim bedrückt.
Ich nickte nur, es schien doch wie verhext. Wenigstens war es auch diesmal nicht Francesca Giuliani. Ich hatte wirklich Lust auf diesen Job. Ich brauchte diese Veränderung in meinem Leben, hier fiel mir die Decke auf den Kopf. Außerdem hoffte ich, Erfahrungen bei ihr sammeln zu können, die mir später bei der Gründung meines eigenen Geschäfts hilfreich sein würden.
»Du hast das Kostüm nicht links herum gedreht und bringst die Stecknadeln auf der falschen Seite des Stoffes an«, wies mich Kim hin, nachdem wir wieder mit der Arbeit begonnen hatten. Sie hatte recht, die schöne Seite musste nach außen. Solche Fehler passierten mir sonst nicht. Erschöpft sank ich auf meinen Stuhl.
Im Moment lief nichts rund für mich. »Diese vielen Standardabsagen ...« Die Sache mit Maxim und der Estos ...
»Tut mir echt leid, ist heutzutage nicht einfach. Vielleicht solltest du dir nach der Spielzeit eine kleine Auszeit nehmen, um dich zu ordnen«, überlegte Kim und klang plötzlich mehr wie eine große denn eine kleine Schwester, nämlich überaus vernünftig. »Du hast doch Verwandte an der Ostsee? Das wäre jetzt im Sommer sicher total schön.«
Ich würde tatsächlich lieber an die Ostsee fahren, um bei einem Stück selbstgebackenem Sanddorn-Kuchen den Sommer zu genießen oder dem beruhigenden Rauschen der Wellen zu lauschen und den Geruch von Salz in der Luft in mich aufzunehmen, anstatt auf Jobsuche zu gehen. Insbesondere, wenn diese so frustrierend ablief, wie sie es gerade tat.
In den Dünen spazieren, die Zehen ins kühle Nass tauchen. Wie mir das jetzt guttun würde! Einfach alles hinter mir lassen. Nur für kurze Zeit ... um mich zu ordnen.
Meine Großmutter besaß ein kleines Haus samt Änderungsschneiderei im Rostocker Stadtteil Warnemünde, wo ich oft die Sommerferien verbracht hatte, mit der See vor der Tür. Ein wunderschönes zweites Zuhause. Die Erinnerungen an diese Zeiten kamen in mir hoch. Ich hatte nicht nur am Strand von Warnemünde Schwimmen, sondern auch Nähen an Omas Arbeitstisch in ihrem Laden gelernt. Wie ich es geliebt hatte, dem Rattern ihrer uralten Nähmaschine zu lauschen.
Aber derzeit kam ein Urlaub nicht infrage, ich brauchte dringend eine neue Anstellung und musste mich darauf konzentrieren, kein Raum für Erholung. Es blieb mir also nur, in schönen Erinnerungen zu schwelgen und so viel Kraft wie möglich am Wochenende zu tanken ...
2. Kapitel
Ein lautes Bimmeln riss mich am frühen Montagmorgen aus dem Schlaf. Ich schreckte hoch und stellte fest, dass ich auf meiner Couch vor dem Fernseher eingeschlafen war.
Benommen tastete ich zwischen dem neuen Giuliani-Katalog, einer leeren Chipstüte und ein paar unbenutzten Taschentüchern nach dem Handy auf dem TV-Tisch und warf einen Blick aufs Display, wo sich ein Foto von meiner Mutter zeigte.
»Hallo?«
Meine Mutter meldete sich nur überaus selten, als Unternehmensberaterin hatte sie stets einen vollen Terminkalender. Dass sie so früh anrief, verursachte ein ungutes Gefühl in meinem Bauch.
»Lou, es ist etwas Schlimmes passiert«, sagte sie auch schon atemlos. Im nächsten Moment stand die Welt still. Ich hörte nur meinen eigenen Herzschlag.
»Oma hatte einen Unfall.«
Jetzt setzte mein Herz einen Takt lang aus.
»Was? Wie geht es ihr?«, sprudelte es aufgeregt aus mir hervor. Ich hatte noch gestern Abend versucht, sie zu erreichen, nachdem ich die letzten Tage so viel über die Ostsee nachgedacht hatte. Ihre Stimme zu hören hätte mich sicher aufgebaut. Doch es war niemand rangegangen. Daher hatte ich geglaubt, sie wäre früh zu Bett gegangen. Nun dämmerte mir, warum ich sie nicht erreicht hatte. Meine Oma war mit ihren neunundsechzig Jahren zwar taufrisch, aber ›Unfall‹ konnte so ziemlich alles bedeuten!
»Sie ist vom Fahrrad gestürzt und hat sich den Kopf angeschlagen. Ihre Nachbarin Irmgard Nawrath hat mich informiert. Sie wird im Uniklinikum behandelt. Irmchen sagt, es wäre nur eine Platzwunde, doch man behält sie zur Beobachtung da.«
Unruhig stand ich auf und lief in meinem Wohnzimmer auf und ab. Platzwunde schön und gut, aber was meinten die Mediziner denn noch beobachten zu müssen?
»Ich würde gern nach Oma sehen, bin aber gerade in London gelandet, weil ich auf einer Konferenz zum Thema ›Neue Wege für Start-ups im Social-Media-Bereich‹ einen Vortrag halten soll. Die Veranstaltung läuft über mehrere Tage. Und Papa versinkt in all den Rechnungen und Bilanzen für die Buchhaltung. Er muss die Termine seiner Firma unbedingt einhalten. Doch es wäre gut, wenn jemand nach ihr sieht. Könntest du vielleicht ...«
»Ich fahre zu ihr!«, unterbrach ich sie entschlossen. Wenn Oma Hilfe brauchte, gab es keinen Kompromiss für mich.
»Das wäre toll, Schatz. Ich mache mir Vorwürfe«, erklärte sie. »Ich hatte eigentlich längst zu ihr fahren und sie besuchen wollen. Aber die letzten Male hat sie mich nicht gerade willkommen geheißen.«
Zwischen Oma und meiner Mutter flogen oft die Fetzen, immer waren sie verschiedener Meinung, egal um was es ging. Als käme die eine vom Mars und die andere von der Venus. Allerdings waren sie sich in einer Hinsicht ähnlich: Sie trugen beide das Herz auf der Zunge, und wenn sie sich erst so richtig kabbelten, gab keine von ihnen nach. Manchmal fiel der Apfel eben doch nicht weit vom Stamm. Ich hatte einige Male zwischen ihnen vermittelt, aber diesmal schien es ärger zu sein als sonst. Dennoch spürte ich, wie sehr sich meine Mutter sorgte.
»Ein Handy hat sie sich immer noch nicht angeschafft. Sonst hätte ich sie auch in der Klinik angerufen«, klagte meine Mutter. »Und bei der Zentrale vom Krankenhaus lande ich ständig in der Warteschleife. Wäre Irmchen nicht gewesen, wüssten wir nichts von dem Unfall. Sie hat keinem gesagt, dass man uns benachrichtigen soll, Irmchen hat von sich aus angerufen. Kannst du dir das vorstellen?«
Es passte eigentlich nicht zu Oma, uns im Unklaren zu lassen, Streit hin oder her. Das verstärkte meine Sorge.
»Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt«, meinte nun auch meine Mutter. »Irmchen hat merkwürdig rumgedruckst, ich musste ihr alles aus der Nase ziehen, und dann hat sie auch noch schnell aufgelegt, als ich gefragt habe, wer sich nun um das Geschäft kümmert.«
Das klang alles gar nicht nach meiner Großmutter! Ein Grund mehr, sofort aufzubrechen. Das hieß, nachdem ich alles im Theater geregelt hatte.
»Ich kümmere mich um Oma!«, versicherte ich Mama noch mal.
»Ich versuche so schnell wie möglich nachzukommen.«
Klang nach einem Plan.
Nachdem wir aufgelegt hatten, machte ich mir eine Liste für die Dinge, die ich vor meinem Aufbruch zu erledigen hatte. Als Erstes rief ich unsere Personalabteilung an, um zu klären, ob ich für ein paar Tage freinehmen konnte. Mein Urlaub war schon aufgebraucht, doch ich hoffte, dass man mir unbezahlten Urlaub genehmigte.
Ich wusste, wenige Wochen bevor der Vertrag auslief, war das alles andere als günstig. Und unsere Personalchefin galt auch nicht als besonders umgänglich. Kim nannte sie gern »Mini-Drachen«, was nicht nur ihrer geringen Körpergröße geschuldet war, sondern auch ihrer hohen Stimme, die Frequenzen erreichte, welche den fehlerhaften Rauchmelder meiner Nachbarin vor Neid erblassen ließen. Ich freute mich wenig auf das Gespräch. Aber nachdem ich die Situation geschildert hatte, zeigte sich die Personalchefin überraschend verständnisvoll. Sogar so verständnisvoll, dass ich mir einen Moment lang nicht sicher war, ob ich überhaupt den Mini-Drachen am Apparat hatte, wäre da nicht die verräterische Stimme gewesen.
»Ein familiärer Notfall geht vor, das fällt in den Bereich der Kurzzeitpflege von Angehörigen«, sagte sie völlig unaufgeregt.
»Das heißt, Sie genehmigen den Urlaub?«, versicherte ich mich.
»Können Sie abschätzen, wie lange Ihre Angehörige Ihre Hilfe benötigt?«
Ich vermutete, eine Woche käme hin.
»Ich mache mir einen Vermerk.«
»Und ist der Urlaub genehmigt?«, fragte ich vorsichtig noch mal, ich wollte dem Mini-Drachen nicht durch mein Nachhaken verärgern.
»Natürlich. Wir brauchen allerdings einen schriftlichen Antrag. Wenn Sie es schaffen, schicken Sie uns diesen umgehend zu, Sie erhalten dann eine Bestätigung von uns.«
Es lebe die Bürokratie. Wieso sollte es einfach sein, wenn's auch kompliziert ging. Aber immerhin, der Sonderurlaub war genehmigt!
»Kein Problem, ich kümmere mich darum. Und vielen Dank für Ihr Verständnis!«
»Natürlich, Frau Baumeister. In solch einer Lage gibt es kein Wenn und Aber, ich habe persönliche Erfahrung mit Angehörigenpflege.«
Ah, deswegen war die Personalchefin so handzahm.
»Ich hoffe, Ihrer Großmutter geht es bald besser.«
»Danke«, sagte ich ehrlich.
Dann legte ich auf und setzte mich an den Laptop, um gleich den Antrag zu verfassen. Im Internet gab es Vorlagen, was die Sache einfach machte. Schließlich druckte ich das Dokument aus, unterschrieb es und steckte es in einen Umschlag. Nachdem ich den Brief frankiert hatte, widmete ich mich dem nächsten Punkt meiner Planung. Ich suchte per Handy die Fahrzeiten nach Rostock ab Bahnhof Zoo heraus und buchte gleich eine Fahrkarte für den Zug in zwei Stunden. Bis dahin hatte ich noch einiges zu erledigen. Rasch verschwand ich im Bad, zog mich anschließend an und holte meine Reisetasche unter dem Bett hervor, um das Nötigste zu packen.
Sicher vergaß ich die Hälfte, doch die Sorge um meine Großmutter trieb mich zur Eile. Ich kontrollierte, ob alle technischen Geräte aus waren, und bestellte dann ein Taxi, schlüpfte in meine Schuhe, warf mir die Tasche über die Schulter und verließ meine Wohnung mitsamt meines Antrags in der Hand, um bei Frau Krause nebenan zu klingeln.
Die ältere Dame öffnete mir, eine Kippe hing ihr aus dem Mundwinkel. Sie erinnerte mich an eine der Schwestern von Marge Simpson. »Joa?«, fragte sie und sah mich müde an.
»Ich muss ganz dringend nach Rostock, liebe Frau Krause, eine Familienangelegenheit. Wären Sie so nett, meine Pflanzen zu gießen und ab und zu nach der Post zu sehen?« Ich half ihr immer beim Einkäufe-Hochtragen oder nahm Pakete für sie an, im Gegenzug sah Frau Krause nach meiner Wohnung, wenn ich verreiste. Ich hoffte daher, dass sie das auch diesmal für mich machen würde.
»Aber sicher, Frau Baumeister«, entgegnete sie mit rauchiger Stimme und hielt die faltige Hand auf. Ich machte die Ersatzschlüssel von meinem Schlüsselbund ab und gab sie ihr.
»Vielen lieben Dank, Frau Krause, Sie helfen mir sehr. Der Zimmerefeu braucht immer feuchte Erde. Beim Drachenbaum reicht es, wenn er Ende der Woche etwas Wasser bekommt. Aber das wissen Sie sicher noch. Ich habe beide noch mal gegossen.«
»In Ordnung. Das mache ich für Sie.«
»Sie haben was gut bei mir, Frau Krause.«
Jetzt musste ich mich beeilen, das Taxi wartete sicher schon. Außerdem musste ich noch den Brief einwerfen, zum Glück stand direkt vor unserem Mietshaus ein Briefkasten.
Als ich endlich im Zug nach Rostock saß, schaute ich aus dem Fenster und beobachtete einfach nur die Landschaft, die sich zusehends veränderte, um mich von dem Trubel von heute Morgen etwas zu erholen. Wolken zogen gemächlich über den Himmel, und eine Schar riesiger Windräder zeigte sich bald am Horizont, die sich um die Wette drehten. Ich kam aber kaum dazu, den Anblick zu genießen. Hoffentlich war Oma okay. Sie war eine taffe Frau, gut organisiert und ehrgeizig. Seit Opa gestorben war, führte sie den Laden im Sanddornweg allein. Ich hatte immer den Eindruck gehabt, sie würde selbst in ihrem Alter noch Bäume ausreißen können. Dass sie nun im Krankenhaus lag, besorgte mich sehr.
Ich sollte ihr sagen, dass ich kam. Dann konnte ich auch gleich nachhaken, wie es ihr ging. Also schnappte ich mir mein Handy, suchte im Netz nach der Nummer des Uniklinikums und rief an, in der Hoffnung, nicht in der Warteschleife zu landen wie Mama.
Aber genau dort fand ich mich wieder. Zehn Minuten später fürchtete ich, dass es teuer werden würde, und legte auf. Wie ärgerlich, heutzutage aber wohl ganz normal.
Plötzlich bimmelte das Handy, noch bevor ich es wieder weggesteckt hatte.
Es war Kim, die sich über WhatsApp meldete.
Was ist passiert? Oberding sagt, du kommst nicht mehr zur Arbeit?
Ich muss mich um meine Oma kümmern. Später mehr!, schrieb ich zurück, um Kim nicht in der Luft hängen zu lassen. Aber mehr wusste ich ja im Moment selbst noch nicht.
Der Zug fuhr anderthalb Stunden später ins wunderschöne Rostock ein. Ich verspürte einen Anflug von Nostalgie, als ich durch das Fenster die Grünanlagen und vielen Häuser vorbeirauschen sah, die mit schönen Außenfassaden versehen waren. Sogar den alten stillgelegten Wasserturm konnte ich erkennen, bevor der Hauptbahnhof in mein Blickfeld rückte und mein Herz schneller klopfte. Endlich war ich da.
3. Kapitel
Wegen der beginnenden Sommer- und Urlaubssaison war am Hauptbahnhof fast so viel los wie am Bahnhof Zoo. Ich folgte den Menschen durch die Halle zum Ausgang.
Auf dem Platz vor dem weitläufigen Gebäude, dessen Fassade himmelblau leuchtete, hielt ich inne, um mich zu orientieren. Google Maps hatte mir verraten, dass das Uniklinikum im Nordosten der Stadt lag, südlich von Hohe Düne. Ich brauchte ein Taxi, das ging schneller als mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Hastig lief ich über den Asphalt zum nächstgelegenen Taxistand, doch kurz bevor ich ihn erreichte, rutschte mir der Träger meiner Reisetasche von der Schulter, und mein unhandliches Gepäck sackte zu Boden.
Ich hievte den Gurt wieder hoch, als mich jemand von hinten anrempelte und überholte. Der Kerl hatte so viel Schwung drauf, dass er mich von den Füßen riss. Ich knallte hin, während der Fremde seelenruhig die Tür des nächstbesten Taxis öffnete und einstieg.
»He! Sie ...« Mir fehlten die Worte.
Er reagierte nicht mal.
»Autsch!«, grummelte ich, als ich ein fieses Brennen verspürte. Ich hatte mir das Knie aufgeschlagen, Blut floss über meine Haut. Auch das noch. »Vielen Dank!«, rief ich dem Kerl nach, der aber schon davongebraust war. Doch selbst wenn er mich gehört hätte, es wäre ihm wohl egal gewesen.
»Was für ein Arsch!«, hörte ich eine warme, samtene Stimme hinter mir. Ich wandte den Kopf. Ein hochgewachsener Mann stand hinter mir. Da mich die Sonne stark blendete, waren seine Züge nur schemenhaft. Also legte ich eine Hand über meine Augen, was nur bedingt half.
»Entschuldigen Sie meine Wortwahl. Warten Sie, ich helfe Ihnen.« Eine starke Hand griff nach meinem Arm. Mit einer erstaunlichen Leichtigkeit zog mich der Fremde auf die Beine.
»Danke«, murmelte ich.
»Sind Sie in Ordnung? Sie bluten ja.«
Ich schaute an mir runter, mein Knie hatte ganz schön was abbekommen, aber es war sicher nur eine Schürfwunde.
Er reichte mir ein Taschentuch, das er aus seinen beigen Shorts zauberte.
»Bitte.«
Als ich es entgegennahm, bemerkte ich seine leicht gebräunte Hand.
Ich wischte mein Knie vorsichtig ab und zischte. Tat doch mehr weh als erwartet.
»Ich muss ins Krankenhaus«, murmelte ich und faltete das Taschentuch zusammen. Ich stand ganz schön unter Zeitdruck, Oma brauchte mich.
»Ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht.«
Seine Stimme war tief und männlich, doch auch sanft. Etwas kribbelte in meinem Nacken bei diesem Timbre. Was mich irritierte, denn so was war mir noch nie passiert. Konnte eine Stimme einen streicheln?
»Ich meine, ich muss zu meiner Großmutter ins Uniklinikum.« Ich blickte wieder zu ihm hoch, während ich das Taschentuch in meine hintere Hosentasche stopfte. Noch immer konnte ich sein Gesicht nicht richtig erkennen, nur, dass er markante Züge hatte und volles Haar. Auch ihm hing eine Tasche über der Schulter. Außerdem roch er angenehm nach Nüssen und Moschus. »Wenn hier mal ein Taxi frei wäre, würde das helfen.« Ich ärgerte mich noch immer über diesen Grobian, der es mir vor der Nase weggeschnappt hatte.
»Das haben wir gleich«, sagte der Fremde amüsiert und wandte sich um. Aus dem Hauptbahnhof kamen immer mehr Menschen, und der Platz davor füllte sich.
»Was haben Sie denn vor?«, wunderte ich mich, aber ich bekam keine Antwort. Seine hochgewachsene Gestalt verschwand irgendwo in der Menge.
Sollte ich hier auf ihn warten? Eigentlich wollte ich weiter, doch die kleinste Bewegung genügte, das Brennen wieder aufleben zu lassen. Erneut begutachtete ich mein Knie, es sah nicht schlimm aus, tat aber wirklich gemein weh. Außerdem blutete es wieder. Mit dem Taschentuch, das ich wieder hervorzog, versuchte ich die Blutung zu stillen, indem ich es vorsichtig auf die Stelle drückte. Das half zumindest ein wenig.
Plötzlich hielt ein Taxi direkt vor mir, und ein Mann mit hellblauem Shirt und beigen Shorts, der auf der Rückbank saß, öffnete mir lächelnd die hintere Tür.
»Steigen Sie bitte ein«, forderte er mich auf. Er war es. Ich erkannte seine Stimme, und nun konnte ich ihn auch richtig sehen. Ein Mann wie aus einer Werbeanzeige: Dreitagebart, schwarze Haare, gewinnendes Lächeln. Und geheimnisvolle dunkle Augen, die einen in ihren Bann zogen. Er stieg aus und deutete einladend zur Tür des Wagens.
»Für mich?«
»Wenn Sie mögen?«
»Und Sie? Wollen Sie denn kein Taxi?«, wunderte ich mich.
»Ich dachte, wir teilen es uns«, sagte er und deutete auf meine Tasche, die noch über meiner Schulter hing.
»Vielleicht müssen wir gar nicht in dieselbe Richtung«, gab ich zu bedenken.
»Das Uniklinikum liegt auf meinem Weg.«
Na, wenn das so war. Warum eigentlich nicht.
»Darf ich?«, fragte er und wartete, bis ich zustimmte, dann nahm er mir die Tasche ab und ließ mein Gepäck im Kofferraum verschwinden.
»Wollen wir?«
Er lächelte charmant und ließ mich nicht aus den Augen, während er um das Taxi herumlief. Ich war ziemlich überrascht, dass er das für mich, eine quasi Fremde, machte, und fand es unglaublich sympathisch. Ich nahm Platz, schnallte mich an, und er stieg von der anderen Seite dazu.
Wieder dieser Duft. Ich versuchte ihn zu ignorieren, aber das war kaum möglich. Stattdessen sog ich ihn auf und versank tiefer im Leder der Rückbank.
»Wo müssen wir hin?«, fragte der Fahrer, und mein Begleiter nannte ihm unseren ersten Halt.
»Danke, das war wirklich nett von Ihnen, mir zu helfen«, sagte ich ehrlich. »Wenn Sie nicht gerade auch am Bahnhof gewesen wären, würde ich wohl jetzt noch einem Taxi nachjagen.« Vielleicht saßen wir ja sogar im gleichen Zug, überlegte ich und musterte ihn genauer. Offensichtlich hatten wir jedoch in unterschiedlichen Klassen gesessen. Auch wenn er normale Sommerkleidung trug, sah mein Schneiderinnenauge, sie war teuer. Ich hingegen saß in meinem rostroten Strickkleid mit Beinstulpen und einem angeschlagenen Knie neben ihm, die Haare zu roten Zöpfen gebunden und hochgedreht. Gegensätzlichere Fahrgäste hatte unser Taxifahrer sicher selten.
Mein Begleiter stützte den Kopf in die Hand und musterte mich, als fiele ihm unsere Ungleichheit auch gerade auf. Sein intensiver Blick schickte ein Kribbeln über meine Wangen. Dennoch rechnete ich mit einem abfälligen Kommentar, weil ich das durch Maxim gewöhnt war, der meinen Sinn für Mode gern infrage gestellt hatte. Aber der Fremde sagte nichts dergleichen, stattdessen empfand ich sein Lächeln als warm und herzlich.
»Ihrem Knie geht's gut?«, fragte er besorgt.
»Es ist schon wieder vergessen«, versicherte ich ihm. Es war ja nur eine Schramme. Es hatte außerdem aufgehört zu bluten und, was noch wichtiger war, zu brennen.
»Henrik Manteufel«, stellte er sich vor und hielt mir die Hand hin, die groß und kräftig war, mit schönen, langgliedrigen Fingern.
Ich nahm seine Hand an, die sich angenehm anfühlte. »Teufel, ja? Da hoffe ich, der Name ist nicht Programm?«
Er lachte. Es klang sexy. »Wer weiß?«
»Lou ... Louisa Baumeister«, sagte ich ein bisschen durcheinander. Etwas Teuflisches hatte er definitiv an sich. Anders konnte ich mir nicht erklären, wie er mich so schnell in seinen Bann zog.
»Freut mich sehr.« Grübchen bildeten sich an seinen Wangen. Mir waren noch nie so viele Details an jemandem aufgefallen, den ich gerade erst kennengelernt hatte.
»Sie sind also wegen Ihrer Großmutter in der Stadt? Ich hoffe, es ist nichts Ernstes ...«
»Sie hatte einen Unfall. Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Ich erfahre es erst dort.« Ich fragte mich, wie es überhaupt zu dem Unfall hatte kommen können. Hatte Oma die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren? Einfach so? Kam mir unwahrscheinlich vor. Tief atmete ich durch. Meine Oma war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich hoffte, sie war okay. Aber was, wenn mehr dahintersteckte?
»Es ist sicher alles in Ordnung«, sagte Henrik beruhigend, und ich war, so merkwürdig es klang, froh, dass er hier war. Irgendwie lenkte er mich ab. Seine Stimme fuhr meinen Stresspegel herunter. Und ohne ihn, da war ich mir sicher, hätte ich mir die ganze Fahrt über nur noch mehr Sorgen gemacht.
»Ich unterbreche die Herrschaften ungern: Wir sind gleich da«, warnte uns der Fahrer in grummeliger Manier vor.
»Danke«, sagte ich und erkannte bereits die Klinik am Ende der Straße.
Als der Wagen hielt, erspähte ich durchs Fenster einen mehrstöckigen Gebäudekomplex, in dessen unzähligen Fensterreihen sich der azurblaue Sommerhimmel spiegelte.
»Ihre Großmutter wird sich freuen, Sie zu sehen, da bin ich mir sicher«, munterte Henrik mich auf.
Wir schnallten uns ab. Hier endete also unsere gemeinsame Fahrt. Ich drückte die Tür auf, und mit mir kam auch sein angenehmer Duft hinaus, der mich umspielte, bis ein Windstoß ihn fortblies.
»Ich helfe Ihnen noch«, sagte Henrik, stieg aus und befreite meine Reisetasche aus dem Kofferraum, während ich nach meinem Geldbeutel in meiner Strickhandtasche suchte.
»Wie viel schulde ich Ihnen?«, fragte ich und schaute durchs Fenster auf das Taxometer, doch Henrik schüttelte den Kopf.
»Ihre Strecke lag auf meinem Weg. Ich würde mich nicht wohl fühlen, Ihnen etwas abzuknöpfen.«
»Danke«, sagte ich leise. Das war wirklich nett von ihm.
»Ihre Tasche.«
Ich steckte die Geldbörse wieder ein, und er reichte mir die Tasche. Dabei berührten sich kurz unsere Hände. Meine Haut fing an der Stelle an zu kribbeln. Irritiert hängte ich mir die Tasche über die Schulter und betrachtete dann meine Finger.
»Alles Gute für Ihre Großmutter«, sagte Henrik und ging um den Wagen herum. Er schenkte mir ein letztes Lächeln, dann setzte er sich ins Auto, und der Wagen fuhr los.
Und mir wurde klar, ich würde ihn nicht wiedersehen, was ich plötzlich schade fand. Was für eine merkwürdige Begegnung. Einen Moment lang sah ich ihm nach, ehe ich mich fasste und mitsamt meiner Reisetasche in die Lobby des Hospitals begab. Krankenhäuser waren nicht nur so klinisch rein, dass man sich im Boden spiegelte, sie wirkten immer etwas kühl, sodass ich augenblicklich einen kleinen Schauer verspürte.
Ich fragte mich am Empfang durch, wurde auf die neurologische Station geschickt, wo ich Omas Krankenzimmer suchte und mithilfe einer zuvorkommenden Pflegerin fand. Zimmer zwölf. Ich zog die schwere Tür auf und betrat endlich das lang gesuchte Zimmer mit klopfendem Herzen.
Das rechte Bett war leer, in dem anderen lag meine Oma. Sie blätterte in einem Magazin und riss erschrocken die Augen auf, als sie mich sah.
»Lou?«
Sie sah sehr dünn aus, aber immer noch adrett, und zum Glück wirkte sie nicht halb so mitgenommen, wie ich es befürchtet hatte. Wenn man von dem Verband absah, der um ihren Kopf gewickelt war und unter dem ihre schneeweißen, kinnlangen Haare hervorlugten. Und sie bekam es irgendwie hin, trotz der wenig modischen Krankenhauskluft so adrett wie Helen Mirren auszusehen.
»Du liebes bisschen, was machst du denn hier?«, wunderte sie sich und legte das Magazin auf ihren Rolltisch.
Ich umarmte sie innig.
Ich konnte spüren, wie dünn sie war. Meine Oma war seit jeher eine sehr schlanke Frau, Sorgen hatte ich mir deswegen noch nie gemacht. Nun aber kam sie mir zerbrechlich vor.
»Irmchen!«, fiel es ihr ein. »Das sieht ihr ähnlich. Ich hatte sie doch extra gebeten, niemanden zu informieren! Ist deine Mutter etwa auch hier?«
»Mutti sitzt in London fest.«
Ich zog einen Stuhl zu ihrem Bett heran. Oma Viola hatte also wirklich nicht gewollt, dass wir von dem Unfall erfuhren? Meine Mutter hatte ja gemeint, sie hätte offenbar auch dem Krankenhauspersonal nichts von uns erzählt. Sonst hätten die uns doch angerufen anstatt Irmchen. Aber warum hatte Oma das so gewollt?
»Möchtest du nicht, dass wir dich besuchen kommen?«, fragte ich traurig und verwirrt. Wenn es meiner Großmutter nicht gut ging, wollte ich ihr beistehen!
Oma drückte sanft meine Hand. »Du kannst immer zu mir kommen, Lou, das weißt du doch. Und Annia und ich – wir sprechen derzeit nur das Nötigste. Aber das ist jetzt egal.«
»Warum auch immer ihr euch gestritten habt, ihr solltet wieder miteinander reden«, beharrte ich. Gerade jetzt.
Oma nickte langsam, was mich erleichterte.
»Mama hat sich auch große Sorgen um dich gemacht«, betonte ich.
»Aber es ist doch nichts passiert. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht.«
»Ach, Oma ... das ist doch ganz normal, du bist uns wichtig.« Meine Oma war die liebste Person, die ich kannte, wenn sie etwas aber nicht mochte, dann war es, im Mittelpunkt zu stehen oder eben anderen Sorgen zu machen. »Jetzt verrate mir bitte, was ist denn überhaupt passiert?«
Oma seufzte. »Ich bin nur vom Fahrrad gestürzt, als ein Auto dicht an mir vorbeigefahren ist. Ich wollte ausweichen und habe das Gleichgewicht verloren.« Ihre Hand wanderte zu ihrem Hinterkopf und tastete über dem Verband eine Stelle ab. »Der Fahrer hat einen Krankenwagen gerufen, weil ich kurz das Bewusstsein verloren hatte.«
Was völlig richtig gewesen war. Ich konnte nicht verstehen, wie Oma das auf die leichte Schulter nahm! Aus ihrem Mund klang es wie eine Lappalie.
»Hast du keinen Helm getragen?«, fragte ich besorgt.
Oma senkte den Kopf. »Die Ärzte haben deswegen schon mit mir geschimpft. Aber mein alter Helm ist kaputt, und ich wollte doch nur, wie jeden Morgen, den Sanddornweg runterfahren und dann in die Fjordstraße rein, um im Supermarkt einzukaufen, wie ich es seit Jahren mache. Und nie ist etwas passiert.«
»Jetzt aber schon«, erinnerte ich sie. Wir konnten froh sein, dass nichts Schlimmeres geschehen war.
»Sie haben mich gleich zwei Tage zur Beobachtung hierbehalten und auch in so eine Röhre geschoben. Ich hoffe, dass sie mich bald entlassen. Das Essen hier ist, unter uns gesagt, grässlich. Gestern gab es ein Steak wie eingeschlafene Füße. Ich bin wirklich nicht wählerisch ... Erzähl das alles bitte nicht deiner Mutter!«
»Aber wieso ...«
»Es geht mir doch gut, wir wollen sie nicht aufregen.«
Die Tür ging auf, und ein Mann im weißen Kittel betrat das Zimmer, den Blick auf die Akte in seiner Hand gerichtet. »Guten Tag, Frau Bartschek«, sagte er und hielt inne, als er mich sah. »Sie haben Besuch.«
»Meine Enkelin.«
»Guten Tag«, grüßte ich den Arzt, der mir freundlich zunickte.
»Werde ich heute entlassen, Herr Doktor?«, fragte Oma hoffnungsvoll.
Der Arzt lachte. »Sie haben es wohl eilig? Wir wollten Sie eigentlich heute noch zur Beobachtung hierbehalten, Frau Bartschek.«
»Was möchten Sie denn noch beobachten, mir geht es gut!«, beharrte Oma freundlich, aber bestimmt.
Der Arzt musterte mich erneut. »In meinen Unterlagen steht, dass Sie allein leben. Aber wenn Ihre Enkelin die nächsten Tage nach Ihnen schaut, können wir Sie auch heute schon entlassen.«
»Ja, das mache ich gern«, bot ich an.
Meine Großmutter faltete überaus erfreut die Hände, als wollte sie ein Dankesgebet gen Himmel senden.
»Ich muss allerdings die Entlassungsunterlagen vorher von unserem Chefarzt unterzeichnen lassen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil er noch nicht im Haus ist.«
»Wann kommt er denn?«, hakte Viola ungeduldig nach.
Der Arzt deutete auf seine Armbanduhr. »In zwei Stunden, schätze ich. Es ist nur eine Formalität, wir warten auch noch auf den Ausdruck Ihrer Blutergebnisse. Das Entlassungsgespräch können wir aber jetzt schon führen.«
»Ja, dann machen wir das!«
Wieder blätterte er in seinen Unterlagen. »Wir haben keine Anzeichen für eine Gehirnerschütterung gefunden, wie Sie ja bereits wissen, auch keine anderweitigen Auffälligkeiten im Kopfbereich, von der Platzwunde am Hinterkopf abgesehen.«
»Das ist wohl gut, nehme ich an.«
»Sie hatten Glück im Unglück, auch kleine Stürze können große Folgen haben. Aber Sie sind mit einem blauen Auge davongekommen. Ich muss Sie noch abschließend untersuchen.«
»Oh, natürlich.«
Der Arzt beugte sich über sie und leuchtete ihr mit einer winzigen Taschenlampe abwechselnd in die Augen. »Pupillenreflexe normal.« Dann musste sie ein paar merkwürdige Anweisungen ausführen wie den Arm heben, die Augen abwechselnd öffnen und schließen oder die Stirn runzeln. »Sie machen einen hervorragenden Eindruck, Frau Bartschek.«
Oma lächelte zufrieden.
»Die nächsten Tage ruhen Sie sich bitte noch aus. Nichts Schweres heben, zwei Wochen lang kein Sport. Die Wunde am Kopf ist recht groß.« Dies sagte der Untersucher in meine Richtung.
Und ich passte besser auf, dass Oma sich an die Vorgaben hielt und nicht gleich wieder in ihrer Änderungsschneiderei arbeiten wollte.
»Natürlich, Herr Doktor«, sagte Oma.
»Dann alles Gute für Sie, Frau Bartschek. Ich stelle Ihnen noch ein Rezept für ein Schmerzmittel aus. Und sollte es Ihnen plötzlich schlechter gehen, Sie Schwindel, Übelkeit oder starke Kopfschmerzen verspüren, melden Sie sich bitte umgehend bei uns oder Ihrem Hausarzt.«
»Das wird sie, dafür sorge ich schon«, fiel ich Oma ins Wort, bevor die überhaupt hatte antworten können. Wie ich Oma kannte, wollte sie niemandem zur Last fallen und würde eher tagelang mit schwerer Migräne ausharren, als ihrem Hausarzt durch einen unangekündigten Besuch Zeit zu rauben.
»Ich werde mich an die Anweisung halten, aber das Schmerzmittel brauche ich nicht.«
Skeptisch zog der Doktor die Braue hoch, und Oma beharrte, dass sie eh keine Chemie zu sich nehme. Ich konnte nur hilflos die Schultern zucken.
»Also kein Rezept«, meinte er und machte sich eine Notiz.
»Ganz genau.«
»Dann ist das ja geklärt«, sagte der Mann im Kittel und verabschiedete sich.
Oma kletterte sofort aus ihrem Bett, zog eine Tasche unter diesem hervor, die frappierend meiner ähnelte – wir hatten offenbar einen recht ähnlichen Geschmack –, und durchsuchte diese gewissenhaft.
»Ach du liebes bisschen!«
»Was hast du, Oma?«
»Ich habe gar keine frischen Sachen«, stellte Oma plötzlich fest. »Das hatte ich völlig vergessen. Irmchen ist ja wirklich eine Seele von Mensch, sie hat mir die Tasche hier gepackt und hergebracht, sogar was zu lesen hat sie für mich besorgt. Sieh, alles da, Shampoo, Seife, Zahnputzzeug, Bademantel, Hausschuhe – nur saubere Kleidung hat sie vergessen.«
»Das ist doch kein Problem, ich fahre rasch zu dir nach Hause und hole etwas Frisches zum Anziehen. Du musst ja eh noch auf den Chefarzt warten. Bei der Gelegenheit kann ich auch deine Tasche und die alte Wäsche schon mal mitnehmen.«
»Ach, Lou, ich will dir doch nicht noch mehr Umstände machen.«
»Tust du nicht, Oma. Ich rufe mir gleich ein Taxi! Und ich bin so schnell wie möglich wieder hier, um dich dann abzuholen.« Schon hatte ich mein Smartphone in der Hand, um das Taxi zu bestellen.
4. Kapitel
Das Taxi hielt vor dem Torbogen, der das altehrwürdige Sanddorn Hotel mit dem Fischbistro Krabbenstube verband, in dem man die besten Fischbrötchen der Stadt essen konnte. Ein wohliges, nostalgisches Gefühl wärmte mir die Brust beim Anblick der beiden Gebäude mit ihrem historischen Flair, die den Sanddornweg flankierten. Mein zweites Zuhause ...
»Der Rest ist für Sie«, sagte ich zum Fahrer und händigte ihm das Geld aus, schnallte mich ab und stieg aus, um meine und Omas Taschen aus dem Kofferraum zu nehmen. Schon kam mir der belebende Duft der See entgegen, den ich tief einsog.
Da ich etwas Zeit hatte, bevor ich ins Krankenhaus zurückmusste, folgte ich gemächlich dem Pfad unter dem Möwenbogen hindurch, dessen Innenwände durch wild wachsende Efeuranken grün leuchteten. Ein paar der Blätter verdeckten die silberne Gedenktafel, die man dem Ehepaar Sanddorn aufgrund seiner gemeinnützigen Taten gewidmet hatte. Opa hatte mir früher oft erzählt, dass der Sanddornweg nicht nach dem Küstenstrauch, sondern nach Carlotta und Reginald Sanddorn benannt worden war, denen Anfang des 20. Jahrhunderts sowohl das Sanddorn Hotel mit seinen fünf Stockwerken und dem imposanten mehrstufigen Mansardendach als auch viele der Läden in der kleinen Geschäftsstraße gehört hatten. Für die damalige Zeit sollen sie sehr modern und innovativ gewesen sein.
Ich trat aus dem Bogen. Die Sicht auf die schräge Gasse wurde frei, deren idyllischer Anblick in mir die schönsten Sommererinnerungen wachrief. Der Sanddornweg war so gut versteckt, dass man ihn leicht übersah. Aber wer ihn fand, wurde mit der zauberhaften Sicht auf alte, leicht schiefe Häuschen belohnt, die aus einer anderen Epoche zu stammen schienen und wie in Reih und Glied nebeneinanderstanden. Mansardendach an Mansardendach.
Ich lief die kleine Einkaufsgasse hinunter, ein paar Passanten mit Einkaufstüten kamen mir entgegen. Das Kopfsteinpflaster machte den Weg uneben, weswegen ich zum Bürgersteig auf der linken Seite wechselte.