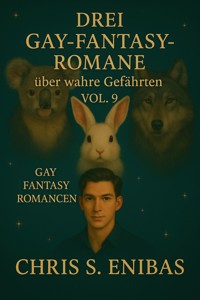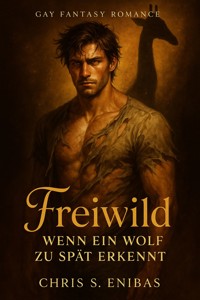8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Drei Männer. Drei Tierseelen. Eine Wahrheit: Wahre Gefährten finden einander – gegen alle Regeln der Welt.
In dieser sinnlich-magischen Sammlung vereinen sich drei romantische Fantasygeschichten voller Leidenschaft, innerer Zerrissenheit und tierischer Instinkte. Ob Bär, Wolf oder Bison – jeder Gestaltwandler kämpft mit seinem Schicksal, seiner Herkunft und dem Verlangen nach dem Einen, der ihn vollständig macht.
Drei Geschichten, drei Wege zur wahren Liebe:
- Instinktverloren - Sein Duft, sein Feind, sein Gefährte
- Herz aus Instinkt
- Herz im Schatten des Bisons
Gay Fantasy Romance in ihrer wildesten, zärtlichsten und magischsten Form – für alle, die an wahre Verbindung glauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Drei Gay Fantasy Romane über wahre Gefährten Vol. 14
Inhaltsverzeichnis
Instinktverloren - Sein Duft, sein Feind, sein Gefährte
Kapitel 1 – Neubeginn im Schatten des Alphas
Kapitel 2 – Der Blick, der alles verändert
Kapitel 3 – Krallen aus Stolz
Kapitel 4 – Im Glanz des Gefährtenbands
Kapitel 5 – Eifersucht schmeckt nach Blut
Kapitel 6 – Mein und nur mein
Kapitel 7 – Der erste Biss
Kapitel 8 – Wenn Stolz verbrennt
Kapitel 9 – Im Bann des Instinkts
Kapitel 10 – Herz aus Feuer
Epilog
Herz aus Instinkt
Kapitel 1 – Geruch von Gefahr
Kapitel 2 – Reibungspunkte
Kapitel 3 – Nähe aus Trotz
Kapitel 4 – Rudelinstinkt
Kapitel 5 – Nachtschwärze
Kapitel 6 – Danach
Kapitel 7 – Feuer im Kreis
Kapitel 8 – Kehrtwende
Kapitel 9 – Rudelrecht
Kapitel 10 – Herz aus Instinkt
Epilog
Herz im Schatten des Bisons
Kapitel 1 – Der erste Hauch
Kapitel 2 – Unvergessene Jagd
Kapitel 3 – Der Schatten einer Katze
Kapitel 4 – Stille Beobachtung
Kapitel 5 – Flüchtige Nähe
Kapitel 6 – Eifersucht entbrennt
Kapitel 7 – Das erste Gespräch
Kapitel 8 – Die Gefahr des Begehrens
Kapitel 9 – Der Sturm im Blick
Kapitel 10 – Gefährliche Zärtlichkeit
Kapitel 11 – Gefährtenband
Kapitel 12 – Die Prüfung der Nähe
Kapitel 13 – Das erste Mal
Kapitel 14 – Verwirrung im Herzen
Kapitel 15 – Ein Rivale tritt auf
Kapitel 16 – Kampf ums Recht
Kapitel 17 – Die Narben der Nacht
Kapitel 18 – Zähmung im Sturm
Kapitel 19 – Heimat im Herzen
Kapitel 20 – Das Band im Schatten
Epilog
landmarks
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Buchanfang
Instinktverloren - Sein Duft, sein Feind, sein Gefährte
„ Er ist mein Feind. Mein Stiefbruder. Mein Gefährte.“
Als Easton mit seiner Mutter ins Bärenrudel zieht, ahnt er nicht, dass sein neues Leben mit einem einzigen Blick aus den Fugen gerät. Denn Thomas, der älteste Sohn des Alphas – schön, stark und eiskalt – lässt keinen Zweifel daran, was er von Easton hält: nichts. Für Thomas sind Nasenbären schwach, fehl am Platz – und ganz sicher nicht gut genug für sein Blut.
Doch etwas in Easton ruft nach ihm. Ein Duft, ein Gefühl, ein unausweichlicher Sog. Alle spüren es – das Gefährtenband, das zwischen ihnen knistert. Alle… nur Thomas kämpft dagegen an. Mit Spott. Mit Härte. Mit unerträglicher Nähe.
Erst als seine Brüder beginnen, sich Easton auf ganz eigene Weise zu nähern, bricht etwas in Thomas – ein Instinkt, wild und unkontrollierbar. Besitzergreifend. Gefährlich. Und doch alles, was Easton je wollte.
Zwischen brennender Eifersucht, unterdrücktem Verlangen und dem Drang, einander zu hassen – oder zu retten – beginnt eine Geschichte, in der Instinkte nicht nur das Herz, sondern auch das Fleisch fordern.
Gay Fantasy Romance voller roher Leidenschaft, schmerzlicher Sehnsucht und einem Alpha, der alles verlieren muss, um zu erkennen, was ihm wirklich gehört.
Kapitel 1 – Neubeginn im Schatten des Alphas
Der Geruch von feuchter Erde und moosgetränktem Waldboden hing schwer in der Luft, als Easton zum ersten Mal den Fuß über die unsichtbare Grenze setzte, die das Territorium des Bärenrudels markierte – ein Moment, der sich tief in seine Sinne brannte, nicht etwa wegen der alten Magie, die zwischen den Bäumen zitterte, sondern wegen der Tatsache, dass sich mit diesem Schritt sein gesamtes Leben veränderte.
Er wusste nicht, was ihn erwartete, nicht wirklich – obwohl seine Mutter versucht hatte, ihn vorzubereiten, mit ruhiger Stimme und sanftem Lächeln, das jedoch nicht über die Wahrheit hinwegtäuschen konnte: Dass sie von nun an nicht mehr nur seine Mutter sein würde, sondern die Gefährtin eines Alpha-Bären, die Frau an der Seite des mächtigsten Gestaltwandlers weit und breit.
Und er?
Er war nichts weiter als ihr Anhang.
Ein Nasenbär zwischen Bären.
Easton spürte die prüfenden Blicke der Rudelmitglieder auf sich lasten, als sie gemeinsam das Herz des Territoriums erreichten – ein weitläufiges Areal aus ineinander verschlungenen Holzhäusern, erdigen Wegen und Markierungen, die selbst für ungeübte Sinne deutlich die Botschaft sendeten: Hier beginnt unser Reich.
Er versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie eng sich seine Kehle anfühlte. Wie seine Finger unruhig an der Naht seiner Jacke zupften. Wie sehr er sich wünschte, irgendwo anders zu sein.
Doch als seine Mutter stehen blieb, ihm ein letztes aufmunterndes Lächeln schenkte und sich dann dem mächtigen Mann näherte, der vor dem größten der Häuser auf sie wartete, wusste er, dass Flucht keine Option war.
Der Alpha war riesig, sogar für Bärenmaßstäbe – breit gebaut, mit grauschwarzem Haar und einem Blick, der sowohl Ruhe als auch Unnachgiebigkeit ausstrahlte. Als er Easton musterte, war da keine Feindseligkeit. Kein Spott. Aber auch kein Interesse.
„Willkommen im Rudel“, sagte er mit tiefer, vibrierender Stimme, die nach Macht schmeckte. „Ich bin Ragan.“
Easton nickte steif. „Easton.“
Der Alpha schenkte ihm ein knappes Nicken, wandte sich dann jedoch sofort wieder seiner Mutter zu – und etwas in der Art, wie ihre Körper zueinander fanden, wie ihre Energien sich berührten, ließ Easton frösteln.
Das Gefährtenband. Echt. Greifbar.
Verflucht.
Noch während er versuchte, sich von der Intimität dieser Begegnung abzuwenden, hörte er Schritte – schwere, langsame Schritte, die den Boden erzittern ließen.
Als er sich umdrehte, sah er ihn.
Und vergaß für einen Moment, wie man atmete.
Thomas.
Der älteste Sohn des Alphas, wie seine Mutter ihn beschrieben hatte – aber keine Beschreibung hatte ihn vorbereiten können auf die raubtierhafte Präsenz dieses Mannes. Er war groß, sogar noch größer als sein Vater, mit Schultern, die aussahen, als könnten sie Berge versetzen, und einem kantigen, attraktiven Gesicht, das in seiner Strenge fast schmerzhaft war.
Die Augen – dunkelbraun, wachsam, unnachgiebig – ruhten auf Easton.
Und sie verengten sich sofort.
„Das ist er?“ Die Stimme war tiefer als Ragans, kratziger, voller Kälte.
Easton schluckte, spürte, wie seine Schultern sich instinktiv verengten.
Ragan nickte knapp. „Easton wird ab heute bei uns leben.“
Thomas’ Blick glitt über ihn, langsam, als würde er jedes Detail prüfen. Seine Kleidung. Seine Haltung. Sein Geruch.
„Ein Nasenbär also.“ Das Wort tropfte aus seinem Mund wie Gift.
Easton öffnete den Mund, wollte etwas sagen, irgendetwas – aber da war kein Platz zwischen seinen Gedanken. Nur Hitze. Scham. Und… ein seltsames, viel zu starkes Flattern tief in seiner Brust.
Denn obwohl Thomas ihn verachtete, ihn mit diesem Blick behandelte wie Dreck am Schuh – war da etwas anderes.
Etwas, das flackerte.
Und Easton wusste nicht, ob er es hassen oder sich danach verzehren sollte.
Easton hatte keine Ahnung, wie lange er einfach nur dastand, während Thomas ihn mit diesem Blick fixierte – einer Mischung aus Abscheu und wachsamem Misstrauen, als würde er darauf warten, dass Easton jeden Moment etwas Peinliches tat oder einfach umfiel.
Dann endlich, fast wie auf Kommando, bewegte sich etwas im Hintergrund. Weitere Schritte, leichter, aber dennoch kraftvoll. Drei Männer traten aus dem großen Haupthaus, und Easton erkannte sofort, dass sie verwandt sein mussten – breite Schultern, markante Gesichtszüge, Blicke, die sich wie zahnlose Bärenbisse anfühlten, wenn sie dich musterten.
Doch im Gegensatz zu Thomas waren ihre Ausdrücke nicht abweisend, sondern neugierig.
„Also das ist unser neuer Bruder?“ Der Jüngste – Easton schätzte ihn auf nicht viel älter als zwanzig – lächelte offen und kam näher, die Hände lässig in den Hosentaschen, die braunen Locken vom Wind zerzaust. „Ich bin Milo. Willkommen im Chaos.“
Easton versuchte zu lächeln, nickte kurz und murmelte: „Danke.“
Ein zweiter Bruder, mit helleren Augen und einem verschmitzten Grinsen, trat daneben. „Lass dich von Thomas nicht einschüchtern. Er knurrt mehr, als er beißt. Meistens jedenfalls.“
„Kellan“, sagte der Dritte mit ruhiger Stimme und streckte Easton die Hand entgegen. „Ich bin der Älteste nach Thomas. Du wirst dich schon einleben.“
Easton nahm die Hand – stark, warm, nicht dominierend. Und zum ersten Mal seit ihrer Ankunft lockerte sich etwas in seiner Brust. Vielleicht würde es doch nicht ganz so schlimm werden. Vielleicht gab es in diesem Rudel mehr als nur Härte und Hierarchien.
Doch kaum hatte er diesen Gedanken zu Ende gedacht, spürte er wieder diesen Blick.
Thomas.
Unverändert stand er da, verschränkt die Arme vor der breiten Brust, der Kiefer angespannt, die Augen verengt zu Schlitzen.
„Seid ihr jetzt alle plötzlich Fans von Streifenratten?“ Seine Stimme war schneidend.
Kellan warf ihm einen scharfen Blick zu. „Thomas.“
„Was? Sagst du’s nicht, dann sagt’s keiner? Er gehört nicht hierher. Er ist kein Bär, kein Kämpfer, kein Rudelblut.“
Easton fühlte, wie die Worte sich wie Krallen in seine Haut bohrten. Und schlimmer noch: Dass sie ausgerechnet von ihm kamen, von Thomas – dem, zu dem sein Blick immer wieder wanderte, ohne dass er es verhindern konnte – brannte.
„Du kennst ihn doch nicht mal,“ sagte Milo leise, seine Miene plötzlich ungewohnt ernst.
Thomas lachte ohne Humor. „Ich brauch keinen Roman, um den Klappentext zu lesen.“
„Dann solltest du vielleicht mal einen Blick zwischen die Seiten werfen“, murmelte Easton, ehe er sich bremsen konnte.
Stille.
Dicke, gespannte Stille.
Thomas’ Augen weiteten sich für den Bruchteil einer Sekunde. Dann trat er einen Schritt vor, nur einen, aber Easton spürte sofort, wie sich die Luft zwischen ihnen veränderte – dichter wurde, elektrisiert.
„Was hast du gesagt?“
Easton hob das Kinn. Er wusste nicht, woher der Mut kam, doch er war da. Vielleicht, weil er wusste, dass Wegducken ihn auf Dauer nicht retten würde. Vielleicht auch, weil der brennende Blick in Thomas’ Augen nicht nur Abscheu enthielt, sondern etwas anderes.
Etwas, das knisterte.
„Dass man Bücher nicht nach dem Einband beurteilen sollte.“
Wieder diese Stille. Diesmal mit Unterstrom.
Dann war da eine Bewegung – schnell, instinktiv, nicht ganz menschlich – doch bevor Thomas etwas sagen oder tun konnte, legte seine Mutter ihm die Hand auf die Schulter.
„Easton?“ Ihre Stimme war ruhig, aber fest. „Hilfst du mir beim Auspacken?“
Er nickte, folgte ihr wortlos, spürte jedoch, wie Thomas’ Blick noch lange auf seinem Rücken brannte, selbst als sie längst außer Sicht waren.
Sie betraten das kleinere Gästehaus, das Ragan ihnen zur Verfügung gestellt hatte – schlicht, aber warm, mit alten Holzdielen, einem Kamin und dem Geruch von Fichtennadeln und frischem Brot.
Erst als die Tür ins Schloss fiel, atmete Easton hörbar aus.
Seine Mutter trat zu ihm, legte ihm sanft eine Hand auf den Arm. „Du warst mutig.“
Er schüttelte den Kopf. „Dumm. Ich hätte ihn nicht provozieren sollen.“
„Vielleicht nicht. Aber du hast dich nicht klein gemacht. Und das zählt hier. Die Bären respektieren Stärke – auch dann, wenn sie leise ist.“
Easton sah sie an. „Denkst du, er hasst mich, weil er ahnt, was ich fühle?“
Sie schwieg einen Moment. Dann sagte sie mit ruhiger Stimme: „Ich denke, er hasst sich selbst dafür, dass er dich riecht.“
Eastons Herz setzte aus.
„Was… was meinst du damit?“
Seine Mutter trat zum Fenster, blickte hinaus, wo Thomas noch immer stand – unbewegt, als würde er Wurzeln schlagen.
„Gefährtenbande sind wie Ketten. Manche reißen sich sofort aneinander. Andere… wehren sich. Mit allem, was sie haben.“
Easton schluckte. Er wusste es längst. Schon bei der ersten Begegnung. In seinem Bauch, in seinem Herzen – in seinem verdammten Blut.
Thomas war sein Gefährte.
Sein Feind.
Sein Duft.
Sein Untergang.
Easton hatte sein neues Zimmer kaum betreten, da wusste er schon, dass die kommenden Nächte ihm nicht den Frieden schenken würden, den er sich heimlich erhofft hatte.
Das Zimmer war schlicht, aber liebevoll eingerichtet – ein schmales Bett mit wolkenweicher Decke, ein kleiner Schreibtisch, eine Kommode aus hellem Holz, deren Oberfläche bereits nach altem Harz roch. Ein Fenster zeigte in Richtung Waldrand, durch das milchiges Licht fiel, matt und weich, als würde der Tag nicht gehen, sondern sich verflüchtigen.
Er setzte sich auf die Bettkante, ließ die Schultern sinken und streckte die Finger aus, die noch immer leicht zitterten. Nicht vor Angst. Nicht wirklich.
Vor… Etwas anderem.
Thomas’ Blick verfolgte ihn, auch jetzt noch – dieses Glühen darin, dunkel wie heiße Kohle unter einer dicken Schicht aus Verachtung.
Easton presste die Hände gegen sein Gesicht. Warum ausgerechnet er? Warum musste sein Körper auf einen Mann reagieren, der ihn kaum als lebendig anerkannte? Und schlimmer noch: Warum fühlte es sich an, als wäre ein unsichtbares Band zwischen ihnen gespannt, das jeden Moment reißen oder sich erbarmungslos um seine Kehle legen konnte?
Ein leises Klopfen ließ ihn hochfahren.
„Easton?“ Die Stimme war ruhig, ein wenig tiefer als erwartet. Kellan.
Easton öffnete die Tür und sah in das ernste Gesicht des zweitältesten Bruders. Kellan musterte ihn mit einem Blick, der weder forderte noch bewertete – sondern verstand.
„Ich wollte nur sehen, ob du zurechtkommst. Du hattest… einen schwierigen Empfang.“
Easton zuckte mit den Schultern. „Ich bin Schlimmeres gewohnt.“
Kellan runzelte die Stirn. „Ich glaube nicht, dass man das sein sollte.“
Stille.
Dann, sanft: „Er meint es nicht so, weißt du. Thomas… hat seine eigene Art, mit Dingen umzugehen, die er nicht einordnen kann.“
Easton lachte leise, bitter. „Ich bin keine algebraische Gleichung. Ich atme. Ich existiere. Das ist ein ziemlich simples Konzept.“
Kellan nickte nur. Dann, als wolle er etwas hinzufügen, zögerte aber. Schließlich legte er ihm eine Hand auf die Schulter, warm und beruhigend.
„Wenn du etwas brauchst – egal was – ich bin da, okay? Lass ihn dir nicht den Boden unter den Füßen nehmen.“
„Danke“, sagte Easton leise.
Und er meinte es.
Als er später im Bett lag, eingewickelt in fremde Wärme und halb getrocknete Blätter, die in der Matratze raschelten, versuchte er, die Gedanken zu vertreiben.
Es gelang ihm nicht.
Die Nacht kam still und langsam. Schatten krochen über die Wände, und der Wald flüsterte durch das offene Fenster. Eastons Gedanken verirrten sich, verhedderten sich in Bildern, Stimmen, Gesten.
Thomas. Diese Augen. Diese Präsenz.
Er wusste nicht, wann der Schlaf kam. Nur, dass er ihn nicht sanft nahm.
Denn der Traum war kein Traum.
Er war ein Beben. Ein Duft. Ein Rufen.
Er stand auf einer Lichtung, nackt, das Fell seiner inneren Gestalt kribbelte unter der Haut. Der Mond stand wie ein weißes Auge über ihm, riesig, unbarmherzig. Etwas bewegte sich hinter den Bäumen. Schwer. Lautlos.
Und dann war da ein Bär.
Groß. Gewaltig. Dunkelbraun wie Erde nach Regen. Er kam näher, nicht laufend, sondern wie eine Welle, die alles mit sich nahm.
Easton konnte nicht fliehen. Wollte nicht.
Der Bär berührte ihn nicht, aber der Druck seiner Nähe brannte auf seiner nackten Haut.
Dann ein Wechsel – der Bär wurde zu Thomas.
Nackt, atemlos, gleißend vor Macht. Seine Augen waren golden jetzt, die Pupillen schmal.
„Du riechst nach mir,“ flüsterte Thomas, raunte, knurrte – Easton wusste es nicht. Nur, dass er diese Stimme bis ins Mark spürte.
„Du gehörst mir.“
Easton wollte widersprechen, doch da war kein Platz mehr für Worte.
Thomas griff zu – keine Gewalt, nur Anspruch. Seine Hand legte sich an Eastons Hals, drückte nicht, hielt nur. Und Easton… senkte den Blick. Er wusste nicht, warum. Nur, dass es sich richtig anfühlte.
„Mein“, sagte Thomas.
Dann biss er zu.
Der Schmerz war heiß. Süß.
Easton erwachte keuchend, Schweiß auf der Stirn, der Lakenstoff feucht zwischen den Fingern. Sein Herz raste, sein Körper war hart, sein Geist ein Trümmerfeld.
Sein Gefährte hasste ihn. Und sein Instinkt… …wollte trotzdem von ihm gebissen werden.
Kapitel 2 – Der Blick, der alles verändert
Easton wusste nicht genau, wann es begonnen hatte – dieser Moment, in dem sein Blick sich verselbstständigte, in dem er nicht mehr Herr darüber war, wohin seine Augen wanderten, wohin seine Gedanken drifteten, wohin sein Herz raste. Es geschah einfach. Immer wieder. Ohne Vorwarnung. Ohne Schutz.
Immer, wenn Thomas den Raum betrat. Oder durch ihn ging. Oder auch nur in der Nähe war.
Da war kein großes Aufeinandertreffen, keine bedeutungsschwere Geste, kein Wort, das einen Umbruch markierte – nur diese flüchtigen, verdammten Sekunden, in denen Eastons Brust sich verengte, sein Atem kurz stockte und etwas in seinem Innersten sich reckte, verlangte, brannte.
Thomas trat ein – und Easton sah auf. Immer. Wie aus einem Reflex, den er nicht ablegen konnte.
Es war nicht einmal körperlich – oder vielleicht gerade doch. Denn Thomas wirkte nie harmlos. Er war keine hübsche Silhouette im Hintergrund, kein warmer Schatten, an dem man sich vorbeidrückte. Nein. Thomas füllte jeden Raum, den er betrat, mit seiner schieren Masse, mit der Dominanz, die in seinem Gang lag, in der Härte seiner Schultern, in den Bewegungen seiner Hände, die so kontrolliert waren, dass sie gefährlich wirkten.
Und Eastons Blick blieb jedes Mal an ihm hängen – wie an einem Dorn, der zu tief stach, um ihn einfach zu ignorieren.
Manchmal versuchte er, ihn zu vermeiden. Wirklich. Wenn sie gemeinsam am Frühstückstisch saßen, er zwischen Milo und Kellan, und Thomas am Kopfende, schweigend, reglos, mit diesem Blick, der durch ihn hindurchsah wie durch Nebel – dann senkte Easton den Kopf, konzentrierte sich auf den dampfenden Tee in seiner Tasse oder auf den Geschmack des Honigs auf dem Brot. Doch selbst dann spürte er ihn. Wie Hitze an der Seite seines Gesichts. Wie ein Gewicht im Raum.
Und manchmal – nur manchmal – fing er Blicke ein, die nicht leer waren.
Blicke, in denen sich etwas anderes versteckte. Etwas, das flackerte. Wut vielleicht. Verlangen. Oder beides, ineinander verwoben, zu etwas, das er nicht benennen konnte.
Doch immer, wenn Easton diese Blicke zu lange hielt, zu offen war in seinem Staunen, in seinem inneren Drang, Nähe zu suchen, die er nicht haben durfte – war da wieder diese Wand.
„Glotz nicht so.“ Oder: „Gibt's ein Problem, Nasenratte?“ Oder, wenn Thomas besonders gleichgültig wirken wollte: „Halt dich lieber nicht an mir fest. Du würdest nicht überleben.“
Easton antwortete nie. Nicht mehr. Nicht nach dem dritten Mal. Nicht, nachdem jedes Wort von ihm wie Öl auf Thomas’ Feuer wirkte.
Er begann, sich zurückzuziehen.
Zuerst langsam – durch Ausreden, kleine Fluchten, durch Gespräche mit Milo, wenn Thomas den Raum betrat. Später direkter. Er verließ Mahlzeiten früh, vermied Gemeinschaftsräume, ging längere Wege durch den Wald, selbst wenn der kürzere durch das Hauptgelände führte.
Er sah weniger hin. Und spürte dennoch alles.
Die anderen Brüder bemerkten es.
Milo war der Erste, der etwas sagte – nach einem dieser angespannten Abende, als Thomas Easton beim Abendessen laut zurechtgewiesen hatte, weil er „zu laut atmete“, und Easton danach schweigend in sein Zimmer verschwunden war.
„Er ist ein Idiot“, sagte Milo und trat neben ihn auf die kleine Holzveranda hinter dem Gästehaus. Die Sterne funkelten über ihnen, aber Easton sah sie nicht.
„Ich will nur keinen Ärger“, murmelte er.
„Du bist nicht der Ärger, Easton. Er ist es.“
Dann schob Milo sich gegen das Geländer, so dicht neben ihn, dass sich ihre Schultern fast berührten, und seine Stimme wurde weicher. „Manchmal fragt man sich, ob er dich mehr hasst oder sich selbst dafür, dass er dich riecht.“
Easton erstarrte. „Was?“
Milo sah ihn an – ein schiefer Blick, sanft und ein wenig traurig. „Wir sind keine Narren. Nicht wir alle. Rudel spüren solche Dinge. So wie du zitterst, wenn er nur an dir vorbeigeht – so wie er jedes Gespräch unterbricht, sobald du lachst. Glaubst du, das bleibt unbemerkt?“
Easton senkte den Blick. „Ich will das nicht.“
„Das ist egal. Es ist trotzdem da.“
Milo schwieg kurz. Dann, zögernd: „Er wird sich wehren. Er wird beißen, kratzen, stoßen. Das ist Thomas. Aber wenn du zurückweichst, gewinnst du nichts.“
„Ich will nicht gewinnen. Ich will nur nicht… kaputtgehen.“
„Dann lauf nicht allein. Du hast uns.“
Easton blickte ihn an – zum ersten Mal wirklich. Und für einen Moment war da Wärme. Verbundenheit.
Doch genau in diesem Moment knarzte die Veranda.
Thomas stand im Schatten der Bäume.
Nicht nah. Aber nah genug.
Easton spürte seinen Blick, ehe er ihn sah – und als sich ihre Blicke trafen, war da keine Leere. Keine Gleichgültigkeit.
Da war Eifersucht. Nackt. Wütend. Fast schmerzhaft.
Und dann drehte sich Thomas um und verschwand in der Dunkelheit.
Am nächsten Morgen war die Luft im Haupthaus dick wie Nebel – kein Wort wurde zu viel gesprochen, keine Geste war beiläufig. Easton nahm seinen Platz am Ende der langen Holztafel ein, wie immer still, mit gesenktem Blick, den Rücken durchgedrückt wie ein Schild gegen das, was gleich kommen würde.
Thomas saß weiter oben, wie üblich schweigend, sein Blick auf das Messer gerichtet, mit dem er scheinbar gedankenlos die Rinde vom Brot schnitt. Doch Easton spürte ihn. Jeder in diesem Raum spürte ihn.
Kellan reichte Easton ein Glas Wasser, so beiläufig, dass es fast übersehen werden konnte – wäre da nicht die Art, wie seine Finger beim Übergeben kurz Eastons berührten. Ein Atemzug zu lang. Ein Hauch zu langsam.
Easton hob den Blick – und sah in Augen, die sanft, warm und offen auf ihn ruhten.
Kellan sagte nichts. Aber seine Geste war eine Einladung.
Und Thomas bemerkte es.
Er legte das Messer langsam ab. Die Klinge schnitt hörbar über das Holz. Dann hob er den Blick – geradewegs auf Kellan. Dann auf Easton. Und wieder zurück.
Ein Muskel zuckte in seiner Wange.
„Wenn ihr fertig seid mit diesem Theater,“ knurrte er, „vielleicht könnt ihr euch dann auf das konzentrieren, wofür ihr eigentlich hier seid.“
„Frühstücken?“ fragte Milo mit übertriebener Unschuld, während er sich Honig aufs Brot schmierte.
Thomas’ Blick zuckte zu ihm, aber er sagte nichts. Stattdessen stand er abrupt auf, so heftig, dass sein Stuhl gegen die Wand krachte, und verließ das Haus durch die Hintertür – das Knallen hallte noch lange in Eastons Brust nach.
Später, als die Sonne hoch am Himmel stand und das Rudel sich zerstreute – zur Arbeit, zu Aufgaben, zur Jagd – blieb Easton allein zurück. Oder so dachte er.
Er saß auf der Verandatreppe, starrte in den Wald, ließ die Gedanken treiben. Sein Körper fühlte sich fremd an, als würde er auf etwas warten, das er nicht benennen konnte.
Kellan trat neben ihn, ließ sich in den warmen Staub sinken, ohne ein Wort zu verlieren.
Sie schwiegen lange.
Dann sagte Kellan leise: „Du weißt, dass du für ihn eine Bedrohung bist, oder?“
Easton wandte langsam den Kopf. „Für Thomas? Ich bin der Letzte, was ihn bedrohen könnte.“
Kellan sah ihn an, mit diesem ruhigen, fast unbarmherzigen Blick, der direkt durch jede Lüge schnitt.
„Nicht, weil du stark bist. Sondern weil du ihn fühlen lässt. Und Thomas hasst es, zu fühlen.“
Easton schwieg.
„Er hat nie gelernt, weich zu sein,“ fuhr Kellan fort. „Alles in ihm ist Abwehr. Aber sein Körper spricht längst eine andere Sprache. Du bringst ihn aus dem Gleichgewicht. Du bist… zu echt.“
„Ich will ihm nichts tun.“
„Du tust es schon. Mit jedem Atemzug.“
Ein Windstoß ließ die Blätter rauschen, und für einen Moment war da nichts als Natur und Herzklopfen.
Dann beugte sich Kellan ein Stück näher. Nicht viel – nur genug, dass Easton seinen Duft wahrnahm, holzig, warm, mit dem Unterton von frischer Erde.
„Wenn du willst,“ sagte Kellan leise, „helfe ich dir, ihn zu vergessen.“