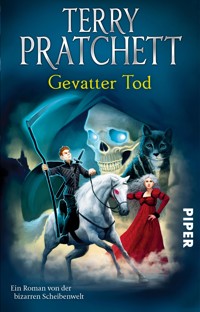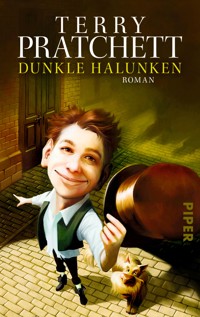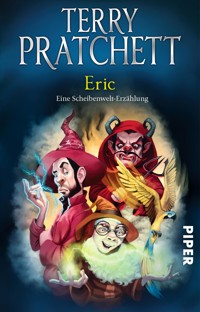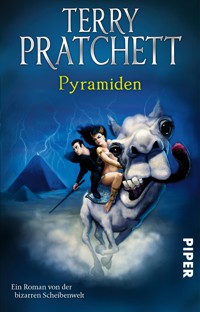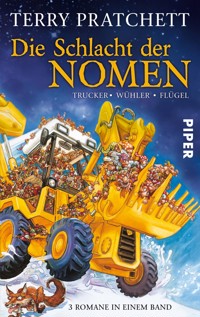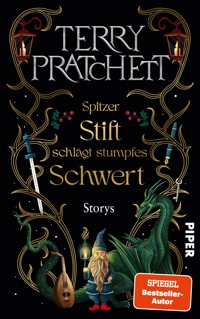9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Apokalypse mit Humor: In Terry Pratchetts und Neil Gaimans Kult-Klassiker »Ein gutes Omen« liefern sich Gut und Böse ein bitter-komisches Duell. Das gemeinsame Buch der beiden Fantasy-Schwergewichte Terry Pratchett und Neil Gaiman ist ein wahrer Geniestreich voll absurder Komik. Es ist das Ende des 20. Jahrhunderts, Himmel und Hölle machen sich für ihren finalen Kampf bereit: Die Apokalypse steht bevor – aber irgendwie will der Antichrist nicht so richtig in die Gänge kommen. Die Engel Erziraphael und Crowley sollten den jungen Warlock eigentlich zum Niedergang verkündenden Höllenfürsten erziehen. Doch viel mehr als für den Weltuntergang interessiert sich der vermeintliche Sohn des Teufels für Baseball und seine Briefmarkensammlung. Da stellt sich heraus, dass Warlock einst im Krankenhaus vertauscht wurde und tatsächlich nur ein ganz normaler Junge ist. So beginnt eine kuriose Suche nach dem wahren Antichristen. Die humoristische Fantasy-Erzählung von Pratchett und Gaiman erschien erstmals im Jahr 1990 und hat sich seitdem zu einem Kultroman entwickelt. Durch die Erzählkunst und den schrägen bis bitterbösen Humor der beiden Fantasy-Meister hat »Ein gutes Omen« eine treue Fangemeinde um sich geschart. »Alles in allem ist ›Ein gutes Omen‹ ein superwitziges Buch mit viel Spannung.« ― Augsburger Allgemeine Terry Pratchett kennen und lieben Fantasy-Fans durch seine Scheibenwelt-Bücher, Neil Gaiman wurde durch seine Comic-Serie »Sandman« sowie zahlreiche Romane bekannt. Im Doppelpack laufen die beiden zu Höchstform auf und steigern sich in einen fulminanten Rausch aus Witz und humorvoll verpackter Gesellschaftskritik. Weltuntergang zum Nachlesen: das Buch zur Serie In Kooperation mit Amazon entstand 2019 die Mini-Serie »Good Omens« zum Buch. Neil Gaiman verfasste das Drehbuch selbst, der inzwischen verstorbene Pratchett gab sein Einverständnis in einem posthum veröffentlichten Brief bekannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
Übersetzung aus dem Englischen von Andreas Brandhorst
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
10. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-96001-4
© 1990 Neil Gaiman, Terry und Lynn Pratchett Titel der englischen Originalausgabe: »Good Omens«, Workman Publishing, New York 1990 © Piper Verlag GmbH, München 2004 Deutsche Erstausgabe: Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München 1997 Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München Umschlagabbildung: Josh Kirby via Agentur Schlück GmbH
Warnung:
Kinder! Es kann gefährlich sein,
mit dem Weltuntergang zu spielen.
Ihr solltet ihn besser nicht
im eigenen Heim heraufbeschwören.
WIDMUNG
Die Autoren möchten dem Wunsch
des Dämonen Crowley
entsprechen und dieses Buch
G. K. Chesterton
Am Anfang …
Ein sonniger Tag.
Inzwischen waren mehr als nur sieben Tage vergangen, und ständig herrschte prächtiges Wetter – den Regen hatte man noch nicht erfunden. Aber jenseits von Eden ballten sich dunkle Wolken zusammen und kündigten ein Unwetter an, das erste in der Klimageschichte des Paradieses. Es handelte sich um eins jener Gewitter, die nicht zum Scherzen aufgelegt sind.
Der Engel am Osttor hob die Flügel über den Kopf, um sich vor den ersten Regentropfen zu schützen.
»Entschuldige bitte«, meinte er höflich, »was hast du gerade gesagt?«
»Ich sagte: Der Typ fiel wie eine bleierne Ente«, erwiderte die Schlange.
»O ja«, murmelte der Engel, dessen Name Erziraphael lautete.
»Um ganz ehrlich zu sein«, fuhr die Schlange fort, »ich halte die Reaktion für etwas übertrieben. Ich meine, gleich beim ersten Vergehen und so. Er war nicht mal vorbestraft. Außerdem: Warum ist es so schlimm, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu kennen?«
»Es muß schlimm sein«, entgegnete Erziraphael im besorgten Tonfall eines Mannes (nun, eines Engels), der eigentlich gar keine Antwort auf diese Frage wußte – was verständliches Unbehagen in ihm weckte. »Andernfalls wärst du nicht daran beteiligt.«
»Man sagte mir nur: ›Geh nach oben und mach ein bißchen Ärger‹«, erklärte die Schlange. Sie hieß Kriecher, spielte jedoch mit dem Gedanken, sich einen anderen Namen zuzulegen. ›Kriecher‹, so beschloß sie, paßte nicht recht zu ihr.
»Ja, aber du bist ein Dämon«, wandte Erziraphael ein. »Vermutlich ist es dir gar nicht möglich, Gutes zu bewirken. Ich meine, es liegt an deiner, äh, Natur. Womit ich dir keineswegs zu nahe treten möchte.«
»Du mußt allerdings zugeben, daß es ein wirklich dickes Ding ist«, sagte Kriecher. »Ich meine, auf Den Baum zu zeigen und dann fettgedruckt zu verkünden: Rührt seine Früchte nicht an! Von Taktgefühl keine Spur. Ich meine, warum hat Er ihn nicht auf irgendeinem weit entfernten, hohen Berg angepflanzt? So etwas stimmt einen doch nachdenklich. Man fragt sich, was Er plant.«
»Es ist bestimmt besser, nicht darüber zu spekulieren«, gab Erziraphael zurück. »Wie ich immer sage: Es hat keinen Sinn, Vermutungen darüber anzustellen, was Seine Erhabenheit bezweckt. Auf der einen Seite steht das Richtige, auf der anderen das Falsche. Wenn man sich für etwas Falsches entscheidet, obwohl man aufgefordert wurde, sich ans Richtige zu halten, so hat man Strafe verdient. Äh.«
Engel und Schlange schwiegen verlegen und beobachteten, wie Regentropfen auf die ersten Blumen herabprasselten.
Nach einer Weile fragte Kriecher: »Hattest du nicht ein Flammenschwert?«
»Äh«, machte Erziraphael. Ein Schatten von Schuld huschte ihm über die Züge, kehrte zurück und klammerte sich im Gesicht des Engels fest.
»Das stimmt doch, oder?« fügte Kriecher hinzu. »Die Flammen sahen toll aus.«
»Äh, nun …«
»Ich war echt davon beeindruckt.«
»Ja, äh, nun …«
»Du hast es verloren, hm?«
»O nein! Nein, nicht wirklich verloren, eher …«
»Nun?«
Erziraphael wirkte zerknirscht. »Wenn du’s unbedingt wissen willst«, sagte er ein wenig trotzig, »ich hab’s verschenkt.«
Kriecher starrte ihn groß an.
»Nun, eigentlich blieb mir gar nichts anderes übrig«, fuhr der Engel fort und rieb sich geistesabwesend die Hände. »Ach, sie froren so, die Armen, und sie ist schon in anderen Umständen, und ich dachte an die bösartigen Tiere dort draußen, und außerdem zog das Gewitter herauf und so, ja, und ich hatte einfach Mitleid, was kann’s schaden? fragte ich mich. Und deshalb sagte ich ihnen: Hört mal, wenn ihr zurückkehrt, geht’s hier drunter und drüber, ihr wißt schon, der Zorn des Allmächtigen kann ziemlich allmächtig sein, nehmt das Schwert, und bedankt euch nicht groß dafür, tut mir und den anderen im Garten Eden bloß den Gefallen und verschwindet so schnell wie möglich.«
Erziraphael sah Kriecher an und lächelte schief.
»Das war doch Richtig, oder?« fragte er zaghaft.
»Vermutlich bringst du es gar nicht fertig, Böses zu bewirken«, erwiderte Kriecher. Der Engel überhörte die Ironie.
»Oh, ich hoffe, du hast recht«, sagte er. »Ja, das hoffe ich wirklich. Den ganzen Nachmittag über habe ich mir Sorgen gemacht.«
Eine Zeitlang sahen sie dem Regen zu.
»Seltsam«, brummte Kriecher schließlich, »ich frage mich immer wieder, ob das mit dem Apfel Falsch genug war. Ich meine, ein Dämon kann in Schwierigkeiten geraten, wenn er das Richtige anstellt.« Er stießden Engel freundschaftlich in die Rippen. »Und wenn wir uns beide irrten, hm? Stell dir nur mal vor, ich hätte mich Richtig verhalten und du Falsch. Komisch, was?«
»Nein, eigentlich nicht«, sagte Erziraphael.
Kriecher blickte ins Paradies und wurde wieder ernst. »Wahrscheinlich hast du recht.«
Ein schiefergrauer Regenschleier umhüllte Eden. Donner grollte über den Hügeln. Die Tiere – sie hatten gerade erst ihre Namen erhalten – verkrochen sich irgendwo.
Weit entfernt im nassen Wald glühte und schimmerte es zwischen den Bäumen.
Eine dunkle und stürmische Nacht zog herauf.
EIN GUTES
OMEN
Eine Erzählung, die Gewisse Ereignisse
während der letzten elf Jahre
der menschlichen Geschichte schildert.
In völliger Übereinstimmung
(wie sich herausstellen wird)
mit dem prophetischen Werk
Die freundlichen und zutreffenden
Prophezeiungen
der Hexe Agnes Spinner
Zusammengestellt, redigiert, mit Der Bildung
Förderlichen Fußnoten und Lehren
Für Die Klugen versehen von
Die aktuellen Theorien über die Erschaffung des Universums laufen auf folgendes hinaus: Wenn der Kosmos überhaupt erschaffen wurde und nicht einfach entstand, wie man inoffiziell annimmt, so ist er derzeit zwischen zehn und zwanzig Milliarden Jahre alt.
Demnach müßte das Alter der Erde etwa viereinhalb Milliarden Jahre betragen.
Diese Angaben sind nicht korrekt.
Im Mittelalter stellten jüdische Gelehrte umfangreiche Berechnungen an und gelangten zu dem Schluß, die Schöpfung sei im Jahr 3760 vor Christi Geburt erfolgt. Griechisch-orthodoxe Theologen sind etwas großzügiger und glauben, die Welt habe 5508 v. Chr. Gestalt angenommen.
Auch das stimmt nicht.
1654 veröffentlichte Erzbischof James Usher (1580 bis 1656) die Annales Veteris et Novi Testamenti, und darin führte er aus, die Schöpfung habe im Jahre 4004 v. Chr. Himmel und Erde entstehen lassen. Einer seiner Mitarbeiter wollte es noch genauer wissen und verkündete schließlich triumphierend, die Erde sei am Sonntag, dem 21. Oktober 4004 v. Chr., um genau neun Uhr erschaffen worden – offenbar pflegte Gott seine Arbeit morgens zu erledigen, wenn er sich noch frisch fühlte.
Der Assistent des Erzbischofs irrte sich. Um fast eine Viertelstunde.
Die Sache mit den Fossilien und Dinosaurierknochen ist ein Witz, den die Paläontologen nur noch nicht verstanden haben.
Was zwei Dinge beweist.
Erstens: Gottes Wege sind nicht nur unerfindlich, sondern führen durch ein Labyrinth, in dem selbst Er sich zu verirren droht. Gott würfelt nicht etwa mit dem Universum. Nein, Er hat ein ganz neues Spiel erfunden, und wenn man es aus dem Blickwinkel seiner Mitspieler* [* Womit alle lebenden Wesen gemeint sind.] betrachtet, so läßt es sich mit einer besonders verzinkten Pokerpartie vergleichen. Das Spiel findet in einem finsteren Zimmer statt, und man benutzt Karten, die weder Zahlen noch irgendwelche Symbole aufweisen. Alle Einsätze sind unbegrenzt hoch, und was den Geber betrifft … Er weigert sich hartnäckig, die Regeln zu erklären – und lächelt die ganze Zeit über.
Zweitens: Die Erde ist eine Waage.
Als diese Geschichte beginnt, enthält die IHRE STERNE HEUTE-Rubrik im Tadfield-Kurier folgende astrologische Botschaft:
WAAGE – 24. September bis 23. Oktober.
Sie fühlen sich erschöpft und im täglichen Trott gefangen. Häusliche und familiäre Angelegenheiten gewinnen eine besondere Bedeutung und führen zu diversen Schwierigkeiten. Vermeiden Sie unnötige Risiken. Ein Freund erweist sich als hilfreich. Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen, bis Sie die Folgen überblicken können. Heute besteht die Gefahr einer Magenverstimmung; verzichten Sie auf Salat. Vielleicht erhalten Sie Hilfe von unerwarteter Seite.
Das Horoskop gibt genau die richtige Auskunft – sieht man einmal von der Sache mit dem Salat ab.
Es war keine dunkle und stürmische Nacht.
Eigentlich sollte es eine dunkle und stürmische Nacht sein, aber auf das Wetter ist eben kein Verlaß. Für jeden wahnsinnigen Wissenschaftler, der sein großes Werk fertigstellt, während draußen Blitze zucken, gibt es ein Dutzend andere, die ziellos unter friedlichen Sternen umherwandern, während Igor Überstunden macht.
Aber lassen Sie sich von dem Nebel (später soll es regnen, und außerdem hat die Wettervorhersage einen Temperatursturz angekündigt) nicht in Sicherheit wiegen – Sie könnten eine ziemliche Überraschung erleben. Eine ruhige Nacht bedeutet keineswegs, daß die Mächte des Bösen gemütlich vor den Kaminfeuern der Hölle sitzen. Sie sind stets und ständig gegenwärtig, und zwar überall.
Das Böse ist allgegenwärtig. Das liegt in der Natur der Sache.
Zwei seiner Repräsentanten lauerten auf dem alten Friedhof. Schattenhafte Gestalten, die eine bucklig und gedrungen, die andere hoch gewachsen, schlank und drohend – wäre Lauern eine olympische Disziplin gewesen, hätten sie echte Chancen auf eine Goldmedaille gehabt. Wenn Bruce Springsteen jemals auf die Idee gekommen wäre, sein neues Album Geboren, um zu lauern zu nennen, so hätte das Cover diese beiden Gestalten gezeigt. Schon seit einer Stunde warteten sie im Nebel. Eine Zeitlang belauerten sie sich gegenseitig, um nicht aus der Übung zu kommen. Sie waren durchaus imstande, die ganze Nacht über zu lauern und sich genug Düsternis zu bewahren, um am Morgen einen Lauer-Spurt einzulegen.
Nach weiteren zwanzig Minuten erklang eine ungeduldige Stimme. »Verdammter Mistkerl. Er hätte schon vor Stunden eintreffen müssen.«
Die Worte stammten von Hastur, seines Zeichens Höllenfürst.
Viele Phänomene – Kriege, Seuchen, unangekündigte Steuerprüfungen – werden darauf zurückgeführt, daß sich Satan in die Angelegenheiten der Menschen einmischt und maßgeblichen Einfluß darauf nimmt. Aber wenn sich irgendwo Studenten der Dämonologie versammeln, so kommen sie schon nach kurzer Diskussion überein, daß die Londoner Autobahn M25 ganz oben auf der Liste der Existenzbeweise Satans stehen müßte. Sie irren sich natürlich mit ihrer Annahme, die betreffende Straße sei nur deshalb Teil des Bösen auf Erden, weil sie jeden Tag einen hohen Blutzoll verlangt und bei Tausenden von Autofahrern Wutanfälle bewirkt.
Nur sehr wenige Menschen wissen, daß die Form der M25 dem Zeichen Odegra entspricht. Jenes Symbol stammt aus der Sprache der Schwarzen Priesterschaft des Uralten Mu und bedeutet ›Gruß dem Erbarmungslosen Tier und Weltenverschlinger‹. Tag für Tag kriechen Myriaden qualmender Wagen über die Autobahn, und sie haben die gleiche Wirkung wie Wasser auf eine Gebetsmühle, mahlen einen endlosen Nebel aus hochgradig Bösem, der die metaphysische Atmosphäre im Umkreis von vielen Meilen verseucht.
Die M25 war eins der größten Verdienste Crowleys. Er brauchte Jahre, um diese Leistung zu vollbringen, und die Vorbereitungen umfaßten: Datenmanipulationen in drei verschiedenen Computern, zwei Einbrüche und eine Bestechung (für die er allerdings nur einen bescheidenen Betrag verwendete). Als trotzdem der erhoffte Erfolg ausblieb, entschloß er sich zu drastischeren Maßnahmen. In einer regnerischen Nacht stapfte er durch den Matsch eines halb überschwemmten Felds, griff nach Absteckpflöcken und versetzte sie um einige in okkulter Hinsicht geradezu unglaublich bedeutende Meter. Als Crowley den ersten dreißig Meilen langen Stau beobachtete, genoß er das überaus angenehme Gefühl, schlechte Arbeit außerordentlich gut geleistet zu haben.
Er bekam eine Belobigung dafür.
Derzeit befand sich Crowley östlich von Slough, und seine Geschwindigkeit betrug hundertzehn Meilen pro Stunde. Wenn man klassische Maßstäbe anlegte, sah er eigentlich gar nicht wie ein Dämon aus. Ihm fehlten Hörner und Flügel. Zugegeben, er hörte sich eine Best of Queen-Kassette an, aber daraus lassen sich keine Schlußfolgerungen ziehen – alle Musikkassetten, die länger als zwei Wochen in einem Wagen liegen, verwandeln sich auf geheimnisvolle Weise in Best of Queen-Alben. Im Augenblick gingen Crowley keine besonders dämonischen Gedanken durch den Kopf. Er fragte sich gerade, ob es nicht angebracht sei, den Weltuntergang mit hunderttausend Watt starken Heavy Metal-Klängen einzuleiten. Das größte Festival aller Zeiten. Und gleichzeitig das letzte.
Crowley hatte dunkles Haar und hohe Jochbeine. Er trug Schuhe aus Schlangenleder – oder zumindest lag die Vermutung nahe, daß er Schuhe trug –, und mit der Zunge konnte er einige recht seltsame Dinge anstellen. Manchmal, wenn er zerstreut war, zischte er leise.
Außerdem zwinkerte er nur selten.
Er fuhr einen schwarzen Bentley Baujahr 1926, den er von sich selbst gekauft und gut gepflegt hatte.
Für seine Verspätung gab es einen schlichten Grund: Crowley fand enormen Gefallen am zwanzigsten Jahrhundert. Er hielt es für besser als das siebzehnte und für viel angenehmer als das vierzehnte. Crowley betonte häufig, die Zeit habe unter anderem den Vorteil, daß sie ihn immer weiter vom vierzehnten Jahrhundert forttrug, den langweiligsten hundert Jahren auf Gottes – Verzeihung – Erde. Das zwanzigste Jahrhundert hingegen war alles andere als langweilig. Um nur ein Beispiel zu nennen: Schon seit fünfzig Sekunden beobachtete er ein blaues Blinklicht im Rückspiegel; es wies ihn auf zwei uniformierte Männer hin, deren Absicht zweifellos darin bestand, ein höchst interessantes Gespräch mit ihm zu führen.
Crowley warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Es handelte sich um eine jener Armbanduhren, die Tiefseetaucher benutzen, um immer genau zu wissen, wie spät es in einundzwanzig Städten der Welt ist, während sie sich unter Wasser aufhalten.* [* Crowley besaß ein spezielles Modell. Es verfügte über eine zusätzliche Funktion, die ziemlich viel Geld gekostet hatte, aber der Dämon konnte es sich leisten, einen hohen Preis zu bezahlen. Diese Uhr gab Auskunft über die Zeit in zwanzig Städten der Erde und an einem anderen Ort, wo es immer zu spät war.]
Der Bentley raste auf die Ausfahrt zu, jagte auf zwei Rädern durch die Kurve und erreichte eine laubbedeckte Straße. Die blauen Lichter folgten.
Crowley seufzte, löste die eine Hand vom Lenkrad, drehte den Kopf und vollführte eine komplizierte Geste.
Das Blinklicht verblaßte in der Ferne, als der Streifenwagen ausrollte – sehr zum Erstaunen der beiden Polizisten. Ihre Verblüffung nahm schlagartig zu, als sie die Kühlerhaube öffneten und feststellten, wozu sich der Motor verwandelt hatte.
Hastur, der größere Dämon, marschierte über den Friedhof, blieb stehen und reichte seinem Kollegen Ligur – dem kleineren und erfahreneren Lauerer – einen Zigarettenstummel.
»Ich sehe Licht«, sagte er. »Da kommt er endlich. Hat sich verdammt viel Zeit gelassen.«
»Welches Transportmittel benutzt er?« fragte Ligur.
»Ein Auto – eine Art Kutsche ohne Roß«, erklärte Hastur. »Autos gab es wahrscheinlich noch nicht, als du das letzte Mal hier warst. Wenigstens nicht für den allgemeinen Gebrauch.«
»Ich erinnere mich an Leute, die am Straßenrand warteten, um Pferdeäpfel einzusammeln«, sagte Ligur.
»Heute tragen diese Leute weiße Kittel und fahren Unfallopfer weg. Das ist der Fortschritt.«
»Und was ist mit Crowley?« fragte Ligur.
Hastur spuckte aus. »Er ist schon zu lange hier oben«, erwiderte er. »Von Anfang an. Meiner Ansicht nach hat er sich viel zu sehr an diese Welt gewöhnt. Er hat sogar ein Autotelefon.«
Ligur dachte nach. Wie die meisten Dämonen verstand er nicht viel von Technik, und deshalb wollte er antworten: ›Da stecken sicher viele Drähte drin.‹ Er schwieg jedoch, als der Bentley vor dem Friedhofstor hielt.
»Und er trägt eine Sonnenbrille.« Hastur schnaubte verächtlich. »Selbst wenn er keine braucht.« Lauter fügte er hinzu: »Gepriesen sei Satan.«
»Gepriesen sei Satan«, wiederholte Ligur.
»Hallo, Jungs!« rief Crowley und winkte. »Entschuldigt die Verspätung. Ihr wißt sicher, wie es auf der A40 bei Denham zugeht, tja, und als ich die Abkürzung nach Chorley Wood fuhr …«
»Jetzt sind wir alle hier«, warf Hastur bedeutungsvoll ein. »Wir werden nun von den Taten des Tages berichten.«
»Ja, äh, Taten«, sagte Crowley im Tonfall eines Mannes, der zum erstenmal seit Jahren die Kirche besucht und sich nicht mehr genau daran erinnert, wann man aufsteht.
Hastur räusperte sich.
»Ich habe einen Priester in Versuchung geführt«, begann er. »Als er den Bürgersteig entlangging und die hübschen jungen Frauen im Sonnenschein sah, säte ich Zweifel in ihm. Er hätte ein Heiliger werden können, aber in zehn Jahren gehört er uns.«
»Nicht übel«, kommentierte Crowley und gab sich beeindruckt.
»Ich habe einen Politiker verderbt«, berichtete Ligur, »indem ich ihn davon überzeugte, daß er sich ruhig bestechen lassen kann. In einem Jahr gehört er uns.«
Die beiden Dämonen richteten erwartungsvolle Blicke auf Crowley, der von einem Ohr bis zum anderen grinste.
»Ich habe zur Mittagszeit alle Funktelefone im Zentrum von London gestört«, verkündete er. »Und zwar fünfundvierzig Minuten lang.«
Stille folgte, nur unterbrochen vom fernen Motorbrummen auf den Straßen.
»Ja?« fragte Hastur. »Und dann?«
»Es war nicht gerade einfach«, entgegnete Crowley.
»Ist das alles?« erkundigte sich Ligur.
»Hört mal, die Menschen …«
»Was genau hast du getan, um unserem Gebieter Seelen zu bringen?« knurrte Hastur.
Crowley seufzte innerlich.
Was sollte er den beiden Gesandten der Finsternis erzählen? Daß zwanzigtausend Personen völlig aus dem Häuschen geraten waren? Daß man in der ganzen Stadt hören konnte, wie Zornesadern anschwollen? Daß Manager, Geschäftsführer und Abteilungsleiter ihren Ärger an Sekretärinnen, Politessen und so weiter ausließen – und daß deren schlechte Laune daraufhin nach anderen menschlichen Zielscheiben suchte? Dadurch kam eine regelrechte emotionale Lawine ins Rollen. Tausende von Gehirnen, die nur an Rache dachten – für den Rest des Tages. Und das Schönste war: Sie ließen sich die Methoden der Vergeltung von ganz allein einfallen. Zahllose Seelen, deren heller reiner Glanz sich langsam trübte – und man brauchte kaum einen Finger zu rühren.
Aber so etwas konnten Hastur und Ligur nicht verstehen. Dämonen wie sie dachten noch immer in Begriffen des vierzehnten Jahrhunderts – manchmal investierten sie Jahre, um Gott eine einzelne Seele zu stehlen. Nun, sie waren echte Künstler, aber die moderne Zeit erforderte eine moderne Strategie. Man mußte sich der veränderten demographischen Situation anpassen. Inzwischen gab es mehr als fünf Milliarden Menschen auf der Erde, und demnach hatte es keinen Sin, sich auf einzelne Individuen zu beschränken. Man erzielte weitaus größere Erfolge, wenn man sich bei den seelenfängerischen Bemühungen auf die breite Masse konzentrierte. Diese Erkenntnis blieb Hastur und Ligur nach wie vor fremd. Zum Beispiel wäre es ihnen nie in den Sinn gekommen, Fernsehprogramme in Walisisch zu senden. Vermutlich hätten sie nicht einmal genügend teuflische Phantasie aufgebracht, um die Mehrwertsteuer zu erfinden. Oder eine Stadt wie Manchester.
Auf Manchester war Crowley besonders stolz.
»Bisher scheinen die Verantwortlichen in der Hölle zufrieden zu sein«, sagte er. »Die Zeiten ändern sich eben. Nun, was liegt an?«
Hastur griff hinter einen Grabstein.
»Das hier«, antwortete er.
Crowley starrte auf den Korb hinab.
»Oh«, machte er. »Nein.«
»Doch«, erwiderte Hastur und lächelte.
»Schon?«
»Ja.«
»Und, äh, ich bin damit beauftragt …?«
»Ja.« Hasturs Lächeln wuchs in die Breite.
»Warum ausgerechnet ich?« klagte Crowley. »Du kennst mich, Hastur. Ich meine, ich spiele mich nicht gern in den Vordergrund. Um ganz ehrlich zu sein: Ich begnüge mich mit einer Statistenrolle.«
»Diesmal nicht«, widersprach Hastur. »Diesmal bekommst du die Hauptrolle. Die Zeiten ändern sich eben.«
»Ja«, bestätigte Ligur und grinste. »Bald hören sie auf. Eine nette Abwechslung.«
»Warum ich?«
Offenbar hast du dort unten irgendeinen Gönner«, lächelte Hastur boshaft. »Ich bin sicher, Ligur gäbe den rechten Arm für eine solche Chance.«
»Und ob«, pflichtete ihm Ligur bei. Zumindest war er bereit, irgendeinen rechten Arm zu geben. An rechten Armen herrschte kein Mangel – warum den eigenen verschwenden?
Hastur griff unter seinen feuchten, schmierigen Regenmantel und holte ein Klemmbrett hervor.
»Unterschreib mal eben. Hier«, sagte er und trennte die beiden letzten Worte mit einer unheilvollen Pause.
Crowley tastete unsicher in die Innentasche seiner Jacke, und kurz darauf kehrte die rechte Hand mit einem dünnen matt-schwarzen Kugelschreiber zurück. Er schien bereit zu sein, jede Geschwindigkeitsbeschränkung zu überschreiten.
»Tolles Ding«, brummte Ligur.
»Schreibt sogar unter Wasser«, murmelte Crowley.
»Ach, was mag den Menschen wohl als nächstes einfallen?« überlegte Ligur laut.
»Nun, wenn sie noch was erfinden möchten, sollten sie sich besser beeilen«, sagte Hastur. Und: »Nein! ›A. J. Crowley‹ genügt nicht. Unterzeichne mit deinem richtigen Namen.«
Crowley nickte kummervoll und malte mehrere Schlangenlinien aufs Papier. Ein oder zwei Sekunden lang glühten sie in einem düsteren Rot – und lösten sich dann auf.
»Was fange ich damit bloß an?«fragte Crowley und deutete auf den Korb.
»Du bekommst noch Anweisungen.« Hastur runzelte die Stirn. »Warum machst du dir Gedanken? Jahrhundertelang haben wir auf das Ziel hingearbeitet, und jetzt ist es fast erreicht.«
»Ja. Genau. Stimmt.« Crowley sah nun nicht mehr aus wie der geschmeidige Mann, der vor einigen Minuten mit geschmeidiger Geschmeidigkeit aus dem Bentley gesprungen war. Er wirkte niedergeschlagen und betrübt.
»Der Zeitpunkt unseres ewigen Triumphes rückt näher!«
»Ewig, ja«, murmelte Crowley.
»Und du bist das Werkzeug eines ruhmreichen Schicksals!«
»Werkzeug«, wiederholte Crowley. »Ja.« Er hob den Korb so vorsichtig hoch, als sei er hochexplosiv. Sein Inhalt sollte tatsächlich dazu dienen, eine in jeder Hinsicht verheerende Wirkung zu entfalten.
»Äh, in Ordnung«, sagte er. »Ich gehe jetzt. Nicht wahr? Ich meine, ich möchte das hier so schnell wie möglich loswerden. Ich meine, ich möchte es nicht loswerden, meine ich«, fügte Crowley rasch hinzu, als er daran dachte, was geschehen könnte, wenn Hastur einen ungünstigen Bericht für ihn verfaßte. »Aber ihr kennt mich ja: Ich bin immer voll dabei.«
Die beiden dienstälteren Dämonen schwiegen.
»Also gut, ab geht die Post«, fuhr Crowley nervös fort. »Bis später, Jungs! Ich meine, wir sehen uns bestimmt wieder. Äh. Bis dann. Tja. Na schön. Äh. Tschüs. Ciao.«
Der schwarze Bentley rollte durch die Nebelschwaden davon und schien mit der Finsternis zu verschmelzen.
»Das letzte Wort klang irgendwie komisch«, sagte Ligur. »Hast du es verstanden?«
»Ist italienisch«, erwiderte Hastur. »Bedeutet ›Essen‹, glaube ich.«
»Was für ein komischer Abschiedsgruß.« Ligur sah dem Wagen nach und beobachtete in der Ferne verblassende Rücklichter.
»Traust du ihm?« fragte er.
»Nein«, antwortete Hastur.
»Gut.« Ligur nickte. Die Welt wäre wirklich ein Tollhaus, wenn Dämonen plötzlich Vertrauen zueinander hätten, dachte er.
Crowley raste irgendwo westlich von Amersham durch die Nacht, griff nach einer Kassette und versuchte, sie aus der Kunststoffhülle zu lösen, ohne von der Straße abzukommen. Im Scheinwerferlicht eines anderen Wagens las er den Titel: ›Vier Jahreszeiten‹ von Vivaldi. Ruhige, tröstende Musik – genau das brauchte er jetzt.
Mit einem entschlossenen Ruck schob er die Kassette in den Recorder.
»Ohmistmistmistmistmist!« zischte er. »Warum jetzt? Warum ich?«
Vertraute Queen-Klänge dröhnten aus dem Lautsprecher.
Und plötzlich sprach Freddy Mercury zu ihm.
WEIL DU ES VERDIENT HAST, CROWLEY.
Der Dämon fluchte lautlos. Es war seine Idee, die Elektronik als Kommunikationsmittel zu verwenden, und erstaunlicherweise ging man Unten sofort auf seinen Vorschlag ein. Crowley hatte gehofft, daß sich die Höllenfürsten zunächst anhand von Fachzeitschriften informieren würden (er dachte in diesem Zusammenhang an Artikel wie ›So richtet man eine häusliche Funkstation ein‹ und ›Akustische Spezialeffekte leichtgemacht‹), aber statt dessen gingen sie einfach auf Sendung, wann und wie es ihnen gefiel. Dabei spielte es keine Rolle, was er sich gerade anhörte; Satan und sein Mitarbeiterstab sahen in der Akustik eine weiche Knetmasse, die sich ganz nach Belieben formen ließ.
Crowley schluckte.
»Vielen Dank, Gebieter«, sagte er.
WIR SETZEN GROSSES VERTRAUEN IN DICH, CROWLEY.
»Danke, Gebieter.«
DIESE SACHE IST SEHR WICHTIG, CROWLEY.
»Ich weiß, ich weiß.«
ES GIBT NICHTS WICHTIGERES, CROWLEY.
»Überlaßt alles mir.«
GENAU DAS HABEN WIR VOR, CROWLEY UND WENN IRGEND ETWAS SCHIEFGEHT, SO WERDEN DIE SCHULDIGEN HART BESTRAFT. DAS GILT AUCH FÜR DICH, CROWLEY. GERADE FÜR DICH.
»Ich verstehe, Gebieter.«
HIER SIND DEINE ANWEISUNGEN, CROWLEY.
Und plötzlich wußte Crowley Bescheid.
Er haßte so etwas.
Die Höllenfürsten hätten es ihm einfach sagen können; sie hätten ihm das Wissen, das ihn erschauern ließ, nicht unbedingt ins Gehirn pflanzen müssen. Das Ziel war ein ganz bestimmtes Krankenhaus.
»Ich bin in fünf Minuten dort, Gebieter. Kein Problem.«
GUT. Woraufhin Freddy Mercury seinen Gesang fortsetzte.
Crowley trommelte mit den Fingern aufs Lenkrad. Während der vergangenen Jahrhunderte war alles wie am Schnürchen gelaufen; es gab überhaupt keine Schwierigkeiten. Typisch: Im einen Augenblick ist man munter und fidel, und im nächsten muß man den Weltuntergang einleiten, dachte der Dämon verbittert. Der Große Krieg. Die Letzte Schlacht. Himmel gegen Hölle, drei Runden, auf jeden Fall eine Entscheidung – keine Verhandlungen. Es gibt die Welt nicht mehr. Das allein bedeutet der Satz vom Ende der Welt. Anschließend gab es nur noch ewigen Himmel oder ewige Hölle – es kam ganz darauf an, wer sich durchsetzte. Crowley wußte nicht, was schlimmer war.
Rein definitionsgemäß sollte die Hölle schlimmer sein. Aber Crowley erinnerte sich auch an den Himmel, und seiner Ansicht nach hatten die beiden Orte gewisse Dinge gemeinsam. Weder Oben noch Unten bekam man einen ordentlichen Drink. Und die Langeweile im Himmel konnte fast ebenso unerträglich sein wie die Aufregungen in der Hölle.
Es gab keinen Ausweg. Man konnte nicht Dämon sein und sich gleichzeitig den freien Willen bewahren.
Nun, wenigstens passierte es nicht sofort. Es dauerte noch eine Weile bis zum Weltuntergang. Es blieb Crowley genügend Zeit, ein paar Dinge zu erledigen. Zum Beispiel konnte er seine Aktien und langfristigen Obligationen verkaufen. Es hatte keinen großen Sinn mehr, finanziell für die Zukunft zu planen.
Queen-Chef Mercury sang noch immer, und Crowley hörte geistesabwesend zu.
… I will not let you go (let him go) …
Warum nicht?
Was mochte geschehen, wenn er auf dieser dunklen, feuchten und leeren Straße anhielt, den Korb nahm, weit ausholte, das Ding fortwarf und …
Vermutlich irgend etwas Schreckliches.
Einst war er ein Engel gewesen. Er hatte nicht fallen wollen. Er fiel nur deshalb, weil er Umgang mit den falschen Leuten pflegte.
Der Motor des Bentley brummte wie ein zufriedener Hornissenschwarm, und die Benzinuhr zeigte weiterhin einen leeren Tank an. Nun, inzwischen war der Tank schon seit sechzig Jahren leer – es hatte nicht nur Nachteile, wenn man ein Dämon war. Zum letztenmal hatte Crowley im Jahr 1967 getankt, um eins der James-Bond-Einschußloch-in-der-Windschutzscheibe-Abziehbilder zu bekommen, die damals als letzter Schrei für den modernen Autofahrer galten.
Im Fond wackelte der Korb, und das Wesen darin begann zu weinen. Crowley lauschte der Stimme des Neugeborenen. Sie klang wie das Heulen einer Fliegeralarm-Sirene und war schrill und wortlos und alt.
In einem solchen Krankenhaus konnte man sich wohl fühlen, fand Mr. Young. Es gab nur einen Haken: Es fehlte jene Art von angenehmer Stille, die es Patienten und Besuchern ermöglichte, sich zu entspannen.
Der Grund dafür: die Nonnen.
Mr. Young mochte Nonnen. Um falschen Schlüssen des Lesers vorzubeugen: Nein, er war nicht sonderlich religiös. Wenn es darum ging, Kirchen auszuweichen, so konzentrierte er seine entsprechenden Bemühungen in erster Linie auf gewisse anglikanische Institute, die Demut und Frömmigkeit viel zu ernst nahmen. Anderen heiligen Stätten ging er aus reiner Angewohnheit aus dem Weg. In manchen von ihnen roch es nach Bohnerwachs, während man in anderen höchst verdächtige Kräuter verbrannte. Tief im Ledersessel seiner Seele fragte sich Mr. Young, was Gott davon hielt. Wahrscheinlich nicht viel.
Was Nonnen betraf … Ihre Gesellschaft gefiel ihm ebenso wie die Gegenwart der Heilsarmee. Wenn er sie beobachtete, hatte er das Gefühl, daß alles in Ordnung war und man sich keine Sorgen zu machen brauchte – irgend jemand achtete darauf, daß die Welt nicht aus den Fugen geriet.
Dies war seine erste Erfahrung mit dem Schwatzhaften Orden der Heiligen Beryll. [* Der Name des Ordens bezieht sich auf die Heilige Beryll Articulatus von Krahakau, die angeblich im fünften Jahrhundert als Märtyrerin starb. Legenden beschreiben Beryll als junge Frau, die man gegen ihren Willen mit einem Heiden verheiratete, Prinz Kasimir. In der Hochzeitsnacht betete sie zum Herrn und hoffte auf ein Wunder. Sie wußte nicht genau, was es zu erwarten galt, rechnete aber irgendwie damit, daß ihr ein wundersamer Bart wachse. Um vorbereitet zu sein, hatte sie sich ein kleines Rasiermesser mit Elfenbeingriff (Sonderanfertigung für Damen) besorgt. Doch der Allmächtige beschloß statt dessen, Beryll mit der erstaunlichen Fähigkeit auszustatten, pausenlos zu reden und alles auszusprechen, was ihr in den Sinn kam – ohne zwischendurch Luft holen oder etwas essen zu müssen.
In einer Überlieferung heißt es, Prinz Kasimir habe Beryll drei Wochen nach der Hochzeit erwürgt, ohne die Ehe vollzogen zu haben. Demnach starb seine Angetraute als Jungfrau und Märtyrerin – und redete bis zum Tod.
Eine andere Version behauptet folgendes: Kasimir kaufte sich Ohrwatte, und Beryll starb zusammen mit ihrem Mann im Bett, als Zweiundsechzigjährige.
Die Angehörigen des Schwatzhaften Ordens sind verpflichtet, ständig dem Beispiel der Heiligen Beryll zu folgen. Es gibt nur eine Ausnahme: Am Dienstagnachmittag dürfen die Nonnen eine halbe Stunde lang schweigen und Tischtennis spielen.] Deirdre hatte bereits Gelegenheit gefunden, ihn kennenzulernen, vermutlich bei einem ihrer politischen Kreuzzüge – sie betrafen meistens irgendwelche unfreundlichen Südamerikaner, die gegen andere unfreundliche Südamerikaner kämpften und von Priestern angestachelt wurden, anstatt sich auf ihre priesterlichen Aktivitäten zu konzentrieren, die darin bestanden, Reinigungs-Dienstpläne für ihre Kirchen aufzustellen.
Nonnen sollten eigentlich still sein, meinte Mr. Young. Sie hatten genau die Form wie jene spitzen Dinger, die Mr. Young irgendwie aus Hi-Fi-Testkammern kannte. Diese Nonnen aber schnatterten dauernd.
Er stopfte sich Tabak in die Pfeife – soweit man das als Tabak bezeichnen konnte; unter ›Tabak‹ stellte man sich normalerweise etwas anderes vor – und überlegte, was geschehen mochte, wenn er sich nach der Herrentoilette erkundigte. Vielleicht bekam man kurze Zeit später einen bitterbösen Brief vom Papst. Er seufzte hingebungsvoll und warf einen Blick auf die Uhr.
Wenigstens hatten ihm die Nonnen verboten, bei der Geburt zugegen zu sein – in dieser Hinsicht vertraten sie einen unerschütterlich festen Standpunkt. Deirdre war bestimmt enttäuscht. Sie hat wieder angefangen, irgendwelches Zeug zu lesen, dachte Mr. Young. Wir haben bereits ein Kind, aber ganz plötzlich erklärt sie, diese Entbindung solle die glücklichste aller glücklichen gemeinsamen Erfahrungen für zwei Menschen werden. Das kam davon, wenn man der Ehefrau individuelle Lektüre gestattete. Mr. Young mißtraute Zeitungen und Magazinen, die Worte wie ›Lebensstil‹, ›Harmonie‹ und ›eheliche Selbstverwirklichung‹ enthielten.
Nun, er hatte nichts gegen glückliche gemeinsame Erfahrungen. Seiner Meinung nach gab es an glücklichen gemeinsamen Erfahrungen kaum etwas auszusetzen. Die Welt brauchte wahrscheinlich mehr glückliche gemeinsame Erfahrungen. Aber diese spezielle glückliche gemeinsame Erfahrung konnte Deirdre ganz für sich allein behalten.
Die Nonnen stimmten ihm zu. Sie sahen keinen Grund dafür, den Vater an der Geburt zu beteiligen. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, so argwöhnte Mr. Young, hätten sie sogar die väterliche Teilnahme am Zeugungsakt abgeschafft.
Er drückte den sogenannten Tabak fest und sah auf das Schild an der Wand des Wartezimmers. Es wies zu seinem eigenen Besten darauf hin, daß er nicht rauchen solle. Zu seinem eigenen Besten entschied er, den Raum zu verlassen und nach draußen zu gehen. Er dachte an seine Blase – vielleicht fand er irgendwo einen geeigneten Busch, der es ihm erlaubte, auf ein päpstliches Mahnschreiben zu verzichten.
Mr. Young wanderte durch leere Korridore, fand eine Tür und trat auf den regennassen Hof. Von Büschen und Sträuchern keine Spur. Auf der einen Seite standen nur einige sorgfältig aufgereihte Mülltonnen. Nun gut.
Er fröstelte und zündete die Pfeife an.
Frauen! Es ereilt sie in einem bestimmten Alter. Fünfundzwanzig untadelige Jahre – dann plötzlich machen sie sich auf und ergehen sich in diesen roboterhaften Freiübungen, wobei sie rosafarbene Socken ohne Fußteil tragen, und dann werfen sie ihren Ehemännern vor, daß sie ihren Lebensunterhalt nie selbst verdienen mußten. Es sind die Hormone oder so was ähnliches.
Ein großer schwarzer Wagen hielt bei den Mülltonnen. Der Fahrer, ein junger Mann mit dunkler Sonnenbrille, stieg aus, griff nach einer Säuglings-Tragetasche und schlängelte sich durch den Nieselregen.
Mr. Young nahm die Pfeife aus dem Mund.
»Sie haben vergessen, das Licht auszuschalten«, sagte er freundlich.
Der junge Mann erweckte den Eindruck, als stehe die Batterie des schwarzen Wagens ganz unten auf der Liste seiner Sorgen. Er hob die Hand, blickte zum Bentley zurück und winkte kurz. Das Scheinwerferlicht verblaßte.
»Nicht übel«, sagte Mr. Young. »Ein Infrarotsignal?«
Die Feststellung, daß der junge Mann überhaupt nicht naß wurde, überraschte ihn ein wenig. Und die Tragetasche schien keineswegs leer zu sein.
»Hat es schon begonnen?« fragte Mr. Sonnenbrille.
Es erfüllte Mr. Young mit Stolz, daß man ihn sofort als werdenden Vater erkannte.
»Ja«, erwiderte er. »Die Nonnen haben mich fortgeschickt«, fügte er dankbar hinzu.
»Schon? Wieviel Zeit haben wir noch?«
Das wir entging Mr. Young nicht. Offenbar war der junge Mann ein Arzt, der väterliche Gefühle teilte.
»Ich glaube, wir, äh, sind bereits voll bei der Sache«, sagte er.
»In welchem Zimmer liegt sie?« fragte Mr. Sonnenbrille aufgeregt.
»Wir sind in Raum Drei«, antwortete Mr. Young. Er klopfte auf die Taschen seiner Jacke und fühlte das ebenso zerknitterte wie gewohnte Päckchen.
»Möchten Sie eine glückliche gemeinsame Raucherfahrung mit mir teilen?«
Aber Mr. Sonnenbrille war bereits im Krankenhaus.
Mr. Young steckte das Päckchen wieder ein und blickte nachdenklich auf seine Pfeife hinab. Ärzte haben es immer eilig, dachte er. Sie nutzen die von Gott gegebene Zeit, um ihren Mitmenschen zu helfen. Bewundernswert.
Sie kennen doch den Trick, den man mit einer Erbse und drei schnell bewegten Tassen ausführen kann. Nun, etwas in der Art findet jetzt im Krankenhaus statt, und es geht dabei um mehr als nur eine Handvoll Kleingeld.
Die Autoren schreiben hier etwas langsamer, damit man dem Bewegungsmuster der drei – metaphorischen – Tassen besser folgen kann.
Mrs. Deirdre Young befindet sich in Kreißsaal Drei. Sie bringt einen blonden Jungen zur Welt, den wir Baby A nennen wollen.
Die Frau des amerikanischen Kulturattachés, Mrs. Harriet Dowling, liegt im Kreißsaal Vier. Sie bringt einen blonden Jungen zur Welt, den wir Baby B nennen.
Schwester Maria Redeviel ist fromme Satanistin, und zwar seit ihrer Geburt. Als Kind besuchte sie die Sabbat-Schule und wurde für Handschrift und gutes Betragen mit schwarzen Sternchen ausgezeichnet. Sie gehorchte sofort, als man sie aufforderte, dem Schwatzhaften Orden beizutreten – was dauerhaftes Schwatzen angeht, ist Maria Redeviel ein echtes Naturtalent, und außerdem wußte sie, daß sie sich einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten anschloß. Sie kann recht intelligent sein, wenn sie Gelegenheit dazu findet, aber schon früh wurde ihr klar, daß man als Schussel wesentlich besser durchs Leben kommt. Sie erhält gerade einen blonden Jungen, der einen ziemlich langen Namen hat. Er heißt: der Widersacher, Zerstörer von Königreichen, Engel der Dunkelheit, Großes Tier-das-man-Drachen nennt, Herr dieser Welt, Vater aller Lügen, Satansbrut und Fürst der Finsternis.
Achtung, es geht los. Die Tassen bewegen sich …
»Ist er das?« fragte Schwester Maria und betrachtete das Baby aufmerksam. »Ich hätte andere Augen erwartet. Rot oder grün, wissen Sie. Vielleicht auch etwas schlitzförmig. Außerdem hat er gar keine winzig-klitzikleinigen Hufilein. Und ein Ringelschwänzchen fehlt ebenfalls.« Die Nonne drehte den Knaben um und hielt vergeblich nach Hörnern Ausschau. Das Kind des Teufels wirkte geradezu verblüffend normal.
»Ja, das ist er«, bestätigte Crowley.
»Kaum zu glauben«, staunte Schwester Maria. »Ich halte den Antichristen in den Armen. Und ich zähle seine kleinen süßen Zehilein …«
Sie sprach nun direkt zu dem Kind, und ihre Gedanken verloren sich in einer privaten Welt. Crowley hob die Hand und wedelte vor dem Nonnenschleier hin und her. »Hallo? Hallo? Schwester Maria?«
»Oh, entschuldigen Sie! Aber er ist wirklich ein Schatz. Sieht er nicht wie sein Papi aus? Oh, ich finde schon. Na, sieht er nicht wie sein liebes Papilein aus …?«
»Nein«, erwiderte Crowley fest, »das finde ich nicht. Es wird Zeit, zu den Kreißsälen zu gehen.«
»Was meinen Sie – wird er sich an mich erinnern, wenn er aufwächst?« fragte Schwester Maria wehmütig und betrat den Flur.
»Hoffen Sie, daß ihn sein Gedächtnis im Stich läßt«, entgegnete Crowley und floh.
Die Nonne schritt durchs nächtliche Krankenhaus, in ihren Armen der Widersacher, Zerstörer von Königreichen, Engel der Dunkelheit, Großes Tier-das-man-Drachen-nennt, Herr dieser Welt, Vater aller Lügen, Satansbrut und Fürst der Finsternis. Sie fand eine kleine Korbwiege und legte den Knaben hinein.
Er gluckste leise. Schwester Maria kitzelte ihn.
Ein matronenhaftes Gesicht blickte in den Korridor. »Was tun Sie da, Schwester Maria?« fragte es. »Sollten Sie nicht im Entbindungsraum Vier sein?«
»Meister Crowley sagte …«
»Seien Sie eine brave Nonne und helfen Sie im Kreißsaal. Übrigens: Wissen Sie, wo der Ehemann steckt? Er sitzt nicht im Wartezimmer.«
»Ich habe mit Meister Crowley gesprochen, und er meint …«
»Da bin ich ganz sicher«, erwiderte Schwester Liebreiz Redegewandt fest. »Nun, ich suche besser nach dem verflixten Mann. Kommen Sie herein und kümmern Sie sich um Mrs. Young. Die Mutter ist ein wenig benommen, aber dem Kind geht es prächtig.« Schwester Liebreiz zögerte kurz. »Warum blinzeln Sie? Haben Sie Probleme mit den Augen?«
»Sie wissen schon«, hauchte Schwester Maria unterwürfig. Ihre Brauen tanzten mehrmals auf und nieder. »Die Neugeborenen. Der Austausch …«
»Oh, natürlich, natürlich«, sagte Schwester Liebreiz. »Alles zu seiner Zeit. Wir dürfen doch nicht zulassen, daß der Vater überall im Krankenhaus umherwandert, oder? Er könnte gewisse Dinge sehen und Verdacht schöpfen. Deshalb schlage ich vor, Sie warten hier und behalten das Baby im Auge, bitte seien Sie so lieb.«
Die Oberin rauschte über den frisch gebohnerten Flur. Schwester Maria betrat, den Korbkinderwagen vor sich her schiebend, den Kreißsaal.
Mrs. Young war nicht nur benommen. Sie schlief tief und fest, mit der tiefen Zufriedenheit einer Frau, die weiß, daß sie die Lauferei endlich einmal anderen Leuten überlassen kann. Baby A schlummerte neben ihr, gewogen und mit einem kleinen Namensschild versehen. Schwester Maria hatte die Angewohnheit, sich ständig nützlich zu machen, und auch diesmal wollte sie sich nicht damit begnügen, einfach nur zu warten. Sie nahm das Namensschild, kopierte es und stattete den Knaben in ihrer Obhut mit dem Duplikat aus. Die beiden Kinder sahen sich sehr ähnlich: Sie waren klein, fleckig und wirkten wie Miniaturausgaben von Winston Churchill.
Jetzt könnte ich eine Tasse Tee vertragen, dachte Schwester Maria.
Bei den meisten Angehörigen des Schwatzhaften Ordens handelte es sich um eher altmodische Satanisten, so wie ihre Eltern und Großeltern. Sie wuchsen mit dem Satanismus auf, und eigentlich konnte man sie nicht als sonderlich böse bezeichnen. Es gibt nur wenige Menschen, die durch und durch böse sind. Allerdings lassen sich viele von neuen Ideen anstecken: Sie ziehen Schaftstiefel an und erschießen Leute; sie hüllen sich in weiße Laken und lynchen Leute; oder sie zwängen sich in hautenge ausgewaschene Jeans und foltern Leute mit elektrischen Gitarren. Wenn man Menschen eine Philosophie und die dazu passende Kleidung gibt, gewinnt man mit Sicherheit viele Anhänger. Außerdem: Wenn man als Satanist aufwächst, ist alles halb so schlimm. Der Satanismus wird dadurch zu einer Art Samstagabendvergnügen. Während der übrigen Zeit führt man ein ganz normales Leben wie alle anderen. Hinzu kam, daß Schwester Maria als Krankenschwester arbeitete, und Krankenschwestern sind in erster Linie Krankenschwestern, ganz gleich, woran sie glauben. Sie neigen dazu, ihre Armbanduhren andersherum zu tragen, bei Notfällen die Ruhe zu bewahren – und sich nach einer Tasse Tee zu sehnen. Schwester Maria Redeviel hoffte, daß man sie möglichst bald ablösen werde. Sie hatte ihre Pflicht erfüllt, und nun wollte sie eine Tasse Tee trinken.
Man kann menschliche Angelegenheiten weitaus besser verstehen, wenn man sich folgender Erkenntnis stellt: Die größten Triumphe und Tragödien in der Geschichte gehen nicht etwa auf Menschen zurück, die vollkommen gut oder vollkommen böse sind, sondern darauf, daß Menschen einfach Menschen sind.
Jemand klopfte an die Tür. Schwester Maria öffnete.
»Ist es schon passiert?« fragte Mr. Young. »Ich bin der Vater. Der Ehemann. Ich meine, beides.«
Die Nonne hatte damit gerechnet, daß der amerikanische Kulturattaché wie Blake Carrington oder J. R. Ewing aussah. Mr. Young wies nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Amerikanern im Fernsehen auf – ließ man den onkelhaften Sheriff in besseren Kriminalfilmen unberücksichtigt.* [* Hier sind jene Filme gemeint, die eine ältere Dame als Detektivin ermitteln lassen und nur dann eine Verfolgungsjagd zeigen, wenn sie in aller Gemütsruhe stattfindet.] Er stellte eine Enttäuschung dar. Und von seiner Strickjacke hielt Schwester Maria ebenfalls nicht viel.
Schade, dachte die Nonne und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
»O ja«, antwortete sie. »Herzlichen Glückwunsch. Ihre Frau schläft. Armes Ding.«
Mr. Young blickte ihr über die Schulter. »Zwillinge?« brachte er hervor. Er griff nach seiner Pfeife. Er schob sie wieder in die Tasche. Er holte sie erneut hervor. »Zwillinge? Niemand hat etwas von Zwillingen gesagt.«
»O nein!« entfuhr es Schwester Maria. »Dies ist Ihr Sohn. Das andere Baby hat, äh, andere Eltern. Ich kümmere mich nur um ihn, bis Schwester Liebreiz zurückkehrt.« Sie deutete auf Widersacher, Zerstörer von Königreichen, Engel der Dunkelheit, Großes Tier-das-man-Drachen-nennt, Herr dieser Welt, Vater aller Lügen, Satansbrut und Fürst der Finsternis. »Dieser Junge sieht Ihnen auch viel ähnlicher. Er ist geradezu Ihr Ebenbild, vom Kopf bis zu den winzig-klitzikleinigen Hufilein – die er nicht hat«, fügte sie rasch hinzu.
Mr. Young beugte sich vor.
»Äh, ja«, erwiderte er skeptisch. »Scheint mir tatsächlich aus dem Gesicht geschnitten zu sein. Es ist doch, äh, alles in Ordnung mit ihm, oder?«
»O ja«, versicherte Schwester Maria. »Ein ganz normales Kind«, betonte sie. »Ganz, ganz normal.«
Kurze Stille schloß sich an. Nonne und Vater blickten auf den schlafenden Knaben hinab.
»Sie haben überhaupt keinen Akzent«, sagte Schwester Maria nach einer Weile. »Wohnen Sie schon lange hier?«
»Seit ungefähr zehn Jahren«, sagte Mr. Young ein wenig verwirrt. »Ich bin hierherversetzt worden.«
»Ihre Arbeit ist bestimmt sehr interessant«, vermutete Schwester Maria. Mr. Young lächelte erfreut. Nur wenige Leute wußten die faszinierenden Aspekte des betrieblichen Rechnungswesens zu schätzen.
»Wahrscheinlich dauerte es eine Weile, bis Sie sich eingewöhnten«, fuhr Schwester Maria fort.
»Wie man’s nimmt«, erwiderte Mr. Young ausweichend. Soweit er sich erinnern konnte, gab es zwischen Luton und Tadfield kaum Unterschiede. Die gleichen Leute. Die gleichen Hecken zwischen den Häusern und der Eisenbahnstrecke.
»Ich nehme an, dort, wo Sie früher tätig waren, sind die Gebäude größer«, hakte Schwester Maria nach. Es klang fast verzweifelt. »Und höher.«
Mr. Young musterte die Nonne unsicher. Meinte sie vielleicht die Niederlassungen der Banken und Versicherungsgesellschaften?
»Sicher veranstalten Sie häufig Gartenparties«, mutmaßte Schwester Maria.
Ah, dies war vertrauteres Terrain. Deirdre fand großen Gefallen an Gartenfesten.
»Ja«, bestätigte er erleichtert, »meine Frau läßt unsere Gäste von ihrer selbstgemachten Marmelade kosten, und ich muß mich um die Bratwürstchen und den Kartoffelsalat kümmern.«
Schwester Maria Redeviel runzelte überrascht die Stirn. Sie hörte nun zum erstenmal, daß im Buckingham Palace auch derart bürgerliche Speisen auf den Tisch kamen. Nun, die Königin ist auch nur ein Mensch.
»Nun, mit bestimmten Dingen muß man sich eben abfinden«, kommentierte sie. »Ich habe gelesen, daß sie ständig Geschenke von ausländischen Würdenträgern erhält.«
»Wie bitte?«
»Wissen Sie, ich bin ein großer Fan der königlichen Familie.«
»Oh, ich auch«, sagte Mr. Young und sprang damit auf eine neue Eisscholle im verwirrenden Strom ihrer Gedanken. Ja, mit der königlichen Familie kannte er sich aus; sie bot festen thematischen Halt. Natürlich galt Mr. Youngs Sympathie nur den richtigen Prinzen und Prinzessinnen, die ihrem Volk zuwinkten und neue Brücken einweihten. Von den anderen, die sich nächtelang in Diskotheken herumtrieben und auf die Paparazzi* [* Vielleicht sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß Mr. Young unter ›Paparazzi‹ italienische Fliesen verstand.] spuckten, hielt er nicht viel.
»Das freut mich«, sagte Schwester Maria. »Ich dachte immer, Sie und Ihre Landsleute halten nicht viel von Königinnen und Adel. Und was hat es mit der Revolution auf sich und damit, daß Sie die ganzen Teeservice in den Fluß geworfen haben?«
Die Nonne plauderte weiter und achtete damit das Gebot des Schwatzhaften Ordens, stets das zu sagen, was ihr gerade in den Sinn kam. Die meisten Worte blieben für Mr. Young völlig rätselhaft, und er war viel zu müde, um sich Gedanken darüber zu machen. Vermutlich führte das religiöse Leben dazu, daß man irgendwann ein wenig seltsam wurde. Mrs. Young schlief noch immer, was er sehr bedauerte. Er wünschte sich, daß sie bald erwachte.
Mehrere von Schwester Maria aneinandergereihte Silben weckten vage Hoffnung in Mr. Young.
»Gibt es vielleicht die Möglichkeit, daß ich möglicherweise eine Tasse Tee bekommen könnte, bitte?« wagte er zu fragen.
»Ach, du meine Güte!« platzte es aus Schwester Maria heraus. »Warum habe ich nicht längst daran gedacht? Was werden Sie jetzt von mir denken …«
Mr. Young verzichtete auf eine Antwort.
Die Nonne eilte zur Tür. »Ich bin gleich wieder da«, versprach sie. Mr. Young verstand es als Drohung. »Mögen Sie vielleicht lieber einen Kaffee? Im Flur steht ein Automat.«
»Nein, Tee ist mir lieber«, erwiderte Mr. Young.
»Sie haben sich wirklich eingelebt, wie?« meinte Schwester Maria fröhlich und verließ das Zimmer.
Mr. Young blieb allein mit einer schlafenden Frau und zwei schlafenden Säuglingen zurück, seufzte und nahm in einem Sessel Platz. Ja, sicher lag es am frühen Aufstehen, dem häufigen Niederknien und ständigen Beten. So etwas konnte nicht ohne Folgen bleiben. Leute wie Schwester Maria meinten es natürlich gut, tief in ihrem Herzen, aber wenn man längere Zeit mit ihnen zu tun hatte …
Mr. Young entsann sich an einen Ken Russel-Film, in dem auch Nonnen vorkamen. Nun, solche Dinge schienen hier nicht zu geschehen. Doch wie hieß es so schön? Kein Rauch ohne Flamme …
Er seufzte erneut.
Eine Sekunde später erwachte Baby A und beschloß, seine Stimmbänder zu testen.
Es war schon viele Jahre her, seit Mr. Young zum letztenmal versucht hatte, einen schreienden Säugling zu beruhigen. In dieser Hinsicht ließ sein Geschick ohnehin zu wünschen übrig. Er hatte Sir Winston Churchill immer große Verehrung entgegengebracht, und daher widerstrebte es ihm, kleineren Versionen des berühmten Politikers auf den Po zu klopfen.
»Willkommen auf der Welt«, sagte er schlicht. »Früher oder später wirst du dich an sie gewöhnen.«
Das Baby klappte den Mund zu und sah Mr. Young so an, als wäre er ein unbotmäßiger General.
Schwester Maria wählte genau diesen Augenblick, um mit dem Tee zurückzukehren. Satanistin oder nicht: Sie brachte sogar einen Teller Kekse mit. Normalerweise wurden solche Leckereien serviert, wenn man Teatime-Gäste diskret darauf hinweisen wollte, daß sie schon seit zwei Stunden am Tisch saßen und besser gehen sollten. Mr. Young betrachtete sie mit mäßigem Interesse. Die rosarote Tönung erinnerte ihn an Chirurgen-Handschuhe, und der Zuckerguß sah aus, als hätten sich kleine Schneemänner in den Backofen verirrt.
»Wahrscheinlich kennen Sie so etwas nicht«, sagte Schwester Maria Redeviel. »In Ihrer Heimat nennt man sie Plätzchen. Wir hingegen sprechen von Bis-kuits.«
Mr. Young wollte antworten, daß er durchaus mit dem englischen Vokabular vertraut sei und häufig Biskuits gegessen habe, wie alle anderen Leute in Luton. Aber er kam nicht dazu, auch nur einen Ton von sich zu geben. Eine andere Nonne eilte atemlos ins Zimmer.
Sie sah Schwester Maria an und begriff, daß Mr. Young nie im Innern eines Pentagramms gestanden hatte. Stumm deutete sie auf Baby A und zwinkerte.
Schwester Maria nickte und zwinkerte ebenfalls.
Die zweite Nonne griff nach einem der beiden Säuglinge und trug ihn fort.
Die menschliche Kommunikation läßt für gewöhnlich einen breiten Interpretationsspielraum, was insbesondere auf das Zwinkern zutrifft. Aus einem Zwinkern kann man viel herauslesen. Die zweite Nonne teilte damit folgendes mit:
Wo zur Hölle sind Sie gewesen? Baby B ist geboren, und wir müssen den Austausch vornehmen. Aber Sie sitzen hier im falschen Zimmer bei Widersacher, Zerstörer von Königreichen, Engel der Dunkelheit, Großes Tier-das-man-Drachen-nennt, Herr dieser Welt, Vater aller Lügen, Satansbrut und Fürst der Finsternis – und trinken Tee. Ist Ihnen eigentlich bekannt, daß man mich fast erschossen hätte?
Nonne Nummer Zwei glaubte, in Schwester Marias gezwinkerter Antwort folgende Botschaft zu erkennen: Hier ist der Widersacher, Zerstörer von Königreichen, Engel der Dunkelheit, das große Tier-das-man-Drachen-nennt, Herr Dieser Welt, Vater aller Lügen, Satansbrut und Fürst der Finsternis. Ich kann nicht sprechen, weil ein Außenstehender zugegen ist.
Im Gegensatz dazu hatte Maria Redeviel das Zwinkern der anderen Krankenschwester folgendermaßen interpretiert:
Gut gemacht, Schwester Maria – Sie haben den Austausch ganz allein vorgenommen. Zeigen Sie mir jetzt das andere Kind, damit ich es fortbringen und Sie Ihrem Gespräch mit Seiner Königlichen Exzellenz der amerikanischen Kultur überlassen kann.
Und deshalb bedeutete ihr eigenes Zwinkern:
Sie haben völlig recht, Teuerste, es ist bereits alles erledigt. Baby B liegt dort. Nehmen Sie es und lassen Sie mich mit Seiner Exzellenz allein. Endlich habe ich Gelegenheit, ihn zu fragen, warum die Häuser in Amerika so hoch sind und aus lauter Spiegeln bestehen.
Die Feinheiten dieses Nachrichtenaustauschs entgingen Mr. Young, der recht verlegen war, weil er das Zwinkern für ein Zeichen geheimer Zuneigung hielt und zu dem messerscharfen Schluß gelangte, daß Ken Russel genau Bescheid gewußt hatte, als er seinen Nonnen-Film drehte.
Vielleicht wäre die andere Satanistin auf Schwester Marias Fehler aufmerksam geworden, wenn sie nicht durch die Anwesenheit der Geheimdienstmänner in Mrs. Dowlings Zimmer überaus verstört gewesen wäre. Ihre Ausbildung verlangte ein gewisses Reaktionsmuster von ihnen, wenn ihnen Gestalten begegneten, die lange Umhänge und Tücher vor den Gesichtern trugen. Derzeit sahen sie sich mit widersprüchlichen Signalen konfrontiert, woraus sich ein höchst problematischer innerer Konflikt ergab. Menschen, die sich mit widersprüchlichen Signalen konfrontiert sehen und an höchst problematischen inneren Konflikten leiden, sollten keine geladene und entsicherte Waffe in der Hand halten. So etwas ist noch weitaus weniger ratsam, wenn sie gerade eine natürliche Geburt gesehen haben – was eine völlig unamerikanische Methode zu sein schien, neue Bürger zur Welt zu bringen. Außerdem hatten sie gehört, es gebe Gebetbücher in dem Gebäude.
Mrs. Young bewegte sich.
»Haben Sie sich schon für einen Namen entschieden?« fragte Schwester Maria schelmisch.
»Hmm?« erwiderte Mr. Young. »Oh. Nein, eigentlich nicht. Ein Mädchen hätten wir Lucinda genannt, nach meiner Mutter. Allerdings meinte Deirdre, Germaine klinge viel besser.«
Die Nonne erinnerte sich an ihre satanistischen Pflichten. »Wie wär’s mit Wormwood?« schlug sie vor. »Oder Damien. Ja, Damien ist derzeit sehr beliebt.«
Die achteinhalbjährige Anathema Apparat – ihre Mutter hatte sich nie sehr eingehend mit religiösen Angelegenheiten beschäftigt; sie las das Wort eines Tages und meinte, es sei ein hübscher Mädchenname – zog sich mehrere Bettdecken über den Kopf, schaltete ihre Taschenlampe ein und las Im Buch.
Andere Kinder lernten das Lesen mit Hilfe von Fibeln, in denen es bunte Bilder von Äpfeln, Bällen, Kakerlaken und anderen Dingen gab. Bei den Sprößlingen der Apparat-Familie lag der Fall völlig anders. Anathema hatte das Lesen mit Dem Buch gelernt.
Darin fehlten Abbildungen von Äpfeln und Bällen. Insekten blieben ebenfalls unberücksichtigt. Statt dessen wartete Das Buch miteinem sehr eindrucksvollen Holzschnitt aus dem achtzehnten Jahrhundert auf: Er zeigte Agnes Spinner, die auf einem Scheiterhaufen brannte und offenbar große Freude daran fand.
Das erste Wort, das Anathema entziffern konnte, lautete freundlich. Nur sehr wenige achteinhalb Jahre alte Kinder wissen, daß nicht nur Menschen freundlich sein können, aber Anathema gehörte zu ihnen.
Das zweite Wort hieß zutreffend.
Und hier sind die ersten Sätze, die sie laut las:
»Ich saget diesiges, unt man möget ghut auf meinige Worte achten. Vier wärden reitigen, unt Vier wärden ebensolchiges reitigen, unt Drei wärden über den Himmel reitigen, wie durch Magieh, und Einer reitiget in Flammen. Unt nichts kann sie aufhaltigen: weder Fisch noch Rehgen noch Schtraße, weder Toifel noch Engel. Unt du wirstet dabei sain, Anathema.«
Es gefiel Anathema, über sich selbst zu lesen.
(Manche Eltern – gemeint sind hier insbesondere Väter und Mütter, die nur gewisse Sonntagszeitungen kaufen – schenken ihren Kindern Bücher, deren Helden oder Heldinnen ebenso heißen wie die betreffenden Söhne und Töchter. [Ein Wunder der modernen Drucktechnik.] Auf diese Weise wollen sie Interesse am Lesen wecken. Aber Dieses Buch schilderte nicht nur das Leben Anathemas – bisher stimmten alle Einzelheiten –, sondern auch die Schicksale der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, bis zurück zum siebzehnten Jahrhundert. Das Mädchen war noch zu jung und zu ichbezogen, um darauf zu achten, daß weder eigene Kinder noch irgendwelche Ereignisse erwähnt wurden, die mehr als elf Jahre in der Zukunft lagen. Wenn man achteinhalb ist, erscheinen einem elf Jahre wie ein ganzes Leben, und genau darauf lief es auch hinaus, wenn man Dem Buch Glauben schenken konnte.)
Anathema war ein intelligentes, aufgewecktes Kind mit blassen Wangen, dunklen Augen und schwarzem Haar. Häufig weckte sie Unbehagen in anderen Leuten, und außerdem besaß sie mehr übersinnliche Fähigkeiten, als für sie gut sein mochte, Eigenschaften, die sie von ihrer Urururururgroßmutter geerbt hatte.
Sie galt als frühreif und beherrscht. Die Lehrer hatten nichts an ihr auszusetzen – abgesehen von einer Orthographie, die nicht etwa entsetzlich, sondern seit dreihundert Jahren überholt war.
Die Nonnen nahmen Baby A und vertauschten es vor der Nase der Frau des Kulturattachés und der Geheimdienstmänner mit Baby B. Dazu setzten sie eine zweckmäßige List ein, indem sie behaupteten, das Baby wiegen zu müssen, wobei sie erklärten, es sei Vorschrift. Sie schoben das eine Kind auf einem Wagen hinaus und kamen mit dem anderen Säugling etwas später zurück.
Der Kulturattaché Thaddäus J. Dowling war vor einigen Tagen überraschend nach Washington zurückbeordert worden, aber während der Geburt stand er in telefonischer Verbindung mit seiner Frau, um ihr beim Atmen zu helfen.
Es war nicht gerade hilfreich, daß er über eine andere Leitung mit seinem Anlageberater sprach. An einem bestimmten Punkt blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Frau zwanzig Minuten lang warten zu lassen. Doch das war schon in Ordnung.
Der Attaché wußte natürlich, daß eine Geburt die glücklichste aller glücklichen gemeinsamen Erfahrungen für zwei Menschen ist, und er wollte keine einzige Sekunde verpassen.
Aus diesem Grund hatte er einem der Männer vom Geheimdienst die Anweisung gegeben, alles mit einer Videokamera zu filmen.
Das Böse im allgemeinen schläft nicht, und deshalb sah es auch nicht ein, daß jemand anders schlafen sollte. Doch Crowley gefiel es, ein Nickerchen zu machen; er sah darin einen der angenehmen Aspekte des weltlichen Daseins. Besonders nach einem schweren Essen. Zum Beispiel hatte er den größten Teil des neunzehnten Jahrhunderts im Schlaf verbracht.* [* Allerdings stand er im Jahr 1832 auf, um zur Toilette zu gehen.] Es war nicht nötig, daß er seine Kräfte erneuerte; er fand einfach Spaß daran, sich hinzulegen und die Augen zu schließen.
Die angenehmen Aspekte des weltlichen Daseins. Nun, er sollte sich beeilen, sie in vollen Zügen zu genießen – solange noch Zeit dazu war.
Der Bentley raste durch die Nacht, in Richtung Osten.
Natürlich begrüßte Crowley den Weltuntergang im allgemeinen. Wenn er gefragt worden wäre, warum er sich seit vielen Jahrhunderten in die Angelegenheiten der Menschheit einmischte, so hätte er geantwortet: ›Oh, um das Armageddon und den Triumph der Hölle zu ermöglichen.‹ Aber es war eine Sache, darauf hinzuarbeiten – und eine ganz andere, die Letzte Schlacht tatsächlich stattfinden zu lassen.
Crowley hatte immer gewußt, daß er den Weltuntergang erleben würde. Schließlich war er unsterblich, und daher blieb ihm kaum eine Wahl. Aber er hatte gehofft, es würde noch lange dauern.
Der Grund: Er mochte die Menschen. Bei Dämonen kamen derartige Einstellungen einem schweren Charakterfehler gleich.
In dieser Hinsicht konnte Crowley einfach nicht über den eigenen Schatten springen. Oh, er gab sich alle Mühe, das kurze Leben der Menschen mit möglichst viel Elend zu erfüllen – das war schließlich sein Job. Doch sein diesbezüglicher Ideenreichtum wurde weit davon übertroffen, was sich die Menschen selbst antaten. Die Gattung Homo sapiens schien da eine natürliche Begabung zu haben; vielleicht hatte es irgend etwas mit den Genen zu tun. Die Menschen wurden in eine Welt hineingeboren, die Tausende von Problemen für sie bereithielt, und den größten Teil ihrer Energie verwendeten sie darauf, alles noch schlimmer zu machen. Im Lauf der Jahre fiel es Crowley zunehmend schwerer, sich etwas Dämonisches einfallen zu lassen, das aus der Masse der allgemeinen Gemeinheiten herausstach. Während des letzten Jahrtausends hatte er mehrmals mit dem Gedanken gespielt, eine folgendermaßen formulierte Botschaft nach Unten zu schicken: He, Jungs, wir brauchen uns überhaupt nicht mehr anzustrengen. Wir sollten die Unterwelt und das Pandämonium schließen, um uns hier oben niederzulassen. Die Menschen nehmen uns die Arbeit ab und sind fest entschlossen, alle Möglichkeiten von Leid, Grauen und Entsetzen zu nutzen. Ihrem Einfallsreichtum sind keinerlei Grenzen gesetzt, und sie verwenden Dinge, die wir überhaupt nicht kennen, zum Beispiel Elektroden. Die Menschen besitzen das, was uns fehlt. Sie haben Vorstellungskraft. Und natürlich Elektrizität.
Ein Sterblicher hatte irgendwann und irgendwo geschrieben: ›Die Hölle ist leer. Alle Teufel befinden sich hier.‹
Wie wahr, wie wahr.
Crowley dachte an seine Auszeichnung für die spanische Inquisition. Oh, er hatte sich damals in Spanien aufgehalten (er lächelte unwillkürlich, als er sich an seine Streifzüge durch die Tavernen und Schenken erinnerte, an hübsche junge Damen mit Kastagnetten und einer gehörigen Portion Temperament), aber von der Inquisition erfuhr er erst, als er die Belobigung bekam. Woraufhin er beschloß, sich die Sache aus der Nähe anzusehen.
Kurze Zeit später nahm er sich vor, mindestens eine Woche lang betrunken zu sein.
Man denke nur an die Bilder eines gewissen Hieronymus Bosch. Wie schrecklich.
Und wenn man endlich daran glaubte, daß Menschen zu mehr Bosheit fähig waren als die Mächte der Finsternis, da zeigten sie plötzlich eine Güte, die der Güte des Himmels in nichts nachstand. Manchmal betraf dieses Phänomen sogar ein und dasselbe Individuum. Freier Wille und so. Beim Satan höchstpersönlich: Das menschliche Verhalten war immer für eine Überraschung gut. Es war schon eine Plage.
Erziraphael hatte einmal versucht, es zu erklären. Wenn Menschen gut oder böse waren, führte er aus – das Gespräch fand im Jahr 1020 statt, kurz nach Der Übereinkunft zwischen Dämon und Engel –, so ging das entsprechende Gebaren auf eine eigene Entscheidung zurück. Mit anderen Worten: Sie wollten gut oder böse sein. Wohingegen Leute wie Crowley (und Erziraphael selbst) einem vorbestimmten Weg folgen mußten. Die Sterblichen, so fügte der Engel hinzu, konnten nur dann zu Heiligen werden, wenn man ihnen die Möglichkeit gab, ausgesprochen lasterhaft zu sein.
Crowley dachte eine Zeitlang darüber nach, und im Jahr 1023 erwiderte er: He, wart mal, das funktioniert doch nur, wenn alle die gleichen Startchancen bekommen. Wer in einem armseligen Schuppen während eines grausamen Krieges geboren wird, hat wohl kaum die gleichen Chancen wie jemand, der in einem Schloß das Licht der Welt erblickt.
Ah, sagte Erziraphael, das ist ja gerade das Tolle daran. Je weiter unten du beginnst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen.
Total bescheuerte Spielregeln, brummte Crowley.
Nein, widersprach Erziraphael. Typisches Beispiel für Unerfindlichkeit.
Erziraphael. Zweifellos Der Feind. Aber wenn man es sechstausend Jahre lang mit dem gleichen Feind zu tun hatte, wurde er schließlich zum Freund.
Crowley ließ die rechte Hand sinken und griff nach dem Autotelefon.
Von einem Gesandten der Hölle erwartete man, daß er keinen freien Willen entwickelte. Doch ein Dämon, der sich lange genug unter Menschen befand, lernte das eine oder andere.
Mr. Young hielt nicht viel von Damien oder Wormwood. Ebensowenig von den anderen Vorschlägen Schwester Maria Redeviels, die alle satanischen Namenslisten durchging und sich anschließend auf die goldenen Jahre Hollywoods besann.
»Nun …«, sagte sie. Es klang ein wenig gekränkt. »Mit Errol dürfte alles in Ordnung sein. Oder Cary. Es sind hübsche amerikanische Namen.«
»Ich dachte eigentlich an etwas, äh, Traditionelleres«, erwiderte Mr. Young. »In meiner Familie haben wir immer einfache Namen gewählt.«
Schwester Maria strahlte. »Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Die alten Namen sind immer die besten.«
»Ein anständiger biblischer Name«, sagte Mr. Young. »Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes«, fügte er hinzu. Die Nonne zuckte unwillkürlich zusammen. »Allerdings klingen sie nicht wie richtige biblische Namen. Wenn man sie hört, stellt man sich Cowboys und Fußballspieler vor.«
»Saul wäre nicht schlecht«, warf Schwester Maria hoffnungsvoll ein.
»Jetzt werden wir, äh, zu traditionell«, antwortete er.
»Oder Kain.« Die Nonne war der Verzweiflung nahe. »Kain ist viel moderner als Saul.«
»Hmm.« Mr. Young wirkte skeptisch.
»Natürlich bleibt immer noch die Möglichkeit, den Jungen – Adam zu nennen«, sagte Schwester Maria. Dagegen dürfte es eigentlich keine Einwände geben.
»Adam?« wiederholte Mr. Young.
Die Vorstellung, daß die satanischen Nonnen den zweiten Knaben – Baby B – mit der gebotenen Diskretion adoptierten, wäre sicher recht nett. Daß er zu einem normalen, glücklichen, lachenden Kind heranwuchs. Daß er mit kleinen Autos spielte, brav zur Schule ging und darauf verzichtete, Fliegen die Beine auszureißen. Daß er noch mehr wuchs und zu einem normalen, mehr oder weniger zufriedenen Mann wurde.
Nun, vielleicht ist das tatsächlich geschehen.
Denken Sie nur an die Auszeichnungen, die er während der ersten Grundschuljahre für gute Orthographie bekommt. An seine ereignislose, aber angenehme Studienzeit. An seinen Job im Lohnbüro des Tadfield und Norton Bauunternehmens und an seine sympathische Frau. Vielleicht möchten Sie diesem Szenarium auch noch einige Kinder und ein Hobby hinzufügen, etwa die Restaurierung alter Motorräder oder das Züchten tropischer Fische.
Vermutlich wollen Sie nicht wissen, was mit Baby B passieren könnte.
Nun, Ihre Version gefällt den Autoren ohnehin besser.
Wahrscheinlich gewinnt Baby B als Mann sogar Preise für seine tropischen Fische.
Licht brannte im Schlafzimmer eines kleinen Hauses in Dorking, Surrey.
Newton Läuterer war zwölf und dünn. Er trug eine Sonnenbrille mit dicken Gläsern und sollte eigentlich schon seit Stunden schlafen.
Mutter Läuterer war vom Genie ihres Sohns überzeugt und bestand erst gar nicht darauf, daß er früh zu Bett ging. Sie erlaubte es ihm, ›Experimente‹ durchzuführen.
Beim gegenwärtigen wissenschaftlichen Versuch ging es darum, den Stecker eines uralten Röhrenradios zu wechseln, das Newton von seiner Mom bekommen hatte. Der Junge saß an einem zerkratzten Tisch, den er stolz als ›Werkbank‹ bezeichnete, betrachtete ein Durcheinander aus Drähten, Batterien, Glühlampen und einen selbst hergestellten kleinen Detektorempfänger, der jedoch nicht funktionierte. Was auch für das Röhrenradio galt. Irgend etwas – wahrscheinlich das Schicksal – hinderte Newton daran, einen technischen Erfolg zu erzielen. Aber er gab nicht auf.
Drei ziemlich schiefe Modellflugzeuge baumelten an Wollfäden von der Decke herab. Selbst ein flüchtiger Beobachter hätte auf den ersten Blick erkannt, daß sie jemand gebastelt hatte, der sorgfältig, gewissenhaft und nicht besonders gut im Zusammenbauen von Modellflugzeugen war. Newton hatte sie voller Stolz ins Herz geschlossen, selbst die Spitfire, deren Tragflächen eine einzige Katastrophe waren.
Er rückte sich die Brille zurecht, schielte auf den Stecker und setzte den Schraubenzieher an.