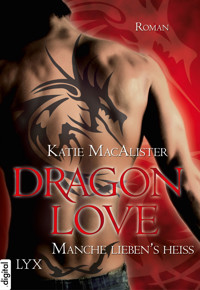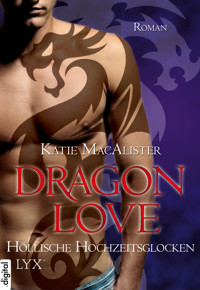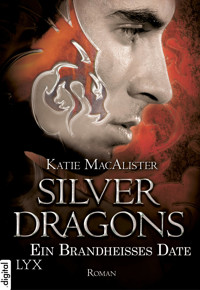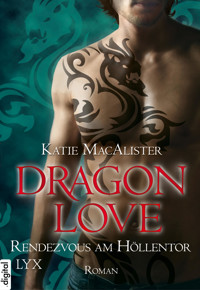9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark Ones
- Sprache: Deutsch
Liebe auf den zweiten Biss
Tempest Keyes will nur eins: einen echten Vampir kennenlernen! Die Chance dazu rückt in greifbare Nähe, als sie eine Einladung auf das Schloss von Christian Dante und dessen Frau Allie erhält. Und tatsächlich findet Tempest bereits in der ersten Nacht den Dunklen Merrick Simon bewusstlos vor den Toren liegend. Als sie ihn mit ihrem Blut vor dem Tod retten kann, sieht sie sich schon am Ziel ihrer Wünsche. Doch dann ist der verführerische Merrick am nächsten Morgen verschwunden, und Tempest versteht die Welt nicht mehr. So sollte ein Vampir seine Auserwählte doch nicht behandeln, oder?
"Ich liebe Ein Vampir um jeden Preis!" BTH Reviews
Band 11 der Dark-Ones-Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin Katie MacAlister
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchProlog12345678910111213141516EpilogZusatzgeschichte12345678EpilogDie AutorinDie Romane von Katie MacAlister bei LYXImpressumKATIE MACALISTER
Ein Vampir um jeden Preis
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Theda Krohm-Linke
Zu diesem Buch
Tempest Keyes liebt Vampire! Sie hat schon unzählige Bücher über sie verschlungen, und nun steht ein Treffen mit einem verführerischen Dunklen ganz oben auf ihrer To-do-Liste. Als sie eine Einladung in das Schloss von Christian Dante und dessen Frau Allie erhält, scheint ihre Chance gekommen: Tatsächlich findet sie dort gleich in der ersten Nacht den Dunklen Merrick Simon bewusstlos vor den Toren des Schlosses. Es gelingt Tempest, ihn mit ihrem Blut vor dem sicheren Tod zu retten. Verständlicherweise erwartet sie, dass Merrick nun in Liebe zu ihr entflammt. Doch weit gefehlt. Am nächsten Morgen ist dieser einfach verschwunden, und Tempest versteht nicht, was da schiefgelaufen ist. So sollte ein Vampir seine Auserwählte doch ganz bestimmt nicht behandeln! Als sie dann aber erfährt, dass
Merrick als einer der vier Reiter die Gemeinschaft der Dunklen beschützt, ist sie sich ihrer Aufgabe sicher: Sie wird Merrick helfen, seine Mission zu erfüllen – und ganz nebenbei sein Herz gewinnen.
Prolog
»Na, wenn das nicht Merrick ist.« Die beiden Männer, die aus einer Gasse aufgetaucht waren, blieben vor einem heruntergekommenen Gebäude stehen.
Der zweite Mann blickte in die Richtung, in die der erste gezeigt hatte. »Was? Wo? Ja, tatsächlich, das ist er. Und er scheint sich nicht gerade zu freuen, uns zu sehen.«
»Nein, kein bisschen. Warum eigentlich nicht?«, fragte der erste Mann. Er ließ den Zahnstocher sinken, mit dem er zwischen den Zähnen herumgestochert hatte, und verzog die Lippen zu einem Grinsen. Dabei enthüllte er schiefe, gelbe Zähne.
Auch der zweite Mann grinste. Genau wie bei seinem Kumpan war es kein angenehmes Grinsen. »Vampire sind seltsame Wesen, Henri. Äußerst seltsame Wesen. Aber wir könnten ihn ja fragen, warum er so ein böses Gesicht macht. Willst du, oder soll ich?«
»Ich würde es ja tun, Jens, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Merrick uns, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, als Abschaum bezeichnet.« Henri, der Mann mit dem Zahnstocher, verzog verletzt sein unschönes Gesicht.
»Abschaum! Empörend!«, befand Jens kopfschüttelnd. »Es ist wirklich schockierend, wenn ein alter Freund wie Merrick so etwas zu uns sagt. So, als ob er uns nicht kennen würde!«
Merrick Simon blieb vor einem Wohnheim in einem heruntergekommenen Stadtteil von Prag stehen und bedachte beide Männer mit einem Blick. »Warum habt ihr mich hierherbestellt? Konntet ihr nicht eine Nachricht schicken?«
»Na, jetzt mach aber mal halblang, Merrick, alter Freund«, sagte Henri und zeigte mit seinem angekauten Zahnstocher auf Merrick. »Du hast uns doch selber gesagt, dass Geheimhaltung von äußerster Wichtigkeit ist.«
»Genau, das hat er gesagt, in der Tat.« Jens nickte und trat hinter Merrick, was ihm wohl, wie Merrick vermutete, ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelte. »Wir tun nur das, was du uns gesagt hast.«
»Und haben die Informationen für dich, die du haben wolltest«, fügte Henri schnell hinzu.
»Und jetzt guckst du uns böse an, weil wir unseren Job machen«, fügte Jens hinzu und lehnte sich nonchalant an ein Geländer. »Das ist wirklich traurig.«
»Na los, nun macht schon«, sagte Merrick, der langsam die Geduld verlor. »Was wollt ihr mir zeigen?«
»Du hast gesagt, du wolltest über jeden Schritt von diesem Mann informiert sein. Er hieß doch Rex, oder?«, fragte Henri.
»Victor«, korrigierte Merrick. Er war sich der Tatsache, dass Jens hinter ihm stand, absolut bewusst. Er war kein Narr – er traute den beiden nicht über den Weg, aber wenn sie wirklich Informationen für ihn hatten, konnten sie ihm nützlich sein.
»Genau, Victor.« Henri riss die Augen auf. »Anscheinend ist sein Assistent vor zwei Tagen nach Prag gereist und wohl immer noch dort.«
»Sein Assistent?« Merrick runzelte die Stirn. Er hatte noch nie davon gehört, dass sein ärgster Feind einen Assistenten hatte. »Wer soll das denn sein?«
»Ich weiß seinen Namen nicht«, sagte Henri und stocherte erneut mit seinem Zahnstocher zwischen den Zähnen herum. »Wir haben Gerüchte gehört, dass er Arbeiten für Rex erledigt.«
»Für Victor«, korrigierte Jens.
Merrick warf einen Blick auf das Haus. Er wusste nicht genau, ob er den beiden Männern Glauben schenken sollte. »Von wem habt ihr diese Information?«
Entgegenkommend hielt Henri ihm sein Handy hin. »Du kannst den Text gerne lesen.«
Und Merrick las. Als er den Namen des Absenders sah, runzelte er die Stirn. »Das ist Nicos Informant. Der, von dem er die Flughäfen beobachten lässt.«
»Er hat es uns gesagt, und wir haben es an dich weitergegeben«, sagte Henri geschmeidig. »Wir dachten uns, wenn jemand, der für die Vier Reiter arbeitet, etwas von sich gibt, dann muss es ja stimmen.«
»Der Assistent ist da drinnen«, fügte Jens hinzu. Er zog ein kleines Taschenmesser aus der Tasche und reinigte sich die Fingernägel. »Oberste Etage. Erste Tür rechts. Wir dachten uns, es lohnt sich, dafür hierherzukommen.«
»Ja, in der Tat«, bestätigte Merrick und nickte ihnen zu. Irgendwas an der Sache schien ihm faul zu sein, aber der Text, den Henri ihm gezeigt hatte, war in Ordnung.
Henri wies mit dem Kopf auf die blaue Tür. »Gehst du hinein?«
»Ja.« Merrick verlagerte sein Gewicht und bedachte Henri mit einem Blick, als ob er keine Ahnung hätte, was hinter seinem Rücken vor sich ging.
»Alleine?«, fragte Henri.
»Willst du etwa mitkommen?«
»Du weißt doch, dass wir uns gerne bedeckt halten«, sagte Jens und klappte sein Messer zu.
»Langsam sollte er uns kennen«, sagte Henri im Plauderton. Mehr Warnung brauchte Merrick nicht. »Er sollte wissen, dass wir nicht gerne in diese kleinen Auseinandersetzungen verwickelt werden.«
Merrick spürte, wie sich hinter ihm die Luft bewegte. Er wirbelte herum und packte Jens, der auf ihn zusprang, um ihm das offene Messer in den Rücken zu rammen. Merrick schleuderte Jens gegen die Wand und wirbelte erneut herum, um einen Tritt auf Henris Brust zu landen. Ein scharfer Schmerz zuckte durch seinen linken Arm, als Henri zwei Schüsse aus seiner Pistole abgab.
Henri flog ein paar Meter zurück und knallte gegen eine Mülltonne. Die Pistole entglitt seiner Hand und rutschte über den Bürgersteig bis vor Merricks Fuß.
Finster blickte Merrick auf das Blut, das aus seinem Arm quoll, aber er ignorierte den Schmerz und bückte sich, um die Pistole aufzuheben. »Wenn ihr mich jemals wieder angreift, sind wir uns zum letzten Mal begegnet, das verspreche ich euch. Die Rechnung für die Schusswunde schicke ich euch«, fügte er an Henri gewandt hinzu. Dann leerte er das Magazin der Pistole und warf sie in die Mülltonne.
Jens lag mit ausgebreiteten Armen an der Mauer. Wo er an den Steinen entlanggeglitten war, verlief ein blutiger Streifen. Er stöhnte und zuckte leicht, also war er wohl nicht tot. Merrick war beruhigt. Er wollte nicht noch einen Toten auf dem Gewissen haben, auch wenn dieser Mann ihn durch seine Taten geradezu dazu herausgefordert hatte. Merrick schob die Gedanken beiseite und betrat das Wohnheim.
Eine Woge von Gerüchen überfiel ihn in der nur schwach beleuchteten Eingangsdiele – gekochter Kohl vermischt mit Urin, Mäusekot und frisch geschlachteten Säugetieren.
Er blieb nicht stehen, um darüber zu sinnieren, wie man in so einem entsetzlichen Gestank leben konnte, sondern lief mit geschärften Sinnen sofort die Treppe zum dritten Stock hinauf. Es war nicht auszuschließen, dass seine beiden sogenannten Informanten ihm eine Falle gestellt hatten.
Im obersten Stockwerk blieb er vor der ersten Tür rechts stehen und lauschte, aber außer der Musik aus einem Radio, das irgendwo im zweiten Stock vor sich hin dudelte, hörte er nichts.
Er rümpfte die Nase. Hier roch es noch stärker nach Schlachthof, was ihm einen solchen Adrenalinstoß verpasste, dass er kurz entschlossen handelte. Ohne zu klopfen, trat er die Tür auf und stürmte hinein, wobei er sich insgeheim vor dem Anblick fürchtete, der ihn wohl erwartete.
Mitten im Zimmer blieb er stehen, erleichtert, weil keine dunklen Wesen getötet wurden. Das Zimmer schien leer zu sein. Verwirrt runzelte er die Stirn. Er hatte nie davon gehört, dass Victor einen Assistenten hatte. Hatte er sich jemanden zu Hilfe geholt?
Die Haare in seinem Nacken richteten sich auf, aber dieses Mal war er nicht schnell genug. Zwei Männer tauchten aus den Schatten auf und griffen ihn an. Einer von ihnen schlug ihm mit einem Kricketschläger auf den Kopf.
Wie aus der Ferne hörte er einen der Männer sagen, es sei schade, dass sie ihn töten müssten. Aber noch bevor die Worte in sein Bewusstsein drangen, zog ihn der Abgrund mit schwarzen Fingern in seine Tiefen.
Nach einer Zeit schien die Schwärze aufzureißen. Waren es Stunden gewesen? Tage? Merrick war durch Schichten der Bewusstlosigkeit gesunken, sein Körper war matt und müde. Er wusste, dass er im Begriff war zu sterben. Es war eine zu große Kraftanstrengung, um sein Leben zu kämpfen, und er ließ sich immer tiefer sinken, wobei er hoffte, der Mann, der seinen Platz bei den Vier Reitern einnahm, würde mehr Glück haben.
Erst da stellte er fest, dass er nicht alleine in den Tod trieb. Es war noch jemand anderer da, jemand, der einen rotgoldenen Schimmer warf, der in der Ferne begann und immer stärker wurde, bis er die Gestalt einer Frau annahm. Der Schimmer schien mehr als nur Licht zu sein, da er in sein ganzes Sein eindrang, während er über ihn hinwegglitt. Ihr Gesicht war das einer Göttin, mit weit auseinanderliegenden grauen Augen, einer kleinen Stupsnase und einem runden Kinn, das aus irgendeinem Grund in ihm den Wunsch weckte zu lächeln.
Sein Körper hatte jedoch andere Vorstellungen, und als sie sich über ihn beugte, verspürte er das dringende Bedürfnis, sie auf sich zu ziehen.
»Nicht«, wisperte sie. Ihre Stimme war nur der Hauch eines Flüsterns, eher ein Gedanke als ein Klang. »Jetzt ist nicht deine Zeit.«
Verwirrt von ihren Worten runzelte er die Stirn. Von einer Göttin hätte er mehr erwartet. »Wie meinst du das?«
Ihre Haare, ein Vorhang aus wilden roten Locken, glitten über sein Gesicht und erfüllten seinen Geist mit dem Duft von Wildblumen, von der Nachmittagssonne gewärmt. »Du darfst nicht sterben.«
Ihre Lippen berührten seine, als sie sprach, ihr Atem war sanft und warm.
»Ich kann nicht anders«, sagte er entschuldigend und schlang die Arme um sie, um sie an seine Brust zu ziehen. Sie war überall dort weich, wo Frauen weich sein sollten. Die Hügel ihrer Brüste pressten sich so an seine Brust, dass er hart wie Granit geworden wäre, wenn er nicht gerade im Sterben gelegen hätte.
Doch sein Penis missachtete die Wahrscheinlichkeit des bevorstehenden Todes. Er erigierte prompt und verlangte Einlass bei der schönen, schimmernden Göttin.
»Jetzt ist nicht deine Zeit«, wiederholte sie. Ihr Gewicht machte erstaunliche Dinge mit seinem Körper.
Er zog ihren Kopf zu sich und küsste sie mit einer Leidenschaft, die ihn überraschte, da er sich sein ganzes Leben lang jede Emotion streng versagt hatte. Ihr Mund war so süß wie ihr Atem, nur viel, viel heißer, und als ihre Zunge seine berührte, erwachte der Hunger, der in ihm gegrollt hatte, brüllend zum Leben und verlangte, er solle sie nehmen.
»Mach weiter«, sagte sie an seinem Mund. Ihre Hände wühlten in seinen Haaren, ihr Knie drang zwischen seine Beine und übte einen köstlichen Druck auf seinen interessierten Penis aus. »Trink, Merrick.«
Er küsste ihren Hals, atmete tief ihren Duft ein und versuchte, mit den Fingern das seidene Nachtgewand zu lösen, das sie trug, weil er ihr weiches, warmes Fleisch spüren wollte – nein, spüren musste.
»Trink«, sagte sie wieder und erfüllte seinen Kopf mit dem Wort, bis es von jedem Schlag seines Herzens widerhallte. Sein Hunger wuchs und löschte alle anderen Gefühle aus. Er küsste eine Stelle an ihrem Hals und öffnete seinen Mund, um zuzubeißen, bereit, seinen Körper, seinen Geist und sein ganzes Sein zu erfüllen, seinen Körper mit ihrem zu verbinden … und dann war sie auf einmal weg, dahingeschmolzen ins Nichts.
Verzweifelt griff er in die Luft, sein Körper sang einen Klagegesang, aber um ihn herum war nur noch die endlose Dunkelheit, die in jede seiner Poren eindrang, das Licht auslöschte und ihn mit Verzweiflung erfüllte.
Er würde alleine sterben, ungeliebt und unbeweint. Die goldrote Göttin würde nie erfahren, was er darum gegeben hätte, mit ihr zusammen zu sein.
Er ließ den letzten Funken Hoffnung fahren und sank ins Vergessen.
1
»Unterwäsche, habe ich. Zahnbürste, habe ich. Neue Kosmetika, habe ich. Gin für Allie, habe ich.«
»Gin für Allie?« Ellis, mit dem ich seit meiner Grundschulzeit befreundet war, zog die Nase kraus – das tat er immer, seitdem ein ehemaliger Liebhaber ihm einmal gesagt hatte, wie hinreißend er damit aussah – und musterte die Flasche, die ich in der Hand hielt, spöttisch. »Warum nimmst du Gin mit nach Tschechien?«
»Ich nehme diesen teuren, schwer aufzutreibenden Gin mit, weil Allegra, die Freundin meiner Tante Roxy, angeblich Gin mag. Das ist mein Dank dafür, dass sie mich mit den Vampiren zusammenbringt, die es in dieser Gegend gibt.« Ich wickelte eine Yogahose um die Flasche und packte sie ganz unten in den Koffer. »Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. So, ich bin fertig. Hast du auch schon gepackt?«
»Herzchen, ich fahre doch erst in einer Woche«, flötete Ellis und wedelte mit der Hand. Er lümmelte sich auf meinem Sessel herum und trank die Flasche Wein, die er mitgebracht hatte, um mir bon voyage zu wünschen und meine Garderobe, meine Packtechnik und ganz allgemein meine Sicht der Dinge zu kritisieren. »Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Listen machen wie du. Ich werfe ein paar sorgfältig ausgesuchte, exquisite Kleidungsstücke in eine Reisetasche, und dann nichts wie ab ins Abenteuer, mit einem Stil und Wagemut, wie man ihn seit den Tagen von William Powell und Errol Flynn nicht mehr gesehen hat.«
»Dieser Kurs über Filme der Dreißigerjahre hat dich wahrlich verändert«, sagte ich und betrachtete nachdenklich die letzten beiden Teile, die auf dem Bett lagen. »Hm.«
»Was heißt da hm?«
»Der Badeanzug«, sagte ich voller Abscheu.
»Was ist damit? Du weißt doch, dieser roséfarbene ist ganz ordentlich. Ich war mir nicht sicher, weil Rosé so knallig sein kann, aber dieses hier ist erträglich.«
»Das ›Hm‹ bezog sich auf die Frage, ob ich ihn überhaupt einpacken soll.« Ich hielt den Badeanzug hoch. »Findest du ihn zu … freizügig?«
»Das kann ich erst sagen, wenn du ihn anhast.«
Ich warf ihm einen entsetzten Blick zu. »Ich zeige mich dir doch nicht im Badeanzug!«
»Warum nicht?«
»Weil …«, stotterte ich verlegen, »weil du …«
»Weil ich schwul bin?«
»Nein! Das ist mir egal. Aber du bist …«
»Ein Mann?«
»Na ja … ja, ich glaube, das spielt auch eine Rolle.« Ich wedelte hilflos mit den Händen, während ich nach Worten suchte, um ihm eine meiner seltsamen Blockaden zu erklären. »Aber vor allem, weil du mein Freund bist. Was du denkst, ist mir wichtig, und wenn du findest, ich sehe im Badeanzug pummelig aus, dann bin ich am Boden zerstört.«
»Pummelig?« Er legte den Kopf schräg und musterte mich. Sofort zog ich den Bauch ein. »›Pummelig‹ ist nicht das richtige Wort, um dich zu beschreiben. Du siehst aus wie die Frauen, die Tizian gemalt hat. Du könntest einem seiner Bilder entsprungen sein mit deinen roten Haaren und deinen üppigen Kurven.«
»Das ist lieb von dir«, sagte ich und entspannte mich ein wenig. »Ich … es fühlt sich einfach komisch an, einen Mann so viel von meinem Körper sehen zu lassen.«
Ellis schnaubte in sein Weinglas. »Wenn es mir gelungen ist, deinen zahlreichen Reizen im zehnten Schuljahr, als wir hinter der Turnhalle Petting gemacht haben, zu widerstehen, dann bist du jetzt in keiner großen Gefahr mehr.«
»Das liegt nur daran, dass du Frauen in sexueller Hinsicht nicht magst«, erwiderte ich. Ich rollte den Badeanzug zusammen und stopfte ihn in eine Kofferecke. Obenauf packte ich das übergroße Männer-T-Shirt, das ich immer darüberzog. »Das Petting war doch nur, weil du herausfinden wolltest, wer du warst. Oh, Mist!«
»Was?«
Seufzend zog ich aus meiner Nachttischschublade eine lädierte, leicht angestaubte Schachtel. »Wenn ich den Badeanzug tragen will, dann muss ich mich … äh … entlauben.«
»Entlauben?« Ellis zog erneut die Nase kraus.
»Ja, den Damengarten beschneiden.«
Er starrte mich an, das Weinglas bewegungslos am Mund.
Ich seufzte noch ein bisschen lauter und deutete mit der Schachtel auf meinen Schritt. »Meine Scham enthaaren, du Blödmann.«
Endlich begriff er. »Soll das heißen, du bist da unten noch nicht enthaart?«
»Nein, natürlich nicht.« Ich hielt schützend eine Hand über meinen Schamhügel. Dann prüfte ich den Inhalt der Schachtel. »Diese Wachsstreifen benutze ich nur zu besonderen Anlässen.«
Er schauderte ein wenig und trank einen großen Schluck Wein. »Ich könnte mir nie im Leben vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, wenn ich nicht vorher alles Unansehnliche entfernt hätte.«
»Oh, oh«, sagte ich, als ich die Anleitung las.
»Es gibt nichts Köstlicheres als ein glattes Skrotum. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Tempest. Tempest!«
»Hm? Was soll das denn heißen? ›Wenn der Streifen aufgelegt ist, ziehen Sie ihn rasch in entgegengesetzter Richtung zum Haarwuchs ab‹. Wie ein Pflaster?«
Ellis starrte mich an. »Du willst doch nicht etwa sagen … als du besondere Anlässe erwähnt hast, hast du doch nicht etwa gemeint, dass du noch nie gewaxt hast?«
»Nein, aber …«
»Kein einziges Mal?« Seine Stimme klang völlig entsetzt, was mich irritierte. Schließlich gingen ihn meine Schamlippen überhaupt nichts an.
»Nein. Du weißt doch, was ich für ein Leben geführt habe. Kannst du dir vorstellen, was mein Vater gesagt hätte, wenn er herausgefunden hätte, dass ich mir die Schamhaare rasiere?« Ich schauderte bei dem Gedanken an den Wutanfall, den so etwas bei meinem verstorbenen Vater ausgelöst hätte. »Er hat mich drei Tage lang ins Schlafzimmer eingesperrt, weil ich mir die Achseln rasiert habe. Das Waxing von Schamhaaren hätte ihm einen Herzanfall beschert.«
»Wie du es mit diesem Tyrannen nur all die Jahre ausgehalten hast …« Ellis schüttelte den Kopf. »Warum gehst du nicht wie alle anderen in einen Kosmetiksalon und lässt es da machen?«
»Iiih. Und lasse mich von einem Fremden anfassen? Nein, danke. Als ich achtzehn wurde, habe ich mir diese Wachsstreifen gekauft, und ich habe vor, sie nun zu benutzen. Endlich.«
Ellis verzog das Gesicht. »Sind die überhaupt noch gut?«
»Es ist doch nur klebriges Wachs. Das kann doch nicht schlecht werden, oder?«
»Keine Ahnung, tut mir leid. Warum hast du es denn nicht benutzt, als du es gekauft hast?«
»Ich hatte nie Gelegenheit dazu, und außerdem habe ich die Schachtel unter einem Dielenbrett versteckt, damit niemand sie findet.«
Ellis warf mir einen mitfühlenden Blick zu. »Ja, es war wahrscheinlich klug von dir, dass du es versteckt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sekte es gutgeheißen hätte, wenn du Dinge waxt.«
»Ihnen hat ja sowieso so gut wie gar nichts gefallen. Aber das gehört der Vergangenheit an. Wir wollen uns lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren.«
»Auf deine Liste?«
Ich nickte. »Auf meine Liste.« Erneut las ich die Waxing-Anleitung durch.
»Du bist die einzige Frau, die ich kenne, die das Entfernen von Schamhaaren auf ihre To-do-Liste setzt, aber …« Er stand auf und schenkte sich ein weiteres Glas Wein ein. »Du bist auch die einzige Frau, die ich kenne, die einen Großteil ihrer Erbschaft dazu benutzt, Vampire zu suchen.«
Ich grinste ihn an. »Papa würde sich vermutlich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich sein kostbares Geld verwende, um mich zu amüsieren.«
»Wahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie wenig Spaß er dir erlaubt hat. Es ist das reinste Wunder, dass du nicht so geworden bist wie die anderen Frauen in der Sekte.«
»Verschüchtert und geistlos?« Ich zuckte mit der Schulter. »Ohne Mom wäre ich wahrscheinlich so geworden. Es war ein kluger Schachzug von ihr, dass sie in den Sorgerechtsverhandlungen erreicht hat, dass ich in eine staatliche Schule gehen konnte. Das und die Tatsache, dass sie dafür bezahlt hat, dass ihre Briefe mich erreichten. Ich hätte sonst wahrscheinlich alles für bare Münze gehalten, was Papa und die Ältesten mir erzählt haben.«
»Warum bist du eigentlich nicht wütend auf sie, dass sie dich nicht mitgenommen hat, als sie die Sekte verlassen hat?«, fragte Ellis.
»Oh, ich war jahrelang wütend. Und dann hat Dad mir eines Tages erzählt, dass die Sekte ihr gedroht hat, ihrer Familie etwas anzutun, wenn sie mich mitnimmt, deshalb hat er sie gebeten, mich bei ihm zu lassen.«
»Ja, aber das ist eine Sekte!«, wandte Ellis ein. »Wie konnte sie so etwas tun?«
»Es gibt nur eine einzige Person, über die Papa niemals ein böses Wort verloren hat, und das war Mom«, antwortete ich. Ein leises Gefühl der Nostalgie stieg in mir auf. »Deshalb hatte er auch nichts gegen ihre zahlreichen Anweisungen bezüglich des Sorgerechts einzuwenden – das war seine Art, ihr zu vermitteln, dass er sich um mich kümmern würde.«
»Tja, jeder, wie er kann«, sagte Ellis kopfschüttelnd.
»Genau. Okay, dann will ich das mal hinter mich bringen, bevor ich den Mut verliere. Halte den Wein für mich bereit, ich habe das Gefühl, ich werde ihn brauchen!«
Ellis hob das Glas, das er in der Hand hielt, und zog das Spiralheft, das mir als Tagebuch diente, zu sich heran. Ich verschwand im Badezimmer, ließ aber die Tür offen, damit ich mich mit ihm unterhalten konnte.
»Auf wie viele Punkte ist deine To-do-Liste eigentlich mittlerweile angewachsen?«, fragte er.
»Auf über hundert, aber die meisten haben mit der Europareise zu tun.«
»Nummer achtundzwanzig: Mit einem Flugzeug fliegen. Neunundzwanzig: In der Öffentlichkeit singen. Zweiunddreißig: Im Flugzeug mehrere Flaschen Alkohol trinken. Dreiunddreißig: Mile-High-Club. Schätzchen, ich sage es dir nur ungern, aber Letzteres wird nicht leicht für dich werden, wenn du alleine nach Tschechien fliegst.«
»Ich weiß. Ich muss nicht die gesamte Liste auf einen Schlag erledigen. Außerdem habe ich viele Punkte schon gestrichen. Traubensaft zum Beispiel.«
»Was? Wo?«
»Nein, nein, nicht richtiger Traubensaft. Einfach nur … Traubensaft!«
»Weißt du, jetzt, wo dein Vater tot ist und du kein Mitglied dieser bescheuerten Religionsgemeinschaft mehr bist, kannst du einfach fluchen, statt Ersatzwörter zu benutzen.«
»Wie ein Matrose zu fluchen ist eigentlich erst Punkt achtundsiebzig auf meiner Liste. Mann, ist das blöd. Wie klebt man denn diese kleinen Streifen auf?« Ich rutschte auf der Toilette herum, um die äußerst klebrigen Wachsstreifen so anzubringen, wie es in der Anleitung bildlich dargestellt war, aber die Streifen fielen ständig wieder auf den Toilettendeckel hinunter.
»Ich setze mich dabei immer auf den Fußboden. So hast du vollen Zugang zu der Zone«, sagte er. »Wo sind denn die Punkte, die du schon gestrichen hast? Ah, hier. Papas Haus verkaufen und keinen einzigen Cent der Kirche vermachen. Mir eine hübsche Wohnung kaufen. Riesige Summen ausgeben, um mir Klamotten zu kaufen, statt formlose Säcke zu nähen. Bücher lesen, die Tante Roxy geschickt hat. Das waren die Vampirbücher, oder?«
»Ja. Die Reihe ›Dark Ones‹ von C. J. Dante, der ein enger, persönlicher Freund von Tante Roxy ist. Sie hat mir versprochen, ihn mir vorzustellen.« Ich ließ mich auf dem weichen, blauen Badezimmerteppich nieder, lehnte den Spiegel an ein Knie und klebte die Streifen auf eine Seite der Schamlippen. Vor meinem geistigen Auge sah ich Bilder eines hübschen, glatten Schambereichs ohne die wirren roten Locken, die ich auch auf dem Kopf hatte.
»Es überrascht mich, dass dein Vater dir erlaubt hat, diese Bücher zu lesen.«
»Das hat er auch nicht. Er hat sich von der Schulverwaltung jedes einzelne Buch zeigen lassen, das ich ausgeliehen habe, um Einfluss auf meine Lektüre zu nehmen. Die Vampirbücher habe ich erst nach seinem Tod gelesen.«
»Hat deine Mutter keine vernünftigen Bücher für dich einschmuggeln können?«
»Ein paar, aber einer der Ältesten hat sie gefunden und mich bloßgestellt, indem ich sie vor der gesamten Kirchengemeinde verbrennen musste.« Ich fragte mich, ob es mit einem Rasierer nicht vielleicht besser ginge – aber jetzt war ich schon so weit gekommen, jetzt würde ich es auch zu Ende bringen.
»Das muss ja haarsträubend gewesen sein.«
»Es war schrecklich, eine einzige Qual, aber ich war ja daran gewöhnt, vor aller Augen bestraft zu werden. In einer bestimmten Phase habe ich so gut wie jede Grundregel der Wahren Glaubenskirche der Apostel von Armageddon gebrochen. Ich habe in meinem Zimmer getanzt, und Tanzen war eine Sünde. Ich wollte im Schulchor singen, aber Singen war natürlich auch eine Sünde. Ich versuchte, im See hinter dem Gelände zu schwimmen, aber da war die Hölle los, denn Schwimmen war eine Megasünde. Und ich kann gar nicht zählen, wie oft ich in der Ecke sitzen musste, die Bestrafungshaube über dem Kopf, während alle anderen zu Abend aßen, nur weil ich mit einem Jungen geredet hatte. Traubensaft, das Zeug klebt wirklich.«
»Es ist ein Wunder, dass du keine Deprogrammierung brauchst, Schätzchen«, rief Ellis.
»Dafür habe ich ja dich. Ich bin so froh, dass ich dich nach Papas Tod im Internet wiedergefunden habe.«
»Darüber bin ich auch froh, mein Engel. Dass wir uns in den letzten drei Monaten wieder kennengelernt haben, war eine wunderbare Erfahrung. Wie klappt es?«
»Ganz gut, glaube ich. Ich muss die Streifen fest andrücken und dann abreißen. Kommt mir irgendwie … sündig vor. Warte mal, spricht da wieder die Kirche aus mir?«
»Unverkennbar. Daran, sich die Schamhaare auszureißen, ist nichts Sündiges. Beeil dich besser, sonst habe ich die Flasche ausgetrunken.«
»Okay.« Ich holte tief Luft, ergriff das eine Ende eines Streifens, wappnete mich sowohl mental als auch körperlich und zog den Streifen ab.
Mein Schrei hallte so laut von den Badezimmerwänden wider, dass ich für einen kurzen Moment wie taub war. Ellis kam angerannt und blieb in der Tür stehen, die Hand erschrocken vor den Mund geschlagen, während er mir auf den Schritt starrte. »Du lieber Himmel, was hast du denn mit deiner Muschi gemacht? Warum ist sie hellblau?«
Ich schrie erneut auf und warf mich auf den Bauch, die Beine fest zusammengepresst. »Was tust du hier drin? Du kannst dir doch nicht meine unbedeckten Geschlechtsteile angucken!«
»Herzchen, ich gucke nur auf deinen nackten Hintern, und ich kann dir versichern, dass ich das alles schon gesehen habe.«
»Iiih! Hör sofort auf, mich anzugucken!«
»Ich kann es nicht vermeiden, Süße. Er ist so groß wie ein Vollmond. Warum hast du geschrien?«
»Weil es höllisch wehtut!«, sagte ich und biss die Zähne zusammen. Ich zog ein großes Badehandtuch von meinem Handtuchständer und wickelte mich darin ein. Als ich mich umgedreht hatte, hob ich es oben an und spähte hinein, um mir anzuschauen, wie schlimm es um mich stand.
»Ja, natürlich tut es weh. Du ziehst die Haare ja mitsamt den Wurzeln aus. Soll ich dir Salbe holen?« Er trat an den Spiegelschrank und öffnete ihn. »Etwas Beruhigendes, würde ich sagen, etwas mit Aloe Vera. Was hast du denn hier? Hm, ich glaube, Mentholsalbe und eine Creme gegen Pilzinfektionen sind nicht das Richtige.«
»Es … geht … schon …«, sagte ich und kämpfte mit dem Handtuch, um mir den lädierten Bereich genauer anzusehen. Unglücklicherweise schienen jedoch meine Beine zusammenzukleben, und sogar die Badematte schien an meinen Beinen zu haften. »Oh, das hat mir gerade noch gefehlt!«
»Was ist das Problem – ach, du heilige Scheiße!« Fassungslos zeigte Ellis mit dem Finger auf den Boden neben mir. »Was ist das denn?«
Ich ergriff das rot behaarte Stück Klebestreifen, das ich erfolgreich von meinen intimen Stellen abgerissen hatte, und blieb sofort mit den Haaren an einem Stück klebrigem Wachs hängen. »Guck nicht hin! Oh, verdammt noch mal, jetzt hat es auch noch meine Haare erwischt!«
Ellis krümmte sich, und einen schrecklichen Moment lang dachte ich, er würde sich auf mich übergeben. Ich rutschte auf dem Badezimmerboden zurück, hielt aber inne, als ich merkte, dass er sich kaputtlachte.
»Das ist nicht lustig!«, sagte ich und warf ihm einen finsteren Blick zu. Mit einer Hand versuchte ich, meine Oberschenkel auseinanderzudrücken, ohne dass das Handtuch etwas von mir preisgab. »Meine Beine kleben zusammen!«
»Was?«
»Sie kleben zusammen.«
»Ich dachte, du hast den Streifen abgerissen?«
»Ja, aber doch nur auf einer Seite«, sagte ich wütend. Ellis liefen die Lachtränen übers Gesicht. »Wirklich, Ellis. Ein bisschen Mitgefühl wäre durchaus angebracht!«
»Meine Liebe, ich tue mein Bestes, aber wenn du dich sehen könntest …« Erneut brach er in wieherndes Gelächter aus. Er ließ sich auf den Toilettendeckel sinken und rollte Klopapier ab, um sich das Gesicht abzuwischen. »Du sitzt da wie ein Burrito mit so viel rotem Fell, dass du damit eine große Maus verdecken könntest, die in deinen Haaren hängt … oh, wo ist mein Handy? Davon muss ich ein Foto machen.«
»Wenn du das tust, wirst du nie wieder aufrecht gehen können«, drohte ich ihm.
Das brachte Ellis nur noch mehr zum Lachen, und es dauerte volle fünf Minuten, bis er sich wieder einigermaßen unter Kontrolle hatte.
»Na gut, mein Schatz, dann wollen wir mal sehen, wie schlimm es ist«, sagte er. Er kniete sich neben mich und griff nach dem Handtuch.
»Das kommt von Papa! Ich wusste es!«, stöhnte ich. »Das ist sein Fluch. Er hat immer gesagt, er wünschte, er wüsste, wie er mich rein halten könnte, und das hat er jetzt bestimmt vom Grab aus bewirkt!«
»Atme tief durch, Amiga, atme ganz tief durch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie dein Vater aus dem Jenseits deine Muschi verfluchen sollte.«
»Du hast ja keine Ahnung, wie gestört er war«, sagte ich und putzte mir mit Toilettenpapier die Nase. »Ich würde das nicht von der Hand weisen.«
»Ich greife jetzt dazwischen«, sagte Ellis und schob seinen Finger zwischen meine verklebten Oberschenkel. Weiter als ich kam er auch nicht.
Er beugte sich über meinen Schamhügel und begutachtete die Lage einen Moment lang. Dann richtete er sich auf. »Bleib sitzen. Ich bin gleich wieder da.«
»Wohin gehst du?«, fragte ich voller Panik, als er aus dem Badezimmer ging. »Lässt du mich etwa im Stich?«
»Ich hole nur etwas Eis und das Handy. Beruhige dich, Darling. In diesem Zustand, in dem du für den Rest deines Lebens Jungfrau bleiben würdest, lasse ich dich auf keinen Fall im Stich. Hallo? Sind Sie der Ansprechpartner für fachliche Hilfe beim Gebrauch von Ipanema Waxing Kits? Es freut mich, dass ich Sie noch erreiche. Was empfehlen Sie jemandem, der in einer Sekte groß geworden ist und nicht weiß, dass man fünfzehn Jahre alte Wachsstreifen nicht auf seine Muschi-Puschi kleben darf?«
Eine halbe Stunde später kam Ellis aus der Apotheke zurück, wo er eine Flasche Babyöl und eine Flasche Mineralöl geholt hatte. Wir gossen beides über meine Oberschenkel, und danach klebten meine Beine zum Glück nicht mehr zusammen. Immer noch schmückten Fussel der blauen Badematte meine intimsten Stellen, untermalt von dicken, roten Striemen, die von den Klebestreifen herrührten, aber zumindest war das verdammte Ding ab.
»Ich komme mir total lächerlich vor«, sagte ich kurz darauf, als ich einen Eisbeutel auf die wunde Stelle presste.
»Mmm. Wenn du mich fragst, ist es weniger lächerlich als vielmehr naiv«, sagte Ellis.
»Hä?«
»Vampire, mein Täubchen. Du weißt es nicht besser, weil du so aufgewachsen bist, aber wir anderen sind mit Star Wars, Spielberg-Filmen und Buffy – Im Bann der Dämonen groß geworden, während du lediglich die misanthropische Version der Bibel gelesen hast.«
»Du glaubst doch nicht etwa, dass es Vampire wirklich gibt, oder?« Ich warf ihm einen fragenden Blick von der Seite zu.
Er zuckte mit den Schultern. »Was spielt das für eine Rolle?«
»Eigentlich keine.« Ich schwieg einen Moment, dann fügte ich hinzu: »Ich kriege einfach den Traum, den ich letzte Nacht hatte, nicht aus dem Kopf. Ein Vampir ist darin vorgekommen, und er brauchte mich. Ich meine, er brauchte mich ernsthaft. Es ging um Leben und Tod, und dann begann er mich zu küssen, und danach …«
Ellis richtete sich auf. »Was danach? Sprich weiter, Schätzchen. Ich liebe gute erotische Träume.«
Ich machte eine abwehrende Handbewegung. »Ja, nichts. Gerade als ich dachte, jetzt wird es gut, puff, war es vorbei.«
»Das ist bei allen Vampiren so, Liebes. Es gibt sie nur im Traum.«
Ich schüttelte den Kopf, weniger, um Ellis’ Kommentar zu verneinen, als um die Erinnerung an den Traum zu vertreiben. »Meine Tante Roxy schwört, dass es sie wirklich gibt. Sie sagt, es gibt eine ganze Gruppe von Vampiren, von denen niemand etwas weiß. Nur ein paar Leute wissen, wer sie wirklich sind, und sie kennt zufälligerweise den Anführer dieser Vampirorganisation.«
»Du wirst es sicher sehr nett haben in Tschechien, und wenn du entspannt zurückkehrst, kannst du Italien mit mir erst richtig genießen.« Er lächelte mich an. Dann blickte er auf die Uhr und erhob sich seufzend. »Ich gehe jetzt besser nach Hause, sonst bin ich morgen tot. Küsschen, Darling. Ich hoffe, es geht dir morgen da unten wieder besser. Schick mir eine E-Mail, wenn du bei der Freundin deiner Tante angekommen bist.«
»Danke, Ellis, das mache ich«, rief ich ihm nach, als er zur Tür schwankte. Es war gut, dass ich eine Wohnung im gleichen Block wie er gefunden hatte. »Lass dich nicht von einer dieser seltsamen pferdelosen Kutschen überfahren, die ihr Heidenvolk so gerne benutzt.«
Er blieb an der Tür stehen, um mir einen Blick zuzuwerfen. Ich kicherte.
»Ich würde ja sagen, für diese Blasphemie kommst du in die Hölle, aber das ist vermutlich ein bisschen zu nahe an dem dran, was du früher immer zu hören bekommen hast. Küsschen, Darling. Guten Flug morgen.«
Als er weg war, kuschelte ich mich auf die Couch, den Eisbeutel auf die schmerzende Stelle drapiert, und nahm eines von C. J. Dantes köstlich bösen Vampirbüchern zur Hand. Ich schlug das Buch an irgendeiner Stelle auf und genoss die Beschreibung des großen, dunkelhaarigen und umwerfend sexy Helden.
»Das wird der beste Urlaub, den ich je gemacht habe«, seufzte ich. Ich freute mich schon auf die höllisch begehrenswerten Vampire.
Hoffentlich waren sie so gut wie der, von dem ich geträumt hatte.
2
»Ich bin da!«, verkündete ich meiner Tante Roxy fast sechsundzwanzig Stunden später. »Mit Jetlag, hungrig und verwirrt von der Sprache, aber ich bin in Tschechien und warte auf den Zug, der mich nach Blansko bringt. Wie ist es in Australien?«
»Großartig. Hat Allie dir geschrieben? Ich habe ihr deine Nummer gegeben, und sie sagte, sie würde versuchen, noch vor deiner Ankunft mit dir Kontakt aufzunehmen.«
»Nein, ich habe nichts gesehen. Noch mal danke, dass du sie gebeten hast, mich aufzunehmen.«
»Pfft«, sagte Roxy. »Wozu hat man alte Freundinnen, wenn man nicht seine Nichten bei ihnen abladen kann, obwohl man selber die Nichten auch nur von Telefonaten und Textnachrichten kennt, weil der Mann deiner Schwester ein Irrer war? Oh, Entschuldigung, Tempest.«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich freue mich, dich endlich persönlich kennenzulernen, wenn wir beide wieder zu Hause sind. Liebe Grüße an Onkel Richard.«
»Er lässt dich auch grüßen. Gib Allie und Christian einen Kuss von mir, aber lass dich bloß nicht mit Christian ein, sonst schmeißt Allie dich raus. Bis später, Kind!«
»Ein echter Vampir«, seufzte ich gedankenverloren ein paar Stunden später, während ich aus dem Fenster des Taxis blickte, das mich nach Schloss Drahanská brachte. »Hoffentlich hat dieser Vampir ein paar unverheiratete Freunde. Einer würde ja schon reichen. Mehr will ich ja gar nicht. Einen einzigen Vampir nur.«
»Fehlt Ihnen etwas?«, fragte mich die Taxifahrerin und warf mir einen Blick im Rückspiegel zu. »Soll ich anhalten?«
»Nein, nein, fahren Sie weiter. Ich habe nur mit mir selbst geredet.«
»Okay«, sagte sie mit tschechischem Akzent und drehte das Radio lauter, aus dem fröhliche Blasmusik drang.
Eine Viertelstunde später fuhren wir an einem Pförtnerhaus vorbei und eine lange gewundene Schotterstraße hinauf. Am Straßenrand standen Fackeln, richtige brennende Fackeln, keine elektrischen.
»Das ist ja toll«, sagte ich ganz verzückt von dem Anblick. Die Bäume versperrten die Sicht auf das Schloss, aber die Flammen, die in der leichten Brise tanzten, versetzten mich in freudige Erwartung.
Schließlich fuhren wir um eine Kurve, und mir stockte der Atem. Vor uns lag das Schloss, wuchtig zeichnete es sich vor dem Abendhimmel ab. Einige kleine Gebäude lagen am Straßenrand, auch eine riesige Gruft, mit zwei mächtigen Adlern, die Flügel ausgebreitet und die Köpfe wie im Siegesgeheul zurückgeworfen. »Vorausgesetzt, Adler heulen«, murmelte ich und verrenkte mir den Hals, um noch einen Blick auf das schöne, aber angsteinflößende Gebäude zu werfen.
Ich wusste aus meinem Reiseführer, dass vor dem Schloss makellos gepflegte Rasenflächen und ein architektonischer Garten lagen, wo die GothFaire ihr Allerheiligen-Festival abhalten würde. Die Schotterstraße führte zum hinteren Teil des Schlosses, und auf dem Weg dorthin fuhren wir an allen möglichen bedrohlichen Umrissen vorbei, die offenbar zu den Wirtschaftsgebäuden gehörten.
»Hier ist Schloss«, verkündete die Fahrerin und zeigte auf das große Gebäude vor uns.
»Das habe ich mir schon gedacht.« Ich beugte mich vor und kurbelte das Fenster herunter, damit ich das Ungetüm besser sehen konnte. An jeder Ecke des Schlosses saßen Türme mit Zinnen. Auf der Rückseite des Schlosses – wir hatten uns von der Bedienstetenseite her genähert, da der vordere Teil offensichtlich dem gepflegten Garten vorbehalten war – befanden sich zahlreiche hohe, schmale Fenster, die von einem sanft schimmernden weißen Stein eingerahmt waren. Oder zumindest kam es mir im Mondschein so vor.
Das Taxi hielt vor zwei mächtigen Holztüren, die ebenfalls von Fackeln flankiert wurden. Ich stieg aus. Mir blieb der Mund offen stehen, und die Augen traten mir beinahe aus den Höhlen, als ich versuchte, alle fünf Stockwerke des Gebäudes auf einmal zu betrachten. »Das ist wirklich wundervoll. Okay, ich will, dass mein Vampir ein Schloss hat. Hier könnte ich auf der Stelle einziehen.«
»Hier ist Schloss«, ließ sich die Taxifahrerin erneut vernehmen. Mit ein bisschen mehr Nachdruck fügte sie hinzu: »Fünfundzwanzig Euro.«
»Oh, Entschuldigung. Ja, klar. Hier, ich glaube, ich habe … ja. Bitte sehr.« Ich gab ihr das Geld und ein beachtliches Trinkgeld, stieg aus und trat auf die Türen zu, meinen Koffer in der Hand.
Auf jeder Tür war ein Türklopfer in Form eines großen Herzens, von einem Pfeil durchbohrt, aber gerade als ich damit an die Tür klopfen wollte, fiel mein Blick auf einen kleinen Knopf unter einer Sprechanlage aus Metall. Ich war ganz wibbelig vor Aufregung, als ich auf den Knopf drückte. Ich würde endlich Tante Roxys Vampir kennenlernen! Ich hatte so viele Fragen an ihn, brannte darauf, so viele Dinge zu erfahren, nachdem ich seine heißen Bücher gelesen hatte. Und jetzt würde ich ihn kennen ….
Eine Stimme drang aus dem Metallgrill über dem Klingelknopf. Kurz war ich enttäuscht, weil es die Stimme einer Frau war, aber ich nahm mich zusammen und beantwortete die Frage, wer ich sei und was ich wolle.
»Hallo. Mein Name ist Tempest Keye, und meine Tante ist eine Freundin von Mr Dante. Sie wollte ihm eigentlich ausrichten, dass ich heute ankomme.«
»Tempest?«, fragte die Frau. Die Stimme klang verzerrt und blechern. »Ihr Name ist Tempest? Das heißen Sturm, oder?«
»Ja. Sind Sie Allie? Roxy hat gesagt, sie hat mit Ihnen darüber gesprochen, dass ich komme.«
»Ich Tilda. Ich Haushälterin. Sie warten.«
Enttäuschung dämpfte meine Freude. »Sei nicht albern«, sagte ich zu mir. »Geduld, Kraft und all so was. Oh, hallo.«
In der Tür stand eine kleine Frau mit grau melierten Haaren. »Kommen Sie«, sagte sie und ergriff meinen Koffer. »Sie haben gelbe Zimmer. Dante und Allie nicht hier. Kommen später. Sie mit mir gehen.«
Ich folgte ihr. Sie ging die Treppe hinauf, durch einen mit dunklem Holz getäfelten Flur voller mittelalterlicher Waffen an der Wand und einigen Spielsachen. Es gab ein Fahrrad, ein kleines Puppenhaus und eine beeindruckende Lego-Landschaft mit Star-Wars-Figuren. Wir stiegen eine weitere Treppe hinauf, und nach einer verwirrenden Anzahl von Fluren blieb Tilda schließlich an einer Tür stehen. Dahinter lag ein Zimmer, das in verschiedenen Gelb- und Rottönen gehalten war, mit wundervollen japanischen Gemälden auf den Seidenvorhängen.
»Wollen erst waschen oder gleich in Bibliothek gehen?«
»Eine Bibliothek im Schloss?«, fragte ich zögernd. Ich wollte sichergehen, dass sie nicht vorhatte, mich in den Ort in die öffentliche Bibliothek zu schicken.
»Ja, ja. Dantes Bibliothek. Sie kommen.«
Ich ließ meinen Koffer stehen und eilte hinter ihr her. Wenn ich sie aus den Augen verlieren würde, wäre ich auf ewig dazu verdammt, durch die Gänge zu irren. Wir gingen eine Treppe hinunter und standen schließlich, nachdem wir ein paar Mal abgebogen waren, in einem großen Raum, der von einem weichen goldenen Licht erhellt wurde, das die Buchrücken in den massiven Mahagoni-Bücherschränken mit den Glasfronten zu vergolden schien. An einer Wand standen auch ein paar niedrige Schaukästen. Beim Anblick der gewaltigen Menge an Büchern verschlug es mir die Sprache.
»Sie hierbleiben. Ich bringe Tee, dann ich gehe. Allie und Dante bald kommen nach Hause«, verkündete Tilda.
»Oh. Wohnen Sie nicht hier?«
»Nein.« Sie war weg, bevor ich noch etwas sagen konnte. Ich überlegte, ob es mich wohl nervös machte, in einem großen, mittelalterlichen Schloss alleine zu sein, aber dann fiel mir ein, dass ich wahrscheinlich gar nicht alleine war. Auf so einem großen Anwesen gab es bestimmt jede Menge Personal.
Als Tilda mit einem Tablett mit einer Kanne Tee, ein paar Plätzchen und ein paar Sandwiches ohne Kruste hereinkam, merkte ich erst, wie hungrig ich war. »Oh, vielen Dank. Das sieht wundervoll aus. Ach, können Sie mir sagen, wer sonst noch im Schloss ist?«
Sie blieb an der Tür stehen und blickte mich an. »Wer sonst?«
»Ja, welche anderen … äh …« Ich wollte das Wort »Dienstbote« nicht sagen, weil es viel zu arrogant klang. »Wer vom Personal ist sonst noch hier?«
»Nur ich. Ich jetzt gehen. Dante gleich kommen nach Hause.«
Die Tür schloss sich hinter ihr, und einen Moment lang fühlte ich mich schrecklich allein.
»Sei nicht albern«, schalt ich mich und setzte mich an den Tisch, auf den Tilda das Essen gestellt hatte. »Wie viele Leute haben schon Gelegenheit, die Sandwiches eines Vampirs in seiner Bibliothek zu essen? Bestimmt nicht viele.«
Dieses aufmunternde Selbstgespräch rettete mich über die nächsten beiden Stunden, in denen ich in C. J. Dantes Büchern stöberte. Aufgeregt stellte ich fest, dass er nicht nur seine eigenen Vampirbücher, sondern auch viele Bücher anderer Autoren besaß, und ich vertiefte mich glückselig in einige davon, die ich noch nicht kannte. Als jedoch die kleine Uhr auf dem massiven Schreibtisch, der die gesamte Ecke des Zimmers einnahm, elf schlug, war ich völlig erschöpft, was wahrscheinlich vor allem dem Jetlag geschuldet war.
Ich ging in den Hauptflur mit den Spielzeugen, wobei ich mich fragte, wo meine Gastgeber wohl waren. »Ob ich aufbleiben soll, bis sie endlich kommen? Oder soll ich in mein Zimmer gehen und schlafen, damit sie mich nicht zusammengesunken auf einem Stuhl vorfinden, mit Speichelfäden aus dem offenen Mund?«
Das Bild, das ich vor meinem inneren Auge sah, trieb mich die Treppe hinauf, aber vorher hinterließ ich noch eine Notiz auf einem der Tische, dass ich angekommen, aber zu Bett gegangen sei.
»Hoffentlich ist ihnen nichts passiert«, murmelte ich, als ich in mein Bett kletterte. Ich konnte mir alle möglichen schrecklichen Unfälle vorstellen, die jemanden davon abhielten, nach Hause zu kommen, aber die Tatsache, dass Vampire (und ihre Gefährtinnen) sehr schwer zu töten waren, tröstete mich. Selbst wenn sie einen Autounfall gehabt hatten, ging es ihnen wahrscheinlich gut.
Der Traum begann mit einem Vogel, der durch die Nacht flog, durch einen Wald voller hoher Fichten. Sein Schatten flackerte über den Boden, der von einem großen, silbernen Mond erhellt wurde. Ich begann gerade, die anmutigen Bewegungen des Vogels zu bewundern, als er auf eine Schlange hinunterstieß … es war aber gar keine Schlange, sondern ein gewundener Feldweg, auf dem ein Mann einen anderen an den Füßen entlangzog.
Die beiden Männer hielten vor prächtigen dunklen Holztüren an, in die die groben Umrisse von Herzen geschnitzt waren. Es waren die Schlosstüren, das wusste ich, aber seltsamerweise schien der Rest des Schlosses zu fehlen. Der Mann, der gegangen war, ließ den anderen einfach an der Tür liegen und hob die Hand, um zu klopfen.
Ich wollte ihm erklären, dass es hinter den Türen gar kein Gebäude gab und er nur um die Türen herumgehen musste, um dahinterzugelangen, aber meine Aufmerksamkeit richtete sich auf den Mann, der auf den Steinstufen vor der Tür lag. Ich beugte mich besorgt über ihn, weil ich irgendwie wusste, dass der Mann sich nicht mehr an sein Leben klammerte.
»Nicht«, flüsterte ich, wobei meine Nase die seine beinahe berührte.
»Wie meinst du das?«, fragte er. Seine Stimme war tief und doch so leise, dass ich nicht sicher war, ob ich sie mir nicht nur eingebildet hatte.
»Stirb nicht.«
Das Klopfen hinter mir hielt an, was mich irritierte.
»Deine Zeit ist noch nicht gekommen«, sagte ich, gegen alle Vernunft entschlossen, den Mann wach zu halten.
»Ich kann nichts dagegen tun.« Er seufzte, ein wortloser Ausdruck von so viel Verzweiflung, dass ich am liebsten geweint hätte. Aber zugleich hätte ich auch den Mann hinter mir anschreien können, der immer noch gegen die Türen hämmerte. Ich blickte auf, um ihm zu sagen, dass er seine Zeit verschwendete, aber in diesem Moment packte mich der am Boden liegende Mann am Handgelenk.
»Öffne die Tür nicht«, beschwor er mich. Seine Augen waren von einem wunderschönen tiefen Blau mit schwarzen Sprenkeln, und sein Blick schien sich bis in meine Seele zu brennen.
»Warum?«, fragte ich flüsternd und beugte mich über ihn, sodass meine Haare uns vor dem Mann an der Tür verbargen.
»Ich bin tot«, erklärte der Mann mit den schönen Augen. Sein Körper wurde schlaff, und seine Augen schlossen sich. Ich wusste, wenn ich nichts unternahm, würde er sterben. Deshalb beugte ich mich über ihn, bis meine Lippen die seinen berührten.
»Ich rette dich«, versprach ich, wobei ich mir nicht die geringsten Gedanken darüber machte, wie ich das bewerkstelligen wollte.
Er schlang die Arme um mich, zog mich an seine Brust, und sein Mund nahm mich, nahm mich im wahrsten Sinne des Wortes, ein Akt der Dominanz, obwohl er schon so gut wie tot war. Seine Lippen waren heiß, süß und scharf zugleich, und als seine Zunge in einer stummen Bitte über meine Lippen glitt, schienen alle meine dunklen, geheimen Teile zu erwachen.
Ich gab mich dem Verlangen hin und erwiderte seinen Kuss mit allem, was ich hatte. Meine Hände wühlten in seinen Haaren, meine Brüste waren empfindlich und schwer, als sie sich an ihm rieben. Seine Hände glitten über meinen Rücken, und ich drückte meinen Körper gegen seinen. Ich wollte mehr von ihm, mehr als nur seinen Mund und seine Hände und löste mich ein wenig von ihm, um es ihm zu sagen. Unsere Umgebung nahm ich nicht mehr wahr. Ich küsste das Kinn des Mannes, seine Wangen, sogar seine geschlossenen Augen. Am liebsten hätte ich mein Gesicht in seinen Haaren vergraben. Er wiederum bedeckte meinen Hals und meine Schulter mit Küssen. Ich wand mich und überlegte fieberhaft, was ich brauchte, um den Mann zu retten, aber ein scharfer Schmerz unterbrach meine Gedanken, ein Schmerz in meiner Schulter, der sich rasch in das erotischste Gefühl auflöste, das ich jemals gehabt hatte. Ich stand kurz vor einem Orgasmus, glitt darauf zu, wollte ihn unbedingt erleben, wollte jedoch zugleich, dass das Gefühl niemals endete. Und dann, als ich kurz vor dem Höhepunkt stand und in das gleißende Licht der Verzückung eintauchte, wachte ich auf.
Das Klopfen war real. Ich dachte zuerst, es sei mein Herz, das in meinen Ohren hämmerte, als ich aus dem erotischsten Traum meines Lebens erwachte, aber dann merkte ich, dass das dumpfe Geräusch nicht aus meinem Körper kam.
»Christian Dante und seine Frau!«, sagte ich zu mir. Ich ergriff den durchsichtigen Morgenmantel aus Chiffon, der zu meinem Satin-Negligé passte. »Ich wette, sie haben sich ausgesperrt.«
Auf bloßen Füßen rannte ich zur Treppe, über Holz und Marmor, durch die Flure und die Stufen hinunter, bis ich zur Eingangstür kam. Ich riss sie auf, ein erwartungsvolles Lächeln auf den Lippen.
Der Mann, der an der Tür stand, war eine Enttäuschung. So hatte ich mir C. J. Dante – und einen Vampir – nicht vorgestellt. Er war dunkel, drahtig, mit stacheligen, pink gefärbten Haaren und einigen Piercings im Gesicht. Auf den Hals hatte er eine Regenbogenfahne tätowiert. Er sagte etwas, das wie Französisch klang.
»Tut mir leid, ich spreche kein Französisch.«
»Sind Sie Amerikanerin?« Er hatte einen britischen Akzent und klang seltsam nervös. »Das ist für Ihren Herrn. Er ist noch nicht ganz tot, obwohl er es eigentlich sein müsste, weil man ihm sein Blut ausgesaugt hat, aber ich denke nicht, dass es richtig war, ihn zu töten, nur weil er ein Vampir war. Deshalb habe ich ihn hierher zu Ihrem Herrn gebracht.«
»Meinem was?«
Der Mann drehte sich um, schleifte etwas über die Stufen zur Tür und legte es mir vor die Füße. »Sagen Sie niemandem, dass ich ihn hierhergebracht habe, sonst reißt mein Herr mir den Kopf ab.« Voller Angst blickte er sich um. »Sie haben mich nicht gesehen. Sie wissen nicht, wer ich bin. Ich war nie hier. Verstehen Sie?«
Entsetzt starrte ich auf das Objekt zu meinen Füßen. Nur vage bekam ich mit, dass der Mann an der Tür in der Dunkelheit verschwand.
»Was … wer … heiliger Traubensaft! Ein Vampir? Tot? Sagten Sie …« Ich blickte auf, aber der Mann war weg. »Hey! Mister! Hey!« Ich trat über den Körper hinweg und rannte die Vordertreppe hinunter, sah jedoch, wie ein weißer Lieferwagen mit Ladefläche die Auffahrt hinunterfuhr. Ich rannte ihm ein paar Meter hinterher, aber er war schon viel zu weit weg, als dass ich das Kennzeichen hätte erkennen können.
Die Nachtluft war kühl. Fröstelnd raffte ich meinen Morgenmantel zusammen und rannte zurück zum Haus. Zögernd blieb ich bei dem Mann stehen. Er lag mit dem Gesicht nach unten da, seine kinnlangen Haare so schwarz wie seine Kleidung.
»Was soll ich bloß tun?«, fragte ich mich. Ich kniete mich hin und versuchte, die Situation klar zu erfassen, während mir immer noch der Traum durch den Kopf ging. »Wie bringt man einen beinahe toten Vampir wieder ins Leben zurück?«
Vorsichtig drehte ich den Mann um. Als ich sein Gesicht sah, taumelte ich rückwärts.
Es war der Mann aus meinen Träumen, der Mann, der mir gesagt hatte, er sei tot.
Und jetzt sah es so aus, als ob er die Wahrheit gesagt hätte.
3
»Ich weiß nicht … uff … wie viele Leute … Traubensaft! … schon einmal einen ausgewachsenen Vampirbullen … aua! … irgendwohin ziehen mussten, aber Sie, Sir, sind wahrhaftig nicht gerade ein Leichtgewicht.« Ich richtete mich auf und rieb mir den schmerzenden Rücken. Der Mann sah zwar nicht so schwer aus, aber für mich fühlte er sich so an.
»Nun, ich könnte Sie ja hierlassen, aber …« Ich blickte mich in der Eingangshalle um. Es kam mir so wenig fürsorglich vor, ihn einfach in einer kalten Halle in Gesellschaft eines Lego-Millennium-Falken zurückzulassen. Selbst wenn er tot war, was ja Rosa Stachelhaar bestritten hatte. Obwohl er mir eigentlich ziemlich tot vorkam. Ich tastete nach seinem Puls, fand aber keinen, und auch seine Haut fühlte sich nicht warm an. Stirnrunzelnd blickte ich ihn an. »Wenigstens sitzt dein Kopf noch auf den Schultern, also hat ihn dir niemand mit dem Schwert abgehauen, aber wenn du noch lebst, warum fühlst du dich dann nicht lebendig an? Na ja, tot oder lebendig, ich kann dich hier nicht liegen lassen wie einen Sack Hundefutter, den jemand vor die Tür gelegt hat. Aber wie ich dich von der Stelle bewegen soll, ist mir ein Rätsel … hm.«
In der Eingangshalle lagen keine Utensilien herum, mit denen man einen Vampir von der Stelle bewegen konnte, aber ich brauchte trotzdem nicht lange, um zu einer wichtigen Erkenntnis zu gelangen: Ein antiker persischer Läufer auf einem wunderschönen Marmorboden ist perfekt, um fast tote Vampire über riesige Flächen zu transportieren.
»Zumindest solange diese aus Marmorböden bestehen«, grunzte ich, während ich den Teppich durch den endlos langen Flur zur Bibliothek zog. Hier lag Teppichboden, aber nach einem prüfenden Blick auf den gut aussehenden, fast toten Vampir, um mich zu vergewissern, dass ich ihn nicht verletzte, zog ich ihn einfach über den Teppich zum Kamin. »Und jetzt wärmen wir dich erst einmal auf. Du fühlst dich an wie ein Eiszapfen, und ich friere in diesem dünnen Nachthemd …«
Ich schaltete den Gaskamin ein, wobei ich darauf achtete, dass der Mann nicht zu dicht an den Flammen lag. Dann raffte ich meinen durchsichtigen Morgenmantel zusammen und eilte zurück zur Haustür, in der Hoffnung, dass langsam mal ein Auto mit dem Schlossbesitzer vorfahren würde. Er wüsste sicherlich, was man mit einem möglicherweise toten Vampir machen musste. Leider war niemand draußen, noch nicht einmal ein buckeliger Diener, der Igor hieß. Die tiefe Dunkelheit der Nacht wurde nur schwach vom Mondlicht und den immer noch flackernden Fackeln erhellt.
»Scheiße«, fluchte ich leise und schloss die Tür sorgfältig hinter mir ab, bevor ich mich wieder auf den Weg in die Bibliothek machte, um nach dem Vampir zu sehen, der wahrscheinlich gar nicht richtig tot war. »Wo ist Igor, wenn ich ihn brauche? Es muss doch jemand draußen sein, der die Fackeln am Brennen hält. Na gut. Dann sehe ich mal, was ich für den attraktiven Vampir tun kann.«
Ich überlegte gar nicht erst lange, ob es überhaupt so klug war, einen Vampir zu retten – seit ich Dantes Bücher gelesen hatte, war es mein größter Wunsch gewesen, einmal einem von ihnen zu begegnen, auch wenn sich dahinter ein geheimes Verlangen verbarg, das so sündig war, dass ich es mir bisher noch nicht einmal selbst eingestanden hatte. Jetzt jedoch tat ich es.
»Ich will ihn nähren«, flüsterte ich, als ich die Bibliothek betrat. Der Mann lag noch genau da, wo ich ihn abgelegt hatte. »Ich will all das fühlen, was Frauen laut Dante empfinden, wenn sie sich einem sexy Vampir hingeben. Ich will fühlen, wie es ist, sich mit einem Mann auf einer höheren Ebene zu vereinen. Ich will etwas tun, was sonst niemand kann. Hey, Mister.« Ich schüttelte den Vampir leicht an der Schulter. »Wollen Sie von mir gerettet werden?«
Er antwortete natürlich nicht, deshalb hockte ich mich neben ihn, um mir zu überlegen, wie ich am besten vorgehen sollte. Ich legte meine Hand auf seinen Hals. Die Haut war kühl, aber nicht kalt oder klamm, und ich fühlte immer noch keinen Puls. Kurz überlegte ich. Hatten dunkle Wesen überhaupt einen Puls? Ich war mir nicht ganz sicher – Dante hatte es nie erwähnt. Erneut schüttelte ich den Mann. »Hallo? Sind Sie da drin? Oh, Traubensaft! Tempest, das ist eine blöde Frage. Natürlich ist er da drin. Okay, reiß dich zusammen. Er braucht Blut. Du willst ihm Blut geben. Also tu es einfach!«
Ich beugte mich über das Gesicht des Vampirs und strich meine Locken zurück, um meinen Hals freizulegen. »Bon appétit«, sagte ich. Ich drückte meinen Hals gegen seine Lippen und wappnete mich für den Biss.
Nichts passierte.
»Hm.« Stirnrunzelnd richtete ich mich auf. »Vielleicht muss ich den Prozess erst einmal zum Laufen bringen. Dann wollen wir mal sehen. Ich fange an, indem ich deinen Mund öffne …«
Konzentriert streckte ich die Zungenspitze zwischen den Zähnen hervor, während ich mir sorgfältig die Finger an meinem Negligé abwischte und dann vorsichtig die Lippen des Mannes auseinanderschob. Ich konnte keine Reißzähne entdecken, was meiner Meinung nach ein schlechtes Zeichen war. Jeder wusste doch, dass ein Vampir Reißzähne haben musste, um Blut trinken zu können. Ein wenig unbehaglich öffnete ich seinen Mund erneut. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass er mir nicht die Fingerspitze abbiss, und schob meinen Zeigefinger in seinen Mund, um nach seiner Zunge zu tasten. Ich wusste aus dem Erste-Hilfe-Kurs in der Schule, dass man die Zunge aus dem Weg räumen musste, wenn man Mund-zu-Mund-Beatmung machen wollte. Gerade versuchte ich mich zu erinnern, welche Schritte ich als Nächstes unternehmen musste, als ich auf eine warme, feuchte Stelle traf.
»Warm«, sagte ich zu mir und drückte darauf herum. »Deine Zunge ist warm. Das ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass du nicht tot bist. Okay, Mund auf, Zunge runter. Jetzt wollen wir dir mal ein bisschen Blut geben. Äh …« Ich hielt mein Handgelenk über seinen offenen Mund. »Vielleicht möchtest du ja ab hier übernehmen?«
Er wollte nicht. Seufzend erhob ich mich, um C. J. Dantes Schreibtisch zu durchsuchen. Ich fand einen ziemlich scharf aussehenden Brieföffner. Ich hielt ihn über einen meiner Finger, wobei ich mir sagte, dass ich ja nur einmal kurz zustechen müsste. Aber ich hatte immer schon eine Abneigung gegen Blut und brachte es einfach nicht über mich, mir selber etwas abzuzapfen.
»Okay, dann musst du mir eben helfen«, sagte ich. Ich schob ihm den Griff des Brieföffners unter die Achsel, sodass das scharfe Ende auf mich zeigte. Dann hob ich meine Hand, drehte den Kopf zur Seite und ließ meine Hand hinuntersausen.
Natürlich verfehlte ich den Brieföffner komplett. Ich versuchte es noch einmal … und noch einmal … aber ein unwillkürlicher Selbstschutztrieb hielt mich davon ab, die Spitze des Brieföffners zu treffen.
»Herrgott noch mal!«, sagte ich verärgert. Ich ergriff den Brieföffner und packte das scharfe, spitze Objekt zufällig so an, dass ich genau das gewünschte Ergebnis erzielte. »Aua! Rattenkot! Oh! Moment mal … das ist gut.« Ich drückte an meiner Fingerspitze herum, damit die Blutstropfen größer wurden. Der Anblick verursachte mir leichte Übelkeit.
»Uh! Hoffentlich funktioniert das.« Ohne meinen Daumen anzugucken, schob ich ihn dem Mann zwischen die Lippen und fuhr damit über seine Zunge. Jeden Gedanken an Keime und Infektionen verdrängte ich in Erwartung des Glücksgefühls, das mir in Kürze bevorstand.
Jetzt.
Gleich … »Puh!« Ich zog den Daumen heraus und beugte mich dicht über den Mann, um kein Lebenszeichen zu verpassen. »Vielleicht war es nicht genug?«
Ein leichter Atemzug schien seinem offenen Mund zu entweichen und strich über mein Gesicht. »Mister? Brauchen Sie mehr? Wenn ja, müssen Sie die Dinge selber in die Hand nehmen. Mir wird schlecht, wenn ich …«
Die Worte wurden mir förmlich aus dem Mund gerissen, als sich plötzlich zwei Arme um meinen Rücken legten und ich auf seinen Körper hinuntergezogen wurde. Mein Mund traf in einer Art und Weise auf seinen, die kein Zufall sein konnte. Seine Zunge war zum Leben erwacht. Sie drang in meinen Mund ein, als ob er ihr gehörte, und sie schmeckte fremd und doch zugleich seltsam vertraut.
Ohne dass er sich spürbar bewegt hätte, lag ich auf einmal mit dem Rücken auf dem warmen Teppich. Die Hitze des Feuers tanzte auf meiner fast nackten Haut. Das Gewicht des Mannes lag schwer, aber nicht unangenehm auf mir, seine Hände bewegten sich nicht, sondern hielten fest meine Hüften umfasst.
Nur seine Zunge bewegte sich, sie schmeckte und neckte mich, und sie schien tief in mir ein Feuer zu entfachen, das die Erinnerung an meinen erotischen Traum wachrief. »Oh, Mann!«, stöhnte ich, als ich mich von ihm löste. Mir war schwindlig, als ob kein Sauerstoff im Raum wäre, und trotzdem hätte ich am liebsten immer weitergemacht.
Der Mund des Mannes glitt über mein Kinn, er drückte heiße Küsse auf meine Haut, und seine Berührungen ließen mich vor Wonne und sexueller Erregung erschauern. Ich konnte es nicht fassen, dass ich so auf einen Mann reagierte, den ich gar nicht kannte, ganz zu schweigen davon, dass er eigentlich nicht bei Bewusstsein war, aber ich wusste, dass Frauen alleine durch die Berührung eines Vampirs ohnmächtig werden können. »Mann, C. J. Dante hat das ganz richtig beschrieben«, sagte ich. Mir stockte der Atem, als der Mund des geheimnisvollen Vampirs zu meinem Nacken wanderte. Mein Herz schlug wie verrückt, und intime Teile von mir erwachten und begannen, Interesse an den Vorgängen zu zeigen. Ich packte ihn an den Schultern, hoffte auf den Biss, wusste mit Sicherheit, dass er kommen würde und dass es das Letzte sein würde, was ich jemals fühlen sollte.
Der Schmerz war fast schon vorbei, als mein Gehirn ihn registrierte, ein scharfer, schneller Stich, der augenblicklich in ein so starkes erotisches Gefühl überging, dass ich mich unter ihm wand, um mich meiner Unterwäsche zu entledigen. Alles an mir war eine einzige erogene Zone. Mir war heiß und kalt zugleich, und mein Verlangen war so übermächtig, dass es auf der Stelle erfüllt werden musste, sonst würde ich vergehen. Ich zerrte unsanft an seiner Kleidung, Stoff riss, als ich seine Brust entblößte, dann kämpfte ich mit der Schnalle des Ledergürtels, während ich mich die ganze Zeit ruhelos unter ihm bewegte. Stöhnend versuchte ich, seine Hose zu öffnen, um seinen heißen Stab in die Hände zu bekommen.