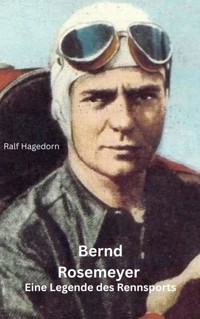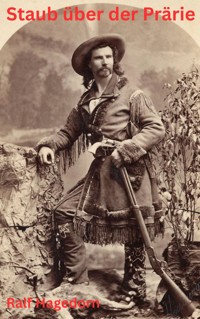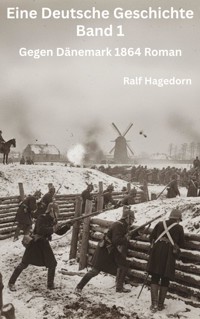
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Krieg kommt, und keiner kann ihn aufhalten. Im Winter 1863 zieht die Unruhe wie ein kalter Nebel über die Herzogtümer. Während Bismarck in Berlin auf eine harte Lösung drängt und ein König in Kopenhagen nicht weichen will, ist für die einfachen Menschen klar: Es beginnt ein blutiger Krieg um Land und Sprache, Ehre und Macht. Dieser historische Roman erzählt vom Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 – einem Konflikt, dessen Höhepunkt, die Schlacht um die Düppeler Schanzen, ein Wendepunkt der deutschen Geschichte wurde. Die Geschichte wird aus verschiedenen, zutiefst menschlichen Perspektiven erzählt: Johann, der preußische Rekrut, wird von seinem Hof in Holstein in die Kasernen Preußens gerufen und marschiert mit seinem Freund Karl in ein ihm fremdes Land, nur um festzustellen, dass das Grauen des Kampfes gegen die Dänen ihm die Frage "Warum?" ins Herz brennt. Niels, der dänische Lehrer, muss Kreide gegen ein altes Vorderladergewehr tauschen, um das Danewerk zu verteidigen. Er erlebt die bittere Notwendigkeit des Rückzugs und den verzweifelten, aussichtslosen Kampf in den schlecht befestigten Schanzen von Düppel. Anna, die Bäckerin, kämpft als Zivilistin im Hinterland gegen Hunger und Angst, versorgt heimlich Verwundete und muss zusehen, wie ihre Heimat zum Lazarett wird. Wilhelm, der preußische Soldat, überlebt den Sturm auf die Schanzen, doch der vermeintliche Triumph kostet ihm einen Teil seiner Seele und lässt ihn am Sinn des Sieges zweifeln. Von der zermürbenden Belagerung, dem unaufhörlichen Donnern der Krupp-Kanonen bis zum finalen, blutigen Sturmangriff am 18. April 1864: Düppeler Schanzen ist ein schonungsloses Mosaik der Angst, der Verluste und der leisen Hoffnung in einem der prägendsten Kriege des 19. Jahrhunderts. Ein Roman, der zeigt, dass auf dem Schlachtfeld keine Helden, sondern nur Menschen sterben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Deutsche Geschichte
Band 1
Gegen Dänemark 1864 Roman
IMPRESSUM:
Ralf Hagedorn
c/o IP-Management #4887
Ludwig-Erhard-Str. 18
20459 Hamburg
Geschichten von mir Erfunden, mithilfe von ChatGPT geschrieben.
Coverbild Gemini.
Prolog
Winter 1863
Der Nebel hing schwer über den kahlen Feldern Holsteins. Von den Dörfern stieg Rauch aus Schornsteinen, als wollten die Menschen die Dunkelheit vertreiben. Doch hinter jeder Tür lag Unruhe, die in den letzten Monaten gewachsen war.
Die Zeitungen berichteten von Gesetzen und Verfassungen, von einem König in Kopenhagen, der nicht weichen wollte, und von Bismarck in Berlin, der auf eine harte Lösung drängte. Worte wie Bundesexekution, Novemberverfassung und Sukzession machten die Runde, doch nur wenige verstanden sie. Für die Bauern, Handwerker und Mägde, die hier lebten, war es einfacher: Der Krieg kam und keiner konnte ihn aufhalten.
Während in den Kasernen Preußens die Trommeln zum Aufbruch schlugen, während österreichische Regimenter aus Böhmen und Mähren heranrollten und in Dänemark die Wehrpflichtigen zu den Fahnen gerufen wurden, ahnte kaum einer, welch blutiger Winter bevorstand.
Es war der Beginn eines Krieges um Land und Sprache, um Ehre und Macht und für die einfachen Menschen ein Kampf ums nackte Überleben.
Johann, der preußische Rekrut
Der Frost hing über den Feldern, als Johann Meier den Hof seiner Eltern zum letzten Mal sah. Es war ein Morgen Ende Januar, das Licht blass und scharf, der Himmel wolkenlos. Aus den Schornsteinen der Nachbarhöfe stieg Rauch, träge, als wolle er die Kälte vertreiben. Doch gegen die Kälte half kein Rauch weder draußen noch in Johanns Herz.
Seine Mutter stand im Hof, das Wolltuch eng um den Kopf geschlungen, die Augen rot von Tränen. Immer wieder griff sie nach seiner Hand, als wolle sie nicht loslassen. „Pass auf dich auf, Johann“, sagte sie zum dritten Mal, „schreib uns, wenn du kannst.“ Ihre Stimme war heiser, wie von einer Krankheit. Aber es war nicht Krankheit es war Angst.
Der Vater stand ein paar Schritte abseits. Er war kein Mann vieler Worte. Seine Hände, hart und voller Schwielen vom Pflug, lagen schwer auf dem Rücken. Als Johann ihm zum Abschied die Hand reichte, drückte der Alte kräftig zu. Keine Worte, nur dieser Griff stark, stumm, fast schmerzhaft. Dann wandte er sich ab und führte die Pferde zum Stall, als ginge das Leben weiter wie bisher.
Johann wusste: Sein Vater weinte nie. Vielleicht würde er es heute Nacht tun, heimlich, allein im Dunkeln.
Er selbst trug die neue Uniform der preußischen Infanterie: dunkelblauer Rock, schwarze Tuch Hose, das Lederzeug über die Brust geschnallt. Auf der Schulter das Zündnadelgewehr, schwer, fast schwerer als er selbst. „Dieses Gewehr ist euer Leben“, hatte der Sergeant gesagt, als er es ihm übergab. Johann hatte genickt, doch er wusste kaum, wie man es richtig reinigte.
Am Tor wartete Karl, sein Jugendfreund aus dem Nachbardorf. Auch er trug Uniform, die Mütze schief auf dem Kopf, ein breites Grinsen im Gesicht ein Grinsen, das zu groß war, um echt zu sein. „Na, Johann, bist du bereit für den großen Krieg?“, fragte er.
Johann zwang sich zum Lächeln. „Bereit genug.“
„Dann los. Die Trommel ruft.“
Sie gingen gemeinsam die schmale Straße hinunter, die zum Sammelplatz führte. Hinter ihnen verhallten die letzten Worte der Mutter: „Komm zurück, Johann! Versprich es mir!“
Er drehte sich nicht um. Wenn er es getan hätte, wäre er vielleicht nie gegangen.
Der Sammelplatz lag am Rand des Nachbardorfes, auf einer kargen Wiese. Schon Dutzende junge Männer hatten sich versammelt. Manche sahen blass aus, andere redeten laut, lachten, schlugen einander auf die Schultern, als sei es ein Fest. Doch in ihren Augen glomm die gleiche Unruhe, die Johann in sich selbst fühlte.
Trommeln wirbelten. Ein Unteroffizier brüllte Befehle. Reihen wurden gebildet, Namen aufgerufen. Johann stellte sich neben Karl, die Füße fest im gefrorenen Boden.
„Wohin geht’s, Herr Feldwebel?“ rief einer aus der Menge.
„Nach Schleswig“, knurrte der Alte. „Dort sitzt der Feind. Dort werdet ihr lernen, was Soldaten sind.“
Ein Raunen ging durch die Reihen. Schleswig das war weit weg, fast wie ein anderes Land. Doch es war nur wenige Tagesmärsche entfernt.
Johann spürte, wie sein Magen sich zusammenzog. Schleswig, dänisches Land, feindliches Land. Ein Ort, den er nie gesehen hatte, gegen Männer, die er nie getroffen hatte. Und doch sollte er sie töten.
Am nächsten Morgen begann der Marsch. Noch vor Sonnenaufgang traten sie an. Der Frost knirschte unter den Stiefeln, der Atem stand wie Rauch in der Luft. Johann fühlte die Last des Gewehrs auf der Schulter, das Scheuern des Ledergurtes an der Brust. Nach einer Stunde war sein Rücken feucht vor Schweiß, trotz der Kälte.
Die Kolonne zog sich über die Landstraße wie ein endloser Wurm. Wagen klapperten, Pferde wieherten, Offiziere ritten die Reihen entlang. Überall das Rufen von Befehlen, das Schlagen der Trommeln, das Schnauben der Tiere.
Mittags hielten sie Rast in einem kleinen Dorf. Die Bewohner standen stumm an den Türen, sahen zu, wie die Soldaten Brot aßen und Wasser tranken. Ein alter Mann zog den Hut, doch sein Blick war kalt. Johann fragte sich, ob sie hier Freunde oder schon Feinde waren.
Karl setzte sich neben ihn, kaute hartes Brot. „Weißt du, Johann, wenn wir die Dänen verjagen, heißt’s vielleicht bald: Schleswig-Holstein ist deutsch. Dann bekommen wir Freibier in Flensburg!“
Die Männer um sie herum lachten. Johann zwang sich zu einem Grinsen. Aber tief in ihm blieb die Unruhe.
Am Abend schlugen sie Quartier in einer Scheune. Stroh auf dem Boden, Mäuse im Gebälk. Johann legte sich neben Karl, das Gewehr stets griffbereit. Der Sergeant hatte es eingebläut: Gewehr nie aus der Hand geben nie.
Johann schloss die Augen, doch der Schlaf wollte nicht kommen. Stattdessen sah er das Gesicht seiner Mutter, die Hände seines Vaters, den Hof im Morgenlicht.
Und immer wieder die Frage: Warum?
Warum sollte er gegen Männer kämpfen, die er nie gesehen hatte? Warum war ein Stück Land so viel Blut wert?
Drei Tage marschierten sie, durch gefrorene Felder, über schlammige Wege, vorbei an Dörfern, in denen die Leute schweigend hinter Fenstern standen. Die Sonne zeigte sich kaum, Nebel lag über dem Land, und manchmal glaubte Johann, die ganze Welt sei nur noch ein grauer Vorhang.
Am vierten Tag erreichten sie Rendsburg. Die Stadt war ein einziges Heerlager. Überall standen Wagen, Kanonen, Zelte. Pferde schnaubten, Offiziere schrien Befehle, Soldaten schleppten Kisten voller Munition. Der Lärm war wie ein eigenes Wetter, lauter als Wind und Regen zusammen.
Johann sah zum ersten Mal die gewaltigen Krupp-Geschütze, die glänzenden Rohre, so schwer, dass Dutzende Pferde sie zogen. „Damit werden wir die Dänen in Stücke schießen,“ sagte Karl ehrfürchtig. Johann nickte, doch die Vorstellung machte ihm Angst.
Auf dem Exerzierplatz wurden die Regimenter aufgestellt. Ein General mit weißem Haar ritt vor die Reihen, die Stimme schneidend wie ein Schwert:
„Männer! Morgen überschreiten wir die Eider. Dort beginnt das Feindesland. Dort entscheidet sich, ob Schleswig deutsch bleibt oder von den Dänen verschlungen wird. Haltet euch bereit der Krieg, wartet nicht!“
Ein Jubel ging durch die Reihen, roh und erzwungen. Johann hob die Stimme mit an, doch in seiner Brust war nur Schweigen.
Am nächsten Morgen zogen sie über die Eider. Es war, als würde eine unsichtbare Grenze überschritten. Links und rechts standen Wachen, die Trommeln wirbelten, die Fahnen flatterten im Wind. „Jetzt sind wir im Krieg“, murmelte Karl. Johann nickte stumm.
Noch am selben Tag kamen sie an die Schlei, bei Missunde. Die Brückenleger begannen sofort, Balken ins Wasser zu werfen. Nebel hing über dem Fluss, dass andere Ufer lag wie ein Schattenreich.
Dann der erste Schuss. Ein Donnern, ein Aufblitzen, und eine Kugel schlug mitten unter die Männer, riss Erde und Wasser auf. Ein Schrei, dann Stille, dann noch mehr Schreie.
„In Deckung!“, brüllte der Feldwebel.
Johann warf sich zu Boden, das Gewehr fest an die Brust gedrückt. Ringsum krachte es, Kugeln zischten durch die Luft, Granaten schlugen in den Boden. Er sah, wie einer der Brückenleger getroffen wurde und ins Wasser stürzte. Nur kurz sah man seine Hände, dann nichts mehr.
„Vorwärts! Niederlegen und feuern!“ rief der Offizier.
Johann kroch nach vorn, legte an. Der erste Schuss riss das Gewehr in seiner Hand zurück, Rauch brannte in seinen Augen. Er wusste nicht, ob er traf. Alles war Chaos Schreie, Schüsse, Rauch.
Neben ihm lag Karl, das Gesicht schweißnass. „Gottverdammt, Johann, das ist die Hölle!“
Johann schoss erneut, lud nach, schoss wieder. Immer wieder. Er hörte nur noch das Rattern der Gewehre, das Donnern der Kanonen.
Doch die Brücke hielt nicht. Immer wieder zerstörte das dänische Feuer die Planken, immer wieder stürzten Männer ins Wasser. Stundenlang dauerte das. Bis schließlich der Befehl kam: Rückzug.
Sie zogen sich zurück, erschöpft, taub vom Lärm. Viele fehlten. Johann sah einen Kameraden, der mit leerem Blick im Schnee saß, die Hände blutig, das Gewehr zerbrochen. Ein anderer weinte offen, ohne Scham.
In der Nacht lag Johann im Zelt, zitternd. Er konnte nicht schlafen. Vor seinen Augen sah er immer wieder den Brückenleger, wie er ins Wasser stürzte, die Hände vergeblich nach Halt suchend.
Er flüsterte leise ein Gebet, so wie seine Mutter es ihm als Kind beigebracht hatte. Doch die Worte klangen fremd.
Am nächsten Morgen erhoben sie sich wieder, als wäre nichts geschehen. Der Krieg wartete nicht.
Die Niederlage bei Missunde war wie ein bitterer Beigeschmack, den keiner ausspucken konnte. Tage später redete kaum noch jemand darüber, doch in den Augen der Männer lag ein Schatten. Selbst Karl, sonst immer zum Spott aufgelegt, schwieg beim Marsch.
Anfang Februar rückten sie weiter vor, tiefer ins Land. Nebel lag über den Sümpfen, Schnee peitschte vom Himmel, und der Boden war so gefroren, dass die Stiefel auf dem Weg klirrten. Überall lag der Geruch von Rauch und Schießpulver in der Luft, selbst wenn keine Kanone feuerte.
Schließlich tauchte das Danewerk vor ihnen auf einen uralten Wall, der sich meilenweit durchs Land zog. Erde, Holz, Palisaden, verstärkt mit Kanonen. Johann hatte so etwas noch nie gesehen. Es wirkte wie ein Monster aus der Erde selbst, gezähmt von Menschenhänden.
„Da drinnen sitzen die Dänen,“ murmelte Karl. „Wenn wir das knacken, sind wir Helden.“
Johann schwieg. Er dachte nur: Wie viele von uns werden diesen Wall nie überwinden?
Die Österreicher griffen zuerst an, bei Ober-Selk und Jagel. Johann hörte das Donnern der Kanonen, sah Rauch über den Hügeln. Dann kam der Befehl: vorwärts.
Sie krochen durch Schnee und Schlamm, legten sich nieder, feuerten, krochen weiter. Johann sah Kugeln über seinen Kopf zischen, hörte das dumpfe Schlagen, wenn sie in Körper trafen. Ein Mann neben ihm schrie auf, fiel ins Weiß, und bewegte sich nicht mehr.
„Vorwärts, Männer!“, rief der Offizier, doch seine Stimme ging im Kanonendonner unter.
Johann lud, schoss, lud erneut, mechanisch, wie ein Rad im Getriebe. Er spürte die Angst nicht mehr, nur das Zittern seiner Hände.
Am Abend hieß es: Sieg. Die Dänen hatten sich zurückgezogen, tief ins Danewerk. Johann war am Leben, doch er wusste nicht, warum gerade er und nicht der Kamerad neben ihm.
Zwei Nächte später, am 6. Februar, geschah das Unerwartete. Frühmorgens, als die Männer gerade die Stiefel schnürten, kam die Nachricht: Das Danewerk ist leer.
Die Dänen hatten die Geschütze zurückgelassen. Keine Schlacht, kein Sturm, kein Blutbad. Einfach leer.