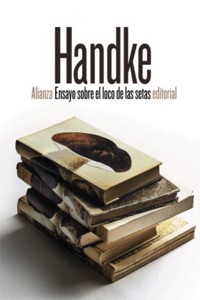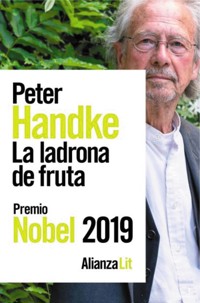Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien E-Book
Peter Handke
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es war vor allem der Kriege wegen, daß ich nach Serbien wollte, in das Land der allgemein so genannten »Aggressoren«. Doch es lockte mich auch, einfach das Land anzuschauen, das mir von allen Ländern Jugoslawiens das am wenigsten bekannte war, und dabei, vielleicht gerade bewirkt durch die Meldungen und Meinungen darüber, das inzwischen am stärksten anziehende, das, mitsamt dem befremdenden Hörensagen über es, sozusagen interessanteste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Handke
Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien
Suhrkamp Verlag
Für die Redakteure:
Elisabeth Bauschmid, Klaus Podak, Achim Zons,
und den Gestalter (Layouter)
Gerhard Engel
»Ach, ich erinnere mich: damals unterschrieb ich Briefe mit Poor Yorick, und meine Mutter ging den ganzen Tag in der Nachbarschaft umher und fragte, wer denn dieser Yorick sei. Eh, so lebte man vor dem Krieg.«
»Was macht es uns aus, drei Millionen Menschen zu töten. Der Himmel ist überall der gleiche, und blau, so blau. Der Tod ist noch einmal gekommen, aber nach ihm wird die Freiheit kommen. Wir werden frei und komisch sein.
»Als der erste Schnee fiel, lernten wir uns besser kennen.«
Miloš Crnjanski, Tagebuch über Čarnojević,1921
1 Vor der Reise
Schon lange, nun fast vier Jahre lang, seit dem Ende des Krieges in Ostslawonien, der Zerstörung von Vukovar, seit dem Ausbruch des Krieges in Bosnien-Herzegowina, hatte ich vorgehabt, nach Serbien zu fahren. Ich kannte von dem Land einzig Belgrad, wohin ich vor beinah drei Jahrzehnten als Autor eines stummen Stücks eingeladen war zu einem Theaterfestival. Von jenen vielleicht eineinhalb Tagen habe ich nur behalten meinen jugendlichen oder eben autorhaften Unwillen wegen einer unaufhörlichen Unruhe, angesichts der wortlosen Aufführung, in dem serbischen Publikum, welches, so mein damaliger Gedanke, südländisch oder balkanesisch, wie es war, natürlich nicht reif sein konnte für ein so langandauerndes Schweigen auf der Bühne. Von der großen Stadt Belgrad ist mir von damals nichts im Gedächtnis geblieben als eine eher sachte Abschüssigkeit beidseits zu den unten in der Ebene zusammenströmenden Flüssen Save und Donau hin — kein Bild hingegen von den beiden Wassern, die Horizonte verriegelt von den »typisch kommunistischen« Hochblöcken. Erst jetzt, vor kurzem, bei meinem zweiten Aufenthalt in der serbischen, seinerzeit jugoslawischen Hauptstadt, kam mir dort, in einer mit Linden, herbstblätterverstreuenden, gesäumten Seitenstraße, beim zufälligen Gehen an einem »Haus der Schriftsteller« vorbei, in den Sinn, daß ich einstmals sogar drinnen gewesen war, bewirtet und nebenbei in meinem juvenilen Autorengehabe freundlichst verspottet von dem gar nicht so viel älteren, damals in ganz Europa berühmten, auch von mir ziemlich begeistert gelesenen Schriftsteller Miodrag Bulatović, »Der rote Hahn fliegt himmelwärts«. (Er ist vor ein paar Jahren gestorben, mitten im jugoslawischen Krieg, bis zuletzt, wie mir in Belgrad erzählt wurde, spottlustig gegen jedermann und zugleich immer hilfsbereit; gab es außerhalb seines Landes Nachrufe auf ihn?)
Es war vor allem der Kriege wegen, daß ich nach Serbien wollte, in das Land der allgemein so genannten »Aggressoren«. Doch es lockte mich auch, einfach das Land anzuschauen, das mir von allen Ländern Jugoslawiens das am wenigsten bekannte war, und dabei, vielleicht gerade bewirkt durch die Meldungen und Meinungen darüber, das inzwischen am stärksten anziehende, das, mitsamt dem befremdenden Hörensagen über es, sozusagen interessanteste. Beinah alle Bilder und Berichte der letzten vier Jahre kamen ja von der einen Seite der Fronten oder Grenzen, und wenn sie zwischendurch auch einmal von der anderen kamen, erschienen sie mir, mit der Zeit mehr und mehr, als bloße Spiegelungen der üblichen, eingespielten Blickseiten — als Verspiegelungen in unseren Sehzellen selber, und jedenfalls nicht als Augenzeugenschaft. Es drängte mich hinter den Spiegel; es drängte mich zur Reise in das mit jedem Artikel, jedem Kommentar, jeder Analyse unbekanntere und erforschungs- oder auch bloß anblickswürdigere Land Serbien. Und wer jetzt meint: »Aha, proserbisch!« oder »Aha, jugophil!« — das letztere ein Spiegel-Wort (Wort?) —, der braucht hier gar nicht erst weiterzulesen.
Zwar hatte es in den letzten Jahren schon die eine und die andere Einladung in das geschrumpfte Jugoslawien, nach Serbien oder Crna Gora, Montenegro, gegeben. Aber ich wollte vermeiden, dort jemand Öffentlicher, und wenn auch nur Halböffentlicher, zu sein. Es schwebte mir vor, mich als irgendein Passant, nicht einmal als Ausländer oder Reisender kenntlich, zu bewegen, und das nicht allein in den Metropolen Belgrad oder Titograd (inzwischen Podgorica), sondern, vor allem, in den kleinen Städten und den Dörfern, und womöglich zeitweise auch fern von jeder Ansiedlung. Aber selbstredend brauchte ich zugleich so jemanden wie einen ortskundigen Lotsen, Gefährten und vielleicht Dolmetsch; denn mit meinem löcherigen Slowenisch und den paar serbokroatischen Gedächtnisspuren von einem Sommer auf der Adria-Insel Krk, vor weit über dreißig Jahren, durfte ich mich, sollte es keine übliche Reise werden, nicht begnügen. (Kein Problem dagegen die fremde kyrillische Schrift: daß ich sie, oft stockend, erst entziffern mußte, erschien für das Vorhaben gerade recht.)
Es traf sich, daß ich schon lange zwei Freunde aus Serbien habe, die beide ziemlich jung aus ihrem Land weggegangen sind, in mehr oder weniger großen Abständen aber heimkehren, auch jetzt während des Kriegs: Besuch der Eltern, oder der verwitweten Mutter, und/ oder des einen und anderen ehelichen oder unehelichen Kindes samt frühverlassener serbischer Geliebter. Der eine ist Žarko Radaković, Übersetzer von einigen meiner Dinge ins Serbische, und à ses heures, wie es so einleuchtend französisch heißt, »zu seinen Stunden«, selber ein Schreiber; im Geldberuf freilich, nach seinem Studium in Belgrad und dann lange in Tübingen, Übersetzer und Sprecher deutschsprachiger Zeitungsartikel bei der balkanwärts gerichteten Funkstelle der »Deutschen Welle«: selbst da, in einem nicht seltenen Zwiespalt zwischen Serbe-Sein und Gegensprechen-Müssen (so etwa die keinmal auch nur in einem Anhauch »proserbischen« Tendenzkartätschen aus der FAZ), ein treulicher Übersetzer — Sprecher dagegen manchmal eher mit versagender Stimme. Mag sein, daß solche Existenz auch zu dem Verstummen beitrug, welches meinen Freund seit Kriegsbeginn befallen hatte, nicht bloß vor der Feindes-, sondern sogar vor der Freundeswelt, und so auch vor mir. Zwar übersetzte er weiterhin dies und jenes, und das kam, trotz des Krieges, in Belgrad, Niš oder Novi Sad als Buch heraus: doch ich erfuhr von ihm nichts mehr davon — Žarko R. lebte, übersetzte und schrieb wie in einer selbstgewählten Verdunkelung. Um ihn darin jetzt aufzuspüren, mußte ich mich an den letzten ihm noch gebliebenen Vertrauten wenden, einen Mormonen weit weg im amerikanischen Bundesstaat Utah. Und wie es solch einem mormonischen Umweg entspricht, fanden der Serbe und ich, der Österreicher, gleichsam im Handumdrehen wieder zusammen: Anruf aus Köln — ja, Anfang November Treffen in Belgrad, »ich besuche da ohnedies gerade meine Mutter« — und für die Woche darauf das Projekt einer gemeinsamen Fahrt an die Grenze nach Bosnien, wo er, ebenfalls »ohnedies«, in einer Kleinstadt an dem Grenzfluß Drina mit seiner dort lebenden einstigen Freundin und der gemeinsamen, inzwischen bald achtzehnjährigen Tochter verabredet war.
Den anderen serbischen Freund, von dem ich mir sein Land und seine Leute nahebringen lassen wollte, kannte ich von dem Fastjahrzehnt meines Lebens in Salzburg. Zlatko B. war Stammgast in einem Lokal der stadtauswärts führenden Schallmooser Hauptstraße, wohin auch ich öfter ging, all die Jahre lang, auch wegen der altväterischen, immer laut eingestellten Jukebox und ihrer nie ausgewechselten Creedence-Clearwater-Revival-Songs, »Have You Ever Seen The Rain?«, »Looking Out The Back Door«, »Lodi«. Zlatko spielte dort anfangs Karten, jeweils um große Summen. Er hatte Serbien, nach einer bäuerlichen Kindheit im Ostland, einer Büromaschinenlehre in Belgrad und der sehr langen Armeezeit in mehreren Winkeln Jugoslawiens, für Österreich verlassen, um, wie er behauptet, reich zu werden. Das war ihm als Arbeiter in einer Salzburger Vorstadtwäscherei nicht gelungen. Und so versuchte er es, zwischendurch Handlanger und Bote in einem Reisebüro, im »Mirjam's Pub« als Berufsspieler, hatte aber, auf sich allein gestellt, gegen die europareifen Spielerbanden, die sich am Ort abwechselten, auf die Dauer keine Chancen. (Im Gedächtnis geblieben ist mir von ihm aus jener Zeit besonders sein nicht eben seltener Blick zum unsichtbaren Himmel nach einem jeden verlorenen Spiel.) Danach wurde er sozusagen beständig ehrlich, ein Gelegenheitsarbeiter, immer prompt, kompetent, beiläufig, und bei Gelegenheit, fast nur auf Bestellung, auch ein Maler seltsamer Genreszenen, weit entfernt von der Buntheit und nicht nur eigengelenkten Phantasie der einst hochgehandelten serbischen Naiven — erinnernd zum Beispiel an die slowenischen Bienenstockmalereien aus dem 19. Jahrhundert (zu betrachten im lieben Museum von Radovljica beim See von Bled) oder die Wirtshausschilder des georgischen Wandermalers Pirosmani. Und wie Žarko R. hatte auch Zlatko B. sich seit dem Ausbruch der jugoslawischen Kriege zurückgezogen, aus der Salzburger Stadt hinaus auf das Land, und hat dann sogar amtlich seinen serbischen Namen abgelegt zugunsten eines deutsch klingenden — in Wahrheit ein getreuer Anklang an den von ihm hochverehrten niederländischen Kleinszenenmaler aus dem 17. Jahrhundert, Adrian Brouwer.
Und auch Zlatko B., alias Adrian Br., war mit meinem Vorschlag einer gemeinsamen Reise durch sein Serbien auf der Stelle einverstanden. Wir würden seine Weinbauerneltern in dem Dorf Porodin, nah dem Mittserbenfluß Morawa, besuchen — nur sollte das womöglich noch vor dem tiefen November sein, damit wir etwas von dem schönen Herbst und den Trauben in den Weinbergen hätten. Er zögerte nur, mit dem eigenen Auto zu kommen, weil das, so hatte er gehört, in seiner serbischen Heimat sofort gestohlen würde.
Ende Oktober 1995 machten wir uns so aus unseren drei verschiedenen Richtungen auf den Weg nach Belgrad: der eine vom Salzburger Land, quer durch Österreich und Ungarn (schließlich doch mit seinem Wagen), der andere aus Köln, mit einem Lufthansaflugzeug, der dritte aus dem Pariser Vorort, nach einer Autofahrt durch Lothringen und die Schweiz, mit der Swissair von Zürich, an der Seite von S. So wurde das eine der wenigen Reisen meines Lebens, die ich nicht allein unternahm; und die erste, bei der ich fast ständig in Gesellschaft blieb.
Ich hatte mich für Serbien im übrigen nicht besonders vorbereitet. Fast hätten S. und ich sogar versäumt, uns die Visa zu besorgen, so sehr war mir noch das weite Jugoslawien von 1970 bis 1990 im Kopf, überall frei zugänglich und ohne Krieg. Und nun sollte ich gar, bei der zuständigen Stelle in Paris, die keine »Ambassade« mehr war, nur noch eine Notbehörde, einen Reisegrund angeben — »Tourist«, was doch zutraf, wurde als unglaubhaft angesehen (war ich der erste seit Kriegsausbruch?), auch als ungenügend. Zum Glück fand sich endlich eine weltoffene Vertreterin Serbiens, in einem Hinterzimmer, der ich nichts mehr zu erklären brauchte; und diese versicherte außerdem, wir hätten, wo auch immer, in ihrem Land keinen Moment Öffentlichkeit zu fürchten. (Aber was war ihr Land? Sie kam aus der Krajina, inzwischen wie für immer dem Staat Kroatien zugefallen.)
Am Vorabend der Abreise schaute ich in einem Kino von Versailles noch Emir Kusturicas Film Underground an. Die vorigen Filme des Bosniers aus Sarajewo, etwa Die Zeit der Zigeuner und Arizona Dream, hatte ich einerseits bewundert wegen ihrer mehr als bloß frei schwebenden — ihrer frei fliegenden Phantasie, mit Bildern und Sequenzen so dichtverknüpft und gleichmäßig, daß sie oft übergingen in orientalische Ornamente (was das Gegenteil von Verengung sein konnte), und andererseits hatte ich doch ganz und gar an diesen Bilderflügen vermißt etwas wie eine Erd- oder Land- oder überhaupt Weltverbundenheit, so daß die ganze Phantastik jeweils bald geplatzt war zu augenverstopfenden Phantastereien; und einem Bewundernmüssen habe ich schon immer das Ergriffensein vorgezogen, oder das Fastergriffensein, welches in mir am stärksten nachgeht, anhält, dauert.
Durch Underground aber wurde ich da erstmals von einem Film Kusturicas (fast) ergriffen. Endlich war aus der bloßen Erzählfertigkeit eine Erzählwucht geworden, indem nämlich ein Talent zum Träumen, ein gewaltiges, sich verbunden hat mit einem handgreiflichen Stück Welt und auch Geschichte — dem einstigen Jugoslawien, welches des jungen Kusturica Heimat gewesen war. Und war es nicht zum Beispiel eine Wucht — eine Shakespearesche, durchkreuzt immer wieder von jener der Marx Brothers —, wenn in einer großen Szene gegen Schluß, im tiefsten Bürgerkrieg, einer der Filmhelden, auf seiner jahrelangen, verzweifelten Suche nach seinem einst in der Belgrader Donau verschwundenen Sohn, durch den Schlachtenrauch rennend in einem fort wechselt zwischen dem Schreien um sein vermißtes Kind und dem Brüllbefehl: »Feuer!«? Wie töricht oder böswillig kam mir dann so vieles vor von dem, was gegen Underground geschrieben worden war. Nicht nur, daß nach der Aufführung in Cannes Alain Finkielkraut, einer der neueren französischen Philosophen, seit Kriegsausbruch ein unbegreiflicher Plapperer für Staatlich-Kroatien, Kusturicas Film, ohne ihn gesehen zu haben, in Le Monde Terrorismus, proserbische Propaganda usw. vorwarf: Noch vor einigen Tagen kehrte in Libération