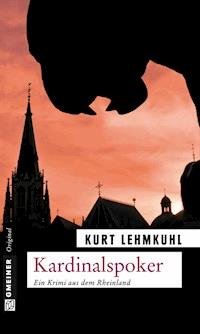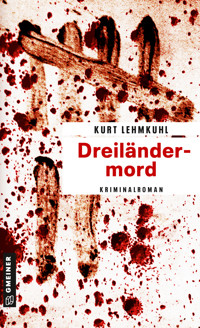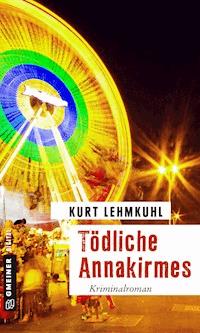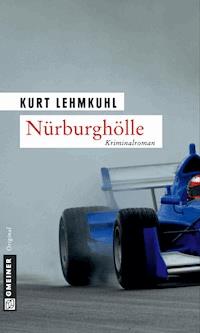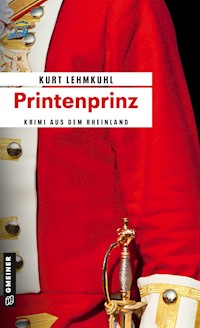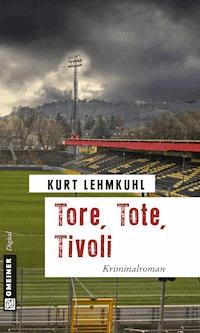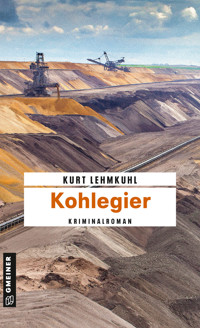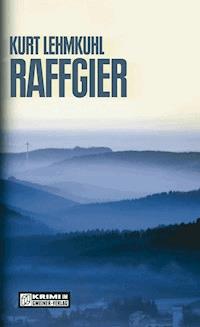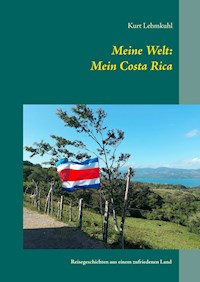Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Böhnke und Rechtsanwalt Grundler
- Sprache: Deutsch
Rudolf-Günther Böhnke findet keine Ruhe in dem idyllischen Eifelort Huppenbroich. Nachdem der pensionierte Kriminalhauptkommissar den verzweifelten Walter Frosch vor einem Selbstmord bewahrt hat, sieht er es als seine Pflicht an, ihm zu helfen: Frosch wird um 500.000 Euro erpresst. Zeitgleich droht Böhnke von anderer Seite Ärger. Ein Kölner hat ein Grundstück in Huppenbroich geerbt und will es mit Thuyas bepflanzen statt mit Buchen. Nachdem erste Anpflanzungen zerstört wurden, beauftragt er Böhnke, die Täter zu ermitteln. Jedenfalls glauben das die Bewohner …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lehmkuhl
Fundsachen
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Benjamin Arnold
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von:
© Bildagentur Zoonar GmbH / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-4630-6
1. Kapitel
»Was ist bloß in Belgien los?« Die Überschrift in der Tageszeitung lenkte den neugierig gewordenen Leser auf eine skurrile Geschichte im Bereich der deutsch-belgischen Grenze zwischen Roetgen und Monschau, obwohl sie auf den ersten Blick eine politische Streiterei zwischen der flämischen und der wallonischen Volksgruppe des Königreichs vermuten ließ. Dort war, wie die Zeitung durchaus süffisant berichtete, auf dem über belgisches Staatsgebiet führenden Teilstück der Bundesstraße 258 zwischen Konzen und Fringshaus in Fahrtrichtung Monschau schon vor Tagen ein am Straßenrand abgestellter Pkw aufgefallen. Pendler auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit nach Aachen und der abendlichen Rückkehr nach Hause in die Eifel hatten einen alten Ford Scorpio bemerkt. Das Fahrzeug stand zwar halb auf der Böschung und dem Entwässerungsgraben, behinderte aber den Verkehrsfluss auf dieser Schnellstraße ohne Seitenstreifen. Unmittelbar hinter der Straße begann der dichte, bereits auf belgischem Territorium liegende Wald.
Mehrere Autofahrer hatten ihre Beobachtung sofort der deutschen Polizei gemeldet, die wiederum, wegen der unzweifelhaften Zuständigkeit, die belgischen Kollegen in Eupen informiert hatten. Nicht untätig, hatten die Ordnungshüter aus dem deutschsprachigen Kanton Belgiens das Fahrzeug inspiziert und prompt wieder die deutschen Kollegen ins Spiel gebracht. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Amtshilfe sollten sie anhand des deutschen Kennzeichens den Fahrzeughalter ermitteln. Immerhin war in erster Linie der Halter für den Abtransport des offensichtlich fahruntüchtigen Scorpio zuständig und nicht der belgische Polizeiapparat.
»Ordnung muss halt sein«, kommentierte der Berichterstatter in seinem Artikel; erst wenn der Halter nicht herangezogen werden könnte, würde das Auto von Amts wegen von der Bundesstraße entfernt. Ob der deutsche Staat oder das belgische Königreich für die Abschleppkosten aufzukommen habe, wäre eine Frage, die erst danach zu klären sei; ebenso, wie die Frage, wer das Auto eventuell als Fundsache für sich beanspruchen könnte, wenn kein Halter oder Fahrer ermittelt würde.
Wenige Stunden nach ersten Meldungen und noch während der deutsch-belgischen Polizeiermittlungen waren die Kennzeichen von dem herrenlosen Wagen von Unbekannten abmontiert worden.
»So blöd kann der Besitzer doch gar nicht sein«, lästerte der Journalist genüsslich.
Der Zeitungsbericht am folgenden Tag gab dem Fund des verlassenen Scorpio eine neue Dimension. Der Wagen war über Nacht in Brand gesteckt und abgefackelt worden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Roetgen hatte wegen Gefahr in Verzug den Löscheinsatz vorgenommen, ohne auf die zuständige Feuerwehr aus Eupen zu warten, das Wrack von der Schnellstraße entfernt und zum Bauhof der Gemeinde geschleppt. Wichtiger als die Aufklärung der Brandursache war nach dem Einsatz die Lösung des finanziellen Problems: Wer hatte für die Kosten aufzukommen? Der Kanton Eupen, die Gemeinde Roetgen oder der Halter des Wagens? Die Wahrscheinlichkeit, die Brandstifter ausfindig zu machen und zur Kasse zu bitten, wurde von der Wehrleitung als sehr gering eingeschätzt. Absolut sicher war sich der Einsatzleiter im Gespräch mit der Zeitung aber, dass der Wagen bewusst und gezielt abgefackelt worden war. Eine Selbstentzündung sei trotz oder wegen der frühlingshaften Temperaturen ausgeschlossen. Ein rasches Eingreifen der Rettungskräfte sei unerlässlich gewesen, damit der Brand sich nicht auf die Bäume und das Hohe Venn ausbreiten konnte.
Man werde selbstverständlich am Ball bleiben, versicherte die Zeitung, und weiter über diesen merkwürdigen Zwischenfall berichten. Bisher sei der Halter des Fahrzeugs nicht ermittelt und es war weiterhin unklar, warum der Fahrer den Scorpio ausgerechnet an dieser Stelle der Schnellstraße abgestellt hatte, anstatt ihn auf einem der vielen Parkplätze in wenigen Kilometern Entfernung abzustellen. Die Spekulation, der Autofahrer hätte wegen eines plötzlichen dringenden Bedürfnisses angehalten und sich in die Büsche geschlagen, wurde schnell verworfen. In 300 Meter Umkreis gab es weder Spuren eines Menschen noch einer menschlichen Hinterlassenschaft, behauptete der Berichterstatter unter Berufung auf die Feuerwehr.
»Wer ist der Tote im Hohen Venn?« Von einer dramatischen Wendung im Zusammenhang mit dem abgewrackten Scorpio sprach die Zeitung wieder einen Tag später und berief sich auf die belgischen Kollegen vom Grenz-Echo in Eupen. Das deutsche Blatt hatte deren Berichterstattung wortwörtlich übernommen.
In dem Artikel war vom Fund einer männlichen Leiche die Rede. Nach Angaben der Polizei war der Mann erschossen worden. Die Tötung musste nach Ansicht der Gerichtsmediziner ungefähr eine Woche her sei. Der Zeitpunkt deckte sich nahezu mit dem, an dem der Scorpio zum ersten Mal aufgefallen war. Prompt kam als Schlussfolgerung die nächste Frage: »Gehört dem Toten im Venn der abgestellte Wagen auf der Bundesstraße im Niemandsland?«
Wer der Tote war, schrieb die Zeitung nicht. Man habe den Mann bislang nicht identifizieren können, so wurde ein Polizist zitiert. Er habe keine Papiere bei sich getragen und weise keine markanten Merkmale auf. Mit anderen Worten, so folgerte die Zeitung, handelte es sich wohl um einen unbescholtenen Bürger, dem Anschein nach um einen Deutschen.
Die Polizei hingegen wollte sich zu derartigen Spekulationen verständlicherweise nicht äußern. Es gebe keine Vermisstenmeldung, die in Verbindung mit dem Toten gebracht werden könne. Für die Ermittler gab es nach derzeitigem Stand nur wenige Fakten: Ein unbekannter Mann war von Spaziergängern im Venn tot aufgefunden worden. Er war mit einem Schuss aus einem Gewehr getötet worden.
In einem Nachtrag zu dem Artikel berichtete die Zeitung von zwei vermeintlichen Zeugen aus Welkenraedt, die sich genau daran erinnern konnten, bei einem ihrer fast alltäglichen Spaziergänge im Venn einen lauten Knall gehört zu haben. Unmittelbar danach hätten sie einen Mann beobachtet, der durchs Unterholz gehastet sei. Damals hätten sie nicht an ein Verbrechen gedacht und sich nur gewundert. Nach den Nachrichten im Rundfunk am Vormittag hätten sie sich dann am Nachmittag bei der Gendarmerie gemeldet und ihre damalige Beobachtung mitgeteilt.
Fast schon mit Bedauern berichtete die Zeitung von der Weigerung der belgischen Polizei, zum Zwecke der Identifizierung ein Foto des Toten veröffentlichen zu lassen. Die Leiche würde in der Gerichtsmedizin untersucht, meinte ein Polizeisprecher. Nach der Untersuchung würde die Ermittlungsbehörde über das weitere Vorgehen entscheiden sowie darüber, ob gegebenenfalls die Öffentlichkeit informiert werden sollte.
Was damit gemeint war, durchschauten nur die wenigsten Zeitungsleser. Das Gesicht des Toten war nach einer Woche in der freien Natur nicht mehr in einem Zustand, den man der Öffentlichkeit zumuten konnte. Tiere hatten sich daran zu schaffen gemacht. Ob sich mit plastischen und kosmetischen Mitteln das Gesicht wiederherstellen ließ, war mehr als zweifelhaft.
Einer der wenigen, der diese Problematik erkannte, war Rudolf-Günther Böhnke; kein Wunder, war er doch bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung als Kriminalhauptkommissar Leiter der Abteilung für Tötungsdelikte im Aachener Polizeipräsidium gewesen. Aber das war einmal. Nun las er mit gehöriger Distanz zu seinem damaligen Beruf die Zeitungsberichte über den Wagen und den Toten im Venn. Mit diesem Problem konnten sich die Kollegen aus Eupen beschäftigen. Er hatte andere Probleme und Schwierigkeiten, die nicht nur ihm Kopfzerbrechen bereiteten, sondern viele der Einwohner von Huppenbroich zu lang anhaltenden Diskussionen veranlassten.
2. Kapitel
Das Rätsel von Huppenbroich fand keinen Platz in der Zeitung. Es hatte weder einen politischen noch einen kriminellen Hintergrund, es war rein privater und tragischer Art und trug einen Namen: Schmitze Billa; obwohl ihr Schicksal eigentlich einen Platz in der Zeitung verdient hatte.
Jeder im Dorf kannte Schmitze Billa, eine ältere Frau, die immer schon alt gewesen sein musste. Sie lebte allein in einem kleinen, unscheinbaren, hinter einer Hecke verborgenen Haus am Ortsrand, das noch älter war als sie. Für die Kinder war sie sogar uralt und damit geheimnisvoll. Nur der Ortsvorsteher und der Pfarrer kannten ihr tatsächliches Alter. Sie hatten der Seniorin erst vor ein paar Wochen zum 92. Geburtstag gratuliert. Sie war zwar damit nicht die betagteste Einwohnerin von Huppenbroich, aber sie wirkte zumindest so.
Schmitze Billa war immer allein. Ob sie jemals verheiratet gewesen war, ob sie überhaupt Verwandte hatte, war im Ort nicht bekannt oder in Vergessenheit geraten, weil Zeitzeugen verstorben waren. Sie hatte nie darüber gesprochen, auch schon vor 20 Jahren nicht, als sie noch im Leprastrickkreis der Frauengemeinschaft mitgemacht hatte oder bei den Seniorenreisen des Deutschen Roten Kreuzes mitgefahren war. Mehr und mehr hatte sie sich im Laufe des letzten Jahrzehnts aus der Gemeinschaft zurückgezogen, lebte nur noch für sich und ihre beiden Katzen. Manchmal wurde sie von den Nachbarn gesehen, wenn sie im Garten herumwerkelte und versuchte, das wuchernde Unkraut in den Griff zu bekommen. Früher war sie noch regelmäßig zum rollenden Lädchen gekommen, das Lebensmittel und andere Alltagsgüter nach Huppenbroich lieferte. Jetzt kamen der Händler und der Hilfsdienst mit dem Essen auf Rädern zu ihr.
Man sah sie fast nie im Dorf. Nur an den katholischen Feiertagen ließ sie sich blicken. Ihre Haltung wurde von Jahr zu Jahr gebückter, wenn sie sich in ihrer schwarzen Kleidung langsam zur Kapelle bewegte, in der letzten Reihe niederkniete und der Messfeier in gläubiger Andacht folgte. Sie gab dabei durch ihr mürrisches Gebaren zu verstehen, dass sie mit niemandem sprechen wollte. Auch die Verabschiedung durch den Pfarrer nach der Messe am Ausgang bestand lediglich in einem kurzen Kopfnicken und einem wortlosen Händedruck. Die Alte hatte sich in Huppenbroich isoliert und wurde nicht mehr wahrgenommen. Niemand fragte nach der alten Frau, wie es ihr ginge, ob sie gesund sei, ob sie alles habe, ob sie etwas benötige. Im alljährlichen Geburtstagsbesuch der dörflichen Obrigkeit bestand die einzige Kontaktpflege mit der Bevölkerung, die sie akzeptierte.
Umso überraschender war ihr Erscheinen an der Bushaltestelle neben der Kapelle, an der die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft und des Kirchenchores Cäcilia auf den Reisebus für ihren alljährlichen Tagesausflug warteten. Schmitze Billa lehnte die Hilfe des herbeigeeilten Pfarrers ab, als er sie am Arm stützend zur Gruppe geleiten wollte. Ihre bescheidene, fast geflüsterte Frage, ob sie mitfahren dürfe, wurde von ihm freudestrahlend bejaht. Selbstverständlich war für sie noch ein Platz frei beim Ausflug zum Freilichtmuseum nach Kommern.
Schmitze Billa war bestens informiert. Sie hatte den Pfarrbrief genau gelesen und wusste, was sie in Kommern erwarten würde. Es sollte eine kleine Führung durch die Sonderausstellung »Berühmte Rheinländer« geben, danach standen Kaffee und Kuchen auf dem Programm. Die Zeit bis zur Rückfahrt nach Huppenbroich war zur freien Verfügung vorgesehen.
Man brauche sich nicht um sie zu kümmern, hatte Schmitze Billa gekrächzt und den Pfarrer gebeten, für sie keine Sonderbehandlung vorzusehen oder Rücksichtnahme walten zu lassen. Es sei gut so, wie es sei. Geradezu beschwingt kletterte sie in den Bus, nicht wie eine schwächliche Greisin, sondern wie eine rüstige Rentnerin. Im Bus setzte sie sich schweigend auf einen Fensterplatz und vermied es, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, indem sie unentwegt in die Landschaft blickte. Sie wollte auch in dieser Gemeinschaft allein sein.
Ohne erkennbare körperliche Anstrengung folgte sie der Gruppe und der Museumsführerin durch die Ausstellung, der insgeheim befürchteten Besorgnis des Pfarrers, es könne alles zu viel für sie werden, zum Trotz. Zu seinem Erstaunen kannte sie alle Persönlichkeiten, ob es sich um Konrad Adenauer handelte oder Elke Heidenreich. Sie nannte viele der Persönlichkeiten, deren lebensgroße Darstellung als Wachsfiguren zwischen Ausstellungsstücken in den unterschiedlichen Räumen und Häusern aufgestellt waren, beim Namen. Mit hellen, flinken Augen entdeckte Schmitze Billa die realitätsgetreuen Kunstwerke meist schneller als ihre oft um Jahrzehnte jüngeren Begleiterinnen.
Das Freilichtmuseum in Kommern bot auf seiner großen Fläche ein Abbild der ehemaligen preußischen Rheinprovinz. Knapp 70 historische Gebäude, Bauernhöfe, Wind- und Wassermühlen, Werkstätten, Gemeinschaftsbauten wie Schul- und Backhaus, Tanzsaal und Kapelle stellten eindrucksvoll das Bauen, Wohnen und Wirtschaften der Landbevölkerung seit dem Ende des 15. Jahrhunderts dar. Die in eine Museumslandschaft mit Äckern, Bauerngärten und Obstwiesen eingebetteten Baudenkmale gaben einen Überblick über das Leben und Arbeiten im Rheinland, den Schmitze Billa auswendig zu kennen schien. Offenbar hatte sie bei der Heimatkunde in der Volksschule gut aufgepasst. Sie nickte immer nur bestätigend, wenn die Führerin ihre Informationen lieferte. Nur einmal widersprach sie laut, als sich die Gruppe in einem alten Schlafzimmer im originalgetreu aufgebauten Haus eines Bäckers aufhielt, das ursprünglich in einem kleinen Eifeldorf gestanden hatte und die Museumsangestellte als Zeitangabe 1898 angab.
Da sagte Schmitze Billa energisch: »1889.«
Diese Zahl stimmte, wie die junge Frau nach einem suchenden Blick in ihre Unterlagen zugeben musste. Errötend entschuldigte sie sich für ihren Zahlendreher.
Woher sie das Datum wisse, fragte der Pfarrer erstaunt, und Schmitze Billa krächzte: »Weil es mein Elternhaus ist, in dem ich geboren wurde.«
Bei Kaffee und Kuchen in der Cafeteria des Museums hielt sich die Alte schweigsam zurück. Dankend lehnte sie ab, als der Pfarrer ihr anbot, ihr in der freien Zeit bis zur Rückfahrt nach Huppenbroich Gesellschaft zu leisten. Langsam machte sie sich auf den Weg zur Toilette und verschwand aus dem Blickfeld des Geistlichen.
Am vereinbarten Treffpunkt bei Abfahrt des Busses fehlte Schmitze Billa. Niemand hatte sie in den letzten beiden Stunden gesehen, niemand wusste, wo sie war.
Für den Pfarrer war es selbstverständlich, dass er ohne sie nicht nach Huppenbroich zurückfahren würde. Er sandte seine Schäflein aus, um die Alte zu suchen. Ihn selbst führte der Weg in das kleine Museumsdorf mit den verschiedenen Häusern der Handwerker. Wie er stutzten auch seine beiden Begleiterinnen wieder beim Anblick der lebensechten Figuren, die scheinbar wie zufällig aus einem Zimmer traten. Die Vorsitzende der Frauengemeinschaft wäre beinahe über Willy Millowitsch gestolpert. Ihre Stellvertreterin hätte beinahe Wolfgang Niedecken um ein Autogramm gebeten.
Endlich fanden sie die Vermisste. Schmitze Billa hatte es sich im Doppelbett ihrer Eltern in ihrem Geburtshaus bequem gemacht. Mit über dem Bauch wie zum Gebet gefalteten Händen lag sie ausgestreckt auf dem Rücken auf der dunklen Decke. Ihre alte Handtasche hatte sie ebenso sorgfältig neben dem Bett abgestellt wie ihre Schuhe.
Beim ersten, flüchtigen Blick konnte man glauben, sie gehöre zur Ausstattung des Raumes.
Sie habe sich bestimmt zum Schlafen niedergelegt, vermutete eine der Begleiterinnen des Pfarrers flüsternd. Der Rundgang durch das Freilichtmuseum sei wohl doch zu anstrengend für sie gewesen.
Doch Schmitze Billa schlief nicht.
Schmitze Billa war tot.
3. Kapitel
Böhnke drängte zur Eile. »Komm endlich in die Puschen!«
Wer wusste, wie lange dieses Schauspiel noch dauern würde? Aber Lieselotte Kleinereich ließ sich Zeit, nach seiner Meinung viel zu viel Zeit.
»Commissario, nun hetz nicht so«, konterte seine Liebste die Nörgelei, »da fließt noch viel Wasser runter.«
Es zog ihn an den Rursee, an den zweitgrößten Stausee Deutschlands. Bei seinen Spaziergängen rund um Huppenbroich konnte er bisweilen einen Blick auf die Wasserfläche erhaschen, die einen großen Bereich der früheren Täler bedeckt, durch die die junge Rur auf dem Weg von ihren diversen Quellen im Hohen Venn zur Mündung in die Maas in Roermond floss.
Momentan gab es ein Schauspiel, das nur selten zu beobachten war. Nach dem schneereichen Winter und den fast ununterbrochenen Regenfällen der letzten Wochen hatte die Talsperre die Grenze ihrer Kapazität erreicht. Sie war, wie es ein Nachbar von Böhnke bei einem Plausch an der Theke der Gaststätte »Zur alten Post« formuliert hatte, bis zum Stehkragen voll; mehr noch, es lief derzeit mehr Wasser in die Talsperre als in die Rur abfloss. Gewaltige Wassermassen schossen derzeit am großen Überlauf an der breiten Staumauer in die Tiefe. Üblicherweise war der Überlauf nicht vonnöten, konnten Zufluss und Ablauf über Schleusen und Ventile gesteuert werden. Doch momentan gab es zu viel Wasser für die ausgeklügelte Technik und nur der Überlauf verhinderte Schlimmeres. Er lieferte ein gigantisches Spektakel aus tosendem Wasser, aufschäumender Gischt, in deren Wasserschleier sich Regenbögen bildeten.
Böhnke wollte unbedingt zur Staumauer, sich direkt oberhalb des Überlaufs über das Geländer lehnen, um sich das ungezügelte Spiel und die unbändige Kraft des Wassers noch einmal anzuschauen. Vor etlichen Jahren hatte es das ungewöhnliche Ereignis zum letzten Mal gegeben, ob er das nächste noch miterleben würde, war in Anbetracht seiner schweren Erkrankung ungewiss.
»Mach hinne!«, raunzte er Lieselotte an, die sich zum wiederholten Male vor dem Spiegel das kurz geschnittene, graue Haar zupfte.
»Commissario, ich bin nicht auf der Flucht«, meinte sie und gab ihm einen satten Kuss mitten auf den Mund, der ihn sofort wieder versöhnte.
Sie waren dem Rat der Zeitung gefolgt und hatten darauf verzichtet, bereits am Wochenende zum Rursee zu fahren. Dort hatte, wie sie am Montag lesen konnten, ein mächtiges Verkehrschaos geherrscht, weil noch mehr Touristen als gewöhnlich in die Nordeifel gekommen waren, um das seltene und spektakuläre Wasserereignis hautnah mitzuerleben. Lieselotte hatte deswegen und ihm zu Liebe ihren Wochenendaufenthalt in der Wohnung in Huppenbroich um einen Tag verlängert. Sie würde erst am Abend nach Aachen fahren, um in ihrer Apotheke den Nachtdienst zu übernehmen.
»Ich kann dich doch nicht alleine an den See lassen. Wer weiß, was du wieder anstellst ohne mich?«, hatte sie schmunzelnd gesagt.
Die Entscheidung für den Abstecher an den Rursee an einem Montag war die richtige gewesen. Als Ausflug konnten sie die Tour nicht betrachten, theoretisch hätten sie sogar zu Fuß dorthin gehen können. Danach war ihnen jedoch beide nicht zu Mute. Sie würden es sich gemütlich machen, am Überlauf das Spektakel beobachten, in einem Restaurant zu Mittag essen, am Nachmittag vielleicht eine Bootstour unternehmen und am späten Nachmittag gemütlich nach Huppenbroich zurückkehren.
»Was sollen wir auch sonst tun, als das, was alle Touristen am Rursee tun?«, hatte Lieselotte seinen Plan kommentiert, als sie schwungvoll in ihrem Polo von der Einfahrt auf die Kapellenstraße fuhr. »Oder willst du es wie Schmitze Billa machen und nicht mehr zurückkommen? Dann wäre ich aber echt sauer auf dich.«
Vor der Staumauer fanden sie auf dem bewachten Parkplatz einen Abstellplatz für Lieselottes Fahrzeug. Böhnkes Knurren wegen der aus seiner Sicht unverschämt hohen Parkgebühr nahm sie nicht zur Kenntnis. Wenn es nach ihm gegangen wäre, würden sie so lange durch die Gegend fahren, bis sie irgendwo vor einem Sportplatz oder an einem Friedhof kostenlos hätten parken können. Am liebsten hätte er sogar am Rand der Straße, die über die Staumauer führte, den Wagen geparkt, aber dort herrschte absolutes Halteverbot.
»Nun komm schon, alter Mann!«, drängelte sie, als er schwerfällig aus dem Beifahrersitz kletterte. Es wurde höchste Zeit, dass Lieselotte sich ein anderes Fahrzeug anschaffte; eines, in dem er nicht so tief saß, brummte er vor sich hin. Aber sie ignorierte seine Lamentiererei, ihr reichte der Kleinwagen.
Langsam gingen sie über die breite Staumauer, rechts breitete sich der aufgestaute See aus, in den sich an der linken Seite eine dichtbewaldete Landzunge hineinstreckte. Direkt vor ihnen lag dort hinter einigen flachen Gebäuden die Anlegestelle der »Weißen Flotte«, die mit ihren Schiffen die Touristen zu Rundfahrten oder zu anderen Orten über den See beförderte. Links, hinter dem Randstreifen und der Fahrbahn, auf der anderen Seite der Staumauer, fiel der Blick ins Grüne, ins Rurtal, durch das der Fluss seinen Weg fand bis zur nächsten Staustufe in Obermaubach. Dort wälzte sich das Wasser ebenfalls über die Absperrung, aber bei Weitem nicht so spektakulär wie hier am Überlauf in Schwammenauel.
Es waren nicht viele Menschen unterwegs, nur wenige Autos fuhren über die Straße auf der Staumauer, die an Wochenenden oft für Motorradfahrer zur großen Herausforderung wurde, wenn sie mit überhöhter Geschwindigkeit darüberrasten, um am hinteren Ende der Staumauer in einer scharfen Linkskurve davonzupreschen, ohne genau zu wissen, wie es dahinter weiterging.
Es gab nahezu keine störenden Geräusche, nur das Donnern der herabstürzenden Wassermassen war mehr und mehr zu vernehmen, je näher sie dem Oberlauf kamen. Oberhalb des Überlaufs sammelte sich die Gischt zu einem dünnen Nebelschleier, in dem sich die Sonnenstrahlen brachen. Einige Schaulustige kamen ihnen auf dem Gehweg entgegen, vor sich sahen sie die Menschen am Geländer stehen und in die Tiefe schauen.
Vorsichtig näherte sich Böhnke dem viereckigen Überlauf, der Lärm wurde ohrenbetäubend, das aufspritzende Wasser benässte das Gesicht und die Kleidung. Es war schon erstaunlich. Gleichförmig glatt, flach und ruhig lag die Wasseroberfläche des Stausees da, geradezu friedlich, nur durch eine Tonnenkette war rund um den Überlauf großräumig ein Bereich abgesperrt. Segelboote oder Paddler wurden auf großformatigen Hinweisschildern frühzeitig vor der Lebensgefahr gewarnt und aufgehalten, eigentlich überflüssig, war doch der Wassersport wegen des Hochwassers untersagt worden. Der Anlegeplatz für Segelboote in unmittelbarer Stelle hinter dem Überlauf war vorsorglich geräumt worden. Wer einmal in den Sog des zum Überlauf fließenden Wassers geriet, der würde unweigerlich mitgerissen.
Die ruhige Oberfläche des Sees war trügerisch, unvermittelt stürzte das Wasser an den zwei dem See zugewandten Seiten metertief in den Betontrog. Der Boden des meistens trockenen oder nur leicht befeuchteten Beckens war nicht einmal zu erahnen, die tosende Masse verwandelte sich in tanzenden Schaum. Es hätte Böhnke gereizt, über die Stege zu gehen, die sich über den beiden Seeseiten des viereckigen Überlaufs befanden. Sie waren nicht nur durch stabile Gittertüren versperrt, davor stand auch noch ein Wachmann, an dem kein Vorbeikommen sein würde.
»Wenn du da reinfällst, hast du es hinter dir«, sagte Lieselotte ehrfürchtig. Sie hatte sich an die Brüstung geklammert und schaute in den brodelnden Überlauf.
»Eine spektakuläre Art, um Selbstmord zu begehen«, murmelte Böhnke, der sich im Gegensatz zu den meisten, ängstlich wirkenden Schaulustigen über das Geländer gebeugt hatte. Er hatte mehr zu sich gesprochen als zu Lieselotte, aber sie hatte ihn trotz der lauten Umgebung verstanden.
»So, wie der da.« Mit einem leichten Kopfdrehen deutete sie auf einen Mann, der wenige Meter von ihnen entfernt an der der Straße zugewandten Seite des Überlaufs an der Absperrung lehnte. »Der sieht so aus, als wolle er sich in die Tiefe stürzen.«
Sie hatte kaum geendet, als der Mann tatsächlich ansetzte, ein Bein auf die Brüstung zu schwingen. Mit einer Behändigkeit, die Lieselotte ihm kaum zugetraut hatte, war Böhnke auf den Mann zugesprungen und hatte ihn an den Schultern gepackt. Ehe dieser sich versah, lag er auf dem Gehweg, und Böhnke kniete auf dessen Brust.
»Commissario, ich bewundere dich«, sagte Lieselotte anerkennend, als sie an seine Seite getreten war.
Böhnke achtete nicht auf sie. Er hatte gehandelt, wie er es in seiner Zeit im Polizeidienst gelernt hatte; die richtigen Griffe zum richtigen Zeitpunkt brachten den Erfolg. Er wunderte sich allenfalls, dass er trotz seines Ruhestands noch über derartige Reflexe verfügt. Stumm und wegen der Anspannung ein wenig außer Atem, betrachtete er den von ihm fixierten Mann.
Der verhinderte Selbstmörder wirkte wie ein normaler Durchschnittsbürger, vielleicht 50 Jahre alt, unauffälliges Gesicht, mit braunem, von einem leichten Grauschleier durchzogenen, kurz geschnittenen Haar, einfach und sauber gekleidet mit Jeans und aufgeknöpfter, heller Jacke, unter der ein blau-weiß kariertes Hemd zum Vorschein kam.
Böhnke scheuchte ein paar Neugierige fort, die sich um sie versammelt hatten. »Polizei, Notfall«, sagte er knapp mit strenger Stimme.
»Was sollte denn diese Nummer?«, schnauzte er den rücklings liegenden Mann an und lockerte den Druck seines Knies von dessen Brust. »Das Leben ist doch viel zu schön, um es in einem nassen Grab zu beenden.«
Der Mann schwieg, nahm aber dankbar Böhnkes Hilfe an, der ihm die Hand entgegenstreckte, um wieder auf die Beine zu kommen. Verlegen klopfte er sich ab, von Böhnke skeptisch beäugt. Das fehlte ihm zu seinem Glück, dass der Kerl sich jetzt mit einem schnellen Sprung über das Geländer doch noch in den Tod stürzte, auch wenn im Gesicht des Mannes nichts mehr dafür sprach.
»Ich kenne Sie doch, Herr …«, Lieselotte beendete die Stille. Sie musterte den Mann genau. »Sie waren doch schon mal in meiner Apotheke.« Nachdenklich kniff sie die Augen zusammen. »Das war doch wegen eines Rezepts für ein Antidepressivum, stimmt’s?« Der Mann wollte etwas sagen, doch Lieselotte bremste ihn mit einer strengen Handbewegung. »Momentchen, wenn ich mich richtig erinnere, ist Ihr Hausarzt Doktor Schwindmann. Richtig?« Wissend lächelnd schaute sie den Mann an, der bestätigend nickte.
»Und Ihr Name ist …«
»Frosch«, sagte der Mann leise. »Ich bin Walter Frosch.«
»Schön«, brummte Böhnke, der Lieselotte ausbremste, die zu einer Entgegnung ansetzen wollte. »Und warum wollten Sie ins Wasser?« Eine Bemerkung wegen des Namens Frosch im Zusammenhang mit Wasser verkniff er sich.
»Das ist eine lange Geschichte«, erhielt er als Antwort, und er wusste in diesem Moment, dass die akute Gefahr vorüber war. Der Mann würde wenigstens in ihrer Gegenwart nicht mehr ins Wasser springen.
»Dann erzählen Sie mal«, forderte er Frosch auf. »Ich habe viel Zeit.«
Der Mann starrte ihn verstört mit verkniffenen Lippen an. Er schluckte mehrmals und schüttelte dann den Kopf.
»Ich habe Hunger«, mischte sich die Apothekerin ein, bevor das Gespräch vollends verstummte. »Darf ich Sie zu einem Mittagessen einladen, Herr Frosch?« Strahlend sah sie ihn an.
»Gerne«, antwortete Frosch unsicher. Er bückte sich, um einen gelösten Schnürsenkel zu binden.
»Du kennst seinen Namen?«, flüsterte Böhnke seiner Liebsten zu.
»Den kannte ich nicht. Ich weiß nur, welche Medikamente Schwindmann bei Depressionen seinen Patienten verschreibt. Er ist der Einzige, der dieses spezielle Medikament verwendet.« Sie grinste Böhnke schelmisch an. »Und ein wenig habe ich von den Verhörmethoden der Polizei mitbekommen, Commissario. Ich habe viel von dir gelernt.«
4. Kapitel
Lieselotte und Böhnke nahmen Frosch in die Mitte, der schweigend mit ihnen ging. Aber er wirkte erleichtert, so kam es jedenfalls Böhnke vor. Das Trio steuerte zunächst erfolglos das Café-Restaurant am Pegel auf der Staumauer an. Fast sämtliche Plätze waren besetzt. Außerdem wollte sich Böhnke nicht wie auf dem Präsentierteller mit dem verhinderten Selbstmörder in der Öffentlichkeit zeigen. Mehr Glück hatten sie im Seehof. An der Selbstbedienungstheke des Hotelrestaurants deckten sie sich mit Speisen und Getränken ein. Böhnke, der sich wie seine Begleiter mit paniertem Schnitzel und Kartoffelsalat zufrieden gegeben hatte, suchte auf der windgeschützten Terrasse mit Blick auf das Wasser und die Bootsstege einen Tisch in einer nicht direkt einsehbaren Ecke. Es war besser, wenn Frosch ein wenig abgeschirmt wurde. Der Mann musste nicht zum Gesprächsthema werden, nur weil er von anderen Gästen als möglicher Selbstmörder wiedererkannt wurde. Er hatte es selbst schon miterlebt, dass eine Frau, die er vor einem Selbstmord bewahrt hatte, von widerlichen Schaulustigen als Feigling bezeichnet wurde und sie tags drauf von einem anderen Dach doch noch in den Tod gesprungen war.
»Man beendet sein Leben nicht ohne Grund freiwillig«, sagte Böhnke bedächtig, nachdem sie die Tabletts abgestellt und es sich bequem gemacht hatten.
Frosch betrachtete verlegen den Senior, den er nicht einschätzen konnte. Ehe er seinen eigenen Entschluss bereuen konnte, hatte ihn der Alte ins Leben zurückgerissen. Und insgeheim war er froh, dass der Fremde es getan hatte.
»Wer sind Sie?«, fragte er leise den nach seiner Schätzung ungefähr 60-Jährigen mit der grauen Kurzhaarfrisur und dem leicht angebräunten Gesicht. Frosch schloss daraus richtigerweise, dass sich der Mann häufig in der Natur aufhielt. Und was machte die Apothekerin, die ihn begleitete?
»Ich bin Rudolf-Günther Böhnke«, stellte sich der Gefragte vor, »Kriminalhauptkommissar im Ruhestand.« Er lächelte Frosch an. »Sie brauchen also nicht zu befürchten, dass ich Sie dingfest mache oder Ihren Selbstmordversuch melde. Ich bin Privatier, wenn Sie so wollen.« Böhnke deutete auf seine durchaus attraktive Begleiterin. »Die Frau an meiner Seite ist Lieselotte Kleinereich. Aber Sie kennen sie ja aus Aachen als Ihre Apothekerin.«
Kennen sei zu viel gesagt, bemerkte Frosch bescheiden. Er sei gerade zweimal mit einem Rezept bei ihr gewesen.
»Aber ich habe Sie sofort erkannt.« Lieselotte lächelte ihn gewinnend an. »Sie sind ja fast schon ein Stammkunde, den ich nicht verlieren möchte.«
»Keine Sorge.« Frosch hatte sich gesammelt. Er grinste verlegen. »Ich bleibe Ihnen treu.«
»Aber zunächst erzählen Sie mir, warum Sie das tun wollten«, hakte sie nach.
Frosch schwieg. Nicht, weil er sich nicht traute, sondern weil er wartete, bis er endlich seinen Bissen geschluckt und an seinem Mineralwasser genippt hatte.
»Also, das ist eine lange Geschichte«, meinte er tief durchatmend.
Das wisse er bereits, wollte Böhnke mäkeln, aber er hielt sich mit seiner Bemerkung zurück, als er Lieselottes mahnenden Blick erkannte.
»Die Geschichte fing vor mehr als einem Jahr an, genauer gesagt, im März des vergangenen Jahres. Ich hatte von Walheim aus – ich wohne dort – mit meinem Hund einen Spaziergang gemacht und bin durch die Höckerlinie des Westwalls gelaufen. Die kennen Sie ja bestimmt.«
Böhnke und Lieselotte nickten synchron zur Bestätigung. Selbstverständlich kannten sie den Westwall mit seinen mächtigen Betonklötzen, beziehungsweise kannten sie die Reste der militärischen Anlage aus dem Nazi-Deutschland, mit der im Zweiten Weltkrieg Panzer der westlichen Alliierten aufgehalten und sogar gestoppt werden sollten. Nach dem Krieg hatte die Bundesrepublik aus Kostengründen darauf verzichtet, die gewaltige Linie aus dreireihig versetzt angeordneten Stahlbetonhöckern, die wie gewaltige Zähne aus dem Boden wuchsen, zu entfernen. Lediglich einige Bunker entlang des Westwalls waren gesprengt worden. Nunmehr zog sich die Höckerlinie vom Norden der Stadt Aachen bis in die Eifel, ihrem Schicksal überlassen, überwucherte teilweise oder fristete hier und da ein Dasein mitten auf einer Kuhweide. Selbst in Huppenbroich auf der Straße aus dem Tiefenbachtal in Richtung Simmerath lugte ein Betonzahn aus dem Grün am Randstreifen.
»Ich laufe also mit meinem Hund quer durch den ehemaligen Westwall in Richtung Himmelsleiter, als mir ein großer Metallkasten auffiel. Eigentlich war es Justus, dem etwas Ungewöhnliches aufgefallen war. In der Nähe eines Feldweges rannte er plötzlich kläffend zwischen die Höcker. Ich bin dem Viech gefolgt und auf den Kasten gestoßen. Als ich genauer hingesehen habe, konnte ich erkennen, dass es sich um einen geöffneten Tresor handelt. Wie lange er dort gelegen hat, weiß ich nicht. Ich habe sofort mit meinem Handy die Polizei angerufen.«
»Warum?«, platzte Böhnke heraus.
Frosch ließ sich Zeit. Er schnitt sich ein Stück Fleisch ab und kaute daran herum. »Ich dachte, dass es ungewöhnlich ist, dass mitten in der Landschaft ein Tresor liegt und hatte an ein Verbrechen geglaubt, einen Raub oder so«, antwortete er schluckend. »Das liegt doch wohl auf der Hand. Oder?«