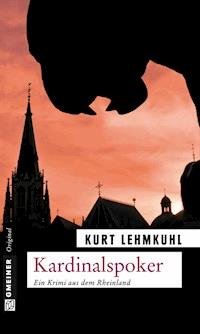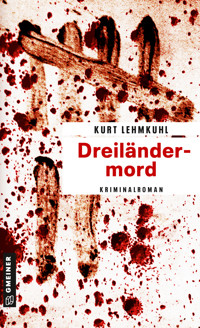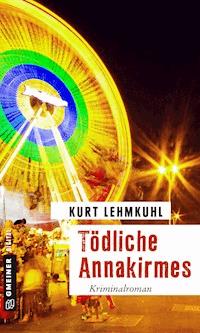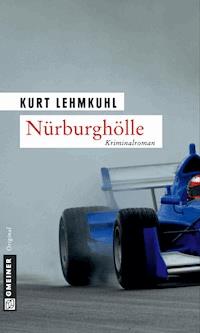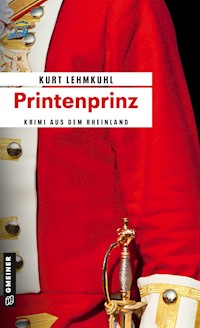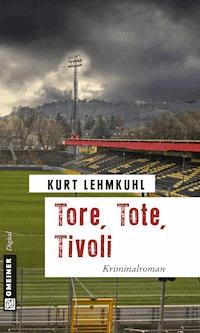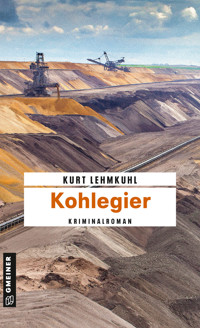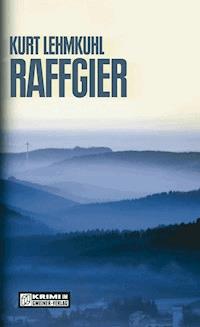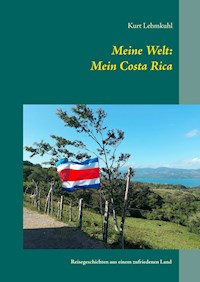Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Böhnke und Rechtsanwalt Grundler
- Sprache: Deutsch
Vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland: Ein deutsches Fußballtalent verliert bei einem Unfall einen Fuß, ein anderer Kicker soll seinen Trainer ermordet haben. Obendrein wird der pensionierte Kommissar Rudolf-Günther Böhnke von einem Journalisten um Hilfe gebeten. Dem wollen Unbekannte ans Leder, weil er mit Hilfe von Sponsoren einen neuen Fußballverein in Aachen etablieren will. Böhnke ermittelt in drei Fällen gleichzeitig. Sein Blick hinter die Kulissen lässt ihn zweifeln, ob Fußball tatsächlich Sport ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lehmkuhl
Marionettenspiel
Fußballkrimi
Zum Buch
Tore sind Nebensache Ein Fußballtalent hadert mit sich: Soll er bei der Weltmeisterschaft in Russland für die Heimat seiner Eltern, Russland, oder für seine neue Heimat Deutschland spielen? Ein weiterer Kicker soll seinen Trainer ermordet haben. Böhnke wird genötigt, in beiden Fällen zu ermitteln. Außerdem bittet ihn ein Journalist um Hilfe, auf den eine Treibjagd begann, als bekannt wurde, dass er in Aachen mit Hilfe eines Mäzens einen neuen Fußballverein etablieren will. Was eindeutig scheint, wird im Laufe von Böhnkes Ermittlungen zwischen Wett-Mafia und Berater-Krieg zweifelhaft. Schnell befindet er sich in einem Spiel, in dem, wie beim Fußball, nicht immer derjenige siegt, der sich an die Spielregeln hält. Fouls und Tricks sind an der Tagesordnung, und nach dem Abpfiff bleibt Böhnke die Erkenntnis, dass in einem Spiel Siege nachrangig sind, dass der Einzelne nichts und der wirtschaftliche Erfolg alles ist, und dass in einem Spiel kein Platz für Freunde ist.
Kurt Lehmkuhl wurde 1952, an einem Sonntag, in der Nähe von Aachen geboren. Er war mehr als 30 Jahre als Redakteur im Zeitungsverlag Aachen tätig. Aufgrund seines Jurastudiums in Bonn beschäftigte sich der Autor ausgiebig mit dem Strafrecht, was ihn zu seinen Kriminalromanen inspirierte. Diese waren zunächst nur als Geschenke für Freunde gedacht. Zur ersten Veröffentlichung kam es 1996.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Weißgott (2017)
Mörderisches Aachen (2017)
Kofferjäger (E-Book Only, 2016)
Mallorquinische Träume
(E-Book Only, 2016)
Tödliches Roulette
(E-Book Only, 2016)
Vertrauen bis in den Tod
(E-Book Only, 2016)
Spritzen für die Ewigkeit
(E-Book Only, 2016)
Aachener Grenzgänger
(E-Book Only, 2016)
Die Aachen-Mallorca-Connection (E-Book Only, 2016)
Ein CHIO ohne Rasputin (E-Book Only, 2016)
Tödliche Annakirmes
(E-Book Only, 2016)
Tödliche Recherche
(E-Book Only, 2016)
Kohlegier (2016)
Blut klebt am Karlspreis
(E-Book Only, 2015)
Ein Sarg für Lennet Kann (E-Book Only, 2015)
Mörderische Kaiser-Route (E-Book Only, 2015)
Fundsachen (2015)
Tore, Tote, Tivoli (E-Book Only, 2014)
Begaben in Garzweiler II
(E-Book Only, 2013)
Printenprinz (2013)
Kardinalspoker (2012)
Dreiländermord (2010)
Nürburghölle (2009)
Raffgier (2008)
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © meineresterampe/pixabay.com
ISBN 978-3-8392-5644-2
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Kapitel
Sein Blick blieb unweigerlich an der Überschrift kleben: ›Fußball-Deutschland in Schockstarre!‹, so hatte die Tageszeitung in großen Lettern und alle anderen Themen verdrängend getitelt.
»Na und? Was soll das?«, nörgelte der ergraute Zeitungsleser. »Das kann doch wohl nicht das wichtigste Thema sein. Gibt es nicht Bedeutsameres auf der Welt als dieser unsägliche Fußball?«, fragte er seine Nachbarin am Frühstückstisch. »Das Käseblatt ist das Abo nicht wert«, sagte er und warf die Zeitung ungehalten auf die Platte. »Die sollten sich lieber um das abgewrackte AKW in Tihange oder die Braunkohlendreckschleuder im Kraftwerk Weisweiler kümmern. Diese Katastrophen bedrohen unsere Leben und wären ein Grund für eine Schockstarre, aber doch nicht irgendein Unfug aus dem Fußball.« Es interessierte ihn nicht die Bohne, welcher Kicker wo, warum und wie oft gegen den Ball trat oder welcher angebliche Star zu welchem Verein wechseln wollte.
»Commissario, ist dir etwa lieber, wenn die schreiben würden: ›Böhnke lebt‹?«, erwiderte die Frau lächelnd.
Bloß nicht. Er war froh, wenn man ihn in Ruhe ließ. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn man sich nicht an ihn erinnern würde. Aber er wusste, dass das ein Wunschtraum bleiben würde.
Die Frau schnappte sich das Blatt und stutzte, nachdem sie den Bericht auf der Aufschlagseite mit wachsender Aufmerksamkeit gelesen hatte. »Das ist ja Sascha.« Sie schluckte schwer. »Der arme Junge.«
»Ist der tot, oder was?«
»Im Prinzip ist er tot, obwohl er lebt.«
»Und was hat das mit der Schockstarre von Fußball-Deutschland zu tun?« Woher seine Lebensgefährtin diesen Sascha kannte, warum er tot war, obwohl er lebte, und weshalb sich deshalb Fußball-Deutschland in Schockstarre befand, würde sie ihm erklären müssen, hoffentlich nicht langatmig und umständlich. Vermutlich waren Sascha oder seine Eltern Kunden in Lieselottes Apotheke in Aachen.
»Später, mein Lieber.« Die Frau war aufgesprungen. »Heute Abend. Ich muss los.« Sie drückte ihm einen feuchten Kuss auf die Stirn. »Und denk dran, heute Abend lassen wir es uns gut gehen.« Die Melodie des Gefangenenchores aus der Verdi-Oper Nabucco summend, verschwand sie frohgelaunt aus seinem Blickfeld.
Böhnke sah seiner Liebsten wohlwollend nach. Er war froh, dass er Lieselotte Kleinereich hatte. Vor einem knappen Jahr noch hatte der vorzeitig pensionierte Erste Kriminalhauptkommissar befürchtet, dass ihr und auch sein Leben beendet waren. Er hatte die von Schüssen getroffene, schwer blutende, langsam vor sich hin sterbende Frau in ihrem Haus zurücklassen müssen und war dann selbst in seiner Verzweiflung und Ohnmacht bewusst mit dem Kleinwagen gegen einen Betonklotz gerast, um Lieselottes vermeintlichen Mörder umzubringen und dabei willentlich in Kauf zu nehmen, dass damit auch sein Leben beendet sein würde.
Es grenzte für ihn an ein Wunder, dass sie beide noch lebten, Lieselotte vollkommen genesen war und wieder ihre Apotheke leitete und er selbst den Kampf gegen seine schweren Unfallverletzungen gewonnen hatte. Doch er blickte nicht mehr zurück. Dazu hatte ihn Lieselotte gebracht. »Nach vorne geht es mit uns. Wir haben noch viel zu tun. Lass uns das Leben genießen«, hatte sie ihm während ihrer monatelangen Genesungsphase immer wieder eingetrichtert, wenn er zweifelte und mit dem Schicksal haderte.
Zu ihrer Art, das Leben zu genießen, gehörte zweifelsohne der Besuch kultureller Veranstaltungen, verbunden mit der Begegnung anderer Menschen; so wie es am Abend vorgesehen war, wenn er Lieselotte zur Monschauer Burg begleiten würde, auf der im Rahmen der Monschau Klassik Nabucco aufgeführt werden sollte. Böhnke selbst liebte es eher geruhsam: Den Spaziergang durch die Natur und das Leben in einem Dorf zog er der Geselligkeit und dem Gewusel der Großstadt vor. Davon hatte er genug miterlebt in seiner Zeit als Leiter der Abteilung für Tötungsdelikte im Polizeipräsidium Aachen. Nach seiner vorzeitigen Pensionierung aus Krankheitsgründen hatte sich der Kommissar in die Stille der Nordeifel zurückgezogen und wohnte in dem Haus in Huppenbroich, in dem Lieselotte und er ihren gemeinsamen Lebensabend verbringen wollten. Seine Hoffnung, in der dörflichen Idylle von Mord und Totschlag verschont zu bleiben, hatte sich nicht erfüllt. Das Verbrechen war ihm auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand treu geblieben.
Nicht von einem Verbrechen, sondern von einem Unfall schrieb die Tageszeitung in ihrem Bericht, demzufolge Fußball-Deutschland in Schockstarre verfallen war. Alexander »Sascha« Strohkämper, das laut Zeitung größte Talent im Fußballsport und der Hoffnungsträger schlechthin bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, hatte sich schwer verletzt, las Böhnke. Er hatte den unbeliebten Hausputz ebenso hinter sich gebracht wie den allmorgendlichen Spaziergang durch den Ort und saß nun in der Küche, eine Tasse dampfenden Tee vor sich und die Zeitung in der Hand. So richtig schlau wurde er aus der Berichterstattung nicht. Der Journalist schrieb zwar häufiger von einem Unfall, durch den das Supertalent Sascha, den er im weiteren Verlauf seines Artikels als deutschen Messi, als Nachfolger von Super-Mario Götze oder als Borussen-Maradonna bezeichnete, zu Schaden gekommen war, aber er behielt für sich, worin der Unfall bestand und wie es dazu gekommen war. Er hielt sich mehr an den dramatischen Folgen auf: Sascha würde nie wieder Fußball spielen können, sein rechter Unterschenkel hatte amputiert werden müssen. ›Die vielversprechende Karriere ist beendet, bevor sie überhaupt erst richtig ins Rollen gekommen ist‹, bedauerte der Journalist. Der Verlust dieses gerade einmal 18-jährigen Ausnahmespielers wiege schwer. Dadurch würden die Chancen der deutschen Fußballnationalmannschaft erheblich schwinden, den Weltmeistertitel zu verteidigen. Selbst der Bundestrainer kam zu Wort: ›Ich bin schockiert. Sascha ist nicht zu ersetzen.‹ Zur weiteren Berichterstattung verwies die Zeitung auf den Innenteil. Dort würde es weitere Einzelheiten zu dieser sportlichen Tragödie geben.
Aha, dachte sich Böhnke, während er in der Zeitung blätterte, weil der Bundestrainer der deutschen Kicker schockiert ist, befindet sich ganz Fußball-Deutschland in Schockstarre.
Eine Frage, die er Lieselotte hatte stellen wollen, hatte sich jedenfalls erledigt. Es war auch ihm klar, dass ein junger Mann ohne Unterschenkel als Profifußballer tot war, selbst wenn er noch lebte. Und die Frage nach der Schockstarre war im Prinzip überflüssig, denn sie änderte nichts daran, dass Sascha sein Schicksal selbst tragen musste. Da ging es dem Fußballer nicht anders als ihm. Auch Böhnke musste mit seinem gesundheitlichen Schicksal zurechtkommen. Der Sensenmann konnte ihn wegen seiner Krankheit jederzeit holen, heute, morgen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, irgendwann – aber garantiert einmal.
Strohkämper befinde sich auf der Intensivstation des Aachener Klinikums. Er sei in ein künstliches Koma versetzt worden und nicht ansprechbar. Böhnke zweifelte fast am Verstand des Autors, als er diesen Satz las. Der Fußballer sei mit seinem Rennrad neben einem Radweg im Meinweg-Gebiet des Naturparks Maas-Schwalm-Nette von einem Spaziergänger gefunden worden, schrieb die Zeitung. Der Mann habe sofort einen Rettungswagen alarmiert, dann aber fast eine Stunde auf Hilfe warten müssen. Offenbar, so entrüstete sich der Journalist in seinem Artikel, hätten sich deutsche und niederländische Rettungsdienste nicht über die Zuständigkeit für einen Einsatz einigen können. ›Vielleicht tragen sie deshalb eine Mitschuld am Gesundheitszustand von Sascha. Vielleicht hätte sein Bein gerettet werden können, hätten sich die Helfer schneller geeinigt‹, mutmaßte der Schreiberling.
Hätte, hätte, Fahrradkette, zitierte Böhnke lakonisch für sich einen Ausspruch, den er einem ehemaligen Bundespolitiker zuordnete, ohne zu wissen, ob er tatsächlich von ihm stammte. Nach der notärztlichen Versorgung sei Strohkämper mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Aachen geflogen worden. »Alle ärztliche Kunst war vergebens, der Unterschenkel musste entfernt werden.«
Immerhin war er etwas schlauer geworden, dachte sich Böhnke. Wenn er die Fakten herausfilterte, schien es, als sei der Fußballer unbegleitet auf einem Rennrad unterwegs gewesen und habe dabei einen Unfall erlitten. Eine Frage blieb, die ihn mehr interessierte als die Umstände des Unfalls und das Leid des jungen Mannes: Woher kannte Lieselotte ihn?
Die Zeitung würde ihm bei der Suche nach einer Antwort nicht weiterhelfen, glaubte Böhnke. Oder doch? Er stieß auf einen weiteren, kleinen Artikel, einen Beisteller zu diesem großen Bericht, den er beinahe überlesen hätte.
Alexander Strohkämper, Sohn russlanddeutscher Übersiedler, hatte als Kind zunächst beim SV Vaalserquartier und danach beim SC 09 Erkelenz gekickt, war dann von der Alemannia aus Aachen als talentfrei abgelehnt worden und zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Dort hatte er vor der letztjährigen Saison einen Profivertrag unterzeichnet, der im nächsten Jahr, im Jahr der Fußballweltmeisterschaft, auslaufen würde. Endlich fiel es Böhnke ein: Lieselotte hatte vor etlichen Jahren eine nach Aachen übergesiedelte Russlanddeutsche als Reinigungskraft eingestellt. Die Frau hatte gekündigt, weil sie mit ihrer Familie umziehen wollte. Erkelenz war das Ziel gewesen, wie sich Böhnke glaubte zu erinnern, weil es in der Kleinstadt nahe Mönchengladbach eine größere Ansiedlung von Spätaussiedlern gab.
Er lehnte sich zufrieden zurück. Damit war auch diese Frage geklärt.
2. Kapitel
Sascha sei der Sohn von Ludmilla, und Ludmilla sei Reinigungskraft bei ihr gewesen, bestätigte Lieselotte schmunzelnd nach ihrer Rückkehr am Abend: »Ich habe mir gedacht, dass du den ganzen Tag darüber grübelst, woher ich den Jungen kenne. Er war ein kleines Kind, als Ludmilla ihn mit in die Apotheke brachte. Mehr weiß ich nicht über ihn.« Sie schubste Böhnke ins Schlafzimmer. »Jetzt ist genug mit Sascha und Ludmilla, jetzt bereiten wir uns auf Ismaele und Fenena vor, mein Lieber.«
»Ich denke, wir gehen zu Nabucco«, wandte Böhnke ein.
»Kunstbanause«, schalt ihn Lieselotte liebevoll und reichte ihm Anzug, Hemd und Krawatte, die sie aus dem Kleiderschrank geholt hatte. »Zieh dich mal vernünftig an. Wie du jetzt gekleidet bist, nehme ich dich nicht mit auf die Burg.«
Böhnke hatte an seiner Kleidung nichts auszusetzen. Er fand, seine Jeans und das karierte Flanellhemd standen ihm gut. Sie waren bequem, robust, alltäglich und passten zum ländlichen Huppenbroich. Aber er kam Lieselottes Wunsch bereitwillig nach.
Sie musterte ihn wohlwollend, als er in angemessener Kleidung vor ihr stand. »Wer sagt’s denn? Du bist mit deinen kurzen, grauen Haaren ein richtig attraktiver Mann, wenn du die passenden Klamotten anziehst.«
»Ich bin ein alter, kranker Mann, der in Ruhe die Restzeit seines Lebens genießen will«, widersprach Böhnke des Widersprechens willens.
»Und ich bin eine alte Schachtel, was?« Lieselotte lachte ihn an. »Außerdem, wer in die Oper will, kann sich nicht kleiden wie ein Waldarbeiter auf dem Weg zum Holzfällen.«
»Du bist schön«, entgegnete Böhnke. Niemand sah Lieselotte die schwere, inzwischen überstandene Verletzung und ihr Alter an. Die große, schlanke Frau mit den mittellangen, braungefärbten Haaren in dem schicken Hosenanzug ging für Anfang 50 durch, obwohl sie die 60 bald erreichen würde. Die Frisur war die einzige Veränderung, die sie nach dem dramatischen Geschehen vor einem Jahr an sich vorgenommen hatte. Die graue Kurzhaarfrisur hatte einer neuen Haarpracht weichen müssen. Jetzt erinnerte sie Böhnke noch mehr an die Zeit ihres Kennenlernens vor mehr als drei Jahrzehnten.
»Na dann, auf in den Kampf«, sagte er entschlossen, als sie festlich gekleidet zum Auto strebten.
»Du bist in der falschen Oper«, mahnte Lieselotte milde. »Heute wird Nabucco aufgeführt, nicht Carmen.«
Ob bei dem Musikgenuss von Monschau Klassik oder von Monschau Festival die Rede war, war Böhnke ziemlich schnuppe. Er hatte einen vergnüglichen Abend auf der Burg erlebt mit einer Opernaufführung, die Appetit auf mehr machte. Selbst das Wetter hatte mitgespielt. Es gab einen lauen Augustabend, und er brauchte nicht, wie er es schon auf der steilen Stahlrohrtribüne vor der Freilichtbühne mitgemacht hatte, vor Kälte zu zittern und zu bibbern, weil sich mit dem Verschwinden der Sonne die Wärme verflüchtigt hatte und die Kälte aus dem schattigen Rurtal hinauf zur Burg kroch. Alles war gut gewesen. Nabucco war seine Lieblingsoper von Verdi geworden, nachdem er im Schlepptau von Lieselotte mehrere Aufführungen von Verdi-Opern in Aachen, Lüttich, Maastricht und Köln miterleben durfte. Vielleicht lag es daran, dass es am Ende gut ausging und nicht wie bei Rigoletto oder Aida das Sterben beklagt werden musste.
Lieselottes gute Laune hatte ihn angesteckt. Er hatte bereitwillig ihrem Vorschlag zugestimmt, sich unten im Städtchen ein Glas Wein zu genehmigen, zumal sie ohnehin mit dem Shuttlebus vom Berg hinab ins Tal zum Parkhaus an der Seidenfabrik fahren mussten. Sie waren an der Rur entlang in den Stadtkern geschlendert und hatten sich auf dem von Fachwerkfassaden geschmückten Marktplatz vor einem Restaurant niedergelassen. Erstaunlicherweise war es trotz der Wassernähe und des späten Abends mild, ein seltenes Ereignis im dicht bebauten Tal, in dem die Sonnenstrahlen etwas später kamen und früher verschwanden. Viele Menschen hatten die Gunst der Stunde genutzt und genossen frohgelaunt den Moment.
Es war bereits weit nach 23 Uhr, als Lieselotte zum Aufbruch bat. Die Apotheke verlangte ihr rechtzeitiges Erscheinen. Die ersten Kunden warteten meistens schon vor der regulären Öffnungszeit. »Der Schlaf vor Mitternacht ist der beste, und ich brauche meinen Schönheitsschlaf«, hatte sie gesagt und sich bei Böhnke auf dem Weg zum Parkplatz eingehakt.
Ihre Hochstimmung hielt an, als er aus dem Talkessel hinaus nach Imgenbroich auf der Höhe und von dort in Richtung Simmerath fuhr. Gemeinsam summten sie die Melodie des Gefangenenchores. Nichts konnte ihre gute Laune trüben. Der neue Corsa hätte den Weg wahrscheinlich von selbst gefunden: an der Kreuzung Am Gericht nach rechts und dann nach ein paar hundert Metern nach links auf die schmale, unbeleuchtete Straße nach Huppenbroich. Am wolkenlosen Himmel strahlten die Sterne, der Vollmond sorgte für Helligkeit. Für seine Verhältnisse forsch lenkte Böhnke den Kleinwagen über das schmale, dunkle Asphaltband. Nur noch ein paar Meter bis zum Ortseingang und dann nicht mehr weit bis zu ihrem Häuschen an der Kapellenstraße. Er freute sich schon auf sein Bett.
»Pass auf!« Lieselottes Schrei schreckte ihn auf. Er schmerzte geradewegs in den Ohren, so laut und schrill hatte er getönt. Böhnke trat voll in die Bremse, ohne im ersten Moment zu wissen, warum. Der angsterfüllte Schrei von Lieselotte hatte ihn dazu veranlasst. Erst danach wurde ihm der Grund dafür gewahr. Vor ihm taumelte eine dunkle Gestalt an der Beifahrerseite an der Straße entlang, mal ein wenig auf dem Grünstreifen, dann wieder mehr auf der Fahrbahn. Nicht einmal einen Meter vor dem Menschen brachte Böhnke den Wagen zum Stillstand. Fast zeitgleich brach der nächtliche Spuk auf zwei Beinen zusammen und blieb unmittelbar vor der Stoßstange liegen.
Warnblinkanlage einschalten, Zündung unterbrechen, Handbremse ziehen, mechanisch erledigte Böhnke die Handgriffe. Im Handschuhfach griff er nach der lichtstarken Taschenlampe, ehe er Lieselotte folgte.
Sie hatte sich neben einen zitternden und keuchenden jungen Mann gehockt. Der Schweiß floss ihm aus allen Poren, sein Trainingsanzug war schmutzig und durchnässt. Krauses Haar umgab das ausgemergelte Gesicht, in dem zwei große Augen vom Schein der Taschenlampe geblendet wurden. Der Mann war dunkel wie die Nacht, allem Anschein nach ein Schwarzafrikaner.
Ob es ihm gutgehe? Ob sie ihm helfen können?
Lieselottes Fragen blieben unbeantwortet. Der Mann verstand sie nicht.
»Was machen wir mit ihm?«, fragte Lieselotte. »Wir können ihn doch nicht hier liegen lassen.«
»Selbstverständlich nicht.« Böhnke betrachtete konzentriert den erschrockenen Mann, der sich auf der Erde zusammengekrümmt hatte und Worte wimmerte, die er nicht verstand. Augenscheinlich war der nicht einmal 20-Jährige unverletzt, seine Gliedmaßen waren nicht unnatürlich abgewinkelt, Blut war nicht geflossen. Der Mann war wahrscheinlich restlos am Ende seiner Kräfte.
»Wir könnten den Notarzt rufen«, schlug er vor.
»… und müssen dann stundenlang warten, bis jemand aus Aachen kommt«, fiel ihm Lieselotte ins Wort. »Du weißt doch, dass der Notdienst eine Katastrophe geworden ist. Darauf habe ich keinen Bock. Der junge Mann braucht keinen Arzt.«
»Okay. Dann informiere ich die Polizei. Die soll sich um ihn kümmern.«
»Non.« Der Dunkelhäutige hob abwehrend die Hände. Der Hinweis auf die Polizei hatte ihn aufschrecken lassen. Mühsam rappelte er sich auf. Er wollte tatsächlich weitergehen. Böhnke verstand nicht, was er sagte.
»Pas meurtrier«, stammelte der Mann, der fast noch ein Junge war, bevor er erneut zusammenbrach und auf den Grünstreifen stürzte. »Pas meurtrier.«
3. Kapitel
»Pas meurtrier. Pas meurtrier. Pas meurtrier.« Ununterbrochen stammelte der Mann die Worte vor sich hin.
Lieselotte und Böhnke hatten ihn in die Mitte genommen und schleppten ihn mehr, als sie ihn stützten, zu ihrem Haus.
»Pas meurtrier. Pas meurtrier.«
»Französisch«, sagte Lieselotte. »Der spricht Französisch.« Als sie den Mann auf Deutsch angesprochen hatte, hatte er nur mit dem Kopf geschüttelt.
»Pas comprends«, hatte er gestottert.
»Der versteht uns nicht«, hatte sie schnell erkannt. Die wenigen Brocken ihrer Französischkenntnisse reichten für die Übersetzung gerade noch aus. Wenn sich in ihre Apotheke Belgier verirrten, die kein Deutsch oder Flämisch, sondern nur Französisch sprachen, musste sie immer eine Kollegin hinzurufen. Doch hier war sie auf sich allein gestellt. Böhnke konnte Deutsch und ein wenig Englisch. Die französische Sprache, die war ihm zu kompliziert, ihm so wenig geheuer wie die Vorliebe der Franzosen für Austern, Gänsestopfleber oder Froschschenkel.
Kraftlos ließ sich der Mann ziehen. Es dauerte Minuten, bis sich sein Atem beruhigt hatte und er in einen Gleichschritt verfallen war. Er ließ seine beiden Retter gewähren, solange sie nicht die Polizei informierten.
Den Gedanken daran hatte Böhnke rasch verworfen. Seine ehemaligen Kollegen würden den jungen Mann einsacken, ins Krankenhaus einliefern und am nächsten Morgen die Ermittlungen aufnehmen. Und das erst, nachdem er und Lieselotte wahrscheinlich eine geschlagene Stunde auf die Ordnungshüter gewartet hätten. Da schien es ihm sinnvoll, den Mann mitzunehmen und am Morgen weiterzusehen. Es hätte viel Mühe bereitet, den Dunkelhäutigen in den Corsa zu hieven, da war es der einfachere Weg, mit ihm im Schlepptau zu Fuß zum Haus zu gehen. Den Wagen würde in dieser Einsamkeit niemand entwenden, wenn er eine Zeitlang unbeaufsichtigt am Straßenrand der wenig befahrenen Strecke abgestellt war. Vorsichtshalber ließ Böhnke die Warnblinkanlage aktiviert.
Die angebotene Wasserflasche hatte der Mann in einem Zuge geleert. Auch die zweite hatte nicht lange Bestand. Lieselotte hatte ihm Brote serviert, die er rasend schnell verschlang.
Böhnke hatte schweigend neben dem schlanken, sportlich wirkenden Jüngling gesessen und ihn beobachtet. Ihr Gast wirkte dankbar, er schien ihre Hilfsbereitschaft nicht für selbstverständlich anzusehen, sondern als Geschenk. Das »Merci« kam ihm mehrfach über die Lippen, was Lieselotte lächeln ließ.
Sie hatte Böhnke angeblickt und ihm flüsternd zu verstehen gegeben: »Das ist ein Guter. Der tut uns nichts.« Aus dem Gästezimmer hatte sie einen Bademantel und Handtücher geholt. Winkend forderte sie den Mann auf, ihr zum Bad zu folgen. Er könne duschen, signalisierte sie ihm mit verständlichen Gesten, und danach schlafen.
»Merci, merci«, stammelte der Mann, überwältigt von der Selbstverständlichkeit, mit der Lieselotte ihm half. »Pas meurtrier«, schob er hinterher, ehe er im Bad verschwand.
Er könne unbesorgt den Wagen holen, gab Lieselotte Böhnke mit auf den Weg. Sie käme mit dem Jungen klar. Und wenn er sich nicht benehmen würde, würde sie ihn mit dem Elektroschocker traktieren. Der Elektroschocker, das war die zweite Veränderung in ihrem Leben nach dem Attentat vor gut einem Jahr. Andere Frisur, aktive Selbstverteidigung – das waren Teile ihres neuen Selbstverständnisses geworden.
Als Böhnke wenige Minuten später in den Hühnerstall zurückkehrte, saß Lieselotte allein im Wohnzimmer, in dem vor etlichen Jahren noch Hühner auf der Stange gehockt hatten. Lieselotte und er hatten das alte Gemäuer, das nach dem Zweiten Weltkrieg als Hühnerstall gedient hatte, komplett entkernt und zu einem Wohnhaus umgebaut, gedacht als Feriendomizil und Alterswohnsitz, inzwischen aber dauerhafte Bleibe des Pensionärs, während Lieselotte üblicherweise in der Woche in Aachen wohnte. An den ehemaligen Hühnerstall erinnerte nichts mehr, nur der Name war geblieben und sorgte gelegentlich für Erheiterung, wenn sie in einer Unterhaltung mit Unwissenden davon sprachen, sie würden in einem Hühnerstall leben.
»Wo hast du unseren neuen Mitbewohner gelassen?«, fragte er um sich blickend.
»Der pennt«, antwortete Lieselotte salopp. »Ich habe dem das Gästebett gezeigt, er ist reingefallen und auf der Stelle eingeschlafen. Vorsichtshalber habe ich die Zimmertür abgeschlossen. Er wird uns heute Nacht nicht behelligen.«
Sie nahm die Zeitung in die Hand. »Fand ich interessant: Als er den Bericht mit dem Bild von dem Fußballer gesehen hat, hat er gestrahlt und fast schon bewundernd ›Sascha‹ gesagt. Der kennt den.«
Sie schaute Böhnke ernst an. Sie habe lange in ihrem Gedächtnis gekramt, bis sie dahintergekommen war. »Weißt du, was er uns mit seinem ›Pas meurtrier‹ sagen wollte?«
»Du wirst es mir sagen, da habe ich keine Zweifel.«
»Ich bin kein Mörder.«
4. Kapitel
Böhnke war es nicht geheuer, dass sich der junge Mann in ihrem Haus aufhielt, obwohl er zugleich einräumen musste, dass er es so gewollt hatte. Schlaflos lag er neben Lieselotte. Er bedauerte, dass der Abend, der so harmonisch verlaufen war, so unbefriedigend enden musste. Aber es war nicht zu ändern. Die Oper hatte längst keinen Platz mehr in seinen Gedankengängen. Er dachte an den Gast, den sie sich aufgehalst hatten, und an dessen immer wiederkehrende Beteuerung, er sei kein Mörder. Und was hatte dieser Typ, der offensichtlich auf der Flucht gewesen war, mit einem deutschen Fußballer zu tun, der zwar noch lebte, aber sportlich tot war?
Seine Zweifel, ob er den Jüngling alleine im Haus lassen könne, hatte Lieselotte beschwichtigend zurückgewiesen. »Der ist harmlos. Der ist froh, dass er lebt.«
Ob er tatsächlich noch lebte? Hinter der verschlossenen Tür zum Gästezimmer war es still.
Er solle ihn schlafen lassen, empfahl Lieselotte.
»Und wenn ich vom Einkauf zurück bin, hat der die Tür eingeschlagen und uns die Hütte leergeräumt«, entgegnete Böhnke unbehaglich.
»Na und?« Lieselotte lachte ihn an. »Hier ist doch nichts, das er gebrauchen oder zu Geld machen könnte. Der stiehlt vielleicht die Küchenmesser, aber dann wüssten wir, dass wir mit seinem ›pas meurtrier‹ nicht so sicher sein könnten.« Sie küsste Böhnke und eilte zu ihrem Auto. »Halte mich auf dem Laufenden, ich komme erst am Samstag wieder.«
Das fehlte ihm noch. Er hatte den Mann am Hals, mit dem er sich nicht unterhalten konnte, und Lieselotte machte sich aus dem Staub. Unbehaglich machte er sich an die Hausarbeit, immer horchend, ob sich im Gästezimmer etwas regte. Der Kerl brachte seinen Alltag durcheinander. Normalerweise würde er sich um diese Zeit auf den Einkaufsbummel in Simmerath machen, aber er wollte das Haus nicht unbeaufsichtigt lassen. Wer weiß, was der Krauskopf in seiner Abwesenheit anstellte?
Unzufrieden mit der Situation wandte sich Böhnke der Tageszeitung zu. Der verunfallte Kicker war kein Thema mehr für die Titelseite. Erst im Sportteil fand Böhnke die hinweisende Überschrift: ›Statt Weltmeister Sportinvalide‹. Trainer, Mannschaftskameraden, Freunde gaben Kommentare zu Saschas Unfall ab. Danach war der junge Mann nicht nur ein überragendes Talent gewesen, sondern auch eine grundehrliche Haut und trotz seines jungen Alters beliebt und geschätzt. Böhnke war überrascht, dass nicht nur der deutsche Bundestrainer zu Wort kam. Auch der Trainer der russischen Nationalmannschaft äußerte seine Betroffenheit. Erst am Ende des Artikels fand Böhnke den Grund dafür. »Strohkämper hatte sich noch nicht definitiv entschieden, ob er für Deutschland oder für Russland bei der Fußballweltmeisterschaft aufläuft. Jetzt ist das Ringen zwischen den beiden Verbänden um den Ausnahmespieler auf tragische Art beendet worden. Sascha wird nie wieder auf einem Fußballplatz stehen.«
Bebildert war der Text mit einem Foto, das einen kleinen, blonden, fast noch pausbäckigen Mann im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zeigte, der frech in die Kamera grinste. ›Sascha Strohkämper: Vor zwei Wochen hatte er seinen letzten Einsatz für Deutschland‹, stand darunter.
Das Klackern der Türklinke und das anschließende leise Klopfen machte Böhnke hellhörig. Langsam näherte er sich dem Gästezimmer, angespannt öffnete er die Tür. Er schaute in das hagere Gesicht des jungen Schwarzafrikaners, der ihn verlegen anlächelte. Dessen »Merci« verstand Böhnke, der kopfnickend zur Seite trat.
Ruhig und bedächtig trat der unbekannte, nur mit einer Unterhose bekleidete Gast hinaus und ging zum Badezimmer. Er war schlank, athletisch, groß gewachsen, durchtrainiert. Wenn der Kerl gewalttätig werden würde, hätte er keine Chance. Da war er zu alt, zu schwach, in allen körperlichen Belangen unterlegen.
Geduldig wartete er am Küchentisch. Er hörte das Rauschen der Toilettenspülung, das Wasserprasseln in der Dusche. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis sein Gast zu ihm kommen würde.
Lieselotte hatte Kleidung bereitgelegt, einen Sportanzug, ein Shirt, Unterwäsche; Sachen, die Böhnke in seiner Reha getragen und danach nicht mehr angerührt hatte.
Der junge Mann hatte sie gerne angenommen, obwohl sie ihm zu groß waren. Die Hose und auch das Shirt hingen sehr luftig an seinem Körper. Böhnke bot dem Mann einen Stuhl an und forderte ihn gestenreich auf, zu essen und zu trinken.
Der Jüngling wirkte nicht unsympathisch, gestand sich Böhnke ein. Langsam fand er Interesse und auch ein wenig Spaß an dem Geschehen, er war gespannt, wie es sich entwickeln würde.
»Toni.« Kauend zeigte der Gast auf sich. »Toni.«
Endlich hatte er einen Namen. Böhnke erinnerte sich am Robinson Crusoe und Freitag. ›Du Toni, ich Böhnke‹, hätte er fast gesagt. Aber er hielt sich zurück. Er nickte und streckte seine Hand über den Tisch aus. »Hallo, Toni.«
Dankbar griff Toni zu. Er strahlte. Sein Händedruck war fest, aber nicht unangenehm. »Toni, pas meurtrier. Ami.«
»Okay, Toni, mein Freund.« Böhnke war aufgestanden und legte dem Gast die Hand auf die Schulter. »Ami.«
Sie lachten sich an.
»Je tien à remercier pour l’aide«, sagte Toni. Aber er winkte ab, als er Böhnkes verständnislosen Blick erkannte. »Merci, mon ami.«
Toni schien nicht dumm, dachte sich Böhnke. Der hatte sofort kapiert, dass ich ihn nicht verstehe, und auf einfache Art versucht, mit ihm zu kommunizieren.
»Smartphone?«
Sicher, er hatte ein Smartphone, dachte sich Böhnke. Aber er würde es nicht abgeben. Später vielleicht, jetzt nicht. Er schüttelte verneinend den Kopf.
»Internet?«
Nicht im Hühnerstall. Da funktionierte nur der Festnetzanschluss des Telefons. Wenn die Zeit reif war, würde er mit Toni vielleicht zu Billas Haus gehen. Dort, im Haus der Stiftungen, hatte er Zugang zum weltweiten Netz. Erneut verneinte Böhnke. Er zeigte auf das Telefongerät. Wenn er wolle, könne er damit anrufen, versuchte er Toni durch Gesten deutlich zu machen. Aber er wusste nicht, ob der ihn verstand.
Wie konnte er Toni verdeutlichen, dass er zum Einkauf wolle? Böhnke zog seine Jacke über, nahm den Jutebeutel und stellte eine leere Wasserflasche hinein. Er müsse gehen, Toni solle im Haus bleiben – ob der junge Mann seine Handzeichen richtig deutete, wusste Böhnke nicht.
Toni nickte bloß, ging zur Haustür, zog den Schlüssel ab, um ihn Böhnke zu geben. Er deutete an, Böhnke solle von außen abschließen, und er lachte, als er in dessen verdutztes Gesicht sah. »Je vais rester ici et attendre.«
Ehe sich der Kommissar versah, befand er sich vor dem Haus. Kopfschüttelnd machte er sich auf den Weg nach Simmerath, nicht absolut davon überzeugt, nach seiner Rückkehr seine Wohnung unversehrt und Toni überhaupt wiederzusehen.
Die Einkäufe waren schnell erledigt: Brot, Käse, Wurst, Äpfel und Aprikosen. Sollte er für Toni was Besonderes mitnehmen? Böhnke entschied sich dagegen. Wer weiß, wie lange der Junge bei ihm bleiben würde. Als er das Schild der Buchhandlung sah, kam ihm die Idee, ein deutsch-französisches Wörterbuch zu erstehen. Für alle Fälle und insbesondere dann, wenn sie sich im Hühnerstall aufhielten. Wenn er Toni einmal mit in Billas Haus nehmen würde, könnte er mit ihm mittels eines Übersetzungsprogramms im Internet kommunizieren.
Eine freundliche, tiefe Männerstimme sprach ihn an der Kasse von hinten an. »Wollen Sie etwa auf Ihre alten Tage noch Französisch lernen, Herr Böhnke?« Die Stimme gehörte einem der beiden Bezirksbeamten, die auf der Polizeistation Simmerath Dienst schoben.
»Kann man immer gebrauchen hier nahe der belgischen Grenze, Herr Krimmpich.« Freundlich reichte Böhnke dem ehemaligen Kollegen die Rechte. Ehe er sich versah, war er in ein Gespräch verwickelt, in dem sich Krimmpich über die aus seiner Sicht fatalen Entwicklungen im Aachener Polizeipräsidium und den immer schlechter werdenden Personalschlüssel bei der Besetzung der Dienststellen beklagte. »Wir werden immer älter und die Gauner immer jünger. Die lachen sich schlapp, wenn wir hinter ihnen herlaufen.«
Noch ein paar Sätze, und Krimmpich fing von seiner näher kommenden Pensionierung an, stöhnte Böhnke. Aber er wollte nicht unhöflich sein und hörte zu.
Doch überraschte ihn Krimmpich. »Jetzt suchen wir gerade einen jungen Sportler, der auf der Flucht ist.«
»So?« Böhnke hatte Mühe, einen zwar interessierten, aber nicht neugierigen Gesichtsausdruck zu zeigen.
»Ja, einen jungen Schwarzafrikaner. Die Kollegen aus Eupen haben uns um Amtshilfe gebeten.«
»Was hat er denn ausgefressen?«
»Mord«, antwortete der Bezirksbeamte lakonisch. »Der Junge soll vor ein paar Tagen seinen Fußballtrainer erstochen haben. Nach der Tat ist er abgehauen. Die belgischen Kollegen wollen nicht ausschließen, dass er über die Grenze nach Deutschland geflüchtet ist. Aber ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Er spricht nur Französisch. Da kann er in Luxemburg oder Frankreich besser untertauchen als in Deutschland.«
»Und dort fällt er wegen seiner Hautfarbe wahrscheinlich weniger auf als bei uns«, fügte Böhnke hinzu.
»So ist es«, bestätigte Krimmpich. Er tippte zum Zeichen des Abschieds mit dem Zeigefinger gegen seine Mütze.
»Wenn Sie ihn zufälligerweise sehen sollten, weil er Ihnen bei einem Spaziergang über den Weg läuft, können Sie ihm ja sagen, er solle sich bei uns melden.« Krimmpichs Lachen klang bitter. »Wir kriegen ihn eh nicht eingefangen. Vielleicht hört er ja auf Sie, Herr Böhnke.« Er deutete auf das Wörterbuch. »Sie können ihm ja auf Französisch verklickern, dass wir ihn festnehmen wollen.«
»Hat der Flüchtende auch einen Namen?« Böhnke schob die Frage schnell hinterher, bevor er an der Kasse Platz machte.
»Antoine Mukunumunu, kurz Toni genannt.«
Toni ein Mörder? War es bei diesem Vorwurf nicht sinnvoll oder gar dringend geboten, ihn seinen Kollegen zu melden? Böhnke war sich unschlüssig. Auf dem Heimweg durchs Tiefenbachtal nach Huppenbroich ging er seinen Gedanken nach. Entweder war der Junge abgebrüht und kalt wie eine Hundeschnauze und spielte ihm etwas vor, oder er war tatsächlich kein Mörder. Sein Bauchgefühl sagte Böhnke, dass Toni nicht zum Mörder taugte. Andererseits suchte man ihn international.
Als Böhnke nach dem steilen Anstieg am ehemaligen Löschteich wieder zu Atem gekommen war, stand seine Entscheidung fest. Er würde seinen Freund Tobias Grundler mit ins Boot holen. Kurzentschlossen bog er nach links ab. In seinem Büro, wie er das Schreibzimmer in Billas Haus nannte, würde er Grundler in einer Mail in Kenntnis setzen und um einen Besuch am Abend bitten. Sowohl der tatsächliche Briefkasten an der Hauswand als auch der virtuelle im Netz war leer. Niemand hatte Informationen für die Stiftungen, niemand wollte Geld für Projekte. Eine Erbschaft von Grundlers Lebensgefährtin und die großzügigen Spenden eines Aachener Industriellen hatten die Basis für zwei Stiftungen gelegt, mit denen zum einen Schulprojekte in Afrika und zum anderen soziale Projekte in der Region unterstützt wurden. Nachdem sie Billas Haus in Huppenbroich erworben hatten, war es Böhnkes Aufgabe geworden, als ehrenamtlicher Geschäftsführer zu fungieren; immerhin hatte er den kürzesten Weg von allen in der Stiftung Tätigen. Böhnke nutzte diesen Umstand ungeniert zu seinen Zwecken. Denn Internetzugang und E-Mailnutzung waren hier im Gegensatz zu seiner Wohnung gegeben. Warum sollte er dort den teuren technischen Aufwand betreiben, wenn er hier bequem und kostengünstig seine Zwecke verfolgen konnte?
›Antoine Mukunumunu‹, gab er als Begriff in die Suchmaschine ein. Er benötigte einige Versuche, bis er die richtige Schreibweise gefunden hatte. Er erhielt nur einige wenige Ergebnisse, die allesamt in Französisch geschrieben waren. Dem Anschein nach schien der junge Mann tatsächlich Fußballspieler zu sein. Darauf wiesen die wenigen Fotos hin, die ihn in einem Trikot oder auf einem Sportplatz zeigten. Über einen Fahndungsaufruf oder gar eine Verwicklung in einen Mord gab es keine Informationen. Entweder war das Ergebnis seiner Suche nicht aktuell oder der Junge stand nicht im Fokus von polizeilichen Ermittlungen. Dagegen sprach allerdings Krimmpichs Wissen. Böhnke verspürte wenig Lust, sich intensiver mit den Dateien zu beschäftigen und leitete die Hinweise in seiner Mail an Grundler weiter, bevor er sich vom Rechner verabschiedete und auf den Heimweg machte.
Er war gespannt, ob Toni auf ihn wartete. Je näher er der Haustür kam, umso mehr wuchs seine Überzeugung, dass er das Haus nicht leer vorfinden würde.
Seine Ahnung hatte ihn nicht getrogen.
Toni war aufgesprungen und kam ihm lachend entgegen, als er die Wohnung betrat.
Böhnkes kurzer Rundblick ließ keine Veränderung der Einrichtung erkennen. Anscheinend hatte Toni die gesamte Zeit am Tisch gesessen.
Jetzt packte ihn der junge Mann am Arm und zog ihn in die Küche. Er hatte die gestrige und die aktuelle Tageszeitung auf dem Tisch ausgebreitet und alle Artikel markiert, die sich mit Alexander Strohkämper beschäftigten. Toni zeigte aufgeregt auf das Foto. »C’est Sascha. Mon ami. Qu’est-ce lui est arrivé?«
5. Kapitel
Auf die Antwort auf seine Frage musste Toni bis zum Abend warten, bis Grundler und dessen Partnerin Sabine in Huppenbroich erschienen.
»Wenigstens eine, die französisch spricht«, meinte Grundler grinsend, als er Böhnke herzlich begrüßte. »Wie immer siehst du aus wie das strahlenden Leben.«
»Und wie immer bist du der große Heuchler«, knurrte Böhnke zurück, während er sich von dem großen, schlanken Mann abwandte, um Sabine zu umarmen. Ohne die Frau, die in seiner Kanzlei die organisatorischen Fäden in der Hand hielt, wäre Grundler wahrscheinlich im Chaos versunken. Sie hielt ihm den Rücken frei, wenn er in seiner Funktion als Rechtsanwalt vor und außerhalb des Gerichts wirbelte.
»Endlich mal ein attraktiver Mensch in dieser Runde«, sagte Böhnke. Er drückte die Blondine fest an sich. »Schön, dass du mitgekommen bist.«
Sabine lachte. »Lieselotte hat mich schon eingeweiht, dass ich es mit Sprachbanausen zu tun habe. Da kann ich euch nicht im Regen stehen lassen.« Sie wandte sich dem verlegen neben ihnen stehenden Toni zu und begrüßte ihn freundlich auf Französisch.
»Wie geht’s dir?«, fragte Grundler seinen älteren Freund.
»Dank dir ganz gut, Tobias«, antwortete Böhnke bedächtig. Ohne Grundler würden Lieselotte und er längst nicht mehr leben. Nachdem sie sich damals gestritten hatten und Grundler beleidigt abgezogen war, hatte sich dieser besonnen und war von Billas Haus zurück zum Hühnerstall gefahren. So hatte er noch mitbekommen, dass Böhnke in Lieselottes Wagen mit einem Fremden auf dem Beifahrersitz von der Kapellenstraße in Richtung Tiefenbachtal abgebogen war. Er war dann zur Wohnung gefahren und hatte dort die blutüberströmte, durch mehrere Schüsse schwerverletzte Lieselotte gefunden. Der von ihm alarmierte Notarzt hatte auf dem Weg vom Simmerather Krankenhaus nach Huppenbroich das Wrack entdeckt, in dem der bewusstlose Böhnke eingeklemmt war, und einen Kollegen informiert.
Die Polizei hatte damals zwar pro forma Ermittlungen aufgenommen und gegen Böhnke wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, da in dem von ihm gesteuerten Wagen bei dem Unfall der Beifahrer gestorben war. Aber diese Ermittlungen waren schnell eingestellt worden, weil niemand Böhnke ein Verschulden anlasten wollte.
Seit dem Unfall, der tatsächlich ein Tötungsversuch gewesen war, war die Beziehung zwischen Böhnke, Lieselotte, Grundler und Sabine noch inniger geworden. Man war quasi eine Familie, in der jeder seine Rolle spielte.
»Willst du eigentlich nicht wissen, was es mit Antoine Mukunumunu auf sich hat?« Wie selbstverständlich hatte Sabine Tee aufgebrüht. Nun saßen die vier am Küchentisch.
»Du wirst es mir verraten«, antwortete Böhnke. Er konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als Sabine Grundler wirsch zu verstehen gab, dass er schweigen soll. Der Mann hatte bestimmt eine flapsige Bemerkung machen wollen.
»Ich habe recherchiert, nachdem ich deine Mail gelesen habe.« Sabine holte aus ihrer Schultertasche einige Papiere. »Ist aber alles auf Französisch.« Es sei daher sinnvoll, wenn sie berichte. »Also, für mich ergibt sich folgendes Bild, wenn ich deine Hinweise und die von mir heute ausgewerteten Zeitungsberichte aus Belgien zusammenfasse.« Sie hatte zunächst Böhnke angeschaut, um sich dann Toni zuzuwenden.
»Antoine Mukunumunu, kurz Toni, ist wahrscheinlich 18 Jahre alt.« Böhnkes Stirnrunzeln deutete sie richtig. »So genau kann ich sein Alter nicht datieren. Laut meinen Unterlagen soll er 18 Jahre alt sein, er kann aber auch 17 oder 19 sein. Okay.« Sabine schnaufte durch. »Toni ist Mitglied eines Fußballinternats, das ein gewisser Jean-Marie Pfifferlin in der Nähe von Eupen betreibt. Pfifferlin ist Trainer, Berater, Betreuer in einer Person für die Fußballer, die in seinem Internat leben. Es handelt sich fast ausschließlich um Schwarzafrikaner aus den ehemaligen belgischen oder französischen Kolonien. Sie werden von Pfifferlin ausgebildet und spielen danach bei diversen Fußballvereinen in Europa. Da sind welche Profis geworden, andere spielen in unteren Klassen.« Sabine sah sich entschuldigend um. »Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinden.« Sie hatte in den letzten Stunden die Internetrecherche fortgesetzt und aktuelle Dateien gefunden. »Dabei habe ich die gesicherte Erkenntnis herausgefunden, dass Toni verdächtigt wird, Pfifferlin erstochen zu haben. Die Polizei fand Pfifferlin gestern Nachmittag in seiner Wohnung in Eupen. Er wurde mit einem Messer erstochen. An dem Messer befinden sich Fingerabdrücke von …«, sie zeigte auf den jungen Mann, »von Toni. Zeugen haben ihn gesehen, als er die Wohnung verließ. Als zwei Streifenpolizisten, die ihn zufällig trafen, ihn auf offener Straße in Eupen verhaften wollten, ist er geflüchtet. Die beiden Polizisten hatten keine Chance gegen den Sportler. Er hat sie abgehängt und ist verschwunden.«
»Und ist mir beinahe vors Auto gelaufen«, sagte Böhnke. Er blickte auf Toni. »Was sagt denn unser Freund dazu?«
Der Trainer hätte ihn zu einem Gespräch in seine Wohnung gebeten, berichtete Sabine. Pfifferlin habe regungslos mit dem Messer in der Brust auf dem Boden gelegen. »Toni hat dann, so sagt er jedenfalls, das Messer aus dem Körper gezogen, wohl in dem Glauben, er könne damit irgendetwas bewirken. Erst dann will er erkannt haben, dass Pfifferlin tot war. Da ist er erschrocken weggelaufen. Als er von den beiden Polizisten gesehen wurde und sie ihn riefen, ist er in Panik geraten und abgehauen.« Sabine sah nachdenklich auf die stummen Männer. »Und jetzt wird Toni von den belgischen Behörden wegen Mordes gesucht.«
»Was macht er überhaupt in dem Sportinternat?«, fragte Böhnke.
»Er will Fußballprofi werden wie so viele Jungen aus Afrika. In Europa sind die Fleischtöpfe«, mischte sich Grundler ein. »Das ist eine komplizierte Materie, die wir besser nicht erörtern. Dazu wirst du an anderer Stelle Gelegenheit haben.«
Die Bemerkung ›an anderer Stelle‹ machte Böhnke hellhörig. Was führte sein Freund im Schilde? Aber er kam nicht dazu nachzuhaken.
»Also, Toni wird wegen Mordes gesucht, er ist geflohen und hat bei dir Unterschlupf gefunden«, fasste Grundler die Fakten zusammen. »Wenn wir ihn hier verstecken, könnten wir uns wegen Verdeckung einer Straftat, Unterstützung eines Verbrechers, Behinderung der Polizeiarbeit und was auch immer strafbar machen.«
Wieder horchte Böhnke auf. Grundler hatte von ›wir‹ gesprochen, was bedeutete, dass er mit im Boot saß.
Indirekt bestätigte ihn der Anwalt. »Da ich davon ausgehe, dass Toni kein Mörder ist, sehe ich keinen Grund, ihn unverzüglich der Polizei zu übergeben.« Er rieb sich die Hände. »Das ist endlich eine spannende Aufgabe«, frohlockte er. Er schlug dem Jungen vergnügt auf die Schulter. »Toni, mein Freund, wir holen dich da raus.«
Das ging Böhnke fast schon zu schnell. Er habe noch nicht für sich entschieden, sagte er langsam, obwohl er sich längst entschieden hatte. Aber er wollte Grundler ein wenig zappeln lassen.
»Woher kennt Toni eigentlich Alexander ›Sascha‹ Strohkämper?«, fragte er Sabine in der Erwartung, dass sie die Frage an den jungen Mann weiterleitete.
Man habe in einem Trainingslager vor der Saison miteinander trainiert und gegeneinander gespielt. Da habe man die E-Mailadressen ausgetauscht und sich gegenseitig geschrieben, übermittelte Sabine. Angeblich hatte sich Sascha dafür einsetzen wollen, dass Toni bei Borussia Mönchengladbach unterkommen könnte. »Der Junge weiß noch nicht, dass Strohkämper den Unfall hatte. Er hat nur das Bild in der Zeitung gesehen.«
»Hat er im Internat mit jemandem darüber gesprochen, dass er zu seinem Trainer wollte?«
»Nein«, antwortete Sabine nach einem kurzen Gespräch mit Toni. »Pfifferlin hatte um Stillschweigen gebeten.«
»Kann er sich denn vorstellen, worum es in dem Gespräch gehen sollte?«
Wieder wurde Sabine zur Dolmetscherin. »Toni hoffte, dass es um den Vertrag mit Mönchengladbach gehen sollte.«
»Und weil der nicht zustande kam, hat er Pfifferling wutentbrannt niedergemetzelt«, folgerte Böhnke laut.
»Erstens heißt das Opfer Pfifferlin und nicht Pfifferling und zweitens ist das eine wüste Spekulation«, widersprach Grundler streng, ganz schon in seinem Element als Strafverteidiger.
Toni meldete sich schüchtern. Er habe sich verspätet, übersetzte Sabine. Er sei eine Viertelstunde zu spät gewesen.
»Weil er zu spät kam, hat er Pfifferlin ermordet.« Grundler verbarg die Ironie nicht.
Böhnke hörte darüber hinweg. »Warum hast du dich verspätet?«
Er habe noch einen Anruf bekommen. Ein Verein hätte Interesse an ihm, habe ein Spielerberater gesagt. Den Namen des Anrufers wisse er nicht. Er habe dessen Rufnummer im Verzeichnis auf seinem Handy gespeichert, das er aber bei seiner Hatz durchs Hohe Venn verloren haben muss.
Dichtung oder Wahrheit? Böhnke machte Grundlers Worte zu den seinen: Im Zweifel für den Angeklagten. »Okay, gehen wir also davon aus, dass Toni nicht der Mörder ist.« Er grinste Grundler an. »Ich werde also ermitteln und du als mein Assistent die juristische Seite abdecken.«
»Gerne. Aber nur unter einer Bedingung.«
Aha, endlich würde Grundler die Katze aus dem Sack lassen, auf die Böhnke schon gelauert hatte. Die eben beinahe beiläufig erwähnte andere Stelle würde zur Sprache kommen.
»Ich helfe dir, und du hilfst mir«, fuhr Grundler fort. »Ich habe nämlich Arbeit für dich. Du musst wegen des vermeintlichen Unfalls von Alexander ›Sascha‹ Strohkämper recherchieren.«
»Hä?«
Grundler musste über den dümmlichen Gesichtsausdruck von Böhnke lachen. »Ich habe den Auftrag, rechtliche Schritte zu prüfen, inwiefern welche Versicherung für welchen Schaden aufkommt, ob Strohkämper eine Berufsunfähigkeitsrente erhalten kann, ob er gegen seine vertraglichen Pflichten verstoßen hat, als er mit dem Rennrad fuhr, oder ob es vielleicht gar kein Unfall war.«
»Und wer ist dein Auftraggeber?«
»Du wirst ihn morgen kennenlernen, Commissario«, sagte Grundler knapp.
6. Kapitel
Sabine hatte Toni vor ihrer Rückfahrt nach Aachen eingetrichtert, er habe das Haus nicht zu verlassen. Als Dunkelhäutiger würde er in dem kleinen Huppenbroich sofort auffallen. Wegen der Nähe zu Belgien müsse man davon ausgehen, dass es sich inzwischen im deutschen Grenzbereich herumgesprochen habe, dass ein junger Schwarzafrikaner als Mörder auf der Flucht sei. Um sicher zu sein, solle Toni in Böhnkes Wohnung bleiben.
Der junge Mann hatte verständnisvoll genickt, und er nickte auch, als ihm Böhnke am Morgen noch einmal gestenreich versuchte zu erklären, dass er das Haus auf keinen Fall verlassen dürfe.
Böhnke konnte nur hoffen, dass sein Appell fruchtete. Schon in Gedanken einen Schritt weiter gab er Toni das deutsch-französische Wörterbuch. »Da hast du was zu lesen.«
Gedanklich beschäftigte er sich mit dem Mann, den er in einer knappen Stunde in Aachen treffen sollte. »Der liegt auf dem Lousberg in einer Hängematte und wartet auf dich«, hatte Grundler beim Abschied am Vorabend gesagt. »Ein ehemaliger Sportjournalist. Paul Christopher ist sein Name.«
Bevor er sich auf den Weg zur Bushaltestelle an der Kapelle machte, steuerte Böhnke Billas Haus an. Seine Suche im Internet war wenig ertragreich. Nach den Einträgen in den verschiedenen Medien war Christopher gerade einmal 60 und vormals Redakteur in Aachen gewesen. Ob Frührentner oder krank, ob reich geerbt oder verarmt geschieden? Das angeblich allwissende weltweite Netz lieferte keine Informationen.
Kurzerhand griff Böhnke zum Telefon. Er mochte es nicht, einem ihm Unbekannten gegenüberzutreten, von dem er nicht wusste, wie er ihn einzuschätzen hatte.
Sein Gesprächspartner war überhaupt nicht begeistert von dem frühmorgendlichen Anruf. Für einen Journalisten sei es fast noch Mitternacht, moserte der Redakteur Hermann-Josef Sümmerling, mit dem Böhnke gelegentlich zu tun gehabt hatte, schlaftrunken.
Böhnke überhörte das Gejammer. »Ich brauche eine Information. Wer ist Paul Christopher?«, fragte er knapp.
»Ehemaliger Kollege aus der Sportredaktion. Ein hochgradiger Alkoholiker, vor dem kein Tropfen in der Redaktion sicher war. Er liebte besonders Calvados, deshalb hatte er bei uns den Spitznamen ›Calva‹. Vor ein paar Jahren hat er für uns alle überraschend das Handtuch geworfen und fristlos gekündigt. Seitdem tingelt er durch Aachen und wird sich wohl langsam zu Tode saufen. Ab und zu treffen die Kollegen ihn bei einem Fußballspiel der Alemannia auf dem Tivoli oder beim Volleyball. Dann schreibt er wohl Berichte für andere Zeitungen, denken wir. Außerdem versucht er sich als Autor an unsäglichen Büchern, die niemand braucht und niemand lesen will.« Achtung vor dem ehemaligen Kollegen schien Sümmerling nicht zu haben. »Das ist ein Spinner und Penner, der sich den Arsch am Lousberg platt liegt. Wir wissen nicht mal, wo er wohnt.« Er lachte gehässig. »Vielleicht im Bahnhof oder auf einer Parkbank.« Es interessierte den sonst immer neugierigen Sümmerling sogar nicht, warum Böhnke ihn nach dem Mann fragte. »Sie brauchen ihm garantiert keine Grüße von mir zu bestellen, wenn Sie ihn sehen«, sagte er ungeniert gähnend zum Abschied.
Böhnke hatte seinen Zeitaufwand falsch eingeschätzt. Der ÖPNV hatte wieder eine Überraschung für ihn bereitgehalten und ihm eine saftige Verspätung eingebrockt. Mehr als eine halbe Stunde war er bereits über der vereinbarten Zeit und war immer noch nicht am Ziel. Am Fuße des Lousbergs stehend pustete er tief durch. Er musste hinauf auf diese höchste Erhebung in Aachen bis zum Drehturm Belvedere, dort würde er auf der anderen Seite des Hügels die Fläche mit den Hängematten finden. Aber würde er dort auch auf Christopher treffen? Die dichtbelaubten Bäume auf der mit attraktiven Häusern aus den 20er Jahren gesäumten Straße spendeten ihm etwas Schatten. Rund 250 Meter hoch war der Lousberg, das wusste er inzwischen, auf ihm war der erste Landschaftspark Europas auf Initiative der Bürgerschaft gebaut worden. Oberhalb der Bebauung begann der Freizeitpark, den er während seiner Dienstzeit in Aachen allenfalls aus ermittlungstechnischen Gründen besucht hatte. Einer seiner letzten Fälle war der eines Professors gewesen, dessen Freundin 30 Jahre zuvor ermordet worden war und der mit Böhnkes Hilfe den Mord aufklären konnte. War eine merkwürdige Sache gewesen, erinnerte sich Böhnke, während er auf der Anhöhe durchschnaufte. Erwartungsvoll wanderte er zur anderen Seite und entdeckte dort tatsächlich die Hängematten. Nur eine war belegt. Kein Wunder, wer ließ sich auch schon die Sonne aus dem wolkenlosen Himmel fast zur Mittagszeit auf den Pelz brennen?
Unterhalb der schattenspendenden Matte döste ein Hund, vermutlich ein Mischling. Er blickte gespannt auf, als sich Böhnke näherte. Er wollte sich aufrichten, legte sich aber wieder hin, als ihm eine tiefe Stimme befahl: »Platz!«
Der Mann in der Hängematte wirkte unbesorgt. »Sind Sie’s, Herr Böhnke?«, fragte er mit geschlossenen Augen.
»Ja, leider etwas zu spät. Ich hatte schon befürchtet, Sie nicht mehr anzutreffen, Herr Christopher.«
Ein helles, freundliches Lachen war die Antwort. »Uns läuft doch die Zeit nicht mehr davon, wir haben genug davon. Oder sind Sie etwa auf der Flucht?«
»Das nicht, aber gerne pünktlich.« Der Mann, der sich langsam aus der Hängematte schälte, irritierte Böhnke nicht nur wegen der Gelassenheit, sondern auch wegen seines souveränen und seriösen Auftretens. Er hatte schlimmstenfalls mit einem abgehalfterten Penner in zerlumpten Klamotten gerechnet oder mit einem vom Alkohol gezeichneten, zerzausten Altersgenossen mit Kleidung aus einem Second-Hand-Shop. Aber er musste sich insgeheim für seine Fehleinschätzung entschuldigen. Der zwar stämmige, aber nicht dicke Mann trug saubere Markenkleidung, hatte sein braunes Haar ordentlich gescheitelt, war glatt rasiert und schaute ihn unbefangen aus wachen Augen ins Gesicht.
»Enttäuscht, Herr Böhnke?« Christopher tätschelte den Hund, der sich neben ihn gehockt hatte.
Ehrlicherweise hätte der Kommissar die Frage bejahen müssen, er redete sich mit einer Gegenfrage raus. »Warum sollte ich?«
Christopher zuckte mit den Schultern. »Hätte ja sein können, dass Sie sich über mich bei meinen ehemaligen Kollegen informiert haben. Die hätten mich dann als Alki, arbeitslos, heruntergekommen und wer weiß was noch beschrieben.«
»Das Gegenteil scheint der Fall.« Böhnke war froh, das Gespräch in ruhiges Fahrtwasser lenken zu können.
»Das Gegenteil ist der Fall«, sagte Christopher energisch. »Seit ich den Laden verlassen habe, habe ich fast keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Und wenn Sie mich nach meinem Beruf fragen, antworte ich Ihnen, ich bin Nichtberufler oder Lustarbeiter. Gelegentlich nehme ich Aufträge an, wenn mich das Thema interessiert, ansonsten privatisiere ich und mache, was ich will.« Er setzte sich in Bewegung. »Kommen Sie, ich lade Sie zum Mittagessen ein.«
»Und wohin?« Böhnke fühlte sich unwohl, weil nicht er die Fäden in der Hand hielt, aber er würde so schnell nicht aus seiner passiven Rolle herauskommen.
»Im Klömpchensklub. Den kennen Sie doch, oder, Herr Kommissar?«
Woher sollte er den ominösen Klub kennen? »Nein. Ist es weit dorthin?«
»Für uns nicht.« Mit der Fernbedienung hatte Christopher die Heckklappe eines neben dem Drehturm geparkten SUV geöffnet. Sofort sprang der Hund hinein und rollte sich zusammen. »Dann steigen Sie mal ein«, forderte er Böhnke auf, der staunend zusah, wie sich die Flügeltüren des Wagens nach oben öffneten.
Ehe er sich versah, hatte Böhnke Platz genommen. Er bemerkte, wie sich der Wagen lautlos in Bewegung setzte.
»Ist ein Stromer«, beantwortete sein Fahrer die nicht gestellte Frage. »Von Tesla. Die deutschen Kisten kannste ja alle vergessen.«
Böhnke schwieg zu der Bemerkung. Er hatte seine eigenen Erfahrungen mit einer Tesla-Limousine gemacht und hätte sich liebend gerne eine eigene angeschafft. Aber leider reichte dafür das Geld in der Portokasse nicht. Wieso sich der selbstsichere Privatier dieses teure Elektroauto leisten konnte, würde er sicherlich erfahren, wenn sie lange genug miteinander zu tun hatten.
Christopher hatte seinen Wagen stadtauswärts über die Krefelder Straße gesteuert. Hinter dem Fußballstadion bog er links ab, um wie selbstverständlich auf einem Stellplatz zu parken, der ausdrücklich dem Vereinsvorsitzenden von Alemannia Aachen vorbehalten war.
»Sind Sie das etwa?«, fragte Böhnke.