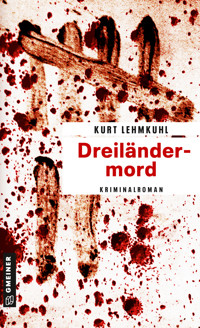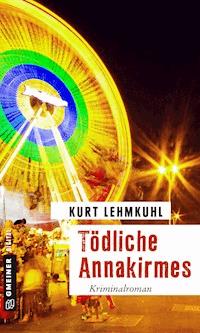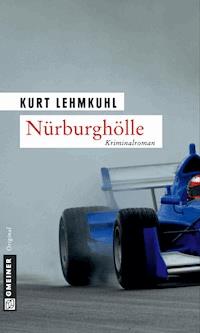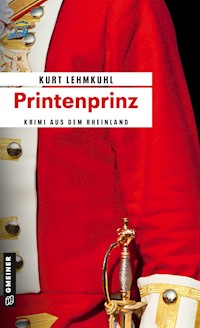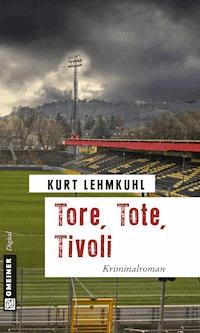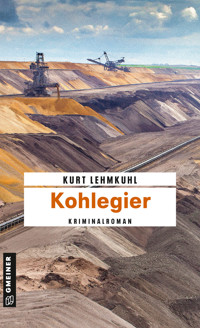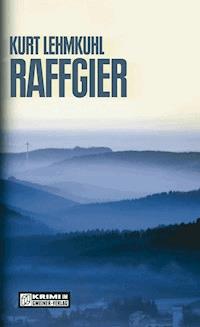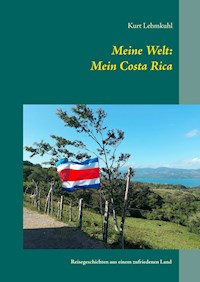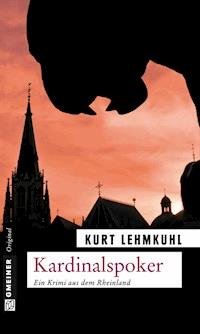
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Böhnke und Rechtsanwalt Grundler
- Sprache: Deutsch
Nach einem Fußballspiel zwischen den rheinischen Erzrivalen Alemannia Aachen und 1. FC Köln im neuen Tivoli-Stadion in Aachen wird ein FC-Fan tot aufgefunden. Es handelt sich um Wolfgang Kardinal, den Vorsitzenden einer populistischen Wahlvereinigung. Die Boulevardpresse am Rhein sieht im Tod des Kölner Ratsherrn den Auftakt zu einem Fan-Krieg zwischen Aachen und Köln. Kurz darauf stirbt ein weiterer Fußballanhänger. Der pensionierte Kommissar Rudolf-Günther Böhnke wird während seiner Ermittlungen mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und sieht sich bald nicht nur in einem sportlichen, sondern auch in einem kommunalpolitischen Dschungel umherirren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lehmkuhl
Kardinalspoker
Kriminalroman
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2012 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: René Stein
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
1.
Der Alte, den er so nannte, obwohl dieser diese Bezeichnung überhaupt nicht mochte, der Alte würde mit ihm zufrieden sein. Ihr gemeinsam ausgeheckter Plan hatte reibungslos funktioniert. Der Plan B konnte für ein anderes Mal aufgespart werden. Andererseits: War es wirklich nötig gewesen, den Kerl zu töten? Verdient hatte der Typ den Tod zweifelsohne. Aber war es richtig gewesen, ihm die Kerze auszublasen? Doch jetzt war es zu spät. Er hatte den Wunsch des Alten erfüllt und jetzt konnte er darauf vertrauen, dass ihn der Alte schützen würde. Immerhin hatte er nichts anderes getan, als das, was er tun musste.
Er hatte richtig kalkuliert. Ihr Wagen war einer der ersten, die auf den Parkplatz direkt am neuen Tivoli eingewiesen wurden. Zügig fuhr er zur entferntesten Stelle des weitläufigen Geländes, bis kurz vor die Böschung am hinteren Ende. Der Parkwächter hatte nur kurz genickt, als er ihnen die fünf Euro Parkgebühren abknöpfte. Vier Männer in Trikots des 1. FC Köln, die es offenbar gar nicht erwarten konnten, zum Meisterschaftsspiel ihrer Geißböcke im neuen Aachener Fußballstadion gegen die heimische Alemannia zu kommen. Es war noch hell. Das Spiel unter Flutlicht würde erst in knapp drei Stunden beginnen.
Er blieb mit einem seiner Begleiter im durchaus auffälligen Fahrzeug, einer dunklen Limousine, sitzen. Der Mann auf dem Rücksitz hinter ihm schien ein Nickerchen zu machen; zumindest entstünde dieser Eindruck bei anderen Autofahrern, die ihn so da liegen sähen. Die beiden anderen FC-Fans hatten sich außen an den Wagen gelehnt, nippten gelegentlich an ihren Kölsch-Flaschen und beobachteten, wie sich der Parkplatz rasch füllte. Sie hatten Zeit. Sich schon früh ins supermoderne Stadion zu begeben, das vom alten, gerade einmal 300 Meter entfernten nur den Namen, nicht aber die Provinzialität übernommen hatte, kam ihnen nicht in den Sinn. Sie würden sich das immer wieder brisante, prickelnde Spiel zwischen den rheinischen Rivalen anschauen, aber sie würden sich nicht, eingeklemmt in der wartenden Menge, an diesem Dienstagabend die Beine in den Bauch stehen. Die beiden Männer, ebenso wie er Ende 30/Anfang 40, schauten gelangweilt auf das anwachsende Treiben der erwartungsvollen Fans. Er hingegen erging sich mehr in der Erinnerung an die Zeiten, in denen er regelmäßig zum Tivoli gegangen war. In diese alte Bruchbude an der Krefelder Straße, trotz allem eine Kultstätte des Fußballs. Eng, steil, laut, immer etwas anders als in anderen Stadien, und mit einem Heimatverein, der Alemannia, die auch immer etwas anders gewesen war als andere Vereine, und mit Fans, die gewissermaßen mit dem Hass auf den 1. FC Köln aufwuchsen. Immer noch fühlten sich die Öcher Fans betrogen, seitdem bei der Gründung der Fußball-Bundesliga 1962 und der Aufnahme des Spielbetriebs 1963 die Kicker vom Rhein in die neue Spielklasse aufgenommen wurden, die Alemannia aber, obwohl sportlich qualifiziert, aus dem Kreis der 16 Elitemannschaften gestrichen wurde. Das war für ihn jedoch, im Gegensatz zu vielen anderen, Schnee von gestern und er wusste auch nur vom Hörensagen davon. Obwohl nur wenige Schritte vom neuen Tivoli entfernt, lagen Welten zwischen beiden Bauten. Abbruchreif, von der bürgerlichen Nachbarschaft hinter der Haupttribüne argwöhnisch beäugt und bei jeder Sanierungsmaßnahme mit einem juristischen Protesthagel überschüttet, so hatte der alte Tivoli keine Zukunft mehr: Es kam zum Umzug der Alemannen in den auch optisch attraktiven Neubau unmittelbar neben dem gewaltigen Reitstadion in der Soers.
Er holte sich zurück in die Gegenwart, nachdem er noch einmal an das letzte Spiel zwischen Aachen und Köln gedacht hatte, das mit einem Sieg der Alemannia geendet hatte. Noch knapp 30 Minuten waren es bis zum Anstoß. Sie waren allein auf dem Parkplatz, der inzwischen restlos mit Autos gefüllt war.
»Packen wir’s an!«, forderte er seine Begleiter auf. Er öffnete die Tür hinter seinem Sitz und fing den Körper auf, der langsam auf ihn zu kippte. Leicht hievte er den Mann an, die beiden anderen griffen die Beine. Zusammen trugen sie den Leichnam an die Böschung, in der sie ihn in den tiefer gelegenen Graben sacken ließen.
»Ruhe sanft!«, sagte er spöttisch. Er drehte sich um, riegelte den Wagen ab und eilte mit seinen Kumpanen zum hell erleuchteten Stadion, aus dem erstaunlicherweise trotz der Kulisse von über 30.000 Zuschauer nur wenige Geräusche ins Freie drangen.
Mit einem laut gegrölten »Eef Cee, Eef Cee« verschaffte er sich Gehör auf der rappelvollen Tribüne. Die grimmigen Blicke der größtenteils als Aachener Fans zu erkennenden Umstehenden störten ihn ebenso wenig wie das sinnfreie »Colon, Colon, die Scheiße vom Dom«, das ihm entgegen gebrüllt wurde. Niemand würde ihm gegenüber handgreiflich werden. Dazu war er zu groß, zu athletisch und zu selbstsicher. Er genoss es, die Zuschauer um ihn herum zu provozieren. Er und seine Begleiter trugen als Einzige rot-weiße Trikots mit der Rückennummer 9 und dem Namenszug des ewigen Kölner Idols: Lukas Podolski.
Das Spiel der alten Rivalen konnte beginnen.
Das Derby endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Alemannia. Den Spott und die Häme der schwarz-gelben Aachenfans konnte er gelassen ertragen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sich das Spiel erst gar nicht angesehen. Aber der Alte hatte es so gewollt, es hatte zu dem Plan gehört.
Alleine fuhr er nach Köln zurück, seine beiden Begleiter sollten plangemäß mit dem Bus und der Bahn in ihre Heimatorte zurückkehren. Wie erwartet, hatte noch niemand den Leichnam hinter dem Parkplatz entdeckt. Zum einen verhüllte ihn die Dunkelheit, zum anderen wollte jeder schnell nach Hause und hatte keine Lust, noch lange durch die Gegend zu laufen. Er hingegen ließ sich Zeit, wartete im Wagen geduldig ab, bis sich der Stau auf dem Gelände auflöste, und überdachte noch einmal das Geschehene. Er hatte seine drei Mitfahrer an einer S-Bahn-Station an der Aachener Straße in Köln aufgelesen und jedem von ihnen sofort eine Bierflasche in die Hand gedrückt. Bedenkenlos hatten sie das Obergärige getrunken. Sein Hintermann hatte das von ihm präparierte Kölsch erhalten.
Schon wenige Minuten später, sie waren kaum auf der Autobahn in Richtung Aachen, wirkte das Mittel bereits, von dem er nicht viel mehr wusste, als dass es ein Teufelszeug war; irgendein Mix aus Schlaf- und Betäubungsmittel oder gar ein lähmendes Gift.
Ohne Zaudern stülpte der zweite Mann auf dem Rücksitz dem Dahindämmernden eine Plastiktüte über den Kopf. Als er sich zwischen Düren und Weisweiler vom Ergebnis vergewisserte und die Tüte lupfte, war der Mann erstickt; genauso, wie es der Plan vorsah.
Anderenfalls hätte er nachgeholfen.
Die hektischen Autofahrer um ihn herum konnten ihn nicht aus der Ruhe bringen. Was sollte er sich jetzt noch Stress antun? Auf der Autobahn zurück zur Rheinmetropole rollte er auf dem rechten Fahrstreifen mit. Das entspannte und war weitaus weniger nervend als das permanente Überholen und Einscheren bei hoher Geschwindigkeit. Auf dem Parkplatz am Rasthof in Frechen legte er den beabsichtigten Zwischenstopp ein. Er suchte sich einen abgelegenen Stellplatz weit entfernt von Tankstelle und Raststätte, der zu dieser nächtlichen Zeit garantiert unbeobachtet war. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass kein Mensch in der Nähe war, entfernte er die schwarzen und weißen Klebestreifen, mit denen er auf dem Nummernschild die Zahlen und Buchstaben verändert hatte, und warf sie in die erste Mülltonne. Das Trikot mit der Podolski-Aufschrift flog in die zweite. Es hätte ihm noch gefehlt, dass später jemand den Schluss ziehen würde, die Klebestreifen und das Trikot könnten zusammengehören, weil sie in einer Tonne gefunden wurden.
Niemand hatte ihn bei seinem Handeln gesehen. Da war er sich ziemlich sicher. Er fuhr weiter, ins Rheintal hinab in die Domstadt. Mal wieder verfranzte er sich, ehe er vom Konrad-Adenauer-Ufer hinter dem blauen Runddach des Musical-Domes linksseitig endlich hinter dem Hauptbahnhof die Jakordenstraße fand. Der Alte hatte ihm untersagt, das Navi zu benutzen. Wer wusste, mit welchem Trick jemand Daten früher eingegebener Routen darauf sichtbar machen konnte? Es waren Kleinigkeiten; aber der Alte legte darauf Wert, und er hielt sich daran.
Den modernen Wohnblock gegenüber der nicht sofort erkennbaren Verwaltungszentrale eines Lebensmittelkonzerns fand er auf Anhieb. Mit der Chipkarte öffnete er das Tor zur Tiefgarage und stellte den Wagen auf dem zugewiesenen Stellplatz ab. Es gehörte schon einiges Geschick dazu, die Limousine vernünftig einzuparken. Chipkarte und Autoschlüssel verstaute er in einem Papierumschlag, den er in den Briefkasten mit dem für Köln absolut unauffälligen Namenszug Schmitz warf.
Nach einem Blick auf die Armbanduhr machte er sich gemächlich auf den Weg zum Hauptbahnhof. Er lag vollkommen im Zeitplan. Die Telefonnummer, die er in sein Handy tippte, hatte er auswendig gelernt. Er würde die extra gekaufte Prepaid-Karte nach dem Anruf sofort wegwerfen.
»Vater«, sagte er, als die Verbindung stand, obwohl der Alte auch diese Bezeichnung überhaupt nicht mochte. »Vater, der Auftrag ist ohne besondere Vorkommnisse erledigt worden.«
Er suchte sich eine freie Bank auf dem Bahnsteig und wartete geduldig auf den Regionalexpress, der ihn nach Aachen zurückbringen würde.
2.
»Ruhe bitte! Ich möchte beginnen!« Doch trotz seiner durchdringenden Bassstimme gelang es dem Oberbürgermeister nicht, den Lärm im Sitzungssaal auf eine erträgliche Phonzahl herunterzudrücken. Die aufgeheizte Stimmung nicht nur unter den Kommunalpolitikern der verschiedenen Ratsfraktionen, sondern auch unter den zahlreichen Zuhörern, ließ einen ordnungsgemäßen Verlauf der Sitzung nicht zu. Viele der erzürnten Besucher machten deutlich, warum sie an diesem späten Mittwochnachmittag in den großen Sitzungssaal im Spanischen Bau des Kölner Rathauses gekommen waren. Die Plakate, die sie in die Höhe reckten, waren eindeutig: ›Keine Riesenmoschee am Rhein!‹ –›Der Dom ist uns heilig!‹ –›Wer is’ ne echte Kölsche?‹ – ›Wer ist für Kölle?‹ stand auf den handgeschriebenen Schildern, die unübersehbar über den Köpfen der Demonstranten prangten. Die fotografierende Journaille wurde nicht müde, die Motive abzulichten.
Die Verweise auf den ›echten Kölsche‹ und ›für Kölle‹ waren eindeutig auf den Oberbürgermeister gemünzt. Werner Müller hatte mit seinem Wahlspruch: ›Echte Kölsche für Kölle‹ bei der letzten Bürgermeisterwahl als unabhängiger Kandidat die beiden Bewerber der großen Parteien aus dem Rennen geworfen. Ihm war das neue Wahlrecht gerade zupassgekommen, das denjenigen zum Sieger erklärte, der die meisten Stimmen erhielt, auch wenn er nicht die absolute Mehrheit für sich verbuchen konnte. Und Sieger war Werner Müller geworden. 32 Prozent hatten ihm gereicht.
Nun glaubten anscheinend die Demonstranten, von ihm ihre Rechte einfordern zu können, nämlich, den möglichen Bau einer weiteren Moschee in Köln zu verhindern. Dabei war nicht einmal sicher, ob es diesen Bau überhaupt geben würde. Es war ein Gerücht, das urplötzlich durch Köln schwirrte: Eine Riesenmoschee sollte gebaut werden. Direkt am Rhein! Vertreter türkischer Organisationen hatten zwar unverzüglich entsprechende Pläne dementiert, aber man wollte ihnen keinen Glauben schenken. Nach einigen krawallartigen Auseinandersetzungen in den letzten Monaten war die Stimmung am Rhein nicht gerade wohlwollend gegenüber den türkischen und türkischstämmigen Mitbürgern.
Müllers Blick fiel auf ein weiteres Plakat. ›Ja zum Antrag der KGB‹ forderte ein Pimpf, der es mit ausgestreckten Armen über seinem Kopf hielt. Es machte den Oberbürgermeister ärgerlich, dass die Demonstranten Kinder für ihre Zwecke einspannten. Der Junge wusste wahrscheinlich nicht einmal, wer diese KGB war.
Früher, vor seiner Wahl zum OB, war Müller einmal eine Nähe zur KGB, der ›Kölner Gemeinschaft aller Bürger‹ nachgesagt worden; ein Grund mehr, weshalb die aufgebrachten Sitzungsbesucher seinen Einsatz für ihre Belange verlangten.
Es konnte durchaus sein, dass bei der Fraktionsvielfalt im 90-köpfigen Stadtrat und den vielen unterschiedlichen politischen Interessen der Parteien und Wahlvereinigungen seine Stimme letztendlich den Ausschlag gab, ob dem KGB-Antrag stattgegeben würde. Rückendeckung von einzelnen Fraktionen konnte er nicht erwarten; er war keiner der ihren; und wenn er sich bei einer Entscheidung auf die Seite der CDU schlug, konnte er damit rechnen, dass die SPD allein deshalb gegen ihn stimmte. Und auch den umgekehrten Fall hatte es in den letzten Monaten gegeben.
Die KGB hatte beantragt, der Stadtrat möge sich definitiv gegen den Bau weiterer islamischer Bauten und besonders gegen den Bau von Moscheen und Gemeindehäusern aussprechen. Die kleine Gruppierung, ein eingetragener Verein und keinesfalls eine Partei, wie sie der Öffentlichkeit glauben machen wollte, setzte voll auf Stimmungsmache. Sie nannte ihr Handeln zwar Sachpolitik für Köln, aber tatsächlich war es reiner Populismus, den die KGB praktizierte, zumindest dieser Gerd-Wolfgang Kardinal, der zugleich Vorsitzender der vierköpfigen Ratsfraktion war.
»Ruhe bitte!« Erneut dröhnte Müllers Bass durch den großen Sitzungssaal. Unterstützt durch das laute Tönen einer Glocke gelang es ihm endlich, die Geräuschkulisse auf ein passables Niveau zu reduzieren. Mit dem formellen »Hiermit eröffne ich die 13. Sitzung des Stadtrates« gab er das Startzeichen, mit dem der Protokollant seine dokumentierende Arbeit aufnahm. Müllers Vorschlag, aus Gründen der Praktikabilität Sitzungen per Tonband mitschneiden zu lassen, war vom Rat vehement abgelehnt worden. Und das Risiko, wegen von ihm veranlasster heimlicher oder vermeintlich heimlicher Mitschnitte angegriffen zu werden, wollte er nicht eingehen. Da war ihm das negative Beispiel eines seiner Vorgänger im Zusammenhang mit dem tragischen Einsturz des Stadtarchivs Mahnung genug. Der hatte wegen eines Mitschnitts sogar ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft am Hals gehabt.
Der Blick auf die von den Politikern abgezeichnete Anwesenheitsliste ließ ihn kurz stutzen, ehe er fürs Protokoll erklärte: »Entschuldigt fehlen einmal Schmitz von der CDU sowie Schmitz von der SPD, Dummloch und Pfannenstiel. Abwesend ist ebenfalls Ratsherr Kardinal, der sich nicht abgemeldet hat.«
Das aufbrausende Gemurmel im Sitzungssaal ließ Müller verstummen. Entsetzen machte sich bei den Demonstranten breit, einige Ratsvertreter konnten sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Die KGB-Stadtverordneten schauten sich irritiert an. Ausgerechnet jetzt fehlte Kardinal! Er hatte den Antrag gestellt, sie hatten diesen Antrag abgenickt. Sie hatten sich nicht den Zorn ihres Vorsitzenden zuziehen wollen. Und jetzt war der Mann nicht im Sitzungssaal, der die Hauptrolle bei dieser Sitzung spielen wollte.
Da braute sich etwas zusammen.
»Hat er dir was gesagt?«, fragte Dormann seinen KGB-Kollegen Jansen verunsichert.
»Nein. Ich habe gestern Mittag das letzte Mal mit ihm telefoniert. Da hat er auf mich nicht den Eindruck gemacht, er würde heute kneifen. Im Gegenteil, er wollte vielmehr heute die Sau rauslassen.«
»Und jetzt?«
»Woher soll ich das wissen?« Jansen rieb sich die Augen. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender war er gefordert. »Hoffen wir mal, dass er noch kommt. Bei dem musst du mit allem rechnen.«
Was als Erstes passieren würde, damit konnte allerdings auch Jansen rechnen. Kaum hatte Müller die Anwesenheitsliste abgehandelt, da meldete sich schon der Vorsitzende der CDU-Fraktion zu Wort.
»Ich stelle einen Antrag zur Geschäftsordnung«, ließ sich Klaus Schlingenheim gewichtig vernehmen. »Angesichts der Zuhörer, die unübersehbar wegen des KGB-Antrages gekommen sind und denen ich keine lange Wartezeit zumuten möchte, bis wir der Tagesordnung folgend an diesen Punkt gelangen, möchte ich im Namen meiner Fraktion beantragen, den entsprechenden Tagesordnungspunkt vorzuziehen und als ersten zu behandeln.« Seine Absicht war durchschaubar, auch wenn er sie hinter seinem angeblichen Entgegenkommen für die Ratsbesucher versteckte: Ohne ihren Anführer würde die KGB nicht viel zu sagen haben. Die drei Typen hinter Kardinal waren in seinen Augen Nullnummern. Das konnte einer Ablehnung des KGB-Antrags, wie die meisten Mitglieder der CDU-Fraktion ohnehin forderten, nur förderlich sein.
Das Angebot zur Gegenrede musste Jansen annehmen. Zum CDU-Antrag zu schweigen, hätte den anderen Fraktionen nur Oberwasser gegeben. »Sicherlich ist es eine nette Geste gegenüber den Zuhörern, wenn wir den sie interessierenden Tagesordnungspunkt vorziehen würden. Aber die Zuhörer würden es nicht verstehen, wenn die KGB über ihren Antrag diskutieren ließe, ohne dass der Antragsteller selbst bei der Diskussion anwesend wäre. Da sich mein Kollege Kardinal nicht abgemeldet hat, gehen wir davon aus, dass er sich aus plausiblen Gründen verspätet. Ich schlage also vor, den Geschäftsordnungsantrag des verehrten Kollegen Schlingenheim abzulehnen, weil wir damit rechnen, dass mein Kollege Kardinal noch auftaucht. Die Besucher dieser Ratssitzung haben ein Recht darauf, dass über den Antrag meiner Fraktion in Anwesenheit von Kardinal beraten wird.«
Das zustimmende Nicken und die vereinzelten »Bravo!«-Rufe bescheinigten ihm, die richtigen Worte gefunden zu haben. Den Aufstand, den Kardinal machen würde, ginge der Antrag durch, wollte Jansen sich erst gar nicht ausmalen. Kardinal war nicht gerade der angenehmste Zeitgenosse, aber wenn er wütend wurde, war er unerträglich und unberechenbar.
Schlingenheim war gewieft genug, die Meinung der Zuhörerschar richtig zu deuten. Nachdem ihm auch der Vorsitzende der SPD-Fraktion auf der gegenüberliegenden Seite des riesigen Sitzungstisches mit einem Handzeichen signalisiert hatte, seine Fraktion würde dem CDU-Antrag nicht zustimmen, zog ihn Schlingenheim zurück.
Den daraufhin aufbrausenden Beifall der Besucher nahm Müller zum Anlass, eindringlich zu mahnen, Beifallsäußerungen oder Bekundungen des Missfallens tunlichst zu unterlassen. Würde der ordnungsgemäße Verlauf der Ratssitzung nicht gewährleistet sein, würde er von seinem Hausrecht Gebrauch machen und den Saal räumen lassen.
Den zornigen Zwischenruf aus der Menge »Und das nennt man dann Demokratie!« ließ er unkommentiert. Er hatte genug Mühe, den Rat im Zaum zu halten, da wollte er seine Kraft nicht auf Nebenkriegsschauplätzen vergeuden. Die Fraktionen ließen ihn oft genug spüren, dass sie nicht mit ihm einverstanden waren. Lediglich die Uneinigkeit zwischen den vielen Gruppierungen verhinderte seine Abwahl durch den Stadtrat. Weder CDU noch SPD, weder die Grünen noch die FDP als die vier großen Parteien im Rat und schon gar nicht die kleineren Abordnungen wie Unabhängige, KGB oder Rechtspartei wollten in den Verdacht geraten, den von der Bürgermehrheit gewählten Müller zu kippen, um einen ihrer Männer oder eine ihrer Frauen an die Spitze des Rathauses zu bringen.
Der Oberbürgermeister reagierte gelassen auf die immer wiederkehrende Diskussion über seine Abwahl. So lange er für die meisten Bürger ›ne echte Kölsche für Kölle‹ war, so lange würden die Parteien sich hüten, ihn abzuwählen. Müller war sich ziemlich sicher, bei einer eventuellen Neuwahl wieder als Sieger hervorzugehen. Und diese Blamage wollten sich die Parteistrategen nun auch nicht ankreiden lassen.
Müller vermutete richtig. Die Fraktionen drückten aufs Tempo, um so schnell wie möglich zum vermeintlichen Höhepunkt der Sitzung zu kommen. Mit jedem Tagesordnungspunkt, den er abhakte, wuchs die Unruhe bei der KGB und den Besuchern. Wo blieb Kardinal?
Mit allen möglichen Verfahrenstricks versuchte Jansen, den Sitzungsverlauf zu verzögern. Er beantragte geheime und persönliche Abstimmungen, bat um Sachvorträge, obwohl diese schon in den vorbereitenden Ausschusssitzungen vorgetragen worden waren, und scheute auch nicht vor Sitzungsunterbrechungen zurück, angeblich, um sich intern beraten zu wollen.
Es nutzte nichts, die Beratung über den KGB-Antrag rückte immer näher. Und immer noch fehlte vom KGB-Führer Kardinal jede Spur.
Endlich war es so weit. Die Beratung über den KGB-Antrag stand als letzter Punkt der öffentlichen Sitzung an. Der ältere Verwaltungsmitarbeiter, der mit blasser Miene in den Sitzungssaal stürmte, verhieß nichts Gutes. Er war von hinten an den Tisch getreten, an dem der Oberbürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und die Dezernenten der Verwaltung saßen, und reichte dem außen sitzenden Beamten einen Zettel. Das Blatt lief durch viele Hände, bis es endlich bei Müller ankam. Die Dezernenten hatten derweil begonnen, intensiv zu tuscheln, was Müller mit einem mahnenden Blick missbilligte.
Auch er las die Information, schluckte und sprach dann mit betroffener Stimme ins Mikrofon: »Meine Damen und Herren, ich muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ratsherr Kardinal nicht erreichbar ist. Ich habe versucht, ihn ausfindig zu machen. Aber er ist unauffindbar.« Müller räusperte sich kurz. »Ich würde gerne die Sitzung für fünf Minuten unterbrechen und die Fraktionsvorsitzenden beziehungsweise Stellvertreter zu mir bitten.«
Das lautstarke Diskutieren und Lamentieren unter den Zuhörern hinderte ihn nicht daran, seine Entscheidung durchzuführen. Mit den Politikern verschwand er kommentarlos hinter der Tür zum kleinen Besprechungszimmer.
Nach wenigen Minuten kehrten sie zurück. Jansen meldete sich zu Wort, nachdem Müller die Sitzung offiziell wieder eröffnet hatte. »In Anbetracht der Umstände, also wegen der unerklärlichen Abwesenheit unseres Fraktionsvorsitzenden, möchte die KGB ihren Antrag vorläufig zurücknehmen und zu einem späteren Zeitpunkt neu einreichen. Ich bitte um Vertagung. Es wäre bestimmt nicht im Sinne unseres Fraktionsvorsitzenden Kardinal«, er hüstelte, »wenn wir heute über seinen Antrag beraten würden.« Er verschwieg, dass er insgeheim froh war, diesen Antrag nicht begründen und verteidigen zu müssen. Er war dagegen gewesen, aber er hatte sich nicht getraut, gegen Kardinal zu stimmen. So war der unselige Antrag zunächst einmal vom Tisch.
Nach Jansen stimmten die Sprecher der anderen Fraktionen dem Vertagungsantrag der KGB zu. Der einstimmige Beschluss des Rates bedeutete zugleich das Ende der öffentlichen Sitzung. Müller bat die Zuhörer, den Saal zu verlassen.
Mit lautem Getöse leerte sich der große Raum. Zwischen Unzufriedenheit und Entsetzen schwankte die Stimmung der Besucher. Sie fühlten sich auf unerklärliche Weise ausgebremst, um den Lohn ihrer Bemühungen gebracht. Da waren sie so kurz vor dem Ziel und dann fehlte plötzlich Kardinal, der so engagiert ihre Interessen vertrat.
Das durfte nicht sein. Das konnte nicht sein. Aber es war so. Und es kam schnell die Ansicht auf: Da stimmt etwas nicht! Und bestimmt war gekungelt worden, eben, als Müller mit den Politikern im Geheimen beraten hatte.
Wenig emotional reagierte Schlingenheim, als er gemeinsam mit dem SPD-Mann Ringelzweig vor dem großen Aschenbecher im Raucherzimmer eine Zigarette rauchte.
»Siehste, Alphons«, sagte er mit großer Gelassenheit, »manche Dinge regeln sich von selbst.«
Ringelzweig drückte nachdenklich die Kippe im Sand aus. »Du bist gut. Ich bin gespannt, wie das ausgeht mit Kardinal. Was ist, wenn der sogar tot ist? Dann wird jetzt noch zum Heiligen erkoren. Und das ist das Schlimme.« Er lächelte verbittert. »Bisher ist er nur der Kardinal.«
»Pah, Kardinal, dass ich nicht lache!«, lästerte Schlingenheim. »Der Kardinal ist ein ganz mieser Schlammwerfer, ein Populist und ein Verbrecher.«
3.
Die Frage verstörte ihn. Hatte er nicht einmal mehr in Huppenbroich seine Ruhe? Konnte er nicht einmal mehr an einem stinknormalen Mittwochnachmittag ungestört und unbehelligt durch das Dorf laufen?
»Sind Sie Kommissar Böhnke?«, hatte ihn der Mann gefragt, der offensichtlich vor der Einfahrt zum Haus an der Kapellenstraße auf ihn gewartet hatte. Die Frage war mehr Feststellung als tatsächlich Frage gewesen, und Böhnke neigte dazu, sie zu verneinen. Er war kein Kommissar mehr, er war pensioniert, demnach Kommissar außer Dienst, ein kranker Mann, der wenige Monate vor dem 60. Geburtstag stand und der aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand geschickt worden war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!