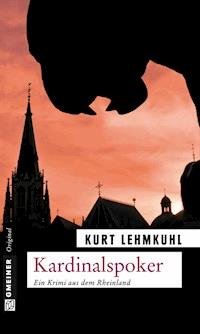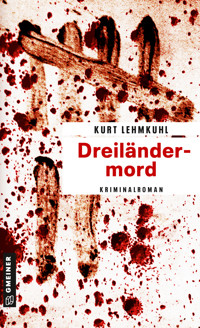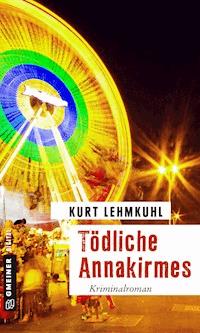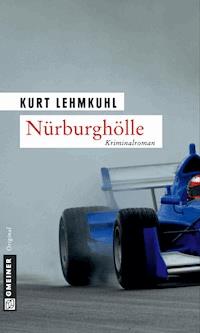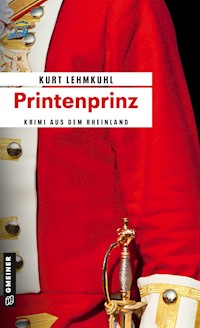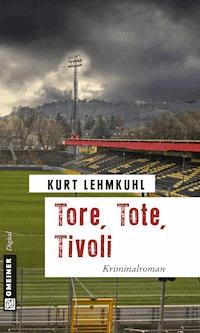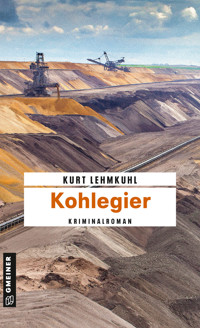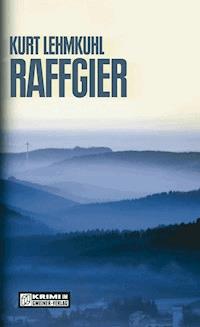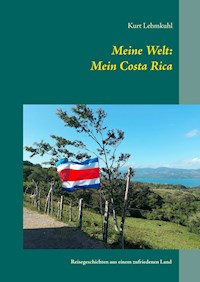Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalist Helmut Bahn
- Sprache: Deutsch
Turbulente Zeiten auf Mallorca. Der einjährige Sohn des Fabrikantenehepaars Franken wird entführt, seine Babysitterin ermordet. Tatverdächtig ist ein kürzlich aus der Haft entlassener Gewaltverbrecher, der vor zehn Jahren aufgrund der Zeugenaussage von Frankens Bruder verurteilt worden war. Redakteur Helmut Bahn vom Dürener Tageblatt wird mit der Übergabe des Lösegeldes beauftragt, die auf Mallorca stattfinden soll. Dort versucht Bahn zugleich, mithilfe seiner Freunde das Verbrechen aufzuklären. Dabei zieht es immer mehr Verdächtige nach Mallorca …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lehmkuhl
Mallorquinische Träume
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: © © Annett Vauteck – istock.com
Umschlaggestaltung: Simone Hölsch
ISBN 978-3-7349-9442-5
1. Kapitel
Anne spürte die Hand in ihrem Nacken und wollte schreien.
Doch sie kam nicht dazu.
»Nimm’s nicht persönlich, Mädchen«, hörte sie eine kalte, laute Stimme. Dann griff eine zweite Hand fest und schmerzhaft in ihr Haar und riss ihren Kopf mit einem brutalen Ruck nach hinten.
Mit einem grässlichen Knacken brach das Genick.
Tot sank Anne auf die Couch zurück.
Viele ihrer Klassenkameradinnen hatten Anne um den Job beneidet. Jetzt waren sie heilfroh, dass sie diese einträgliche Tätigkeit nicht ausgeübt hatten; trotz des vielen Geldes, das es dafür gab. 50 Euro auf die Hand bekam die Schülerin jedes Mal, wenn sie in der Villa der Familie Franken übernachtete und Babysitterin für den knapp einjährigen Sprössling der Unternehmerfamilie spielte.
Schon wenige Monate nach der Geburt von Uwe hatte die Gymnasiastin zunächst tagsüber stundenweise, dann später auch abends und zuletzt sogar über Nacht die Aufsicht und Betreuung des Säuglings übernommen. Durch ihre Mutter, die als Putzfrau im Privathaushalt der Franken arbeitete, war die 17-Jährige an die lukrative Beschäftigung gekommen, mit der sie ihr Taschengeld verdiente.
So hatte Anne miterlebt, wie der Junge langsam heranwuchs, sie begeisterte sich mit den Eltern an seinen ersten Lauten und freute sich über das lachende Gesicht, mit dem er sie begrüßte, wenn sie ihn auf den Arm nahm und durch die geräumige Villa trug.
Das Mädchen besaß das uneingeschränkte Vertrauen von Uwes Eltern und Anne war fest entschlossen, dieses Vertrauen niemals zu enttäuschen oder gar zu missbrauchen. Es wäre für sie ein Leichtes gewesen, mehr Vorteile aus ihrer Tätigkeit als Kindermädchen herauszuholen. Sie hatte freie Hand in dem großen, prächtigen Haus des jungen Unternehmers nahe der Rur. Sie konnte während der Abwesenheit der Bewohner mit deren stillschweigender Duldung tun und lassen, was sie wollte: in der Sauna schwitzen, im Swimmingpool baden oder im Fitnesskeller Gymnastik betreiben. Wahrscheinlich hätte niemand etwas bemerkt oder gesagt, wenn sie sich aus den Weinvorräten oder von den Champagnerflaschen in der üppig gefüllten Vorratskammer bedient hätte.
Anne kam überhaupt nicht der Gedanke, ihre vertrauensvolle Anstellung für diese verlockenden Annehmlichkeiten auszunutzen.
Die Welt der Franken, das war nicht ihre Welt. Das war die Welt der Reichen, in die sie gelegentlich hineinschnuppern durfte, aber zu der sie nicht gehörte. Anne war froh, die betreuende Arbeit zu haben, die ihr viel Geld einbrachte, und sie wollte alles tun, um diese Tätigkeit noch lange zu behalten. Sie war eine ehrliche Haut und sie hatte in ihrer kleinbürgerlichen Familie gelernt, bescheiden zu sein.
Kurz nach sieben war Anne am Freitagabend vereinbarungsgemäß zur ruhig gelegenen Doktor-Overhues-Allee gekommen und hatte von der stets besorgten Helena Franken die letzten Anweisungen erhalten, wie sie Uwe zu behandeln hatte. Der Kleine hatte Anne sabbelnd angestrahlt und mit den Händchen nach ihren langen, braunen Haaren gegrapscht.
Matthias Franken hatte ihr, wie immer, im Voraus die 50 Euro als Vergütung gegeben, ehe er drängelnd mit seiner Frau davonfuhr. Zu einer Spätsommerparty, die Freunde in Köln veranstalteten, wollten sie, so hatte er Anne erklärt. Dort würden sie auch übernachten. Er hatte Anne eine Telefonnummer aufgeschrieben, unter der er und Helena zu erreichen wären für den Fall, dass etwas Ungewöhnliches geschehen sollte.
Aber was sollte schon passieren?
Schon oft war das Ehepaar über Nacht fortgeblieben und ebenso oft hatte Anne auf Uwe aufgepasst. Und wie immer stand Anne mit Uwe auf dem Arm im Hauseingang und winkte den beiden nach, bis sie im Mercedes an der Straßenecke verschwanden. Sie würden sich telefonisch melden, bevor sie am nächsten Morgen in Köln wieder abfuhren, hatte Matthias Franken noch zu Anne gesagt.
Aufatmend trat Anne hinter die schwere Haustür. Der Abschied war nach dem immer gleichen Zeremoniell abgelaufen. Helena hatte ihren Sohn ein ums andere Mal geherzt, als sei es ein Abschied auf ewig, Matthias hatte mit wachsender Nervosität auf die Abfahrt gedrängt und Anne, wie immer, mit einem Augenzwinkern gebeten, nicht die Alarmanlage auszuschalten.
»Keine Bange«, hatte Anne gut gelaunt versichert, »unser Goldstück kommt uns schon nicht weg.« Sie passte gerne auf Uwe auf und verzichtete dafür bereitwillig auf eine Fete am Abend, zu der sie von Freundinnen eingeladen worden war.
Das Mädchen trug das Kleinkind in das Wohnzimmer und legte es in einen großen Laufstall, in dem Uwe sofort nach Spielbällen haschte. Anne griff in ihre Schultasche und holte ein Buch heraus. Sie wollte die Zeit und die Gelegenheit nutzen, um sich für die Englischklausur vorzubereiten, die sie am Montag schreiben sollte.
Uwe war ein ausgesprochen genügsames und pflegeleichtes Kind. Es schien, als warte er geduldig, bis Anne die Zeit fand, sich mit ihm zu beschäftigten. Er lachte übers ganze Gesicht, als sich das Mädchen schließlich über ihn beugte und ihn anhob.
»Jetzt wird gebadet«, verkündete sie verheißungsvoll und Uwe brabbelte begeistert mit.
Er planschte frohgestimmt in der Plastikwanne und zog nur kurz einen Schmollmund, als Anne ihn abtrocknete. Geschickt legte ihm das Mädchen auf der Wickelkommode die Einmalwindel um und den bereitliegenden Schlafanzug. Dann trug Anne ihn in die Küche, in der schon in einer Warmhaltekanne die Flasche mit der Kindernahrung bereitstand. Gierig nuckelte Uwe den Flascheninhalt bis zum letzten Tropfen, anschließend rülpste er laut vernehmlich und brachte damit Anne zum Lachen. »Ab ins Bett und schlafen!«, sagte sie fidel und trug Uwe ins Kinderzimmer. Dort war bereits die Couch vorbereitet, auf der Anne die Nacht verbringen würde.
Uwe machte keine Mühe. Kaum hatte Anne ihn gebettet, da schloss er bereits, rhythmisch an seinem Nuckel saugend, müde die Augen.
Anne blieb einige Minuten neben seinem Bettchen sitzen, ehe sie wieder ins Wohnzimmer ging und sich erneut ihrer Englischlektion widmete.
Das Telefon unterbrach ihre konzentrierte Lerntätigkeit. Es war schon 23 Uhr, wie Anne erstaunt mit einem Blick auf die Standuhr erkannte. Immer um 23 Uhr rief Helena Franken an, insofern verunsicherte dieser Anruf das Mädchen nicht. Der pünktliche Kontrollanruf der stets verängstigten Mutter gehörte auch zum Ritual des Kinderhütens.
Alles sei in Ordnung, bestätigte Anne der Frau, deren Besorgnis sie nicht verstand. ›Wie kann man sich bloß so anstellen?‹, dachte sich Anne, während sie mit dem schnurlosen Telefon ins Kinderzimmer ging. Uwe schlief tief und fest und atmete in gleichmäßigen Zügen.
»Ihr Sohn ist das glücklichste Kind auf der Welt«, sagte sie beruhigend ins Mikrofon, »er freut sich schon darauf, Sie morgen früh wiederzusehen, Frau Franken.«
Die Schülerin nahm den Anruf zum Anlass, die Arbeit für die Schule zu beenden. Nach der telefonischen Kontrolle würde es ruhig bleiben in der Nacht. Anne zog sich um und legte sich leise auf die Couch. Sie lauschte den gleichmäßigen Atemzügen von Uwe und schloss die Augen.
Den kurzen Gedanken, die Haustüre nicht verriegelt zu haben, verwarf sie wieder. Daran dachte sie jedes Mal vor dem Einschlafen und jedes Mal war die Tür verschlossen gewesen. Warum sollte es ausgerechnet jetzt anders sein?
Zunächst glaubte Anne, zu träumen, als sie die flüsternde Stimme hörte. Doch spätestens, als das grelle Licht der starken Taschenlampe sie schmerzhaft blendete, wusste sie, dass sie wach war. Erschrocken fuhr das Mädchen hoch und hielt sich schützend den Arm vor die Augen.
Anne spürte die Hand in ihrem Nacken und wollte schreien. Doch sie kam nicht dazu.
»Nimm’s nicht persönlich, Mädchen«, hörte sie eine kalte, laute Stimme. Dann griff eine zweite Hand fest und schmerzhaft in ihr Haar und riss ihren Kopf mit einem brutalen Ruck nach hinten.
Mit einem grässlichen Knacken brach das Genick.
Tot sank Anne auf die Couch zurück.
2. Kapitel
Nie wieder! Das hatte sich Thomas Thielen geschworen. Nie wieder würde er im Knast landen. Diesen Schwur hatte er zwar schon mehrmals geleistet und immer wieder gebrochen, aber dieses Mal würde er ihn einhalten. ›Nie wieder Knast‹, schwor er sich. Lieber würde er sich umbringen.
Fast ein Drittel seines Lebens hatte der gedrungene, kräftige Mann hinter Gittern verbracht wegen verschiedener Gewaltdelikte: Raub, Körperverletzung und zuletzt wegen Totschlags. Zu einer 15-jährigen Freiheitsstrafe hatte ihn das Gericht verurteilt, zehn Jahre hatte er in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach abgesessen, dann hatte ihn die Gefängnisleitung gehen lassen. Wegen guter Führung, hatte es geheißen, und wegen seiner guten sozialen Entwicklung.
Das Abschlussgespräch mit dem Gefängnispsychologen, dessen Gutachten letztlich ausschlaggebend für die vorzeitige Freilassung gewesen war, stieß Thielen trotz aller Dankbarkeit, die er dem Mann entgegenzubringen hatte, immer noch bitter auf. »Sie sind reif für das Leben in der Gesellschaft«, hatte ihm der Seelendoktor mit vermeintlich voller Überzeugungskraft gesagt. »Ich bin mir absolut sicher, dass Sie Ihren Weg durchs Leben finden und gehen werden.« Und dabei hatte er ihn angelächelt und ihm mit beiden Händen beim Abschied die Rechte geschüttelt, dass Thielen schon befürchtete, im Schwulentreff gelandet zu sein.
Thielen wusste nicht, ob er wegen des salbungsvollen Zuspruchs lachen oder weinen sollte. »Wohin soll ich denn? Wer nimmt denn schon einen Knacki wie mich? Mit meinen Vorstrafen. Ohne Schulabschluss und Berufsausbildung. Anfang fünfzig. Was soll ich machen?«, hatte er gefragt und der Psychologe hatte nur bedauernd mit den Schultern gezuckt, ohne eine hilfreiche Antwort geben zu können. Es werde sich finden, hatte er als erbärmlich schwachen Trost parat. »Sie schaffen das schon«, hatte er fast trotzig Thielen mit auf den Weg gegeben, wobei er wahrscheinlich noch weniger als Thielen wusste, worin dieser Weg in die Welt jenseits der Gefängnismauern bestand. Und insgeheim war der Psychoklempner wohl auch nicht überzeugt davon, dass der Gefangene für lange Zeit in Freiheit bleiben würde.
»Was werden Sie tun?«, hatte der Anstaltsleiter gefragt.
Thielen hatte schwach gelächelt und geantwortet, was der grauhaarige Schwachkopf von ihm hören wollte: »Ich werde mich in Düren beim Sozialamt melden und zum Arbeitsamt gehen. Der Rest wird sich dann von allein ergeben.«
Was hätte er sonst auch antworten sollen? Hätte er dem Knastchef sagen sollen, dass er das Schwein suchen wollte, weswegen er im Bau gelandet war? Hätte er sagen sollen, dass es für ihn nur einen Gedanken gab, der ihn die Zeit im Knast überstehen ließ? Der Gedanke an Rache für das Unrecht, das an ihm begangen wurde. Seine Unschuld glaubte ihm ohnehin niemand, seine Rachegelüste verschwieg er wohlweislich, um die Entlassung nicht zu gefährden.
Die Gefängnisbürokratie in Rheinbach gab sich alle Mühe, Thielens Einstieg in die neuerliche Freiheit so umständlich wie möglich zu gestalten. Nachdem es nahezu vier Monate gedauert hatte, bis er nach der offiziellen Information auf vorzeitige Entlassung tatsächlich auch die Entlassungsbescheinigung erhielt, brachte es die Knastverwaltung am Freitag fertig, die Entlassung bis zum späten Nachmittag hinauszuzögern. Als Thielen endlich mit der blauen, unauffälligen Sporttasche in der Hand, in der er seine dürftigen Habseligkeiten mitnahm, vor dem Gefängnistor stand, war es längst zu spät, noch irgendeine Behörde aufzusuchen.
Feierabend war überall angesagt, die Menschen freuten sich aufs Wochenende.
Niemand machte sich in irgendeiner Amtsstube Gedanken um einen Strafentlassenen namens Thielen, der ein wenig verloren über die staubige Straße stadteinwärts trottete auf der Suche nach einer Bushaltestelle oder dem Bahnhof. Thielen hätte ein Taxi nehmen können, das ihm vom Gefängnispförtner mit gespielter Gefälligkeit und wegen vermuteter Provision geordert worden wäre, aber er hatte darauf verzichtet. Die wenigen Kröten, die er als Entlassungsgeld bekommen hatte, waren auch so viel zu schnell aufgebraucht, als dass er sich den Luxus eines Taxis hätte leisten können.
›Soll ich mich sofort vor den Zug werfen oder mich lieber hineinsetzen?‹, fragte sich Thielen, als im Kölner Hauptbahnhof die Regionalbahn Richtung Aachen einfuhr. Von Rheinbach nach Euskirchen und von dort nach Köln hatte er Glück gehabt. Er blieb unbehelligt, kein Schaffner hatte ihn nach dem Fahrschein gefragt, den er nicht besaß. ›Ich habe heute meinen Glückstag‹, sagte er sich und entschied sich fürs Einsteigen. ›Außerdem hast du noch vieles zu erledigen‹, rief er sich zum wiederholten Male in Erinnerung.
Thielen wollte den vermaledeiten Zeugen finden, das arrogante Schwein, das damals das Gericht von seinem angeblichen Verbrechen überzeugt hatte. Und er wollte seine ehemalige, knapp zwei Jahrzehnte jüngere Lebensgefährtin suchen, diese Schlampe, die ihn von einem Tag auf den anderen verlassen hatte, als er im Untersuchungsgefängnis saß und es hieß, er sei ein Totschläger.
Schließlich wollte er in Düren in aller Bescheidenheit in den großen Unternehmen anfragen, ob sie nicht eine Hilfsarbeit für einen arbeitswilligen Mann seines Alters hätten. Thielen hoffte, dass sich niemand in den Personalabteilungen an seine unrühmliche Vergangenheit erinnerte oder ihn deswegen abwies.
Warum er ausgerechnet nach Düren wollte, hatten ihn der Psychologe und der Anstaltsleiter gefragt.
»Weil es meine Heimat ist«, hatte Thielen geantwortet. Die Stadt hatte ihm zwar in seinem Leben nicht viel Glück gebracht, doch zog es ihn in seine Geburtsstadt, auch in der Erwartung, vielleicht Kumpel aus vergangenen Zeiten zu finden, als sie sich noch im unsanierten Dürener Norden herumgetrieben hatten.
Thielen betrachtete neugierig aus dem Zugfenster die Landschaft und die Orte, die an ihm vorbeihuschten. Kerpen, Buir, die lieblos gewarteten Bahnhöfe sahen für ihn unwirklich aus, anders, als er sie in seiner Erinnerung hatte. Leichtes Herzklopfen überkam ihn, als sich die Regionalbahn der Kreisstadt Düren näherte. ›Auf geht’s‹, munterte er sich auf, als er mit der Tasche in der Hand auf den Bahnsteig kletterte.
Er hatte Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Zu viel hatte sich in den Jahren rund um das alte, sanierte Bahnhofsgebäude, das noch aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhundert stammte, verändert. Gleich drei Ausgänge gab es inzwischen, den ehemaligen Hauptausgang, den neuen zum großen Busbahnhof und einen weiteren, der durch einen kleinen Tunnel zur Innenstadt führte.
Thielen musterte die vielen Menschen, die mit ihm den Zug verlassen hatten, und schaute in die Gesichter von Passanten, die es offenbar alle sehr eilig hatten. Sie nahmen ihn nicht zur Kenntnis. Er war für sie ein nicht sonderlich gut und obendrein unmodern gekleideter, etwas unsicherer Zeitgenosse, mittelgroß, stämmig, schlecht rasiert, mit derben Gesichtszügen und einer Knollennase, die ihn stets an einen Nasenbeinbruch nach einer Prügelei erinnerte, und mit schütteren, braungrauen Haaren, denen der Friseur im Knast noch am Vortag einen kurzen Einheitsschnitt verpasst hatte. Er war kein Typ, dem die Sympathien zuflogen, er hatte sich immer den Respekt erkämpfen müssen. ›Und jetzt soll ich meinen Weg in die Gesellschaft suchen und finden.‹ Thielen blieb nur eine Ausflucht in die Ironie.
Er wunderte sich über die Veränderung der Innenstadt. Es war viel gebaut worden in den letzten sieben Jahren. Das Gesicht der Josef-Schregel-Straße hatte sich gewaltig geändert. Es war moderner geworden, von den Geschäften bundesweit tätiger Filialketten bestimmt, mit noch mehr Reklame und noch mehr Licht. Autos waren nur noch auf einem Teilstück geduldet.
Dennoch hatte er schnell die Orientierung gefunden. Thielen steuerte die nahe Fußgängerzone an, in der es Telefonzellen gab, wie er sich erinnerte.
Darin würde er ein Verzeichnis finden und damit wahrscheinlich den Namen und Wohnort des Mannes, den er suchte.
Lange saß Thielen in der Kneipe an der Theke. Die anderen Gäste hatten sehr schnell das Interesse an dem grantigen und grimmig blickenden Mann, der ihnen fremd war, verloren und palaverten ohne ihn über den Niedergang des Fußballs in Düren. Die stämmige Wirtin beäugte ihn mit unverhohlenem Unmut. Auf Gäste, die sich bis zur Sperrstunde an einem Glas Mineralwasser und einer Frikadelle festhielten und dabei stumm vor sich hin stierten, konnte sie liebend gerne verzichten. Diese Gäste versauten nur die Stimmung und damit das Geschäft.
Thielen ließ sich von den missbilligenden Blicken nicht beirren. Er hatte die beiden ausliegenden Dürener Tageszeitungen gelesen und sich Gedanken über sein Vorgehen gemacht. Ein Zimmer würde er sich für die Nacht nicht suchen. Es war mild, nach dem Wetterbericht in den Zeitungen würde es trocken und warm bleiben und das Thermometer auch in der Nacht nicht unter 15 Grad sinken. Er würde auf einer Parkbank übernachten, hinten an der Doktor-Overhues-Allee oder im Stadtpark oder direkt an der Rur.
Es war fast drei, als die Wirtin resolut die letzten Kneipenbesucher hinaustrieb.
Höflich grüßend trollte sich Thielen. Er hätte nicht damit gerechnet, dass ihm die Frau ein hämisches »Auf Nimmerwiedersehen« hinterherrief.
Er beherrschte sich. Früher wäre eine derartige Bemerkung für ihn Grund genug gewesen, eine Kneipe in alle Einzelteile zu zerlegen. Sein Jähzorn hatte ihn oft zu Handlungen getrieben, die er anschließend selbst nicht verstand. ›Benimm dich!‹, redete er sich ein und atmete tief durch, ›es ist es nicht wert.‹
Langsam schlenderte Thielen durch die leere Stadt, in der es wegen des vollen Mondes am wolkenlosen Himmel überraschend hell war. Er fand das Hoesch-Museum, das Amtsgericht, das Hochhaus an der Kreuzung, in dem die Polizei untergebracht war, und die Aachener Straße, auf der um diese Uhrzeit nur gelegentlich ein Auto fuhr und von der er hinter der Rurbrücke linker Hand sein Ziel ansteuerte.
Es war immer noch angenehm lau. Das beruhigende Rauschen des Flusses war das einzige Geräusch, das Thielen bei seinem langsamen Gang über die Straße hörte. Ohne Mühe fand er das Haus, auf das er durch den kleinen Vorgarten zuschritt. Als er das Namensschild an der Haustür lesen wollte, erkannte er, dass das Schloss nicht eingerastet war. Mit einem leichten Druck ließ sich die Tür öffnen.
Ehe sich Thielen besinnen konnte, war er in den Flur eingetreten. Er sah im Mondlicht die Taschenlampe auf dem Tisch in der Garderobe und griff danach.
Auf leisen Sohlen schlich Thielen durch das stille Haus. Diesen Luxus hatte er nicht erwartet, aber er war überzeugt, das richtige Haus und damit den richtigen Mann gefunden zu haben. ›Verschwinde jetzt!‹, wollte er sich befehlen. Dann näherte er sich doch, wie von einem inneren Drang angezogen, einem Zimmer, dessen Tür offen stand. Er leuchtete mit der Taschenlampe in den Raum hinein und traf mit dem hellen Strahl das Gesicht von Anne. Sie schien sich zu bewegen.
»Verdammte Scheiße«, sagte Thielen leise zu sich und machte erschrocken einen schnellen Schritt nach vorne auf das Mädchen zu.
3. Kapitel
»Mist!«, brüllte Helmut Bahn laut durch die noch leeren Räume der Redaktion. »Verfluchter Mist!« Wütend sprang der Journalist von seinem Schreibtischsessel auf und schleuderte den zerknüllten Lokalteil der Dürener Zeitung in die Ecke. Was der Redakteur des Dürener Tageblatts in der großen Konkurrenzzeitung lesen musste, hatte ihm bereits am frühen Montagmorgen die Laune gründlich verdorben und Sodbrennen verursacht.
»17-Jährige tot – Baby verschwunden«, so hatten die Kollegen in großen Buchstaben über ihren fünfspaltigen Aufmacher getitelt. Mehrere Male hatte Bahn mit wachsender Ohnmacht und Verzweiflung den Artikel gelesen. Beim ersten Mal traute er seinen Augen nicht, war fassungslos und unfähig, den Inhalt des Geschriebenen zu verstehen. Dann las er ungläubig und mit offenem Mund staunend die Texte. Erst anschließend, bei der wiederholten Lektüre, wurde ihm schmerzhaft bewusst, dass die DZ ihre Leser über ein Gewaltverbrechen informierte, das sich in der Nacht zum Samstag fast vor seiner Haustür ereignet hatte und von dem er, im Gegensatz zu den Kollegen, nichts mitbekommen hatte.
Es dauerte lange, ehe Bahn seine Gedanken sortiert und die Informationen über das kriminelle Geschehen verdaut hatte. Nach dem Zeitungsbericht hatten Helena und Matthias Franken bei ihrer Rückkehr von einer Feier in Köln am Samstagmorgen in das Wohnhaus das 17-jährige Kindermädchen Anne B. tot aufgefunden. Die Babysitterin war aller Wahrscheinlichkeit nach von Entführern überrascht und ermordet worden, hieß es in dem Bericht, ohne die Umstände des Verbrechens näher zu erläutern. Der einjährige Sohn Uwe des Fabrikantenehepaars war spurlos verschwunden; mithin ging die Polizei von einer Entführung aus. Bebildert waren die Artikel mit einer Außenansicht des Hauses, einem Foto der Eheleute, einen Porträt des Kindes und einem Passfotos von Anne.
Zu dem ermordeten Mädchen wurden in einem eigenen Bericht ergänzende Angaben gemacht. Sie war Gymnasiastin gewesen, Tochter von Frankens Putzfrau und galt als zuverlässig, fasste Bahn den Inhalt für sich zusammen.
Den Artikel über das Ehepaar schenkte sich Bahn betroffen. Er kannte Matthias Franken seit der Kindheit. Sie waren zwar nicht gerade befreundet, aber seit Jahrzehnten gut bekannt. Auch beim Polterabend anlässlich der Hochzeit vor rund neun Jahren war er gewesen. Seitdem hatten sie gelegentlich beim zufälligen Aufeinandertreffen oberflächlich miteinander geplaudert. Von Frankens Ehefrau hatte er überhaupt keine Vorstellung mehr.
Bahn nahm sich vor, selbst mit Franken zu sprechen. Vielleicht bekam er unter vier Augen die Informationen von ihm, die bislang nicht berichtet worden waren, und er erinnerte sich mit Magenschmerzen an einen dramatischen Vorfall vor etwa sieben Jahren, der jetzt eine schier unglaubliche Fortsetzung gefunden hatte.
Bahn schüttelte sich bei seinem Blick in die Vergangenheit und richtete seine Konzentration auf den letzten Artikel. »Wir haben noch keinen Tatverdächtigen«, wurde darin Kommissar Wenzel von der Kriminalpolizei Düren wörtlich zitiert. Die Spurensicherung am Tatort habe zwar einige Erkenntnisse gebracht, aber sie ließen noch keine Rückschlüsse auf den oder die Täter zu. »Wir gehen von einer geplanten Entführung aus, bei der das Kindermädchen ermordet wurde«, sagte Wenzel nach dem Zeitungsartikel. »Das Mädchen ist wahrscheinlich von den Verbrechern überrascht worden.«
Erst im allerletzten Absatz der Berichterstattung verriet der DZ-Redakteur, woher er sein Wissen hatte: von einer Pressekonferenz der Kripo am Sonntagnachmittag.
›Wieso sind wir nicht informiert worden?‹, schoss es Bahn durch den Kopf, während er ruhelos durch das Zimmer ging. Er vermutete spontan, sein Intimfeind Wenzel habe ihn bewusst übergangen. Zu Pressekonferenzen wurden üblicherweise allen Medien eingeladen. ›Das Schwein von Wenzel hat uns absichtlich übergangen‹, dachte Bahn verärgert weiter. Seine innige Feindschaft zu dem dicken Kommissar war in Düren hinlänglich bekannt. Kaum war Wenzels Chef, Kriminalhauptkommissar Küpper, einmal übers Wochenende nicht im Lande, ließ der Polizist Bahn am langen Arm verhungern. Das würde ein dienstliches Nachspiel haben, schimpfte Bahn vor sich hin. Er würde darauf drängen, Wenzel zur Rechenschaft zu ziehen, sagte er zornig zu sich, als er zum Faxgerät ins Sekretärinnenzimmer ging.
Für einen Augenblick stutzte er, als er in der Ablage keine einzige Mitteilung fand. Dann erschrak er wegen einer unangenehmen Befürchtung. In der Tat: Das Fach für das Faxpapier war leer. ›Das darf doch nicht wahr sein‹, redete Bahn entgeistert mit sich und füllte herzklopfend das Fach auf.
Prompt spuckte das Gerät wenige Sekunden später die elektronisch gespeicherten Nachrichten aus. Schon der erste Ausdruck enthielt als Nachtrag zum Pressebericht der Polizei vom Sonntagmorgen die von Wenzel unterschriebene Einladung zu einer wichtigen Pressekonferenz am späten Nachmittag. Der Eingang der Einladung war im Faxgerät um 14.11 Uhr registriert worden. Bahn hielt das Blatt noch beklommen in den Händen, als bereits das nächste Fax gedruckt wurde: Um 18.45 Uhr hatte die Kriminalpolizei gestern ihren Pressebericht über den Entführungsfall Franken nachgeschoben und dabei auch Fotos angeboten.
»Warum haben wir das nicht, Herr Kollege?«
Bahn hatte zwar mit dem unvermeidlichen Anruf aus der Zentralredaktion des Tageblatts in Köln gerechnet, allerdings nicht so früh und nicht mit der ungewohnten Schroffheit in der Stimme des Chefs vom Dienst.
»Ich glaube, Sie haben den Beruf verfehlt, Herr Bahn«, blaffte ihn der Chef vom Dienst Waldmann an. »Oder können Sie mir nachvollziehbar erklären, warum Sie als einziger Journalist aus Düren nichts von dem Mord und der Entführung mitbekommen haben?« Waldmann war schier außer sich. »Was machen Sie eigentlich in einem Sonntagsdienst?«
Bahn wollte ebenfalls aufbrausen, schlug dann aber vorsorglich einen gemäßigten Ton an. Es würde seine missliche Ausgangslage nicht verbessern und obendrein nichts bringen, sich mit dem aufgebrachten CvD zu streiten. Waldmann würde das bessere Ende für sich behalten, weil er mehr Macht besaß. Auch wenn er keine Ahnung hatte und auf dem Posten eine Fehlbesetzung war.
»Unser Faxgerät hatte mal wieder seine Macken«, log Bahn dreist. »Es ist ja nicht das erste Mal, dass es versagt, wenn es darauf ankommt.« Dieses Argument traf im Prinzip zu und Bahn war froh, dass es ihm eingefallen war. Schon wiederholt hatten sich Bahn und Fritz Waldhausen, der Lokalchef des Dürener Tageblatts, in Köln über das unzuverlässige, störungsanfällige und veraltete Gerät beschwert. Noch am Donnerstag hatte Waldhausen deshalb den CvD angerufen und dringend um einen Austausch gebeten.
»Das haben wir halt davon, wenn wir hier draußen nur mit Billigprodukten und Auslaufmodellen beliefert werden«, meinte Bahn lakonisch. »Dann müssen wir mit solchen Pleiten leben.«
Abrupt beendete Waldmann das Gespräch, das in eine andere, nicht von ihm gewünschte Richtung lief. »Sorgen Sie dafür, dass wir morgen besser sind als die anderen«, bellte er im Kommandoton in den Hörer.
Bahn atmete tief durch. Es schien, als könne er seine beiden Fehler vom Sonntag verbergen. Er hatte zunächst, als er schon kurz nach eins nach Hause fuhr, nicht den Papiervorrat im Faxgerät kontrolliert. Außerdem war er nicht in die Redaktion gefahren, nachdem er am Abend mit Gisela von einer Spritztour in die Eifel zurückgekommen war. Üblicherweise musste der Kollege, der Sonntagsdienst hatte, noch einmal einen Kontrollgang machen, aber Bahn hatte darauf verzichtet und lieber die Zweisamkeit mit seiner Gattin genossen.
Glücklicherweise hatte er den Ausweg gefunden, um die Verantwortung für die journalistische Pleite von sich abzuwälzen. Auch wenn er sich gehörig über diesen Reinfall ärgerte, brauchte niemand von seinem Versagen wissen. Allenfalls seinen Freunden Waldhausen und Küpper würde er vielleicht später einmal von seinem peinlichen Missgeschick berichten.
Der Lokalchef und der Kriminalkommissar waren erst in der Nacht von einem Freundschaftstreffen der Dürener Polizei in der französischen Partnerstadt Valenciennes zurückgekommen und holten den Schlaf nach, den sie bei den Franzosen versäumt hatten.
4. Kapitel
Atemlos und entgeistert war Thielen aus Frankens Haus gestürzt. Mit nervösen Augen blickte er sich verstört auf der Straße um und war erleichtert, keinen Menschen zu sehen. Er überlegte nicht lange und hastete durch die schlafende Stadt zum Bahnhof. Nur gelegentlich fuhr ein Auto vorbei, bei jedem Herannahen zwängte sich Thielen in einen Hauseingang. Er wollte ungesehen bleiben. Niemand sollte sagen können, er sei in dieser Gegend gewesen. ›Zum Bahnhof und dann weg!‹, hatte Thielen für sich entschieden. ›In den ersten Zug, egal wohin. Hauptsache, zunächst einmal weg von hier.‹
So hatte er sich die Rückkehr in seine Heimatstadt nicht vorgestellt, so hatte er sich nicht rächen wollen. Er war sich immer noch nicht im Klaren darüber, was überhaupt im Haus von Franken passiert war. Es war alles so schnell gegangen, es war alles so unwirklich gewesen.
Zusammengekauert saß Thielen am Fenster im Zugabteil und ließ die Dunkelheit an sich vorbeiziehen. Kaum hatte er den Bahnhof betreten, war ein Zug eingefahren, ein Interregio von Köln nach Aachen, der bei der nächtlichen Fahrt zwischen den beiden Großstädten an der Rur den einzigen Zwischenhalt einlegte. Der erschöpfte Mann war alleine in dem Abteil, wartete darauf, dass sich sein Puls endlich beruhigte, und hoffte, dass kein Zugbegleiter auf ihn aufmerksam wurde, um den Fahrpreis zu kassieren.
Die Gedanken in seinem Kopf fuhren Achterbahn. Siedend heiß fiel ihm der Fehler ein, den er gemacht hatte, der unverzeihliche Fehler, dem selbst der unprofessionellste Einbrecher nicht passierte, der ihm aber in seiner Hektik unterlaufen war: Er hatte die Taschenlampe in dem Haus zurückgelassen, sie erschrocken fallengelassen, als er fluchtartig den Tatort verließ.
Jetzt war es zu spät, den Fehler zu beheben.
Als Thielen den Zug in Aachen verließ, war ihm klar, was geschehen würde.
Unruhig und hungrig lungerte der frisch entlassene Sträfling in der Bahnhofsnähe herum, bis endlich ein Stehimbiss öffnete. Vor Anspannung zitternd kaufte er zwei klebrige Frikadellenbrötchen, die er hastig in sich hineinschlang. Kurz orientierte er sich am großen Stadtplan, dann machte er sich zielstrebig auf den Weg zum Stadtwald. Dort würde er irgendwo abseits der Wirtschaftswege und der Wanderpfade im Dickicht verschwinden und nach Möglichkeit den Tag verschlafen. Als Unterlagen mussten die samstäglichen Tageszeitungen dienen, die Thielen aus Briefkastenschlitzen gezogen hatte. In den Zeitungen hatte noch nichts über das Verbrechen gestanden. Die Zeitungen begeisterten sich vielmehr am Fußballspiel der Alemannia am Vorabend auf dem Tivoli, als wenn es nichts Wichtigeres auf der Welt gab.
Thielen verschlief den Samstag. Er wunderte sich über seinen tiefen und traumlosen Schlaf, als er aufwachte und sich erholt fühlte. Nachdem er sich im Gebüsch entleert hatte, suchte er einen Weg, der ihn zu einer Wasserstelle oder zurück in die Stadt führen könnte. Er ließ es langsam angehen, versteckte sich vor Spaziergängern und war froh, endlich Wasser gefunden zu haben.
Wegen seines Erscheinungsbildes machte er sich keine Sorgen. Er würde wie ein heruntergekommener Penner wirken. Na und? Bei einem Sozialamt konnte er sich ohnehin nicht mehr blicken lassen, man würde ihn sofort einkassieren. Was blieb ihm schon? Das bisschen Freiheit. Die paar Kröten, für die er sich nicht viel kaufen konnte. Am besten wäre es, abzuhauen. Aber wohin? Die Polizei würde ihn, den brutalen Gewaltverbrecher, überall suchen und irgendwann finden.
›Scheiß Spiel‹, fluchte Thielen, ›und ich stecke mittendrin.‹
Ohne Ziel lief er durch die ruhigen Wohnstraßen und vermied den Kontakt mit Menschen. Als das Hungergefühl unerträglich wurde, steuerte er einen türkischen Imbiss an und bestellte einen Döner, nicht wissend, was er essen würde. In den Knastjahren hatte es allenfalls Pizza gegeben, aber niemals Döner.
Er war froh, als es endlich dämmerte und mit dem Licht auch die Wärme wieder verschwand. Spazierend verbrachte Thielen die Nacht, ehe er sich morgens eine neue Ruhestätte im Aachener Wald suchte. Diesmal hatte er die sonntäglichen Anzeigenblättchen mitgenommen.
Aber auch sie berichteten ausführlich nur über den Fußball, das Verbrechen von Düren wurde mit keiner Zeile erwähnt. ›Konnte es sein, dass es noch nicht entdeckt worden war?‹, fragte sich Thielen. Das Fehlen der Meldung beunruhigte ihn mehr, als es eine Berichterstattung getan hätte. Er wusste nicht, woran er war.
An diesem Tag wurde sein Schlaf häufig unterbrochen; zum einem träumte Thielen haarsträubend, zum anderen raschelte es mehrfach bedenklich in seiner Nähe. Wahrscheinlich Reiter, Spaziergänger oder begleitende Hunde. Er atmete tief durch, als es endlich Abend wurde und er sich aus seinem Versteck traute. Lange würde er dieses Leben nicht mitmachen können. Holland oder Belgien? Weiter nach Frankreich? Wohin er auch gehen würde, einmal würde man ihn erwischen. Wovon sollte er leben? Keine Chance. Zu alt für ’nen Job, der jugendlichen Elan oder kräftige Muskeln verlangte. Fremdsprachen Fehlanzeige. ›Für den Knast geboren‹, dachte Thielen bitter. »Einmal Knacki, immer Knacki.« Der Spruch traf zu. Und jetzt würde er wohl für immer im Bau landen. Mit Vollpension, ohne Rentenanspruch.
Thielen lief quer durch die Stadt, die in der Sonntagsruhe vor sich hin döste, und kam irgendwann, schon spätabends, ohne es bewusst gewollt zu haben, vor dem Zeitungsverlag an der Dresdener Straße an.
An der Einfahrt zum Firmengelände eilte ihm ein älterer Mann entgegen, der oberflächlich durch eine Zeitung blätterte. Er lächelte Thielen grüßend an.
»Wollen Sie?«, fragte er höflich und reichte ihm die Blätter. »Ich weiß schon, was drin steht.«
Unwillkürlich griff Thielen danach und vergaß dabei, sich zu bedanken. Ehe er sich besonnen hatte, war der freundliche Mann schon in einen Wagen zugestiegen und verschwunden.
Thielen blickte auf die Zeitung und erschrak. Er hatte die Montagsausgabe der Dürener Zeitung in der Hand. Im Licht einer Straßenlaterne schlug er die Zeitung auf und stieß im Lokalteil auf die Überschrift in den großen Lettern: »17-Jährige tot – Baby verschwunden«.
Das konnte doch nicht sein! Oder doch? Thielens Augen flogen immer wieder über die Passage, in der ein Kommissar namens Wenzel zitiert wurde: »Wir haben noch keinen Tatverdächtigen.«
Was war mit der Taschenlampe? Kein Wort davon. Darauf mussten seine Fingerabdrücke zu finden sein. Oder hatte er den einzigen Beweis für seine Anwesenheit am Tatort doch mitgenommen und irgendwo weggeworfen? Thielen verstand nichts mehr.
Und was war mit dem Baby?
Wieso war das Baby verschwunden?
5. Kapitel
Kräftig pustete Bahn durch. Sein Lokalchef hatte ihm die Geschichte mit dem unzuverlässigen Faxgerät bedenkenlos abgenommen. Ohne lange zu zaudern, hatte Waldhausen danach in der Kölner Zentrale angerufen und sich bei Waldmann massiv über die unzumutbaren Arbeitsbedingungen in der Redaktion beschwert und über die mangelnde Sorgfalt, mit der die Zentrale die Dürener Außenstelle betreut.
»Die Blamage von heute geht ganz klar auf Ihre Kappe«, hatte Waldhausen erbost dem CvD vorgeworfen. »Ich frage mich, warum wir überhaupt noch mit Ihnen über unsere Probleme reden. Das hat doch keinen Zweck.« Das Tageblatt sei in Düren zur Witzfigur geworden, weil die Zentrale lahmarschiger sei als ein dreibeiniger Ziegenbock mit einem Glasauge. »Ich bin nicht bereit, die Verantwortung für diese Peinlichkeit zu übernehmen und ich weiß, dass mein Kollege Bahn dafür nicht verantwortlich ist.«
Scheinbar wütend knallte Waldhausen den Telefonhörer auf die Gabel und grinste unvermittelt Bahn an, der vor ihm am Schreibtisch saß.
»So, Helmut, jetzt erzähl mal«, forderte er freundlich seinen Kollegen auf. »Was ist Sache? Wie geht’s weiter?«
Bahn ließ sich sehr viel Zeit mit seiner Antwort. Er musterte angespannt seinen Chef, der auch sein Freund war und dem er feige sein Lügenmärchen aufgetischt hatte. Waldhausen war knapp zwei Jahre jünger als er, zwar wie Bahn groß und schlank, aber wegen seiner ständigen Radtouren durchtrainiert und ausdauernd, und, was das wichtigste Merkmal schlechthin war, er war wie Bahn ein Lokalredakteur von Schrot und Korn, dem statt Blut Druckerschwärze durch die Adern floss, wie Bahns Frau Gisela stets freundschaftlich zu lästern pflegte. Mitte 30 waren die beiden Freunde.
Bahn hatte es Waldhausen nicht übel genommen, als dieser als Externer von Bonn kommend statt seiner vor ein paar Jahren zum Chef der Dürener Lokalredaktion bestimmt worden war. Bahn verfügte zwar in der Redaktion über die meiste Erfahrung, Waldhausen hatte aber stets den Überblick über das gesamte redaktionelle Geschehen, der ihm selbst bisweilen abging. Bahn wusste, dass ihm Waldhausen den Rücken freihielt, wenn er wieder einmal zu schnell gehandelt und weit übers Ziel hinausgeschossen hatte und dabei zuweilen abstruse Schlüsse zog. Waldhausen bremste ihn und hielt ihn oft unmerklich zurück oder brachte den begeisterungsfähigen Bahn wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurück, wenn mit ihm die Fantasie vollends durchging.
Mit ruhigem Blick und großer Gelassenheit wartete Waldhausen auf Bahns Antwort. Falls er dachte, dass er Bahn die Version mit dem Faxgerät nicht glaubte, so ließ er seine Zweifel jedenfalls nicht durchblicken. Waldhausen hatte sich bequem in seinen Sessel zurückgelehnt, die Füße übereinander auf die Tischkante gelegt und die Arme im Nacken verschränkt. Das war seine typische Gesprächshaltung, wenn er sich unter vier Augen in der Redaktion mit seinem Freund unterhielt.
Bahn nahm die Dürener Zeitung in die Hand. »Das sind die Fakten, auf die wir aufbauen können«, sagte er langsam. »Jetzt müssen wir sehen, dass wir mehr Informationen als unsere Kollegen von der anderen Straßenseite bekommen.«
Bahn wertete Waldhausens kurzes Kopfnicken als Zustimmung. »Ich werde auch mit Küpper reden. Und …«, er legte absichtlich eine Pause ein, »und ich werde Franken anhauen. Ich kenne ihn seit ewigen Zeiten. Was meinst du dazu, Fritz?«
Waldhausen schüttelte ablehnend den Kopf. »Das würde ich nicht tun. Der hat garantiert anderes im Sinn, als sich mit dir zu unterhalten.«
»Wenn du meinst. Aber du wirst mir sicherlich nicht den Blick ins Archiv verbieten?«
Waldhausen stutzte kurz: »Warum sollte ich?«
Bahn schmunzelte selbstzufrieden. »Lass dich überraschen. Wenn ich mich recht erinnere, hat es vor deiner Zeit hier an der schönen Rur, als du noch im ehemaligen Bundesdorf Bonn am schmutzigen Rhein versuchtest, Journalismus zu betreiben, eine tragische Geschichte mit Franken gegeben.« Insgeheim wunderte sich Bahn im Nachhinein, dass in der aktuellen Ausgabe kein Medium auf die damalige Geschichte eingestiegen war. Das Fehlen konnte nur damit zusammenhängen, dass in den anderen Lokalredaktionen relativ junge Kollegen am Werke waren, die erst seit wenigen Jahren in Düren arbeiteten. Da war Bahn mit seinen mehr als 15 Dienstjahren beim Dürener Tageblatt trotz seines noch relativ jungen Alters schon ein Dinosaurier, der Mann mit der meisten Erfahrung aller Journalisten im Städtchen. Anders als viele Kollegen aus seiner Anfangszeit hatte es ihn nie danach gedrängt, aus der angeblichen Provinz zu entfliehen und anderenorts eine vermeintliche Karriere zu machen. Er war damals noch einer der wenigen gewesen, die das Glück gehabt hatten, quasi direkt von der Schulbank und nach dem Wehrdienst in eine Zeitungsredaktion hineinzurutschen, was inzwischen undenkbar war. Ein abgeschlossenes Studium wurde nun zur Grundvoraussetzung gemacht, um überhaupt eine Ausbildung zum Redakteur beginnen zu dürfen. So war Bahn zwar kein Akademiker, aber mit einem reichlichen Ortswissen gesegnet, das den hochnäsigen Unischnöseln auf ihrer Zwischenstation nach oben abging.
Bahn war eingefleischter Dürener Junge und würde nur unter Zwang diese Stadt, die seine Stadt war, verlassen.
Für Küpper war es geradezu eine Selbstverständlichkeit, sich zum Mittagessen mit Bahn in der Gaststätte Stollenwerk zu treffen. »Wenzel hat mir heute Morgen sofort gesagt, dass du gestern niemanden zu der PK geschickt hast. Er war schon ganz unruhig und hat danach noch ein Fax losgelassen, damit du informiert wirst«, berichtete der Kommissar, als Bahn angerufen hatte. »Warum hast du nichts gebracht?«
»Ist eine lange Geschichte«, knurrte Bahn gereizt, »werde ich dir beim Essen erzählen.« Wenn er mit Küpper allein war, duzten sie sich, in Anwesenheit anderer beließen sie es beim förmlichen »Sie«. Ihre Freundschaft war für den Hausgebrauch bestimmt, wie Küpper meinte. Pressekollegen hätten schnell von Kumpanei gesprochen, bei der Kripo wäre womöglich von einer Bevorzugung eines Journalisten gesprochen worden, wenn sie ihre, in gemeinsam durchlebten Kriminalfällen gewachsene Freundschaft offen gezeigt hätten.
»Was ich dir privat anvertraue, Helmut, geht Sie, Herr Bahn, als Journalist nichts an«, so umschrieb der Kommissar die Beziehung, wissend, dass Bahn sich nicht immer daran halten konnte.
Der Redakteur winkte freundlich, als Küpper suchend das gut gefüllte Lokal betrat. Der Kommissar sah wie immer mit seinem betrübten Hundeblick um sich, weswegen er in Kollegenkreisen den Spitznamen Bernhardiner erhalten hatte. Der trübsinnige Blick täuschte oft darüber hinweg, dass der fast 60-jährige Beamte in leitender Funktion als versierter Ermittler galt und in Ganovenkreisen gehörigen Respekt besaß. Wenn es in Düren eine komplizierte Nuss zu knacken gab, schaltete sich der Nussknacker Küpper ein, der fast immer, mehrmals sogar mit Bahns Unterstützung, zu den gewünschten Erfolgen gekommen war.
Küpper hielt sich nicht lange mit der Begrüßung auf. »Nur eines muss ich loswerden. Ich wusste gar nicht, dass dein Chef so viel Calvados vertragen kann«, meinte er scherzhaft rückblickend auf die Frankreichtour.
»Mich interessiert nicht die Standfestigkeit der Schnapsblase«, brummte Bahn, während er am Kölsch nippte. »Was gibt’s Neues bei Franken?«
»Nichts, mein Freund«, antwortete der Kommissar und griff ebenfalls zum Glas. »Noch nichts, Helmut«, fügte er dann ruhig hinzu.
Bahn horchte sofort auf. »Nichts«, das war die offizielle Version, »noch nichts«, das war der Ausdruck für den tatsächlichen Stand der Ermittlungen. Der Journalist sah Küpper fragend an. ›Erzähl schon!‹, forderte er mit einem stummen Blick.
»Wir haben in der Nähe der Leiche eine Taschenlampe auf dem Boden im Kinderzimmer gefunden. Darauf befinden sich einige schöne Fingerabdrücke. Fast wie aus dem Lehrbuch.«
»Schon identifiziert?«
Der Bernhardiner nickte bejahend. Er schwieg, bis eine Serviererin das Mittagessen, Schnitzel mit Blumenkohl und Kartoffeln, gebracht und wieder gegangen war. »Eine Kleinigkeit, längst schon erledigt. Sie gehören einem unserer alten Bekannten.«
»Dann habt ihr also doch einen Tatverdächtigen?«, fragte Bahn verwundert. Bei der Aussage von Wenzel am Sonntag hätte sich die Sachstandbeschreibung anders, erfolgloser angehört.
Küpper lächelte entschuldigend. »Aus ermittlungstechnischen und taktischen Gründen hat mein Kollege zu diesen Abdrücken geschwiegen. Ich hätte es auch getan. Gerade bei einer Entführung musst du sehr vorsichtig taktieren. Wir wollen den Täter in Sicherheit wiegen.«
»Den Täter oder die Täter?«, hakte Bahn rasch nach.
»Wir haben eindeutige Hinweise auf einen Täter, eben die Fingerabdrücke«, antwortete Küpper geduldig, »das schließt aber selbstverständlich nicht aus, dass es Mittäter gibt, wenn nicht sogar geben muss.«
Er habe die Akten des identifizierten Tatverdächtigen angefordert, berichtete er weiter. »Kopfzerbrechen bereitet uns auch die Taschenlampe. Sie stammt aus Frankreich und ist in Deutschland überhaupt nicht im Handel erhältlich.«
Nachdenklich kratzte Bahn sich das kurze Haar. »Wo ist das Baby geblieben?«
»Kennst du die Lottozahlen vom nächsten Samstag«, entgegnete der Bernhardiner und griff zum Bierglas. »Wir wissen es nicht. Der Junge ist spurlos verschwunden.«
»Wie Ernst Franken«, sagte Bahn sachlich.
Der Kommissar verschluckte sich und musste mehrmals heftig husten, bevor er wieder Luft bekam. »Bahn, du bist und bleibst ein elender Schweinehund. Du vergisst wohl nie.«
Nur mit Mühe konnte sich der Journalist ein Grinsen verkneifen und gelassen bleiben. Ironie wäre der Tragik nicht angemessen gewesen.
»Ich habe eben ein ausgezeichnetes Archiv«, erklärte er in falscher Bescheidenheit. »Wenn du willst, kannst du die Zeitungsartikel von damals haben«, bot er bereitwillig an.
Doch winkte Küpper mürrisch ab. »Hab ich doch alle.« Mit einem kräftigen Schluck spülte er seinen Unmut herunter.
Schweigend kauten sie für Minuten an ihren Mahlzeiten. »Meinst du, ich kann das morgen schreiben?«, fragte Bahn schließlich seinen väterlichen Freund zweifelnd.
»Bist du der Journalist oder ich?«, antwortete der Kommissar schnell mit einer Gegenfrage. »Ich würde es gefühlsmäßig nicht tun.« Er schob die Speisereste zu einem letzten Bissen auf der Gabel zusammen. »Am besten lässt du Waldhausen entscheiden, wenn du zu schissig bist.« Er stand auf, winkte die Bedienung herbei und zückte die Geldbörse. »Zur Feier des Tages lade ich dich ein.« Küpper gab Bahn einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. »Ruf mich gegen sechs an, dann kann ich dir mehr sagen.«
Nach der Rückkehr in die Redaktion steuerte Bahn sofort das Büro von Waldhausen an und brachte sein neues Wissen an. »Immer noch im Calvados-Rausch?«, frotzelte er, lässig im Türrahmen angelehnt.
»Nur so ist die Scheiße von gestern zu ertragen«, gab der Lokalchef patzig zur Antwort und konterte böse: »Was sagt dein Polizeispitzel?«
Die Retourkutsche saß. Bahn zuckte zusammen. Zum einem mochte er es überhaupt nicht, wenn jemand so über den Bernhardiner sprach, zum anderem irritierte es ihn, dass Waldhausen bereits von dem gemeinsamen Mittagessen wusste.
»Ein guter Chef weiß halt immer, wo sich seine Mitarbeiter herumtreiben«, klärte ihn Waldhausen zufrieden auf. »Und wenn die Gattin eines Mitarbeiter mit der Allerliebsten des Chefs auf Einkaufsbummel gehen will, bleibt es nicht aus, dass sie Mitarbeiter und Informant sehen und als gute Seelen den Chef sofort aufklären.«
Bahn war erleichtert. Gisela und Thea hatten ihn beobachtet und die beiden Tratschtanten hatten nichts anderes zu tun, als unverzüglich Waldhausen zu informieren. Aber so war das halt, wenn man fast schon eine große Familie war, in der niemand etwas tun konnte, ohne dass es der andere erfuhr.
Er wechselte das Thema: »Fritz, du musst eine Entscheidung treffen.«
Bahn setzte sich vor den Schreibtisch und berichtete: »Vor ungefähr sieben Jahren wurde der damals einjährige Ernst Franken entführt. Direkt von der Straße weg im Kinderwagen. Auf dem Weg nach Hause wurde das Kindermädchen überfallen. Der Junge ist nicht wieder aufgetaucht. Als sich Matthias Franken geweigert hat, ein Lösegeld für seinen Sohn zu bezahlen, haben die Entführer sich nicht mehr gemeldet. Seitdem gibt es keine Lebenszeichen des Jungen mehr. Vermutlich oder sogar wahrscheinlich ist der Junge getötet worden.«
Bahn stöhnte. »Jetzt beginnt vielleicht die Geschichte sich zu wiederholen. Uwe, der neue Stammhalter der Familie Franken verschwindet auf kriminelle Weise. So viel Familiendrama kann kein Zufall sein.«
Waldhausen betrachte Bahn nachdenklich, die Hände im Nacken verschränkt. »Diese Geschichte willst du wieder ans Tageslicht holen?«, fragte er vorsichtig.
»Warum nicht?« Bahn hob entschuldigend die Arme. »Bevor unser CvD die Story morgen woanders liest und uns deswegen wieder zur Schnecke macht, schreibe ich die Geschichte lieber selbst. Oder?«
Waldhausen antwortete nicht direkt. Er atmete tief durch und schaute durchs Fenster auf die gegenüberliegende Häuserzeile, direkt auf die Fenster der DZ-Redaktion.
»Wem nützt es, wenn wir das Alte aufwärmen?«, fragte er schließlich, als er sich umdrehte.
»Es schadet niemandem«, hielt Bahn dagegen. »Es schmerzt allenfalls Matthias und Helena Franken.«
Das Ehepaar hatte den Tod seines ersten Sohnes immer noch nicht überwunden. Vor ein paar Monaten erst hatte Bahn bei einem Klassentreffen mit Matthias Franken über die damalige Entführung gesprochen. Franken hatte ihm erzählt, dass trotz der Geburt von Uwe die Erinnerung an Ernst immer noch frisch war.
»Unser Bericht wird Mitgefühl für die Familie Franken erzeugen«, behauptete Bahn. Er betrachtete aufmerksam den Lokalchef, der immer noch stumm blieb. »Vielleicht können wir zur Klärung der Entführung beitragen.«
»Achtzig Zeilen«, sagte Waldhausen endlich, »ein Zweispalter mit doppelzeiliger Überschrift.«
Waldhausen hatte zwischenzeitlich das Versäumte über das Verbrechen nachgeholt. Am Dienstag würden die Tageblatt-Leser das lesen können, was wegen Bahns Leichtfertigkeit am Montag im Blatt fehlte. »Achtzig Zeilen und keine mehr«, gab der Lokalchef ihm noch einmal mit auf den Weg, als sich Bahn in sein Zimmer aufmachte. »Beeil dich, ich will die Geschichte noch vor meinem Feierabend lesen.«
Offenbar hatte Waldhausen der Artikel von Bahn gefallen. Jedenfalls hatte er ihn kommentarlos auf seinem Bildschirm korrigiert und auf Seite eins platziert, wie Bahn im Verzeichnis der druckreifen Artikel erkennen konnte.
Zufrieden rief Bahn pünktlich um sechs in der Polizeistation bei Küpper an. »Die Geschichte steht morgen drin«, berichtete er.
»Hätte ich nicht gemacht«, entgegnete der Kommissar spontan, »das wäre mir zu persönlich gewesen.«
Bahn sah keinen Grund, über die gegensätzlichen Auffassungen zu diskutieren. Schließlich hatte nicht er die Verantwortung, sondern sein Lokalchef.
»Was macht eigentlich unser Tatverdächtiger?«, fragte er lieber.
»Ein unangenehmer Zeitgenosse, der mehr im Knast sitzt als davor steht. Wir suchen ihn.«
»Kann ich was schreiben?«
Die schnelle Antwort des Kommissars war unmissverständlich: »Nein!« Solange die Polizei nicht genau wisse, wie viele Tatbeteiligte es gab und was mit dem entführten Jungen geschehen ist, solange sollte der Fall zunächst jedenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit untersucht werden. »Nichts für ungut, Helmut. Aber gerade bei Entführungen ist Diskretion oft der beste Weg zur Lösung.«
Bahn schwieg zu dieser Bemerkung, die er nicht unbedingt teilte. Wohin dieses Diskretion führen konnte, hatte er vor sieben Jahren erfahren. Die Diskretion hatte das Leben von Ernst Franken wahrscheinlich nicht retten können. Der Junge blieb ebenso spurlos verschwunden wie auch seine Entführer spurlos verschwunden blieben.
6. Kapitel
Matthias Franken wunderte sich über seinen ausgeglichenen Gemütszustand. Sachlich und nüchtern, wie ein nicht betroffener Außenstehender hatte er die schreckliche Situation analysiert und die Maßnahmen ergriffen, die er für logisch und erforderlich erachtete. Er funktionierte in seinem privaten Bereich genauso wie in seinem Unternehmen, zielgerichtet, entschlossen und entscheidungsfreudig.
Schon auf der hastigen Rückfahrt von der Party am Samstagmorgen, als Helena geradezu hysterisch auf einen Aufbruch drängte, nachdem sich Anne nicht am Telefon meldete, hatte er vorsorglich seinen Schwager, Doktor Alfons Maibaum, Helenas Bruder, angerufen. Der Psychologe und Facharzt für Neurologie war der einzige Mensch, der Helena zur Besinnung bringen konnte und dem sie vertraute, wenn sie wieder einmal einen ihrer hysterischen Anfälle bekam. Nach dem Verlust von Ernst hatte sie trotzt therapeutischer Betreuung Jahre gebraucht, um den Schock zu überwinden. Jetzt klammerte sie sich an Uwe.
Doch die Erwartung von Matthias, Uwes Geburt würde dazu beitragen, Helena die innere Ruhe zurückzugeben, hatte sich nicht erfüllt. Am liebsten hätte Helena das Kleinkind immer mit sich getragen und niemals aus den Augen gelassen. Nur sehr langsam hatte sie Vertrauen zu Anne gefasst, und erst nach langen Monaten hatte sie zugelassen, dass Anne gelegentlich über Nacht auf Uwe aufpasste, während sie Matthias zu den Feiern begleitete, die manchmal aus Geschäftsgründen unumgänglich waren.
Der junge Inhaber einer traditionsreichen Papiermaschinenfabrik in Düren musste sich bisweilen einfach bei Feiern und Veranstaltungen in Unternehmerkreisen blicken lassen, Einladungen von Geschäftspartnern wahrnehmen, Kontakte pflegen und knüpfen. Die gesellschaftlichen Verpflichtungen gehörten zwangsläufig zu seinem und damit zu ihrem Leben; sie zu missachten, könnte zu erheblichen unternehmerischen Nachteilen führen. Er hatte lange auf seine Frau einreden müssen, bis Helena diese repräsentative Seite des Fabrikantendaseins akzeptierte und ihres Mannes wegen das Kleinkind für Stunden oder ab und zu auch für die Nacht allein ließ, wenn auch unter großer Nervenanspannung.
Umso größer waren die Vorhaltungen gewesen, die Helena in einem Schreikrampf ihrem Mann gemacht hatte, als sie den Leichnam des Mädchens und das leere Kinderbettchen entdeckte. Zeitgleich mit ihrem Bruder erschienen die Polizisten, denen Franken, äußerlich gefasst und mit fester Stimme die Lage schilderte. Er ließ sich nicht von der holprigen und bisweilen unangebrachten Art des ermittelnden Kommissars anstecken.
Entschuldigend hatte der schwitzende Wenzel auf die Abwesenheit seines Chefs hingewiesen, der die Untersuchung des Falles am Montag übernehmen würde. Franken konnte sich auch beherrschen, als Wenzel tollpatschig danach fragte, ob er sicher sei, dass das Kind tatsächlich entführt worden war. Der Junge hätte ja auch, so klang aus der dummen Frage durch, aus dem Gitterbettchen klettern und davonkrabbeln können.
»Uwe ist entführt worden«, hörte sich Franken erstaunlich gefasst sagen. Er hatte seinen skeptischen Blick auf die Polizisten und Bestatter gerichtet, die nach den routinehaften Ermittlungen und der ärztlichen Untersuchung den leblosen Körper von Anne in einen Leichensack packten und abtransportierten.
Die anteilnehmende Sorgfalt der Beamten, mit der sie zu Werke gingen, stand in krassem Gegensatz zum hektischen Gehabe von Wenzel, der offensichtlich seine Unsicherheit überdecken wollte. Anscheinend hörten sich die Polizisten zwar die Kommandos ihres überforderten Einsatzleiters an, ohne sich allerdings daran zu halten.
Franken hatte jedenfalls den Eindruck, als würden sie die Dramatik des Geschehens besser einschätzen als der dicke, kurzatmige Kommissar Anfang 30. Franken hielt es unter diesen Umständen nicht für angebracht, Wenzel über die Entführung und vermutliche Ermordung von Ernst vor sieben Jahren zu unterrichten. Es schien besser, darüber am Montag mit Wenzels Chef zu reden.
»Wo ist Ihre Frau?« Schnaufend und schwitzend war Wenzel auf Franken zugetreten. »Ich brauche ihre Aussage«, meinte er bestimmend.
Franken schüttelte missbilligend den Kopf und deutete auf seinen Schwager, der mit zusammengekniffenen Lippen in einem Sessel sitzend die Arbeit der Polizei beobachtete. »Doktor Maibaum wird’s Ihnen sagen.«
Spontan schoss Wenzel auf Frankens Schwager zu, der sich schweigend das Anliegen des hektischen Inspektors anhörte und ihm eine derbe Abfuhr erteilte.
Der Mediziner und Psychologe ließ Wenzel seine Antipathie deutlich spüren. »Meine Schwester ist derzeit nicht ansprechbar. Ich habe ihr ein starkes Schlafmittel verabreicht.«
Der Kommissar brauste auf und sprach polternd von einer nicht hinnehmbaren Behinderung seiner Arbeit, wenn ihm eine wichtige Zeugin vorenthalten bliebe.
Nur mit Mühe gelang es Maibaum, sich zu beherrschen. Dieser feiste Fettsack wirbelte gehörig Staub auf, ohne ihn zu entfernen. »Sagen Sie Ihrem Chef, Helena Franken ist frühestens am Dienstag für ihn zu sprechen, Herr …«
Mit einem verächtlichen Winken wandte sich Wenzel ab und bellte seinen Kollegen neue Befehle zu, die sie geflissentlich überhörten.