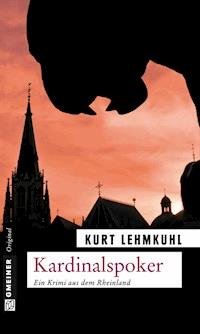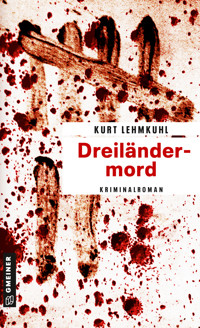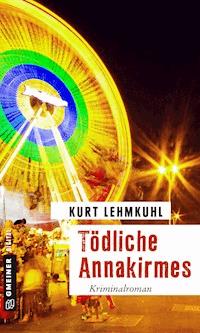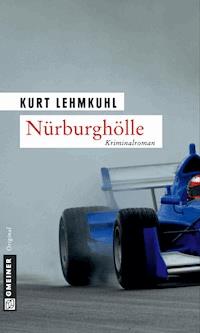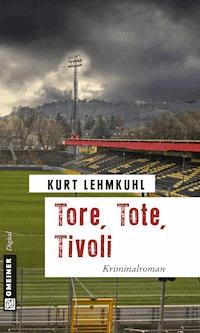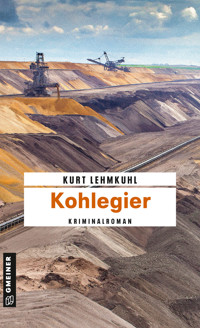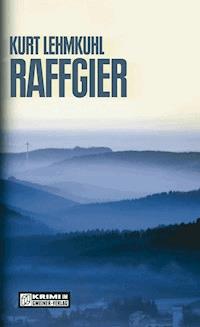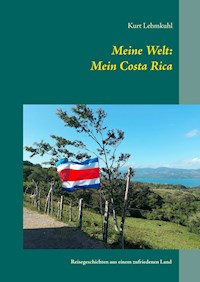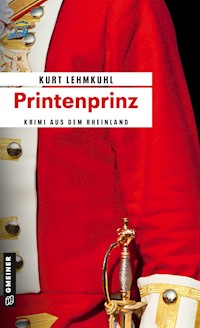
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Böhnke und Rechtsanwalt Grundler
- Sprache: Deutsch
Der pensionierte Kommissar Rudolf-Günther Böhnke muss sein beschauliches Eifeldorf Huppenbroich verlassen, um den Mord an Peter von Sybar aufzuklären, einem betuchten Printenproduzent aus Aachen, der Prinz der klammen Jecken in Köln werden sollte. Ist der Mörder im karnevalistischen, beruflichen oder privaten Umfeld zu suchen? Böhnke ermittelt im Trubel der fünften Jahreszeit und erhält dabei erstaunliche Einblicke hinter die Kulissen des närrischen Brauchtums …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lehmkuhl
Printenprinz
KRIMINALROMAN
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: René Stein
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © arsdigital – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4176-9
Widmung
Im Gedenken an Nele und Hanns Bittmann
1.
Der Begriff, mit dem der Artikel übertitelt war, gefiel ihm. Peter von Sybar las ihn mit Genugtuung. Als ›Printenprinz‹ hatte ihn ein Journalist bezeichnet, der für ein Wirtschaftsmagazin eine Reportage über ihn verfasst hatte. Es schmeichelte ihm sogar, dass der Journalist ihn fast genauso titulierte wie sein großes Vorbild, die Nummer eins in der Aachener Süßwarenbranche, den in einem Nachrichten-Magazin gewürdigten ›Printenkönig‹. Außerdem umfasste der für ihn gefundene Name ›Printenprinz‹ zusätzlich eine Funktion, die der ›Printenkönig‹, der stärkste Mitbewerber seines Schwiegervaters Heinrich von Sybar, auf dem Markt nicht innehatte. Er hatte sich immer gerne mit Printen beschäftigt und daher fühlte er sich gleich in doppelter Hinsicht wohl in seiner Rolle als Prinz.
Nach seiner Heirat mit Elisabeth vor rund 20 Jahren war er in das Imperium des Aachener Printenproduzenten Heinrich von Sybar eingestiegen. Er hatte sogar den Familiennamen seiner Frau angenommen. Sein Schwiegervater galt weltweit neben dem ›Printen-König‹, ebenfalls aus Aachen, als einer der Herrscher in der Branche, geradezu zwangsläufig fiel dessen Schwiegersohn die Rolle des Prinzen zu: Peter von Sybar, geborener Hommelsheim, würde, so war es ausgemacht, die Führung des Unternehmens übernehmen, wenn der Senior irgendwann einmal abdankte.
Eine fast schon unabdingbare Folge seines Mitwirkens im Aachener Geldadel war die Übernahme einer anderen Prinzenrolle, die des Karnevalsprinzen. Wie sein Schwiegervater gehörte er einer der renommierten Karnevalsgesellschaften in Aachen an, bekleidete dort als dessen Nachfolger das Amt des Kassenprüfers und war vor ein paar Jahren in das närrische Gewand der Öcher Tollität geschlüpft. Als Prinz Peter der Zweite hatte er, mit Elisabeth als Ihre Lieblichkeit Lissi die Erste an seiner Seite, die im Rheinland so gerne gefeierte Fünfte Jahreszeit bestritten, war am 11.11. als Prinz Karneval in das Kostüm geschlüpft und hatte am Aschermittwoch dieses Kapitel als erledigt abgehakt. Die nicht unerheblichen finanziellen Aufwendungen für Spenden, für den Unterhalt seiner Begleitmannschaft, für Orden und für die überall verteilten Printen waren in einen sechsstelligen Bereich geklettert. Es war eine gute Investition gewesen, wie er nachher an den Bilanzzahlen feststellte. Der Werbewert und die Umsatzsteigerung während und nach der Session zeigten ihm, dass seine Zeit als Narrenherrscher eine lang anhaltende wirtschaftliche Wirkung erzielt hatte. Auch diesen Aspekt hatte der Journalist mit anerkennender Hochachtung vermittelt.
Er wusste um seine Wirkung auf die Mitmenschen, er konnte sie mit seinem Charme einfangen, sie mit seiner Begeisterung für seine Ziele gewinnen. Schon während des Betriebswirtschaftsstudiums an der RWTH Aachen, bei dem er Elisabeth kennen gelernt hatte, war es so gewesen, das blieb nach dem Diplom so, als er auf Anhieb das Wohlwollen seines Schwiegervaters gewann, das war im Unternehmen so, in dem ihm alle blindlings vertrauten; kurzum, er war allseits beliebt.
Glaubte er jedenfalls.
Elisabeth von Sybar verachtete ihren Mann. Als Hass würde sie ihr Gefühl nicht bezeichnen. Hass war für sie das Gegenteil von Liebe, und da sie Peter im Prinzip nie geliebt hatte, konnte sie ihn auch nicht hassen. Aber sie verachtete ihn, wie sie inzwischen auch ihren Vater verachtete. Sie hatte stets das getan, was er ihr vorgeschlagen hatte. Sie hatte das Abitur gemacht, weil er es wollte. Sie hatte an der RWTH studiert, weil er meinte, ein Abschluss in BWL könne nicht schaden, wenn sie in die Leitung des Unternehmens einsteigen würde. Und sie hatte auf ihn gehört, als sie zugeben musste, dass sie für das Studium nicht geeignet war und sie zugleich Peter kennenlernte. Peter war groß, sportlich, schlank, mit einem soliden Selbstbewusstsein und einer charismatischen Ausstrahlung ausgestattet; kurzum ein Mann, für den nicht nur sie schwärmte. Ihr Vater hatte ihn sofort als geeigneten Schwiegersohn und Firmenleiter anerkannt und ihr die Heirat vorgeschlagen. Also hatte sie Peter geheiratet. Nicht unbedingt aus Liebe, eher aus Gefälligkeit ihrem Vater gegenüber.
In den ersten Jahren ihrer Ehe hatte sie sich noch von Peter blenden lassen, zum einem wegen ihrer finanziellen Unabhängigkeit, zum anderen wegen ihres gesellschaftlichen Lebens, der sozialen Anerkennung und der ständigen Hilfsbereitschaft, mit der ihr Vater und ihr Mann sie umgaben. Elisabeth bemerkte erst spät, dass die Männer aus reinem Selbstzweck handelten. Ihr Vater spielte immer noch die Rolle des zu früh verwitweten Mannes, der sich nach außen hin trotz aller unternehmerischen Tätigkeiten liebevoll um seine Tochter kümmerte. Für Peter war sie schmückendes Beiwerk, wenn er mit ihr auf Empfängen zu Gast war, im Unternehmen ein Fest veranstaltete oder sie zu wichtigen Ereignissen eingeladen waren. Als sie als Prinzenpaar fungierten und Elisabeth dabei duldsam in ihre Rolle geschlüpft war, erkannte sie, welches berechnende Spiel er trieb. Es waren ausschließlich das Geschäft und der wirtschaftliche Erfolg, weswegen sich Peter als Narrenherrscher ausgab. Als er ihr selbstzufrieden ein Jahr später die Bilanzen und die Ergebnisse eines Gutachtens über ihre Zeit als Tollitäten präsentierte, durchschaute sie ihn und seine ursprüngliche Absicht vollkommen.
Sie führten keine Ehe, sie lebten in einer Zweckgemeinschaft, in der weder für Kinder noch für Liebe, Sentimentalität oder Zärtlichkeit Platz war.
Elisabeth empfand es als Wohltat, als Wolfgang in ihr Leben trat; erst als Prokurist und Stellvertreter im Printenimperium, dann als zärtlicher und mitfühlsamer Platzhalter in ihrem Ehebett. Peter bekam nichts davon mit, dass sie ihn hinterging und betrog. Als sie einmal bei einem Streit am Frühstückstisch das Gespräch darauf brachte, was er von einer Scheidung hielte, hatte er nur hämisch gelacht und bemerkt, sie sei ohne ihn und ihren Vater ein Nichts. Und auf wessen Seite ihr Vater stehen würde, darüber gebe es ja wohl keine Zweifel.
Deutlicher hätte er ihr nicht sagen können, was er von ihr hielt. Seit diesem Zeitpunkt wuchs in ihr ein Gedanke: Sie musste Peter loswerden. Irgendwie.
Wolfgang Landmann hatte niemals damit gerechnet, einmal an Stelle seines Chefs das Bett mit dessen Gattin zu teilen. Elisabeth war zwar zehn Jahre älter als er, aber von einer Besessenheit, die ihn atemlos machte. Es schien ihm, als habe sie ihr sexuelles Verlangen so lange aufgestaut, um es schließlich mit ihm zu befriedigen. Sollte sie, dachte er sich. Er kam nicht zu kurz bei ihren wilden Spielchen, bei denen Elisabeth nicht einmal Hemmungen hatte, sie im eigenen Ehebett zu treiben. Kaum hatte der eigene Mann eine Reise zu einer Messe oder zu einem Lieferanten angetreten, sprang Landmann quasi in die noch warmen Federn.
Lange Zeit hatte er geschwiegen, wenn Elisabeth von Liebe anfing. Für ihn waren es eher die Triebe, dem sie sich gemeinsam hingaben. Nach und nach war er zusehends dieser Frau verfallen, für die er zum Mittelpunkt des Lebens geworden war, und er musste sich eingestehen, dass er nicht mehr ohne sie sein wollte.
Wenn sie dieses Gefühl Liebe nannte, so war es wohl Liebe, die er für sie empfand.
An einen Job mit Familienanschluss hatte er im Traum nicht gedacht, als er vor rund fünf Jahren die Stelle angenommen hatte. Peter von Sybar hatte ihn nicht nur mit einem üppigen Gehalt im sechsstelligen Bereich von einem Aachener Großfabrikanten und Mitbewerber weggelockt, sondern auch mit der Aussicht, nach dem Ausscheiden des Seniorchefs als Stellvertreter des Printenprinzen zu fungieren.
Nun war die Zeit reif für einen Wechsel an der Spitze. Der Alte machte es nicht mehr lange, so hatte es jedenfalls den Anschein. Immer häufiger kam er nicht ins Büro. Es machte auf den Fluren das Gerücht die Runde, der Alte wäre zum wiederholten Male im Klinikum von einem Herzspezialisten untersucht worden.
Landmann wähnte sich fast schon am Ziel, wenn da nicht in den letzten Monaten Differenzen zwischen ihm und von Sybar zu Tage getreten wären. Ob der Kerl etwa ahnte, mit wem ihn seine Gattin betrog? Oder hatte er festgestellt, dass Landmann sich nicht hundertprozentig für das Unternehmen einsetzte, sondern gelegentlich seine eigenen Wege ging?
Sie hatten nie über Privates gesprochen. Bei von Sybar gab es nur ein einziges Thema: Herstellung und Verkauf von Printen. Koste es, was es wolle. Diesem Streben hatten sich alle Mitarbeiter zu widmen. Wer nicht in dieselbe Richtung mit ihm marschierte, der war fehl am Platze. Und es kam Landmann vor, als mache er diesen Marsch nicht mehr im Gleichschritt mit. Es war ihm klar, wenn sein Chef herausbekam, dass er Elisabeths Liebhaber war, war seine Karriere vorbei. Von Sybar würde ihn abservieren, mit einer horrenden Abfindung aus dem Unternehmen hinauskomplimentieren.
Würde Elisabeth bei ihm bleiben? Sie musste es. Er brauchte sie wie der Fisch das Wasser. Vor allem wegen ihres Geldes. Alle seine Probleme ließen sich mit einem Schlag lösen. Er würde von Sybars Platz an Elisabeths Seite auch offiziell einnehmen und die Firma leiten.
Wenn der Printenprinz dauerhaft von der Bildfläche verschwand. Aber wie?
Franz-Josef Mandelhartz hatte Angst vor Peter von Sybar. Und das nicht ohne Grund. Jahrelang war Mandelhartz als Kassenwart der traditionsreichen Karnevalsgesellschaft unumstritten und über alle Zweifel erhaben gewesen. Die jährliche Kassenprüfung fand nur pro forma statt. Der alte von Sybar hatte gewissermaßen an einem Nachmittag zwischen Kaffee und Kuchen den Rechenschaftsbericht abgezeichnet, ohne auf die Rechnungen, Quittungen oder Bankauszüge einen Blick zu werfen. »Wenn wir Karnevalisten uns gegenseitig nicht mehr vertrauen können, können wir gleich einpacken«, hatte er immer gemeint, und Mandelhartz hatte beifällig genickt.
Nachdem Peter von Sybar das Amt des Kassenprüfers von seinem Schwiegervater übernommen hatte, wurde die Kontrolle gewissenhafter. Von Sybar ließ sich stets alle Belege ins Büro bringen und hakte jeden einzelnen ab, wenn er ihn in der Abrechnung von Mandelhartz gefunden hatte. Beträge ohne Nachweis musste der Kassenwart mit schriftlichen Kommentaren versehen. Mandelhartz war genervt von seinem peniblen Kontrolleur, diesem Pfennigfuchser, der mit übertriebenem Eifer hinter die Zahlen blickte.
Doch auch von Sybar konnte nicht auf Anhieb die Tricksereien erkennen, mit denen Mandelhartz operierte. Das ausgeklügelte System war einfach wasserdicht und verschaffte ihm alljährlich einen fünfstelligen Betrag für das eigene Portemonnaie. Man durfte es nur nicht übertreiben, so war seine Devise. Lieber zehn Mal 100 Euro einstreichen als einmal 1.000. Das Risiko war einfach geringer, je kleiner der Betrag war, den er für sich abzweigte.
Die Unterschlagung oder der Betrug wären niemals aufgefallen, wenn nicht der vermaledeite von Sybar auf die wahnwitzige Idee gekommen wäre, ein zweites Mal als Prinz Karneval zu fungieren. In der Vorbereitung auf das närrische Amt war er auf die Verfehlungen von Mandelhartz gestoßen. Dann hatte er nachgehakt, die Belege über Jahre zurückgeprüft und schließlich das Ergebnis vorgelegt: Insgesamt 125.000 Euro hatte Mandelhartz nach von Sybars Berechnung unterschlagen. Er überließ dem Kassenwart die Entscheidung: Strafanzeige oder Rückzahlung in Form einer großzügigen Spende von 250.000 Euro.
Einen Monat Bedenkzeit war Mandelhartz gewährt worden. In wenigen Tagen würde die Frist vorbei sein. Das Geld konnte er nicht aufbringen. Woher auch? Wenn er ehrlich gegenüber sich selbst war, musste er zugeben, dass er pleite war. Aber seine finanzielle Situation durfte nicht bekannt werden, wenn er sich nicht selbst ins gesellschaftliche Abseits stellen wollte. Ein Strafprozess kam nicht infrage. Das wäre sein beruflicher und privater Ruin.
Es gab nur eine Lösung: Seine kleine Verfehlung durfte nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Es gab nur einen Mensch, der diese herstellen würde, wenn Mandelhartz nicht zahlte: von Sybar. Der musste zum Schweigen gebracht werden. Mit allen Mitteln.
Dieter Feilen musste ernsthaft befürchten, dass sich das lukrative Geschäft langsam aber sicher in Luft auflöste. Dabei herrschte im Prinzip Klarheit. Der Vertrag hätte nur noch vom Kölner Oberbürgermeister unterschrieben werden müssen und er hätte die Provision von seinem Freund kassiert. Astrein wäre der Deal nicht gewesen, das musste er zugestehen. Doch würde noch ein Hahn danach krähen, wenn das Grundstück erst notariell veräußert und grundbuchmäßig übertragen war?
Sein Freund hatte ihn bei der Suche nach einer neuen Gewerbefläche um Mithilfe gebeten und ihm die Provision zugesichert. Auf diesem neuen Areal hätte der Freund seinen Betrieb einrichten und das bisherige eventuell als Bauland mit hohem Gewinn veräußern können. Davon hätte Feilen ebenfalls einen Anteil erhalten.
Dieser zweite Deal hätte nur über die Bühne gehen können, wenn das Geschäft mit dem neuem Betriebsgelände auch tatsächlich geklappt hätte.
Doch dann war von Sybar aufgetaucht und hatte Eindruck bei Oberbürgermeister Werner Müller hinterlassen. Die beiden waren sich schnell einig geworden. Von Sybar musste, so vermutete Feilen, kräftig mit dem Geldbeutel geklingelt haben, anders konnte er sich nicht erklären, warum dem Industriellen aus Aachen plötzlich alle Türen in Köln offen standen. Die Krönung im negativen Sinne erlebte Feilen, als ihn Müller von den Verhandlungen ausschloss. Er, immerhin Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der Stadt Köln und beratendes Mitglied in der Liegenschaftsabteilung, war nicht mehr mit von der Partie, wenn es um millionenschwere Finanzgeschäfte mit städtischen Grundstücken ging.
Müller servierte auch Feilens Freund kurzerhand ab. Der Oberbürgermeister betrachtete die bisherigen Verhandlungen als bloße Vorbereitungsgespräche ohne rechtliche Relevanz und sah keinen Grund, frühere Absprachen oder Zusagen als verbindlich anzusehen. Für ihn gab es bei dem Grundstücksverkauf nur noch einen ernsthaften Verhandlungspartner: die ›Printe‹, wie Feilen den Mann aus Aachen abfällig bezeichnete.
Noch war das Geschäft nicht unter Dach und Fach. Es gab zwar die verbriefte Einigung zwischen dem Oberbürgermeister und dem Printenproduzenten, solange jedoch der Notar nicht tätig geworden war, bestand die Hoffnung, dass der Vertrag vielleicht platzte. Auf seinen Freund konnte Feilen dabei nicht setzen. Der war viel zu feige. Er selbst musste dafür sorgen. Es war für ihn bittere Notwendigkeit, die Veräußerung an von Sybar zu verhindern. Er brauchte die Provision unbedingt. Von Sybar war der Mann, der zwischen ihm und dem Geld stand – noch.
Fritz Schmitz schäumte vor Wut, eine Reaktion, die ihm die wenigsten zutrauen würden. Für sie war er der liebe und liebenswürdige Witze Fritze. Die Öffentlichkeit kannte ihn in dieser Rolle als Büttenredner und niemand würde glauben, dass dieser Mann privat wenig bis gar keinen Humor besaß. Und fast niemand wusste, dass er mehr war als die von ihm geschaffene Figur. Als Witze Fritze war Schmitz eine kölsche Institution, die in einem Atemzug genannt wurde mit der Sängerin Marie-Luise Nikuta oder den inzwischen bundesweit bekannten ›Höhnern‹. Jede Karnevalsgesellschaft entlang des Rheins von Leverkusen bis Bonn, die etwas auf sich hielt, war darum bemüht, ihn für ihre Galasitzung zu verpflichten. Er war ein Garant für gute Stimmung, allein seinetwegen kamen viele Besucher. Bei ihm konnte man unbeschwert lachen. Dieses Lachen kostete seinen Preis. Schmitz ließ sich nicht locken oder blenden, wenn er um seine Gage feilschte. Da verging manch einem Literaten, der das Sitzungsprogramm zusammenstellte, das Lachen.
Schmitz selbst war auch nicht zu Lachen zumute. Im Gegenteil. Die Situation, die sich vor ihm aufgetan hatte, ließ das Lachen gefrieren. Er schimpfte vor sich hin wie die Kassenwarte der Gesellschaften, wenn sie auf seine Forderungen eingingen. Er hatte halt seinen Preis. Günstig war anders.
In der jetzt anstehenden Session von Mitte November bis zum Aschermittwoch hörte er häufig den Satz, den er selbst immer gerne in den Mund genommen hatte: Der Markt regelt das Geschäft. Nur die wenigsten Karnevalsfreunde wussten, dass die Rolle des Witze Fritze lediglich ein Beiwerk für Schmitz war. Er hatte nahezu alle guten Büttenredner unter Vertrag, ebenso wie die beliebtesten und bekanntesten Musikgruppen. In erster Linie war er Manager.
Und da kam dieser Scheißkerl aus Aachen und versalzte ihm die Suppe. Schmitz verstand das Organisationskomitee mit der Prinzenfindungskommission nicht, wie es sich auf den Handel mit der Printe einlassen konnte. Als er davon erfuhr, war es zu spät für ein Umschwenken gewesen. Er hatte sich in seinem Feriendomizil in Südspanien aufgehalten, als am Rhein die richtungsweisenden Gespräche mit von Sybar geführt wurden. Von Sybar war sogar schon in Vorleistung getreten und hatte seinen Teil des Geschäfts erfüllt, sprich, er hatte einen stattlichen Batzen Geld auf den Tisch gelegt. Für den schnöden Mammon hatten die Karnevalsoberen alle ihre Prinzipien über Bord geworfen. Sie hingegen vertraten einen anderen Standpunkt, sie sahen in der Vereinbarung mit von Sybar einen Aufbruch in eine neue Zeit und hofften so, verkrustete Strukturen, in denen es sich der Kölner Karneval bequem gemacht hatte und langsam Staub ansetzte, überwinden zu können.
Es gebe keine Erbhöfe, hatten ihm Komiteemitglieder unmissverständlich zu verstehen gegeben. Jeder müsse sehen, wo er bleibe. Auch im Karneval regiere das Geld und säße der Rubel längst nicht mehr so locker wie noch am Ende des letzten Jahrhunderts. Schmitz hatte für diese Argumentation kein Verständnis. Für ihn war der Karneval keine Sache des Geldes – jedenfalls dann nicht, wenn es nicht in seine Taschen floss.
Für ihn stellte von Sybar eine Gefahr für die Originalität des Kölner Karneval dar. Wehret den Anfängen! Doch man lachte ihn aus als ewigen Gestrigen.
Schnell merkte Schmitz, dass er mit seiner Rolle als Retter des kölschen Fasteleers bei den Entscheidungsträgern nicht weit kam. Aber er konnte nur auf die aus seiner Sicht bröckelnde Moral hinweisen. Bei seinem verzweifelten Bestreben, gegen von Sybar zu opponieren und die Oberen zu einem Umdenken zu bewegen, musste er die wahren Absichten für sich behalten. So blieb es bei seinem Appell an die Moral und er wurde kalt lächelnd abserviert.
Ohne von Sybar würde es diese unmögliche Situation nicht geben. Es war Schluss mit lustig bei Witze Fritze, wenn er an diese Printe dachte. Es wurde ernst für Schmitz.
Und am besten wäre es, wenn es todernst würde für von Sybar. Was wollte Köln mit einem Printenprinz aus Aachen?
Hermann Weinberg hatte einige Fehler gemacht. Darüber war er sich im Klaren. Die Verfehlungen könnten ihm den Posten als Leiter des Gewerbeaufsichtsamts in Aachen kosten, wenn man ihm auf die Schliche kam. Er verfluchte den Tag, an dem er den gut gefüllten Briefumschlag angenommen hatte, verbunden mit dem diskreten Hinweis, er möge in die Bebauungspläne schauen und sich über ihre Umsetzung informieren.
Weinberg brauchte nicht viel Fantasie, um zu ahnen, was sein Auftraggeber bezweckte. Das Baurecht war zwar nicht sein Fachgebiet und fiel nicht in seinen Zuständigkeitsbereich, aber als Aufsichtsbehörde für ein Gewerbe, das eventuell gegen das Baurecht verstoßen haben könnte, konnte er seinen Teil dazu beitragen, dass er das Geld nicht zu Unrecht erhalten hatte.
Vorteilsannahme? Vorteilsgewährung? Sogar Bestechlichkeit im Amt? Er wusste nicht, wie die strafrechtliche Bewertung für sein Handeln ausfallen würde. Es war ein gewaltiger Fehler gewesen, den Umschlag anzunehmen. Damit hatte er sich in eine Sackgasse begeben, aus der es keinen Ausweg zu geben schien.
Ebenso war es ein Fehler gewesen, überhaupt tätig zu werden. Als eine routinemäßige Überprüfung der Produktionsstätte hatte er seinen ersten Besuch bei von Sybar angekündigt. Wie eigentlich erwartet, fand er keine Missstände, die einen sofortigen Produktionsstopp gerechtfertigt hätten. Es gab einige kleinere Beanstandungen, weil etwa ein Gabelstapler vor einer Fluchttür im Warenlager abgestellt worden war oder weil eine Mitarbeiterin ohne die obligatorische Haube an einem Transportband hantierte. Das waren allerdings keine Gründe, die eine schwerere Sanktion nach sich zogen.
Weinberg musste die nächste Stufe zünden, um im Sinne seines Geldgebers zu handeln. Er bat um die Baupläne des Betriebs, der nach dem Krieg in einem neuen Industrie- und Gewerbegebiet in Eilendorf errichtet worden war. Und er wurde fündig: Er fand heraus, dass ein Teil der Fabrik, der eindeutig industriellen Zwecken diente, auf einem Bereich des Grundstücks gebaut war, der ausschließlich für gewerbliche Nutzung geplant war. Dort wurden Teile für Backgeräte hergestellt, die von Sybar entweder für eigene Zwecke in den Backstraßen benötigte oder veräußerte.
Somit verstieß das Unternehmen unzweifelhaft gegen den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan und das Baurecht. Weinberg kündigte Auflagen an, ein Bußgeld gegen den Printenproduzenten, verbunden mit der Forderung, das Baurecht unbedingt einzuhalten. Der Beamte hatte von Sybar Bedenkzeit gewährt und für sich selbst einen Schlachtplan entworfen, in dem er die weiteren Schritte festlegte.
Weinberg hatte mit vielem gerechnet, nur nicht mit solch einer resoluten Reaktion von Peter von Sybar. Beim nächsten Gesprächstermin verkündete der Printenbäcker seine Absicht, mit dem Unternehmen Aachen zu verlassen. Nur das Geschäft in der Fußgängerzone zwischen Rathaus und Dom wolle er als aus der Werbung bekanntes und berühmtes Aushängeschild von ›Printen von Sybar‹ belassen. Was Dallmayr für München oder das Sacher für Wien, das war von Sybar für Aachen. Er würde den Schein wahren, aber den Firmensitz verlagern. Die Öffentlichkeit bekäme gar nicht mit, dass von Sybar kein Aachener Unternehmen mehr war.
Welche Konsequenzen das haben würde, erkannte Weinberg schnell: Einer der größten Gewerbesteuerzahler würde Aachen verlassen. Hunderte von Arbeitsplätzen würden vor Ort verloren gehen, was nicht nur die Arbeitslosenquote vor Ort nach oben trieb, sondern langfristig noch mehr Menschen ins finanzielle Abseits.
Das alles nur, weil Weinberg in seiner Geldgier seinem Auftraggeber einen Gefallen hatte erfüllen wollen. Aber noch war es nicht zu spät. Noch gab es wahrscheinlich nur zwei Menschen, die Bescheid wussten: er selbst und von Sybar. Wenn beide schwiegen und so täten, als sei nichts geschehen, wäre es gut. Nur, wie konnte er sicher gehen, dass von Sybar schweigen würde? Nur, indem er auf Nummer sicher ging und von Sybar für alle Zeiten schwieg.
2.
Rudolf-Günther Böhnke, vorzeitig in den Ruhestand geschickter Kriminalhauptkommissar und ehemaliger Leiter der Abteilung für Tötungsdelikte im Polizeipräsidium Aachen, wartete geduldig. Er hatte, wie er immer sagte, Zeit ohne Ende. Böhnke hatte es sich auf der Holzbank an seinem Lieblingsplatz auf dem Friedhof in Huppenbroich bequem gemacht. Sein Blick fiel auf die schmale Grünfläche zwischen zwei gepflegten Gräbern, die für ihn reserviert war. Dort, in diesem Fleckchen Erde, würde er seine letzte Ruhestätte finden; das war so sicher wie das Amen in der Kirche.
Wann? Das war die Frage, die er sich kurioserweise nicht mehr stellte, seitdem er wusste, dass seine irdischen Tage knapp wurden. Die unheimliche Krankheit, die ihn in den beruflichen Ruhestand getrieben hatte, würde irgendwann sein Leben abrupt beenden. Er wusste, wie es geschehen würde: Er würde einen Schwächeanfall erleiden, wie schon so oft, aber von diesem würde er sich nicht mehr erholen. Dann wäre es vorbei; vielleicht heute, vielleicht in ein paar Tagen, ein paar Monaten oder vielleicht erst in einem Jahr. Böhnke war dennoch zuversichtlich, was die ›Restlaufzeit‹ seines Daseins betraf, auch wenn er jederzeit mit dem Schlimmsten rechnen musste. Ein Jahr noch, mindestens, das wäre gut, sagte er sich, dann käme er in den Genuss einer Feier zu seinem 60. Geburtstag.
Der pensionierte Kommissar schaute sich um. Er war allein auf dem Friedhof, was ihn nicht verwunderte. Wer trieb sich schon mittags freiwillig an einem kalten Tag im November mitten in der Woche auf einem Friedhof herum? Die Gräber waren winterfest gemacht, die Menschen würden an den stillen Feiertagen kommen, um bei ihren Toten zu sein. Die Buchen zwischen den Grabreihen hatten ihr Laub abgeworfen und machten den matten Sonnenstrahlen Raum, die durch eine dünne Wolkendecke brachen. Langsam wurde es ungemütlich auf den Höhen der Nordeifel. Hierhin kam der Winter früher und mit mehr Wucht als in Böhnkes ehemaligen Wohnort Aachen. Aber jener Wohnort war Schnee von gestern.
Sein wandernder Blick fiel auf den schnurgeraden, mit Kies bedeckten Weg, den er bis zum Friedhofseingang einsehen konnte. Pünktlichkeit, die Höflichkeit der Armen und die Tugend der Könige, schien dem Mann fremd, der ihn auf dem Friedhof treffen wollte, dachte sich Böhnke. Sein Freund Tobias Grundler, Rechtsanwalt in Aachen, hatte das Treffen eingefädelt.
»Es gibt ein Problem, das kannst nur du lösen«, hatte Grundler im Telefonat behauptet. »Für einen Juristen gibt es keinen Ansatz und für die Polizei keinen kriminellen Hintergrund. Es ist im Prinzip eine Privatangelegenheit, aber zu delikat, um damit einen mir nicht bekannten Privatdetektiv zu beauftragen. Da weiß man nie, ob der nicht doch Wissen an Dritte weitergibt, was mein Mandant auf keinen Fall will.«
Böhnke hatte ablehnen wollen. Er wollte sich erholen. Sein Bedarf an Ermittlungstätigkeit oder am Herumschnüffeln in privaten Dingen war gedeckt. Erst vor wenigen Wochen hatten Grundler und er einen Fall geklärt, in dem private Mauscheleien, politische Kungeleien und verbrecherisches Handeln eng miteinander verknüpft waren. Da wollte er endlich einmal seine Ruhe haben.
Doch Grundler hatte nicht lockergelassen. »Höre dir wenigstens einmal an, was mein Mandant dir zu sagen hat. Es ist auch von Vorteil für mich, wenn du mit ihm sprichst. Meine Mandanten sollen schließlich das Gefühl haben, dass ich mich nachhaltig um ihre Belange kümmere. Also, was ist?«
Böhnke hatte knurrend eingewilligt. Wenn er seinem Freund einen Gefallen tun könne, solle der Mann halt zu ihm kommen.
»Aber zu mir nach Huppenbroich«, hatte er als Bedingung ausgemacht. »Am Dienstag, um 14 Uhr auf dem Friedhof.«
Der Besucher war fast 20 Minuten über der Zeit. Böhnke war überrascht, als ein alter Mann sich vom Eingang her näherte. Das musste Grundlers Mandant sein. Böhnke glaubte, den Mann zu kennen. Aus Huppenbroich war der Mensch nicht. Mittlerweile kannte Böhnke so ziemlich alle der rund 440 Einwohner des abgelegenen Dorfes. Der Mann im eleganten, dunklen Mantel war weit über 70, schätze er, aber noch voller Schwung. Mit strammem Schritt näherte sich der Fremde der Bank, auf der Böhnke gelassen sitzen blieb, lupfte den dunkelbraunen Hut und zeigte sein volles, schlohweißes Haar.
»Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Böhnke. Aber ich habe eine Ewigkeit gebraucht, ehe ich Huppenbroich gefunden habe und dann bin ich lange von meinem Parkplatz bis zum Friedhof gelaufen. Das kommt davon, wenn so ein alter Knacker wie ich nichts mit einem Navigationssystem anfangen kann. Die Nordeifel ist für so eine Großstadtpflanze wie ich, die nie richtig aus Aachen rausgekommen ist, schon fast Terra incognita.« Er lächelte unsicher. »Sie sind doch Herr Böhnke? Oder etwa nicht?«
Der Pensionär nickte und bot den Platz an seiner Seite an. Er gab sich betont reserviert. Solange er nicht wusste, was der Fremde im Schilde führte, blieb er auf Distanz. Er musste schlucken, als dieser sich zu erkennen gab und seinen Namen nannte.
»Von Sybar, mein Name. Heinrich von Sybar.«
Er wusste schlagartig, wen er vor sich hatte. Einer der Printenkönige von Aachen saß höchstpersönlich neben ihm. Böhnke konnte nur schweigend staunen. Was für ein Ei hatte ihm Grundler da wieder ins Nest gelegt? Was trieb einen der reichsten und untadeligsten Menschen aus der Region an seine Seite? Er sah von Sybar musternd ins Gesicht, bemerkte dessen klare, blaue Augen und meinte schmunzelnd: »Böhnke, mein Name. Rudolf-Günther Böhnke.«
Beide blieben stumm nebeneinander sitzen und schauten über die Grabflächen durch die Buchen hinaus auf die grünen Hügel am Horizont.
Böhnke sah keinen Grund, das Gespräch zu eröffnen. Schließlich wollte von Sybar etwas von ihm und nicht er etwas vom Printenkönig.
»Hm.« Von Sybar räusperte sich. »Schön haben Sie es hier. So viel Natur macht mich fast schon sprachlos. Und dann …«
Böhnke wusste, was kommen würde. Darauf hätte er wetten können.
»Diese Ruhe. Hier ist es so ruhig, dass man die Ruhe schon wieder hören kann. Einfach schön.«
An Böhnke war es nicht, die Ruhe zu unterbrechen. Von Sybar sollte sagen, was Sache ist.
»Grundler hat Sie vorgewarnt?«
»Ja und nein«, antwortete Böhnke. »Er hat mir gesagt, dass mich ein Mandant besuchen werde. Er hat mir aber nicht gesagt, dass Sie es sind, Herr von Sybar.«
»Was ja im Prinzip auch richtig ist«, behauptete von Sybar. »Immerhin vertritt er meine Interessen und braucht meinen Namen nicht überall hinauszuposaunen.«
Böhnke kommentierte die Bemerkung nicht. Er wusste, dass von Sybar sehr zurückhaltend lebte und gesellschaftlichen Kontakt scheute. In der Öffentlichkeit sah man ihn im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern höchst selten; allenfalls dann, wenn er eine seiner großzügigen Spenden an soziale Einrichtungen leistete.
Von Sybar spielte verlegen mit dem Hut auf seinen Oberschenkeln, als sei ihm die Unterhaltung unangenehm.
»Um zur Sache zu kommen: Ich brauche Ihre Hilfe«, sagte er endlich. »Also …«
»Trauen Sie mir das zu?«, unterbrach ihn Böhnke schnell.
»Ja«, antwortete von Sybar. »Ich weiß, dass Sie kein junger und dynamischer Kriminalhauptkommissar sind, sondern ein Ruheständler. Grundler hat mich vorgewarnt, aber auch gesagt, dass Sie der einzige Mensch seien, dem ich rückhaltlos vertrauen könne.« Er lächelte gewinnend. »Um ehrlich zu sein, war ich ein wenig erschrocken, als ich Sie hier sitzen sah.«
»Wen hatten Sie denn erwartet und womit hatten Sie gerechnet?«
»Da ich nicht wusste, wer mich erwartet, habe ich mit nichts gerechnet. Aber als ich dann einen schätzungsweise 60-Jährigen mit kurzen grauen Haaren, in einer dicken Jacke und in Jeans auf einer Parkbank auf einem Friedhof vorgefunden habe, glaubte ich im ersten Moment, an den Falschen geraten zu sein. Aber Sie waren beziehungsweise sind genau so, wie Grundler Sie beschrieben hat.«
»Okay. Das wäre also geklärt. Ein alter Mann soll Ihnen also helfen. Und wobei?«
Das sei eine lange Geschichte, meinte von Sybar, was ihm prompt die Bemerkung von Böhnke einhandelte, man habe alle Zeit der Welt.
»Folgendes. Ich werde nicht jünger und ich möchte mich endlich ganz auf mein Altenteil zurückziehen. Na ja, nicht ganz«, sagte er sinnierend. »Ich möchte gerne die wenigen Jahre, die ich noch vor mir habe, genießen. Und dazu gehört, dass ich mich aus meinem Printenreich verabschiede. Im Prinzip ist die Nachfolge schon seit geraumer Zeit geklärt. Aber jetzt bekomme ich Bedenken. Sie müssen wissen, Herr Böhnke, ich verlasse mich für gewöhnlich auf meinen Bauch. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass etwas nicht stimmt.«
Der Kommissar runzelte nachdenklich die Stirn. Da kann jemand nicht loslassen, obwohl er loslassen möchte, dachte er sich. Der sucht nur einen Grund, doch nicht abzutreten.
»Bevor Sie jetzt glauben, ich traue niemandem die Leitung meines Unternehmens zu, muss ich Sie enttäuschen«, fuhr von Sybar fort. »Ich werde in wenigen Tagen Aachen verlassen und eine mehrmonatige Weltreise antreten. Einmal mit dem Schiff rund um den Globus. Überall dort Halt machen, wo es uns gefällt.«
Wieder stutzte Böhnke.
Und wieder betätigte sich von Sybar als Gedankenleser. »Wir, damit meine ich mich und meine Partnerin. Ich bin seit fast 30 Jahren verwitwet und habe glücklicherweise eine Frau kennengelernt, in deren Gegenwart ich mich wohl fühle.« Er musste kurz lachen. »Sie ist nun auch in den Ruhestand gegangen und so können wir unbesorgt das Weite suchen.« Endlich legte er den Hut zur Seite, den er zwischen den Händen gedreht hatte, und rieb sich kurz die Nase. »Ich bin davon überzeugt, dass mein Schwiegersohn Peter das Unternehmen gut leiten wird. Er hat bisher immer zu meiner vollsten Zufriedenheit gehandelt, wenn Sie mir den Arbeitszeugnisbegriff nachsehen. Es stehen einige riskante unternehmerische Entscheidungen an, und da ist er der richtige Mann. Er wird Ihnen selbst sagen können, was bei uns passieren wird.«
»Was soll denn da nicht stimmen?«, fragte Böhnke dazwischen, »wenn doch Ihr Nachfolger alle Qualitäten hat?«
»Ich sorge mich nicht wegen Peter, ich sorge mich um Peter«, antwortete von Sybar. »Ich weiß nicht, was geschieht, wenn er aus irgendwelchen Gründen ausfällt. Ich habe zwar eine Tochter, aber die kann ich mit der Firmenleitung nicht betrauen. Die ist nur dumm. Das hat mich ein Heidengeld an Spenden für den Förderverein gekostet, damit die am Gymnasium das Abitur machen konnte. Beim Studium sind ihr dann klar die Grenzen aufgezeigt worden. Die kann nett lächeln und hübsch aussehen, mehr leider nicht. Und das reicht nicht für eine Unternehmensleitung. Das Beste, was sie mir aus ihrem Studium mitgebracht hat, war Peter. Der kann’s. Der ist wie ich.« Von Sybar hustete kurz. »Und bei Peters Stellvertreter Landmann, der nach meinem Ausscheiden zweiter Mann werden soll, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Am Anfang war der Spitzenklasse, aber ich glaube, ihm sind der Erfolg und das Geld zu Kopf gestiegen. Und er scheint mir ein kleiner Frauenheld zu sein. Peter sieht das zwar anders, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich recht habe.«
»Und was soll jetzt meine Aufgabe sein?« Böhnke konnte sich nicht vorstellen, was von ihm erwartet wurde.
»Sie sollen beobachten und überprüfen. Peter, Elisabeth und Landmann und alles, was sich bei uns im Betrieb so abspielt.«
»Und wenn sich nichts abspielt? Wenn alles ordnungsgemäß abläuft?«
»Dann habe ich zumindest ein beruhigendes Gefühl. Machen Sie’s?«
Böhnke würde es machen. Aber nicht, weil ihn von Sybar mit einem bettelnden Hundeblick anschaute, sondern wegen Grundler, dem er einen Gefallen tun wollte.
»Ja.«
»Okay.« Von Sybar erhob sich schwungvoll. »Ich hab kalt. Wenn Sie mich bitte zu meinem Wagen begleiten. Ich habe noch etwas für Sie.« Am Ausgang schaute er sich suchend um, dann erinnerte er sich, wo er sein Fahrzeug geparkt hatte.
Es war an der Parkbucht am weit entfernten, ehemaligen Löschteich abgestellt, wie Böhnke feststellte.
»Haben Sie eigentlich irgendjemandem etwas von mir oder meiner Aufgabe gesagt?«, fragte er von Sybar, als sie vor dem großen Mercedes standen.
»Nicht direkt. Ich habe Peter gesagt, ich würde während meiner Abwesenheit einen persönlichen Berater einstellen, der für mich den laufenden Betrieb beobachten soll, aber keine Entscheidungskompetenz hat. Die anderen wissen von nichts.«
»Und was meinte Ihr Schwiegersohn?«
»Ich glaube, dem ist das egal. Er weiß, was zu tun ist. Und Sie werden ihm kein Klotz am Bein sein.« Von Sybar hatte die Fahrertür geöffnet und beugte sich in den Innenraum. »Hier«, sagte er, als er Böhnke einen Umschlag reichte. »Darin finden Sie einen Generalschlüssel für mein Werk, einschließlich des Zugangs zu meinem persönlichen Büro. Dort kommt ansonsten niemand rein. Nicht einmal der Nachtwächter oder die Putzfrau oder Peter und Elisabeth. In meinem Büro haben Sie Zugang zu allen Papieren und Dateien.« Er lächelte kurz. »Nur die Rezeptur für unsere Printenmischung, die werden Sie nicht finden. Die ist in einem besonderen Safe«, sagte er und tippte sich gegen die Stirn.
Nachdenklich griff Böhnke nach dem Umschlag. Auf was ließ er sich da bloß ein?
»Ach, ja«, fuhr von Sybar fort. »Wir haben noch gar nicht über Ihr Honorar geredet. Aber ich glaube, wir werden uns einig. Oder?«
Der Kommissar nickte stumm. Daran sollte die Geschichte nicht scheitern. Er würde eine saftige Forderung stellen, nahm er sich vor.
»Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr von Sybar. Was ist eigentlich an den Gerüchten dran, dass Sie schwer krank sind? Sie sollen vermehrt im Klinikum gewesen sein?«
Der Printenkönig schaute ihn verblüfft an. »Wie in aller Welt haben Sie hier in dieser gottverdammten Einsamkeit davon gehört?« Er hatte sich an den Wagen gelehnt.
Böhnke blieb ihm eine Antwort schuldig. Erstens war Huppenbroich keine ›gottverdammte Einsamkeit‹ und zweitens war er es, der die Fragen stellte. Er würde von Sybar nicht auf die Nase binden, dass ihm seine Lebensgefährtin davon berichtet hatte, nachdem eine Mitarbeiterin aus der Printenfabrik in ihrer Apotheke davon gesprochen hatte.
»Das mit dem Klinikum stimmt. Mehr aber auch nicht«, fuhr von Sybar fort. »Ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe endlich eine passende Frau für mich gefunden. Dr. Margarethe Hopfenbach war Kardiologin am Klinikum und ich habe ihr an ihren letzten Arbeitstagen vor der Pensionierung geholfen, das Büro zu räumen.« Er lächelte Böhnke an. »Sie sehen, ich habe bei meiner Weltreise sogar meine persönliche Ärztin dabei. Da kann mir gar nichts passieren. Ich bin kerngesund.«
»Weiß Ihre Familie von der Frau?«
»Nein. Sie wird es erfahren, wenn wir zurück sind.«
»Und was halten Ihre Angehörigen von Ihrer Reise?«
»Was sollen sie schon sagen? Ich mache ja doch, was ich will. Also lassen sie mich ziehen. Ich bin da wie Peter. Der macht auch, was er will. Soll er auch, solange der Betrieb läuft und die Zahlen auf dem Konto stimmen.« Von Sybar stieg in den Wagen. »Versuchen Sie nicht, mich zu erreichen. Ich habe niemandem außer Peter gesagt, welche Route ich reise, und ich habe kein Handy dabei. Ich bin für mindestens sechs Monate aus der Welt. Adieda, Herr Böhnke.« Er schlug die Tür zu und fuhr über die Kapellenstraße in Richtung Simmerath davon.
Kopfschüttelnd machte sich Böhnke auf den Weg zu seiner Wohnung. Als er unterwegs den Umschlag öffnete, fiel ein kleines Blatt Papier heraus. Er hob es auf, bevor der Wind es verwehen konnte. Er hielt einen Scheck in den Händen; zwar von von Sybar mit dem Vermerk ›Honorar Böhnke‹ und seiner Unterschrift versehen, aber ohne Datum und ohne Betrag.
3.
Peter von Sybar lehnte sich zufrieden in seinen Schreibtischsessel zurück. Das Feld war bestellt, die Saat aufgegangen. Jetzt begann die Zeit, die Früchte zu ernten. Die Früchte, das waren für ihn die steigende Bekanntschaft des Unternehmens, die Aufmerksamkeit durch seine landesweite Präsenz in den Medien und die Werbewirksamkeit für die Printen aus Aachen; damit einher ging fast zwangsläufig eine Umsatzsteigerung, wie er aus seiner Zeit als Prinz Karneval in Aachen wusste. Lange hatte er mit dem Organisationskomitee für den Kölner Karneval um das Motto der Session gerungen, jedenfalls ließ er die Funktionäre der Narretei aus der Domstadt in dem Glauben, er würde ernsthaft mit ihnen streiten. Er hatte zwei prägnante Mottos zur Diskussion gebracht, von denen er wusste, dass sie Widerspruch hervorrufen würden.
Den Slogan ›Auch am Rhein / muss die Printe knackig sein!‹ hatte er ebenso vorgeschlagen wie ›Printe Alaaf!‹ Die von ihm erwartete Entrüstung kam prompt. Bei diesen Ausrufen handele sich um reine Werbung und unerträgliche Provokation, wurde ihm entgegengehalten. Damit hatte er sein Ziel erreicht, in Köln sprachen die Karnevalsfreunde ebenso über die Sprüche wie in Aachen. So funktionierte Werbung, freute er sich. Bei einer späteren Verhandlung zauberte er den Spruch aus dem Hut, den er von Beginn an für die Zeit seiner närrischen Regentschaft favorisiert hatte:
›In Köln kannste fiere un laache
mit ’ne jecke Prinz us Aache!‹
Grammatikalisch zwar nicht ganz einwandfrei, aber immerhin ein Motto in Reimform, und darauf kam es dem Komitee an, wenngleich sich einige Mitglieder an der Erwähnung von Aachen störten.
Ein wenig aus dem Konzept hatte ihn lediglich die überraschende Ankündigung seines Schwiegervaters gebracht, zu einer Weltreise aufbrechen zu wollen. Wegen des Alltagsgeschäfts hatte er keine Bedenken, wegen der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens hätte er jedoch gerne dessen Rat gehabt. Aber er würde auch ohne den Seniorchef Entscheidungen treffen beziehungsweise die Entscheidungen umsetzen, die sie beide einvernehmlich getroffen hatten. Gespannt war er auf den persönlichen Berater seines Schwiegervaters. Er hatte keine Vorstellung, um wen es sich dabei handeln könnte.
Die leichten Zweifel, ob sie das Unternehmen ohne den Rat des Alten auf einem erfolgreichen Kurs halten könnten, waren schnell verflogen, als sich Landmann zur Mehrarbeit bereit erklärte. Sein Stellvertreter würde ihm den Rücken frei halten, wie er es ohnehin zugesichert hatte, als sein Plan herangereift war, Prinz Karneval in Köln zu werden. Die paar Wochen bis Aschermittwoch würden sie ohne wirtschaftliche Verluste überstehen. Für das laufende Jahr war das Geschäft ohnehin gemacht. Die Printenproduktion für das Weihnachtsfest war fast abgewickelt und die Ware an die Händler ausgeliefert. Was zu organisieren blieb, war der Verkauf in den eigenen Verkaufsstellen in der Aachener Innenstadt und auf dem idyllischen Weihnachtsmarkt auf dem Katschof, auf dem Markt und rund um den Dom. Das vorweihnachtliche Geschäft zu kontrollieren und zu regeln würde Landmann nicht schwerfallen.
Das Klingeln eines Handys unterbrach von Sybars Gedankengänge. Die Melodie von ›Wenn et Trömmelche jeht‹ gab das Gerät zu erkennen, das er speziell für die Karnevalszeit angeschafft hatte. Nur er, seine beiden Mitstreiter aus dem Dreigestirn und einige aus ihrem Tross kannten diese Nummer.
Seine Jungfrau im närrischen Trio, Wolfgang Bartuschak, wollte ihn sprechen. Bartuschak war einer seiner wenigen Freunde, die er von Kindesbeinen an kannte. Der Dritte im Bunde, Bauer Heinrich Mattern, würde später zu ihnen stoßen, wenn Anfang Januar die offizielle Proklamation im Kölner Gürzenich anstünde.
Bartuschak hatte eine Mitteilung zu machen, mit der von Sybar schon gerechnet hatte. Er würde ihn nicht zu einer Veranstaltung nach Köln begleiten können, bedauerte die jecke Jungfrau. Privat hatten sie eine karnevalistische Aufführung besuchen wollen, sie wollten sozusagen inkognito die Stimmung ausloten, die am Rhein herrschte, nachdem sich die Narren mit den Öcher Exporten anfreunden mussten. So würde er sich alleine auf den Weg machen. Auf die Idee, Elisabeth zu fragen, kam er erst gar nicht. Sie würde sich nicht als Lückenbüßer für Bartuschak zur Verfügung stellen und seinetwegen ihre eigenen Pläne für den Abend aufgegeben. Wenn er ehrlich war, war er froh darüber, dass sie anderweitig beschäftigt war. Dann hatte er wenigstens Ruhe vor ihr.
Ohne sich von seiner Frau zu verabschieden, verließ von Sybar das Büro. Am Glashaus des Pförtners reichte er seinen Büroschlüssel durch die Schalterklappe, winkte kurz zum Gruße, und sprang in seinen schwarzen Porsche, der direkt neben dem Firmeneingang auf dem reservierten Stellplatz stand. Zunächst führte ihn seine Fahrt direkt in die Tiefgarage des Hotels am Roncalliplatz im Herzen von Köln. Dort hatte ihm das Festkomitee für die Dauer seiner Regentschaft ein Zimmer angemietet, in dem er und seine zwei Begleiter später ihre Kostüme wechseln und sich ausruhen konnten. Aber er hatte nicht die Absicht, sich länger in diesem geräumigen Hotelzimmer im obersten Stockwerk aufzuhalten. Er holte sich aus der Minibar eine Flasche Mineralwasser und schaute trinkend hinaus auf den Platz, der an den mächtigen Dom und dem vom menschlichen Gewusel belebten Hauptbahnhof angrenzte. Der Trubel bei den Karnevalssitzungen und Bällen reichte von Sybar, er brauchte nicht auch noch das hektische Treiben der Millionenstadt. Er würde in den Sälen und auf den Straßen in Köln seine Rolle spielen und danach immer wieder zurück nach Hause fahren, zurück in seine Villa am Hangeweiher in Aachen.
Im Restaurant nahm er noch eine kleine Mahlzeit zu sich und wunderte sich dabei, dass er von allen Mitarbeitern des Hotels erkannt und höflich behandelt wurde. Das sprach für die Qualität des Hauses, war er doch selbst nur ein einziges Mal zuvor hier gewesen und hatte heute zum ersten Mal den Zimmerschlüssel beim Portier verlangt. Der Mann hatte ihn beim Namen genannt, obwohl er sich nicht vorgestellt hatte. Er war eben bekannt aus Funk und Fernsehen, nicht zu vergessen aus den Zeitungen, schmunzelte von Sybar vor sich hin, als er in seinen Wagen stieg. Routiniert tippte er die Adresse des Veranstaltungsortes in Köln-Nippes in das Navigationsgerät ein und Sekunden später meinte eine männliche Stimme im schönsten Öcher Slang: »Die Route, wa, die wird jetz op der Stell berechnet. Da kannse druff waate.« Und wenig Momente später hieß es: »Mach, dat de fott küsst. Wennse op der Stroat bess, guckse, dat du direktemang nach räets küsst. Und dann schnack jradus, bis ich dich saach, wie et wigger jeht, wa. Hass’et?«
Getreu folgte er den Anweisungen seines Navigators. Wenn er Beifahrer hatte, schaute er stets in verblüffte Gesichter, sobald die Stimme die Anweisungen gab. Die meisten verstanden nicht, was sie aus dem Lautsprecher hörten.
Viele Besucher strömten in die Aula des Schulzentrum, in der es den karnevalistischen Abend der Quartiersgemeinschaft geben sollte, keine große Veranstaltung einer Gesellschaft, vielmehr ein von der Gemeinschaft privat organisiertes Fest mit Kölsch vom Fass und Musik vom Band. Der Kindergarten hatte einen Tanz einstudiert, einige Nachwuchskräfte aus dem Viertel wollten ihre Redebeiträge vortragen und testen, ob sie witzig beim Publikum rüberkamen. Und es sollte ein oder zwei Überraschungsgäste geben.
Zu seinem Erstaunen wurde von Sybar auch an der provisorischen Kasse vor dem Saaleingang erkannt. Mit ehrlicher Herzlichkeit wurde er von dem Kassierer begrüßt. Man fühle sich geschmeichelt, dass er gekommen sei. Man hätte nie geglaubt, dass er die Einladung annehme, immerhin sei er viel beschäftigt. Selbstverständlich sei er Ehrengast. Von Sybar freute sich über diese Wertschätzung, die ihn nicht daran hinderte, einen 50-Euro-Schein in die kleine Geldkassette zu stecken.
Der Kassierer, ein älterer, einfach gekleideter Mann, war offensichtlich auch Organisator des Abends. Wenige Minuten später stand er auf der Bühne, begrüßte die zahlreichen Besucher und konnte es sich nicht verkneifen, auch Prinz Pitter III. zu begrüßen, der gerne zu ihnen gekommen sei. Er nötigte von Sybar geradezu, die Bühne zu betreten.
Laute ›Pitter, Pitter‹-Rufe begleiteten von Sybars Weg zum Mikrofon. Die Menschen wirkten begeistert, er hatte Mühe, sie wieder einigermaßen zu beruhigen. Er gab sich bescheiden. Er sei nicht als Prinz Pitter III. zu ihnen gekommen, sondern rein privat, als Freund des Karnevals, der miterleben wolle, wie der richtige, echte und volkstümliche Karneval im Veedel gefeiert werde. Er wusste, wie er die Menschen einfangen konnte, und der große Beifall und die bestätigenden Rufe zeigten ihm, dass er den richtigen Nerv getroffen hatte. Er sei noch nicht ihr Prinz Pitter III., noch sei er bloß Peter von Sybar. Erst nach der offiziellen Proklamation durch das Festkomitee Anfang Januar werde er Prinz Karneval sein. Als er den Menschen versprach, in der Session noch einmal mit seinem Dreigestirn zu ihnen zu kommen, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. Von wegen, die Kölner würden ihm mit Skepsis und Abstand begegnen, wie die Funktionäre befürchtet und die Medien geunkt hatten. Hier, wo das jecke Herz von Köln schlug, war es anders. Er würde bei den Kölnern ankommen, glaubte der Mann aus Aachen. Den Menschen war es egal, wer als Prinz agierte. Hauptsache, es war jemand, der mit ihnen sprach und der für sie da war.
Von Sybar hatte keine Probleme, die neuesten kölschen Karnevalshits mitzusingen, die von CD kamen. Einige Gruppen vom Rhein hatten selbstverständlich seine Regentschaft zum Inhalt von Liedern gemacht, und er sang unbekümmert den Refrain mit, der sich über ihn lustig machte: »Frag mich nicht, wie ich find’s, dass wir haben ’nen Printenprinz.« Daraufhin hatte prompt eine Gruppe aus Aachen einen Liedtext geschrieben, in dem es hieß: »Kölle, nee, was ist das für ne Stadt, die noch nicht mal nen eigenen Prinzen hat.«
Von Sybar hatte sich dafür eingesetzt, dass dieses Lied nicht an der Rheinschiene gespielt wurde. Für ihn war es eine Geste der Höflichkeit, die Kölner nicht zu verspotten, selbst wenn er persönlich vom Boulevard und zum Großteil auch von Funktionären verhöhnt wurde. Aber deren Häme zählte für ihn nicht. Was zählte, war die angenehme Erfahrung, die er in diesem Saal machte, und das Wissen, dass sich seine Auftritte im steigenden Umsatz beim Printenverkauf niederschlagen würden.