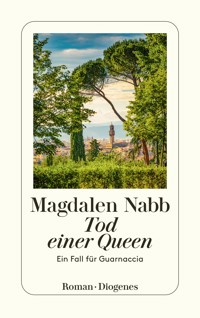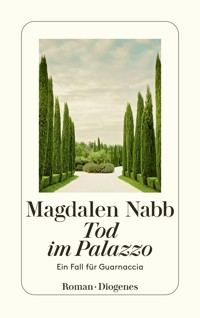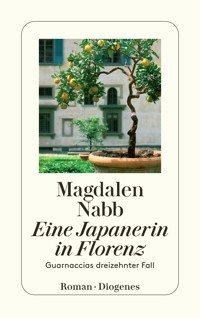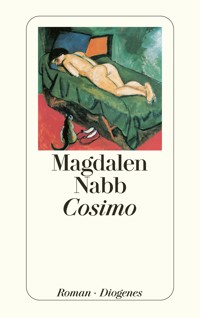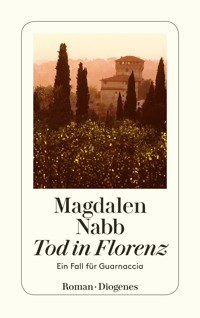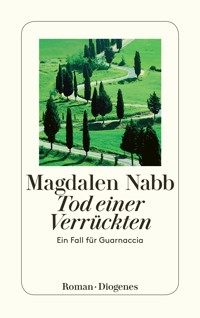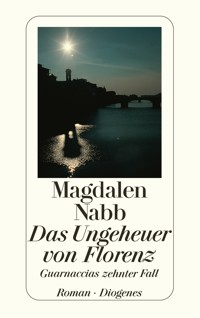9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maresciallo Guarnaccia
- Sprache: Deutsch
Die Schriftstellerin Celia Carter wird ausgerechnet an ihrem Geburtstag tot in der Badewanne aufgefunden in der Villa Torrini, hoch über den Hügeln von Florenz. Maresciallo Guarnaccia glaubt nicht an einen Unfall. Carters Ehemann liegt sturzbetrunken gleich nebenan im Schlafzimmer, beteuert, nichts gehört oder gesehen zu haben, und ändert auch im nüchternen Zustand seine Aussage nicht. Eine vertrackte Geschichte. Als Guarnaccia kurz davor ist aufzugeben, kommt unerwartet Hilfe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Magdalen Nabb
Geburtstag in Florenz
Guarnaccias neunter Fall
Roman
Aus dem Englischen von Christa E. Seibicke
Titel der 1993 bei
HarperCollins Publishers, London,
erschienenen Originalausgabe:
›The Marshal at the Villa Torrini‹
Copyright © 1993 by Magdalen Nabb
Die deutsche Erstausgabe
erschien 1998 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von Guido Ferrera
Copyright © Guido Ferrera
Obwohl dieser Roman unverkennbar in Florenz und Umgebung spielt, sind Figuren und Handlung ausnahmslos frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden Personen, lebenden wie toten, wäre rein zufällig.
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23164 9 (10. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60590 7
Inhalt
Hinweis für den Leser
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Autorenbiographie
Mehr Informationen
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]1
»Vielleicht hab ich sie gestoßen, kann schon sein.«
»Kann sein, sagen Sie?« Der Staatsanwalt wiederholte die letzten Worte des Angeklagten betont laut und hielt dann inne. Ein nervöses Hüsteln ging durch den Gerichtssaal, wie zwischen zwei Sätzen eines klassischen Konzerts. Das Schweigen wurde beklemmend. Auf der Stirn des Angeklagten glänzten Schweißperlen. Der Staatsanwalt schlug die schwarzseidenen Schöße seiner Robe zurück und holte zum Angriff aus.
»Haben Sie die Frau gestoßen – ja oder nein?«
»Ja! Ich hab sie geschubst – glaub ich …«
»Und glauben Sie auch, daß dieser Schubs kräftig genug war, um sie zu Boden zu werfen?«
Er war ein so mickriges Kerlchen, daß es einem schwerfiel, sich vorzustellen, wie er jemanden niederschlug. Die blonden Haare hingen ihm schlaff und fettig um den Kopf, und der schlottrige Anzug sah aus, als wäre er ein paar Nummern zu groß, aber wahrscheinlich hatte er im Gefängnis abgenommen. Der Mann war in den Dreißigern, doch die schmalen Schultern und die umschatteten Augen mit dem leeren Blick gaben ihm das Aussehen eines halbverhungerten, mißhandelten Kindes. Er preßte Knie und Hände zusammen, als müsse er sich anstrengen, um auf [6]dem einzeln stehenden Plastikstuhl das Gleichgewicht zu halten. Freilich zitterte er auch, und vielleicht war es das, wogegen er ankämpfte. Indes waren es weder Gewissensbisse noch die Erinnerung an jene Nacht, was ihn zittern machte. Er hatte nur Angst vor dem, was hier und jetzt mit ihm geschah.
»Hingefallen ist sie, das stimmt …« Sein Blick schweifte nach links zu den Käfigen, wo ein Häftling von wesentlich kräftigerer Statur sich leise hin und her wiegte und still in seine Hände weinte.
»Bitte beantworten Sie die Frage!«
»Sie …« Er riß den Blick vom Käfig los, aber es war offensichtlich, daß er sich nicht mehr erinnern konnte, wie die Frage lautete. »Hingefallen ist sie, ja … Aber sie war betrunken.«
»Sie war betrunken.« Die Angewohnheit des Staatsanwalts, jede seiner Aussagen zu wiederholen, hätte selbst den unschuldigsten Zeugen aus dem Konzept gebracht, doch diesem Mann konnten solch subtile Taktiken nichts mehr anhaben. Wieder schweifte sein Blick zum Käfig. Seine Aufmerksamkeit galt nur zur Hälfte den Fragen des Staatsanwalts.
»Also: Die Frau war betrunken, Sie haben sie gestoßen, und sie ist gestürzt. Ist das alles?«
Unverständliches Gemurmel.
»Bitte sprechen Sie lauter, damit das Gericht Ihre Antworten auch versteht!«
»Sie könnte irgendwo gegengeprallt sein.«
»Ach, und wogegen? Gegen eine Wand? Den Fußboden? Ein Möbelstück? Na, gegen was könnte sie geprallt sein?«
[7]»Da stand eine Kommode in der Diele, gleich da, wo sie hingefallen ist.«
Das Schluchzen des Mannes im Käfig war nun im ganzen Gerichtssaal zu hören, was freilich dem Staatsanwalt, der jetzt auf den Höhepunkt zusteuerte, als Geräuschkulisse durchaus nicht unwillkommen war.
»Hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen, fest steht, daß Anna Maria Grazzini, fünfunddreißig Jahre alt und bei guter Gesundheit, nach einem ›kleinen Schubs‹ mit nachfolgendem Sturz neben einer Kommode … bei ihrer Einlieferung in die Klinik Santa Maria Nuova ihren Verletzungen, darunter eine Kinn- und Schädelfraktur, fünf gebrochene Rippen und eine perforierte Bauchspeicheldrüse, bereits erlegen war! Sie muß wirklich sehr ungünstig gefallen sein, meinen Sie nicht auch, Signor Pecchioli?«
Er hatte richtig kalkuliert. Das Hintergrundschluchzen, das mit seiner Stimme lauter geworden war, illustrierte eindrucksvoll das Grauen jenes Weihnachtsabends.
»Herr Vorsitzender, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich den Geschworenen jetzt die Fotos der Anna Maria Grazzini vorlegen lassen.«
Einer nach dem anderen nahmen sie die Bilder zur Hand, und man spürte förmlich, wie ihre Augen glasig wurden, in der Hoffnung, pflichtbewußt dreinzuschauen, ohne wirklich hinzusehen. Danach richteten sich aller Blicke durchdringender auf die mickrige Gestalt auf dem Plastikstuhl.
Keine Frage, der Staatsanwalt verstand sein Geschäft, auch wenn er sich hier den großen Aufwand hätte sparen können. Pecchioli spekulierte gar nicht darauf, seinen Kopf [8]aus der Schlinge zu ziehen. Er wollte es nur hinter sich bringen, damit er in seine sichere Zelle zurück durfte und einen Happen essen und eine Zigarette rauchen konnte. Der Saal hatte die Fotovorführung für eine gründliche Husten- und Schneuzrunde genutzt. Mindestens die Hälfte der Anwesenden waren nämlich in irgendeinem Stadium der Grippeepidemie befangen, die sich dank eines unnatürlich warmen Februars in ganz Florenz eingenistet hatte. Die Fotos wurden wieder eingesammelt.
Die Verteidigung hatte für alle drei Angeklagten auf Totschlag plädiert, aber in Anbetracht der Nachwirkungen bestand da keine reale Chance. Im übrigen war Pecchiolis Anwalt in Gedanken vermutlich schon beim Mittagessen und einer guten Flasche Wein. Jedenfalls hatte er keinen Blick für den Staatsanwalt übrig, der wieder aufgesprungen war und seine Vernehmung fortsetzte.
»Haben Sie Anna Maria Grazzini geschlagen, nachdem sie neben der Kommode hingefallen war?«
»Nein. Ich hab sie niemals geschlagen. Nein!«
»Wie erklären Sie sich dann die Verletzungen, die ich eben aufgezählt habe? Ich nehme doch an, Sie haben eine Erklärung dafür? Schließlich waren Sie dabei. Und Sie glauben, Sie hätten sie geschubst. Jedenfalls ist sie gestürzt. Was geschah dann?«
»Ich wollte …« Seine Stimme versagte, er räusperte sich und schwieg. Die kleine Hand mit den abgekauten Nägeln tastete, ohne es zu berühren, nach dem Mikrophon, als ob das die Ursache für sein Verstummen sei.
»Ich … sie war betrunken. Ich wollte sie dazu bringen, daß sie aufsteht.«
[9]»Und wie? Haben Sie sie getreten?«
»Ich hab sie vielleicht ein bißchen mit dem Fuß angestoßen, wie Sie das auch getan hätten.«
»Angestoßen!«
»Ja, das haben wir alle gemacht. Sie war betrunken und wollte nicht aufstehen.«
»Zu dem, was Sie alle getan haben, kommen wir gleich. Wo genau haben Sie sie denn ›gestoßen‹, wie Sie’s nennen? Oder wäre ›getreten‹ nicht doch der treffendere Ausdruck? Einer, der eher in Einklang mit Art, Ausmaß und Schwere der nachfolgenden Verletzungen stünde?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Inwiefern wissen Sie das nicht? Wollen Sie vielleicht andeuten …«
»Es liegt an den Wörtern, die Sie gebrauchen. Die sind zu lang. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen.«
Einen Moment lang war der Staatsanwalt verdutzt, und man konnte ihm vom Gesicht ablesen, wie sehr es ihn wurmte, daß so ein erbärmlicher Wicht es gewagt hatte, ihn mitten im Satz zu unterbrechen und seine Wortwahl zu kritisieren. Aber er hatte sich gleich wieder gefangen und sprach nun so langsam und deutlich, als hätte er es mit einem Ausländer zu tun.
»Haben Sie… Anna Maria Grazzini … getreten, nachdem Sie sie durch einen Schubs zu Fall gebracht hatten?«
»Kann sein, ich …« Wieder versagte ihm die Stimme, und man sah seinen Adamsapfel hüpfen, während er mehrmals heftig schluckte. »Ich erinnere mich nicht mehr. Ich war stocksauer auf sie, weil doch Weihnachten war. Wegen [10]dem Kind. Kann sein, daß ich ihr ’nen Tritt gegeben hab, genau wie die anderen. Sie wollte ja nicht aufstehen.«
»Von wem kam der Vorschlag für das, was Sie als nächstes taten? Von Ihnen?«
»Ich weiß nicht. Wir waren alle ganz durchgedreht. Wir sind alle zusammen drauf gekommen. … Ich weiß nicht mehr …«
»Wer hat als erster angerufen?«
»Chiara … Sie rief die Polizei.«
»Chiara Giorgetti?«
»Ja.«
»Und telefonierte sie von der Wohnung aus?«
»Nein. Sie ist mit den anderen zu einer Telefonzelle gegangen.«
»Und Sie gingen nicht mit?«
»Einer mußte doch bei dem Kind bleiben. Sie waren zu zweit, also konnten sie’s schaffen … sie haben es ja auch geschafft, daß …«
Der Staatsanwalt ging nicht darauf ein. Die Geschworenen wußten bereits, was die beiden geschafft hatten, denn sie hatten schon die Aussage von Mario Saverino gehört, dessen Schluchzen inzwischen in rhythmisches Stöhnen übergegangen war. Während seines Kreuzverhörs hatte er ununterbrochen geweint.
Nachdem er den Geschworenen einen Moment Zeit gelassen hatte, sich darauf zu besinnen, was an jenem Abend ›geschafft‹ worden war, fuhr der Staatsanwalt fort.
»Sie wissen aber, was dieser Anruf bei der Polizei ergeben hat, denn Chiara Giorgetti und Mario Saverino haben Sie gleich anschließend verständigt, war es nicht so?«
[11]»Doch.«
»Und was haben sie Ihnen erzählt?«
»Daß die Polizei nicht kommen würde. Die hätten gesagt, man solle einen Krankenwagen rufen.«
»Und haben sie einen gerufen?«
»Nein. Sie haben mir gesagt, sie wollten zum Palazzo Pitti und ich solle zehn Minuten warten und dann dort anrufen.«
»Was Sie auch taten?«
»Ja.«
»Und ich nehme an, Sie haben volle zehn Minuten gewartet?«
»Ja.«
Auch das ließ der Staatsanwalt erst einmal auf die Geschworenen wirken, bevor er, fast beiläufig, die nächste Frage stellte.
»Sagen Sie, als Sie Anna Maria Grazzini zum letzten Mal sahen, war sie da bei Bewußtsein?«
Obwohl Pecchioli sich viel Zeit zum Nachdenken ließ, brachte er keine Antwort zustande.
»Konnte sie sprechen?« hakte der Staatsanwalt nach.
»Nicht so, daß es verständlich gewesen wäre.« Und wieder behauptete er nachdrücklich: »Sie war betrunken.«
»Zu dem Zeitpunkt, um den es hier geht, war das längst nicht alles, was ihr fehlte! Also, hat sie versucht zu sprechen oder sich mit irgendwelchen Lauten bemerkbar zu machen?«
»Laute … ja, Laute hat sie von sich gegeben … So ein abgehacktes Röcheln, wie ein Hund, wenn ihm schlecht wird.«
[12]»Keine weiteren Fragen.« Der Staatsanwalt raffte seine wallende Robe und setzte sich.
Der Richter hob den Kopf; sein Gesicht war ausdruckslos.
»Herr Verteidiger?«
»Keine Fragen.«
Der Richter blickte in die Runde. »Wenn ich recht verstanden habe, hören wir den Bericht des Pathologen erst morgen?«
Der Staatsanwalt schoß in die Höhe. »Das ist richtig, Herr Vorsitzender. Die Gerichtsmedizin …«
»Schon gut. Bitte rufen Sie Ihren nächsten Zeugen auf.«
»Die Staatsanwaltschaft ruft Maresciallo Salvatore Guarnaccia, Dienststellenleiter der Carabinieri-Wache im Palazzo Pitti.«
Der Maresciallo hatte während der ganzen Verhandlung reglos dagesessen, die mächtigen Hände auf die Knie gepflanzt, die großen Augen fast starr nach vorn gerichtet, die Stirn in konzentrierte Falten gelegt. Jetzt erhob er sich langsam, erfüllt von bangen Vorahnungen.
»Salva? Bist du’s? Na, wie ist es gegangen?«
»Überhaupt nicht.« Er legte seine Mütze auf den Flurtisch und ging direkt ins Schlafzimmer, um die Uniform auszuziehen. Normalerweise kam er zuerst in die Küche, sagte ihr guten Tag und erkundigte sich, was es zu essen gab. Teresa, die die heutige Abweichung als Zeichen schlechter Laune interpretierte, gab Salz ins Wasser, das eben zu sprudeln begann. Als er erschien, riß sie gerade eine Packung Spaghetti auf.
[13]»Wie meinst du das, es ging überhaupt nicht? Was ist, willst du auch Pasta?«
»Nein. Ja. Nur ein wenig. Oder vielleicht esse ich auch bloß einen Salat.«
»Du kannst dich nicht nur von Salat ernähren – meine Güte, Salva, gestern abend hast du drei Stück Schokoladentorte verdrückt, und jetzt auf einmal bloß Salat. Deine Leber weiß bestimmt nicht mehr, wo’s langgeht, und ich auch nicht. Warum kannst du dich nicht vernünftig ernähren? Ach, was werde ich froh sein, wenn die Jungs wieder da sind und dieser ganze Zirkus aufhört!«
Es war seine Idee, nicht etwa die seiner Frau, daß er die Zeit, in der die beiden Kinder mit der Schule zum Skilaufen waren, nutzen würde, um seine Leber zu entgiften. Zu dieser Kur gehörten Tage, an denen er verdrießlich in einer Salatschüssel herumstocherte, unterbrochen von Ausrutschern wie besagter Schokoladentorte, die er ebenso verdrießlich in sich hineingeschaufelt hatte. Und dabei fixierte er jeden Bissen mit so traurig-vorwurfsvollem Blick, als ob es die Torte wäre, die ihn verschlang.
Teresa gab die Nudeln ins Wasser und rührte einmal kräftig um.
»Ich hab eine Handvoll für dich mitreingetan. Das gescheiteste ist, du nimmst eine halbe Portion Pasta ohne Sauce, keinen Wein dazu und ißt hinterher noch ein bißchen Salat.«
Daß sie recht hatte, ließ sich nicht bestreiten – aber bestreiten konnte man genausowenig, daß ein Teller blanker Spaghetti mit einem Glas Wasser dazu selbst dem sonnigsten Charakter aufs Gemüt geschlagen hätte.
[14]»Es dauert noch fünf, sechs Minuten.«
Der Maresciallo schlurfte hinüber ins Wohnzimmer und schaltete die Fernsehnachrichten ein. Ihre Stimme folgte ihm.
»Wenn wir mit ihnen zum Skilaufen gefahren wären, dann hättest du wandern können, hättest frische Luft und Bewegung gehabt und viel mehr für deine Gesundheit getan als mit dieser ganzen Salatesserei. Vor allem aber hätte das nicht mal die Hälfte von dem gekostet, was wir für die beiden ausgegeben haben, weil wir nämlich im Militärskiklub gewohnt hätten, aber man kommt sich ja vor, als ob man gegen die Wand redet …«
Die Nachrichten auf dem zweiten Kanal waren zu Ende, und der Maresciallo schaltete um aufs erste Programm.
»Mir wär’s ja egal, wenn du wenigstens einen handfesten Gegengrund anführen könntest!«
Da hatte sie wieder recht, der Maresciallo wartete nur selten mit Argumenten auf. Entweder packte er eine Sache an, oder er blieb untätig. Und für die Berge hatte er nichts übrig.
»Allmächtiger!« Mit diesem Finale schwappte der Inhalt des Topfes ins Sieb, und der Maresciallo, der es gehört hatte, stand auf.
Einen Moment blieb er noch stehen und sah zu, wie zwei weitere Politiker in Handschellen abgeführt wurden, dann schaltete er das Fernsehgerät aus.
»Das Land wird von Banditen regiert«, verkündete er, als er wieder in der Küche erschien.
»Geh mir aus dem Weg! Immer, wenn ich koche, mußt du dich wie eine Straßensperre in der Küche aufpflanzen[15] … Hab ich das Brot rausgestellt? Nein … Salva, ich muß an den Schrank …« Ihre Nörgelei war rhetorisch, und Teresa brachte sie auch ganz mechanisch vor, denn in fünfzehn Ehejahren hatte sie die Hoffnung aufgegeben, ihm abzugewöhnen, daß er wie ein gestrandeter Wal immer da auftauchte, wo was los war. Die übrige Familie mußte sich wohl oder übel um ihn herumschlängeln wie um ein sperriges Möbelstück.
Als sie endlich bei Tisch saßen, betrachtete sie ihn aufmerksamer und sagte: »Du hast Hunger, das ist alles, was mit dir los ist.«
»Ich hab den ganzen Vormittag verplempert, das ist los.«
»Was? Weil du ins Gericht mußtest?«
»Weil ich stundenlang dort rumgesessen habe, und als ich endlich drankam, hat die Verteidigung plötzlich Vertagung beantragt. Wegen irgendeines Problems mit der Aussage des Kindes. Es muß erst geklärt werden, ob es vertretbar ist, die Kleine gegen die eigene Mutter aussagen zu lassen.«
»Na, das wundert mich nicht. Auch wenn ich natürlich nur das weiß, was in den Zeitungen steht …« Wieder so ein rhetorischer Vorwurf. Er erzählte ihr nie etwas, behauptete sie jedenfalls. »Trotzdem finde ich, das Kind hat schon genug durchgemacht, auch ohne daß man es noch vor Gericht zerrt, damit es vor lauter fremden Leuten peinliche Fragen beantwortet. Stell dir das doch bloß mal vor …«
Der Maresciallo, der sich in den letzten paar Tagen nichts anderes vorgestellt hatte, sagte verärgert: »Ganz ohne einen Tropfen Öl kann ich das nicht essen – pappt doch alles zusammen!«
Teresa tröpfelte ihm ein klein wenig Öl auf die Pasta [16]und streute einen Teelöffel geriebenen Käse darüber. »Du machst dir doch nicht immer noch Sorgen wegen dieser neuen Verordnung, oder? Vergiß nicht, Salva, da müssen sich alle dran gewöhnen. Bestimmt fällt es den Richtern und Anwälten auch nicht leicht.«
»Richter und Anwälte haben studiert. Außerdem bin ich zu alt.«
»Was heißt hier zu alt?«
»Zu alt zum Umlernen, meine ich. So was ist gut und schön, wenn einer zwanzig ist – was nicht heißen soll, daß es mir damals leichtgefallen wäre …« Er schielte finster nach dem Glas Wasser, das hätte Wein sein sollen.
»Na komm, gib den Teller her – die Pasta ist doch inzwischen eiskalt. Hier, nimm dir Salat. Im übrigen ist es ja nicht so, als ob du noch nie bei einer Verhandlung ausgesagt hättest.«
»Pah! Früher hieß das, Namen und Rang zu Protokoll geben, die Angaben meines schriftlichen Berichts bestätigen, danke schön und auf Wiedersehen.«
»Um Himmels willen, Salva, man könnte ja glauben, du stündest selber unter Anklage. Dabei hast du doch gar keinen Grund, dich vor einem Kreuzverhör zu fürchten.«
»Was verstehst du schon von Kreuzverhören?«
»Ich gucke Perry Mason, im Gegensatz zu dir – du schläfst immer dabei ein.«
»Pah!«
Sie begann den Tisch abzuräumen. »Ich setze gleich Kaffeewasser auf. Nimm dir noch eine Birne, die sind köstlich. Ach, jetzt regnet es schon wieder!« Sie knipste das Licht an und ließ die Kaffeekanne vollaufen.
[17]Langsam schälte er die Birne. Ob es sich lohnte, die Kopie seines Berichts heute abend noch einmal durchzugehen? Im Augenblick wußte er ja nicht einmal, wann man ihn wieder vorladen würde. Er hatte versucht, das Zeug auswendig zu lernen, besonders Daten, Uhrzeiten und so weiter. Er konnte sich leicht vorstellen, wie er steckenbleiben würde, wenn ein gewiefter Anwalt es darauf anlegte, ihn zu verwirren oder aus dem Konzept zu bringen. Blamieren würde so einer ihn auf jeden Fall. Grausige Erinnerungen an mündliche Prüfungen in der Schule tauchten wieder auf, die ihn auch nach all den Jahren noch vor Scham erschauern ließen. Immerhin konnte ihm jetzt keiner mehr mit dem Lineal auf die Fingerknöchel schlagen oder ihn zwingen, sich in der Ecke auf eine Lage Reiskörner zu knien. Die einzigen Male, wo er als Junge dankbar gewesen war für seine dickliche Statur. Sein armer kleiner Freund Vittorio, der immer abgelegte Kleider tragen mußte, die ihm viel zu groß waren, Vittorio hatte die knochigsten Knie der ganzen Klasse und mußte furchtbar leiden. Die Nonnen wußten natürlich, daß seine Mutter eine Prostituierte war, und faßten ihn deshalb immer besonders hart an. Seine Knie hatten jedenfalls nie Zeit zu verheilen, bevor Schwester Benedetta ihn das nächste Mal in der Ecke auf dem Reis knien ließ.
»Möchtest du einen Schluck Milch rein haben?«
»Schwester Benedetta war ekliger als jeder Richter bei einem Geschworenenprozeß.«
»Salva!«
»Was?«
»Ich frag dich, ob du Milch willst. Und was faselst du jetzt wieder für ein unzusammenhängendes Zeug daher?«
[18]»Nur einen Tropfen. Nonnen. Ich dachte grade an die Nonnen …«
»Oh … Ach, was ich dir noch sagen wollte, heute abend kommt ein guter Film im Fernsehen.«
»Ich dachte, ich geh noch mal die Akte über dieses neue Strafrechtsverfahren durch, nur zur Sicherheit …«
»Nicht schon wieder! Du würdest ja doch bloß drüber einschlafen. Weißt doch, daß du nach dem Abendessen die Augen nicht offenhalten kannst. Ich weiß nicht, wie viele Abende hintereinander du nun schon mit diesem Ordner auf der Brust eingenickt bist. Egal, ob am Tisch oder im Bett. Da kannst du genausogut mal vor einem guten Film einschlafen.«
Und der Maresciallo, der den ganzen Fall bis oben hin satt hatte, war nicht abgeneigt, ihren Rat zu befolgen. Aber er bekam keine Gelegenheit dazu, denn noch bevor er zu Abend gegessen hatte, vielleicht sogar just in dem Moment, als er die Tagesbefehle für morgen abzeichnete und erwog, die Gerichtsverhandlung und seine Diät heute abend einmal zu vergessen, beschloß Signora Eugenia Torrini, die Carabinieri zu rufen, egal, was Giorgio dazu sagte.
»Hoffentlich sind wir hier richtig.«
Sie waren auf dem Berghang hinter dem Forte del Belvedere, und der Fahrer des Maresciallos hatte sich im Dunkeln schon zweimal verfahren, war in eine falsche Zufahrtsstraße eingebogen und mußte dann in riskanten Manövern wieder rückwärts auf die schmale, kurvenreiche Via San Leonardo hinaussetzen. Diesmal aber hatten sie Glück. Eine längere Auffahrt, gesäumt von Zypressensilhouetten,[19] die indes, wie die Anruferin schon erklärt hatte, keine befestigte Straße war, sondern nur ein zerfurchter Feldweg, der an der Villa Torrini vorbeiführte. Jetzt schwenkten die Scheinwerfer zur Linken über ein Tor.
»Ich sehe nirgends Licht …«
Der Fahrer hielt an, öffnete seine Tür und richtete eine Taschenlampe aufs Tor. Es war ein großes, hohes Holzportal, grün gestrichen, mit dem Namen TORRINI auf einem Messingschild. Am Griff hing ein Vorhängeschloß, und im Licht der Taschenlampe glitzerten Regentropfen auf den Pfosten.
Sie fuhren weiter, bogen hinter dem Haus ein und hielten in einem aufgeweichten Seitenpfad. In zwei Fenstern der Villa schimmerte Licht, und in einer umgebauten Scheune ein paar Meter weiter war ebenfalls ein, freilich kleineres, Fenster erleuchtet. Es gehörte zu den Besonderheiten von Florenz, die dem Maresciallo von Anfang an gefallen hatten, daß die Stadt mitunter jäh zu Ende war und man sich unversehens auf dem Lande wiederfand.
»Sie können hier auf mich warten.«
Ein feiner Sprühregen netzte sein Gesicht, als er ausstieg, und die Nachtluft roch nach vermodertem Laub und nassem Gras. Es war so still, daß seine Schritte ungewöhnlich laut auf dem gepflasterten Hof vor dem Haus widerhallten. Riesige Kübel mit geisterhaften Zitronen- oder Orangenbäumchen, in Plastik gehüllt, standen rechts und links vom Eingang. Der Maresciallo drückte auf die beleuchtete Klingel, doch er hörte bereits, wie drinnen schwere Riegel zurückgeschoben wurden. Bestimmt hatten sie den Wagen gehört. Schlüssel klirrten. Dann eine Pause, [20]vielleicht, um sich noch einmal zu besinnen, bevor eine tiefe Frauenstimme fragte: »Wer ist da?«
»Die Carabinieri, Signora. Sie haben uns angerufen.«
»Ach, je …« Neuerliches Schlüsselrasseln. »Es tut mir furchtbar leid, aber Sie müssen sich einen Moment gedulden. Ich kann die anderen Schlüssel nicht finden.«
Er hörte, wie sie sich von der Tür entfernte; wenn er sich nicht täuschte, ging sie am Stock. Und noch immer murmelte sie bekümmert vor sich hin: »Ach, je … Giorgio hat recht, es wird schlimmer mit mir … Ach, wo können sie bloß sein …«
Zum Glück war es nicht kalt. Irgendeine Kletterpflanze rankte sich über die ganze Hausfront. Und doch merkte man, daß man nicht wirklich auf dem Lande war: Man konnte des Nachts zu gut sehen, weil der Himmel wegen der nahe gelegenen Stadt nicht richtig dunkel wurde. Weiter draußen dagegen sah man, falls nicht gerade Vollmond war, nicht einmal die Hand vor den Augen, dafür aber Sterne, Millionen von Sternen. Sie kam zurück … mit noch mehr Schlüsseln.
»Ach …! Es tut mir furchtbar leid. Aber so ist das, wenn man alt wird …«
Sie hantierte immer noch mit den Schlössern. Jeweils acht Umdrehungen, bevor eines aufsprang!
Endlich aber öffnete sich die Tür, und eine hochgewachsene, würdige Dame blickte ihm entgegen. »Ach, ich bin wirklich untröstlich! Ich nehme mir immer wieder vor, sie da hinzulegen, wo ich sie griffbereit habe, aber dauernd kommt irgendwas dazwischen. Entweder das Telefon klingelt oder sonstwas, und ich ziehe mit den Schlüsseln in der [21]Hand los, und schon ist es passiert. Ich hoffe, Sie verzeihen mir?« Sie sah ihn besorgt an.
»Aber natürlich. Das passiert uns doch allen mal …«
Eigentlich hatte er sich von diesem Spruch Einlaß erhofft, aber obwohl sie die Tür einen Spalt weiter aufmachte, mußte er doch bleiben, wo er war. Sie war sehr adrett gekleidet, ganz in Grau.
»Giorgio hat recht, ich sollte meine Sachen mehr in Ordnung halten. Je älter man wird, desto wichtiger ist das. In meinem Alter kann man nämlich nicht mehr improvisieren. Ach, was müssen Sie nur von mir denken … Ich bitte vielmals um Verzeihung.«
Eine zweite Absolution, begleitet von einer leichten Neigung des Oberkörpers, verschaffte ihm endlich Einlaß, und nun entschuldigte sie sich dafür, daß sie ihn so lange auf der Schwelle hatte stehenlassen.
»Giorgio predigt mir das immer, und recht hat er, also er sagt: ›Halt gelegentlich mal den Mund und überleg dir, was du tust.‹ Aber natürlich vergess’ ich’s immer wieder – und dann das Alleinsein, wissen Sie …«
Er folgte ihr in einen langgestreckten Raum, der durch einen Rundbogen in Speise- und Wohnzimmer unterteilt war. Ohne sich groß umzusehen, gewahrte er helle Farben, weiche Teppiche unter den Füßen, sehr viel Komfort und gediegenen Reichtum. Und außerdem jede Menge Zigarettenqualm.
»Bitte, nehmen Sie Platz. Ich werde Ihnen alles erklären, und dann können Sie entscheiden, was zu tun ist – falls Sie mich nicht einfach für eine törichte alte Frau halten. Sehen Sie, ich sitze immer hier …«
[22]Der Eckplatz eines ausladenden Sofas mit hellem Bezug. Ein kleiner Stapel Taschenbücher balancierte auf der Lehne, und auf dem niederen Tisch dicht davor befanden sich Zigaretten, ein goldenes Feuerzeug, ein Glas und eine Flasche Whisky. Der Maresciallo setzte sich in den Sessel ihr gegenüber, legte seine Mütze auf die Knie und wartete. Er wußte aus Erfahrung, daß man den Leuten Zeit geben und sie ihre Beobachtungen auf eigene Weise erzählen lassen mußte, und falls sich herausstellen sollte, daß die alte Dame einfach nur einsam und ängstlich war und Zuwendung brauchte, dann würde er sich auch damit abfinden. Das einzig Peinliche war, daß man bestimmt hören konnte, wie sein malträtierter Magen knurrte.
»Sie haben aber viele Bücher«, bemerkte er laut, um ein besonders geräuschvolles Kullern zu übertönen. Tatsächlich war die Wand hinter ihr vom Boden bis zur Decke mit wohlgefüllten Bücherregalen bestückt.
»O ja, ich lese von morgens bis abends. Leider rauche ich auch den ganzen Tag. Darf ich Ihnen eine Zigarette …?«
»Nein, … nein, danke, ich rauche nicht.«
»Ich sollte eigentlich auch nicht, Giorgio predigt mir das andauernd … Aber in meinem Alter stehen einem nicht mehr viele Laster zur Verfügung, und darum genieße ich meine Zigaretten und abends einen Whisky oder zwei. Wenn Sie auch einen Schluck möchten, dann nehmen Sie sich doch bitte selbst ein Glas. In dem Schrank dort drüben.«
»Nein, nein. Besten Dank.« Er hatte das Zeug seiner Lebtag nicht angerührt.
»Mit diesem elenden Stock brauche ich so lange zum [23]Aufstehen. Ach, es ist schon eine üble Sache, das Altwerden. Innerlich spürt man überhaupt keine Veränderung – ich jedenfalls nicht –, und darum kommt man sich vor wie eingesperrt in einem Körper, den man kaum noch als den eigenen erkennt. Mir wär’s gleich, und wenn ich morgen sterben müßte. Ganz im Ernst. Das Leben macht mir keinen Spaß mehr, und anderen kann ich weder nützen noch Zierde sein. Darum bin ich so gern mit Celia zusammen, weil sie mir das Gefühl gibt, ich wäre doch noch zu etwas gut. Giorgio meint zwar, sie tue es nur aus Freundlichkeit, aber selbst wenn. Wir tauschen Bücher aus – sie ist nämlich Schriftstellerin und liest genausoviel wie ich, und ich meinerseits lese für mein Leben gern englische Romane. Aber mal ehrlich, wie vielen Menschen kann man Bücher leihen und sicher sein, daß man sie auch wiederbekommt? Könnten Sie auch nur für einen Ihrer Freunde die Hand ins Feuer legen?«
»Na ja, ich bin kein …«
»Sehen Sie! Wollen Sie auch bestimmt keine?« Sie zündete sich eine neue Zigarette an. »Celia ist die einzige – was bei ihr als Schriftstellerin natürlich verständlich ist. Die sind übrigens für sie.« Und die alte Dame klopfte auf den Stoß Taschenbücher auf der Armlehne des Sofas.
Der Maresciallo sah sie an und wartete. Ihren Diskurs über Bücher verfolgte er nur mit halbem Ohr, eine der Angewohnheiten, die seine Frau verärgerten: Wenn man ihm etwas erzählte, verlor er irgendwann den Anschluß. Im Augenblick beschäftigte er sich mit dem Bild der Frau, die in ihrem eigenen Körper gefangen war. Die grauen gewellten Haare der Signora waren adrett frisiert; sie hatte [24]tiefblaue Augen, und man sah ihr an, daß sie zeitlebens sehr hübsch gewesen war. Sie trug weder Make-up noch Schmuck.
»Und nun frage ich Sie: Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Giorgio würde sagen, es sind meine Nerven, ich weiß, aber er ist verreist und wird es erst erfahren, wenn er mich morgen zur gewohnten Zeit anruft. Er war schon wütend, weil ich den Priester angerufen habe.«
Der Maresciallo sah sich ertappt und versuchte seine Unaufmerksamkeit zu überspielen.
»Sie glaubten demnach, man bräuchte sowohl einen Priester wie …«
»Einen Priester! Nicht in meinem Haus. Hier setzt kein Pfaffe den Fuß herein, es sei denn, ich würde völlig den Verstand verlieren. Ich hab’s bei zu vielen meiner Freundinnen miterlebt, was passiert, wenn man erst den Priestern in die Hände fällt. Und ich hab’s auch zu Giorgio gesagt, es ist ja nicht so, sag ich, als ob sie hinter irgendwas anderem als deinem Geld her wären – andernfalls wär’s womöglich interessanter! Was meinen Sie? Also ich will Sie ja nicht drängen, aber finden Sie nicht auch, wir sollten was unternehmen? Ich hab fünf-, sechsmal versucht anzurufen – Giorgio würde sagen, ich bin eine Plage, und sie wollen nur nicht gestört werden, aber man weiß ja nicht, wer am Telefon ist, bevor man abhebt, oder? Und Sie sehen ja selbst, wie behindert ich bin. Ich hab zwar mit dem Gedanken gespielt, rüberzugehen und bei ihnen zu klopfen, aber womöglich würde ich in der Dunkelheit stürzen, und was dann? Alles, worum ich Sie bitte, ist, daß Sie nachsehen und versuchen, sich bemerkbar zu machen. Zu Hause sind sie [25]nämlich. Ihr Wagen steht draußen, und es brennt auch Licht. Wenn Sie da durchs Fenster schauen, sehen Sie’s.«
Der Maresciallo stand auf, trat ans Fenster und starrte hinaus in die Dunkelheit. Mit einiger Anstrengung konnte er den gepflasterten Hof erkennen, den er überquert hatte, seinen Wagen, den Fahrer und das erleuchtete Fenster in der umgebauten Scheune.
»Wer sind diese Leute, und wann haben Sie sie zuletzt gesehen?« Sein Blick war immer noch nach draußen gerichtet.
»Celia, ich hab Ihnen doch grade von ihr erzählt. Celia und ihr Mann Julian. Sie sind beide drüben. Ich hab sie gegen halb sechs zusammen heimkommen sehen. Sie waren einkaufen. Ich bin ihnen bis zur Tür entgegengegangen – nicht aus Neugier, das würde ich nie tun, aber Celia hatte mir frische Milch mitgebracht. Wir verabredeten uns für zwischen sechs und halb sieben auf einen Drink und wollten bei der Gelegenheit auch ein paar Bücher austauschen – ja, und jetzt ist es fast neun, und die beiden gehen nicht ans Telefon! Ach, ich bin wirklich eine törichte alte Frau, nicht wahr?«
Der Maresciallo wußte keine Antwort.
»Welches Zimmer ist es denn, wo das Licht brennt?«
»Das ist das Bad. Ich sah das erleuchtete Fenster, als ich meine Läden schloß, und dachte: Celia nimmt ihr Bad – sie hat das gern, so gemütlich, mit einem Glas neben sich, in der Wanne zu liegen. Trotzdem habe ich, als sie Viertel vor sieben noch nicht da war, die Läden wieder aufgemacht und nachgesehen – man badet doch nicht über eine Stunde lang. Darum hab ich dann versucht, drüben anzurufen. Eigenartig ist das schon, das können Sie nicht bestreiten.«
[26]Der Maresciallo hatte die Erfahrung gemacht, daß die Menschen oft eigenartig sind, aber das behielt er für sich. Statt dessen sagte er, in erster Linie, um ihre Ängste zu beschwichtigen: »Es könnte auch sein, daß sie eingeschlafen sind und das Licht haben brennen lassen.«
»Ich weiß, was Sie wirklich meinen.« Bei diesen Worten drehte er sich erstaunt nach ihr um. »Aber in der Hinsicht spielt sich schon seit geraumer Zeit nichts mehr ab zwischen den beiden. Celia erzählt mir allerhand, und ich bin eine gute Zuhörerin. Giorgio kann sagen, was er will, wenn einem jemand zuhört, kann das schon eine Hilfe sein.«
»Ja. Ja, durchaus.«
»Schauen Sie, ich möchte Ihnen um alles in der Welt nicht die Zeit stehlen, aber ich würde es mir nie verzeihen, wenn sich herausstellen sollte, daß etwas passiert ist.«
»Keine Sorge, Signora. Sie haben sich ganz richtig verhalten. Und jetzt bleiben Sie schön ruhig hier sitzen und trinken Ihr Glas aus, während ich rübergehe und nachsehe, was mit Ihren Nachbarn ist.«
»Moment …« Mühsam rappelte sie sich hoch. »Ich hab hier irgendwo die Schlüssel zur Scheune … Celia sagt immer, für den Notfall, wissen Sie, oder wenn sie ihre eigenen womöglich mal verliert, und ich finde sie auch ganz bestimmt …«
Wie nicht anders zu erwarten, dauerte es geraume Zeit.
Der Maresciallo nahm die Schlüssel in Empfang, verzieh ihr die lange Suche und ging hinaus.
Als der Fahrer ihn kommen sah, ließ er den Motor an.
»Nein, nein … Kommen Sie mit. In der Scheune da drüben ist irgendwas nicht in Ordnung.«
[27]Auch wenn er das bis jetzt nicht zugegeben hatte, war der Maresciallo genauso überzeugt, daß drüben etwas nicht stimmte, wie die Signora Torrini. Zunächst einmal war es zu still. In der Wohnung einer Schriftstellerin sollte man hin und wieder eine Buchseite rascheln hören oder zumindest ab und an eine Bemerkung, die die Eheleute sich von Zimmer zu Zimmer zuriefen. Und dann dieses Badezimmerfenster. Das gefiel ihm ganz und gar nicht. Es war erleuchtet, aber nicht beschlagen. Trotzdem, nichts Eindeutiges.
»Läuten Sie mal.«
Nach zwei-, dreimal Klingeln wechselten sie einen Blick. Der Fahrer, ein junger Rekrut aus Sardinien mit großen Augen, der auf den Namen Giuseppe Fara hörte, erbot sich: »Soll ich die Tür aufbrechen, Maresciallo?«
Der Maresciallo zog den Schlüssel aus der Tasche und sperrte auf. Sobald sie drin waren, hämmerte er von innen gegen die Türfüllung und rief: »Carabinieri! Ist jemand da?«
Keine Antwort.
»Suchen Sie mal nach ’nem Lichtschalter.«
Nach einigem Umhertasten hatte Fara ihn gefunden. Es war ein hübsches Zimmer, quadratisch geschnitten, mit farbenfrohem Terrakotta-Fußboden. In der einen Hälfte war die Küche untergebracht, in der anderen standen Korbsessel auf hellen Teppichen gruppiert. In einem riesigen Krug steckten Schilfrohrkolben und hohe gefiederte Gräser. Der große rustikale Kamin stammte zweifellos aus einem Bauernhaus. Der Maresciallo trat näher. Die Scheite waren heruntergebrannt, glühten aber noch schwach in der Asche. Es war warm im Zimmer.
[28]»Sollen wir mal oben nachsehen, Maresciallo?« Fara deutete auf die Wendeltreppe, eine Holz- und Stahl-Konstruktion in der Ecke.
»Sie warten hier.« Er las Enttäuschung und Erleichterung zugleich im Gesicht des Jungen, als er den Aufstieg begann. Die Treppe war nicht für jemanden mit seiner massigen Statur gebaut, und der Maresciallo ging wohlweislich langsam. Im Obergeschoß war der quadratische Raum unterteilt in ein kleines Bad zur Linken, in dem Licht brannte und dessen Tür einen Spaltbreit offenstand, und ein Schlafzimmer auf der rechten Seite. Auch hier war die Tür nur angelehnt, doch der Raum lag im Dunkeln. Der Maresciallo stieß die Badezimmertür auf.
Keine Dampfschwaden, kein Dunst. Es war kalt im Raum, und auch das rote Wasser mit der blaßrosa Schaumschicht drauf war offenbar längst abgekühlt. Es roch nicht nach Tod, sondern nach einem blumigen Parfum, wahrscheinlich der Badezusatz. Die Frau in der Wanne war tot, ihr schlaff herabhängender Kopf war, halb unter Wasser, dem Maresciallo zugewandt. Richtig erkennen konnte er bei dem blutverfärbten Wasser natürlich nichts, aber es sah doch nach einem klassischen Selbstmord aus: Offenbar hatte sie sich in der Badewanne die Pulsadern geöffnet. Hier weiter nachzuforschen war vorerst nicht seine Aufgabe, und so stieg er vorsichtig wieder die Wendeltreppe hinunter.
»Die Frau liegt tot in der Wanne«, beantwortete er den fragenden Blick des Jungen. »Sehen Sie hier irgendwo ein Telefon?«
»Auf dem Tischchen am Kamin.«
[29]Er verständigte den diensthabenden Staatsanwalt und forderte dann im Präsidium in Borgo Ognissanti die Spurensicherung und einen Fotografen an. Als er den Hörer aufgelegt hatte, ging er im Zimmer hin und her, und seine großen, leicht vorstehenden Augen registrierten jedes Detail. Fara beobachtete ihn scharf, fragte aber nicht, wonach er suchte, weil er nicht als ahnungsloser Anfänger dastehen wollte. Hätte er gefragt, wäre der Maresciallo um eine Antwort verlegen gewesen. Er starrte zwar jeden Gegenstand im Raum an, war aber in Gedanken ganz woanders.
Einmal bemerkte er laut: »Wo zum Teufel hat sich eigentlich der Ehemann hin verkrümelt?«
»Haben Sie im Schlafzimmer …« Der Junge brach ab, weil ihm dieser Hinweis dem Chef gegenüber anmaßend erschien, doch dann hörten sie direkt über sich einen lauten Plumps. Beide schraken zusammen, und der Junge wurde blaß. Eigentlich geschah es nur, um seine Angst zu kaschieren, daß er als erster die Wendeltreppe hochstürmte. Der Maresciallo, der sich gut in ihn hineinversetzen konnte, brummte bloß: »Vorsicht, und gehen Sie nicht rein.«
Der Junge gehorchte. Mit einem Finger stieß er die Tür auf und tastete nach dem Lichtschalter. Dann standen beide stumm auf der Schwelle und starrten ins Zimmer. Sie sahen auf den ersten Blick, was den Lärm verursacht hatte, eine leere Chiantiflasche, die zu Boden gefallen war und aus der jetzt die letzten roten Tropfen auf einen Bettvorleger aus weißem Ziegenfell sickerten.
»Glauben Sie, er ist tot?«
[30]Der Maresciallo trat ans Bett und drehte das bärtige Gesicht nach oben. Sowie er losließ, plumpste der Kopf auf die Tagesdecke zurück.
»Nein«, sagte er, »tot ist der nicht. Aber betrunken. Sturzbetrunken.«
[31]2
»Wenn Sie Ihre Proben beisammenhaben, können wir dann das Badewasser ablassen?« Mit diesem Arzt hatte der Maresciallo noch nie zu tun gehabt, und er bemühte sich redlich, ihn mit seiner bulligen Gestalt in dem kleinen Bad nicht zu behindern.
Gurgelnd und glucksend floß das rote Wasser langsam ab. Der Arzt hob vorsichtig einen Fuß des Leichnams an, der den Abfluß blockierte. »Sonst sind wir noch die ganze Nacht hier. Noch eine Aufnahme?«
Das Blitzlicht des Fotografen flammte emsig surrend auf, sobald der Wasserspiegel sank und die Leiche freigab. Dann trat wieder Ruhe ein, und die Männer wechselten einen Blick.
»Na, das ist aber mal ’ne Überraschung …« Der Arzt hob erst ein Handgelenk, dann das andere. Beide unversehrt. »Noch nicht mal ein Kratzer. Aber irgendwo muß das viele Blut ja herkommen. Können wir sie umdrehen? Haben Sie alles im Kasten?«
»Ich bin fertig«, bestätigte der Fotograf.
»Maresciallo?«
Guarnaccia, der sich schon vor ihrem Eintreffen alle für ihn wichtigen Notizen gemacht hatte, nickte nur.