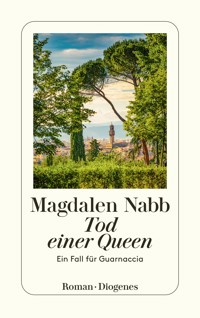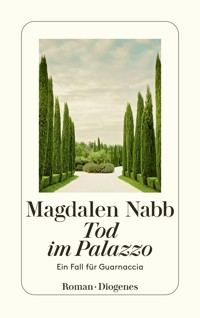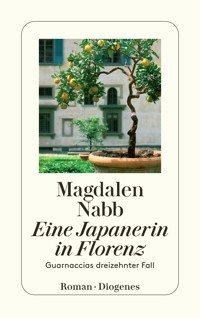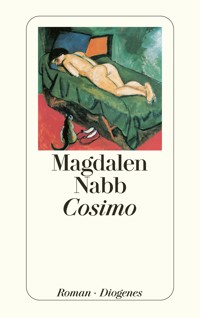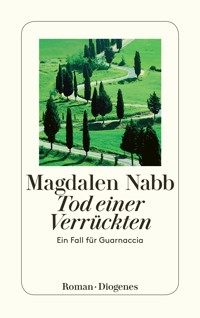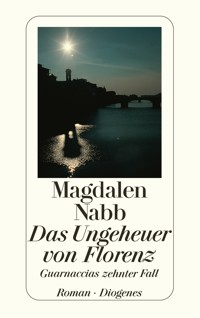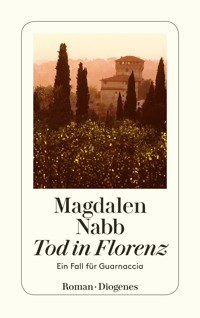
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maresciallo Guarnaccia
- Sprache: Deutsch
Sie ist auf dem Revier, um ihre Freundin als vermisst zu melden. Beide sind ursprünglich zum Italienischlernen nach Florenz gekommen und dann geblieben. In einer nahe gelegenen Kleinstadt hat Monika Heer als Töpferin gearbeitet, doch seit drei Tagen ist sie verschwunden. Als die Leiche der jungen Frau unter einem Haufen Tonscherben entdeckt wird, ist auch Maresciallo Guarnaccia erst einmal ratlos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Magdalen Nabb
Tod in Florenz
Ein Fall für Guarnaccia
Roman
Aus dem Englischen von Monika Elwenspoek
Diogenes
{5}1
»Tja, dann hoffe ich, dass ich Ihre Zeit nicht allzu sehr in Anspruch genommen habe …« Biondini, der Kurator der Galleria Palatina, blinzelte nervös hinter seiner großen Brille und ließ den Blick dabei über die Köpfe der Menschen wandern, die ihnen auf der breiten Steintreppe des Palazzo Pitti entgegenkamen, als sei jeder von ihnen ein verkappter Bilderdieb.
»Nein, nein …«, versicherte Maresciallo Guarnaccia ihm gelassen, »um diese Jahreszeit …«
»Ehrlich gesagt ist es gar nicht so sehr die Sicherheit, die mir bei dieser Ausstellung Kopfschmerzen bereitet, sondern vielmehr, ob wir es schaffen, bis zur Eröffnung alle Bilder aufzuhängen. Der Katalog wird nicht fertig, so viel steht schon jetzt fest, und was die Personalfrage über die Weihnachtsfeiertage angeht … nun, darüber mache ich mir am besten Gedanken, wenn es so weit ist – entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie mit meinen Problemen behellige …«
Sie waren am Fuß der Treppe angelangt, wo die großen eisernen Laternen im Hof immer noch brannten, auch wenn sie kaum die Düsterkeit des nebligen Novembermorgens vertreiben konnten.
»Ich verabschiede mich hier, Maresciallo.«
Die beiden Männer reichten sich die Hand.
{6}»Ach, das hätte ich fast vergessen …« Biondini fischte mit schmalen Fingern zwei gedruckte Einladungskarten aus seiner Brusttasche. »Sie kommen doch zur Vernissage? Und bringen Sie Ihre Frau mit. Jetzt muss ich aber laufen. Es wartet jemand wegen des Katalogs auf mich. Und nochmals vielen Dank …«
Er eilte wieder die Treppe hinauf.
Guarnaccia trat nach draußen unter die gewaltigen Arkaden und ließ den Blick über die parkenden Autos auf dem leicht abfallenden Hof schweifen. Er war wahrscheinlich der einzige Mann in ganz Florenz, der das trübe Novemberwetter zu schätzen wusste, da er dann ohne die Sonnenbrille herumlaufen konnte, die er zum Schutz seiner großen, gegen Sonnenlicht allergischen Glupschaugen fast ständig tragen musste.
Auf dem Parkplatz sah alles ruhig und ordentlich aus. Weiter unten floss der Verkehr gleichmäßig dahin, und nur gelegentlich unterbrach das ungeduldige Gehupe eines Autos das stete Summen der Stadt, die ihren winterlichen Geschäften nachging.
Befriedigt wandte der Maresciallo sich nach rechts zur Carabinieristation, die in einem Flügel des Palazzo untergebracht war.
Die schmale Treppe nach oben gemahnte ihn immer an sein Übergewicht. Er nahm sie gemächlich, schloss auf, durchquerte das leere Wartezimmer vor seinem Büro. In der Wachstube hörte er jemanden Schreibmaschine schreiben, und ein Ausdruck der Erschöpfung machte sich auf seinem Gesicht breit, denn auch er musste heute noch einen ganzen Stapel Papierkram bewältigen. Es war Dienstag, und {7}obwohl er sich jedes Mal vornahm, gleich all die Berichte über gestohlene Autos und kleinere Einbrüche durchzusehen, die am Montagmorgen als Nachwirkungen des Wochenendes hereinkamen, fand er immer etwas Besseres zu tun, und sie blieben bis Dienstag liegen.
Er knipste die Schreibtischlampe an, ließ sich schwer auf seinen Stuhl fallen und starrte auf die Straßenkarte von Florenz an der Wand vor sich. Dann griff er nach dem obersten Blatt des Stapels.
»Maresciallo?«
Brigadiere Lorenzini steckte den Kopf durch die Tür. »Oh … Sie sind beschäftigt. Es kann warten, wenn …« Guarnaccias Untergebener wollte schon wieder gehen.
»Nein, nein! Kommen Sie rein. Ist was passiert?«
»Nichts Besonderes, nur eine junge Frau hat nach Ihnen gefragt, vor einer halben Stunde vielleicht. Wahrscheinlich waren Sie noch bei Dr. Biondini.«
»Was wollte sie denn?«
»Das ist es ja. Sie wollte es nicht sagen. Fragte nach dem Maresciallo, und als ich ihr sagte, Sie seien nicht da, hat sie gemeint, dann käme sie später noch mal. Bloß, die Sache ist die: Ich könnte schwören, sie kennt Sie gar nicht – sie ist Ausländerin. Und dass Sie nicht da waren, hat sie meiner Meinung nach nur als Entschuldigung genommen, sich die Sache anders zu überlegen, Sie wissen ja, wie manche Leute sind, wollen sich über irgendwas beschweren, und wenn sie dann hier hereinkommen …«
»Ich weiß. Eine Ausländerin also? Woher?«
»Schweizerin, sagt sie, aber offenbar hatte sie ihren Pass nicht mit, denn als ich danach fragte, wurde sie plötzlich {8}nervös und ist gegangen. Also, wahrscheinlich ist es nichts weiter, nur hatte ich den Eindruck …«
»Ja?«
»Ich weiß nicht, sie schien ernsthaft besorgt über etwas, das hat sich mir irgendwie eingeprägt. Wenn was dran ist, kommt sie bestimmt wieder.«
»Wahrscheinlich. Wie geht’s zu Hause?«
»Danke, gut. Könnte gar nicht besser sein.«
Seine Frau erwartete demnächst ihr erstes Baby, und man hätte meinen können, es sei das erste Kind, das überhaupt je zur Welt kommen sollte. Lorenzini, immer etwas vorschnell, hatte seinen kleinen Fiat schon dreimal überholen lassen, um für die Eilfahrt in die Klinik gerüstet zu sein, zum ersten Mal, als seine Frau im fünften Monat war.
»Wenn Sie warten, bis die anderen vom Essen zurück sind, können Sie über Mittag nach Hause gehen, wenn Sie wollen.«
»Danke, Maresciallo! Solange ihr immer übel war und sie die Kochdünste nicht ertragen konnte, wollte ich es nicht, aber das ist jetzt vorbei … und ich sehe ganz gern mal nach, schließlich – man kann nie wissen …« Er schaute seinen Vorgesetzten ernsthaft an, als habe er Angst, ausgelacht zu werden, aber der Maresciallo schaute ebenso ernst zurück, die großen Augen ausdruckslos, und sagte: »Natürlich. Aber es ist bestimmt alles bestens, wie bei einer so prächtigen und gesunden jungen Frau nicht anders zu erwarten.«
In Wirklichkeit beneidete er Lorenzini. Als seine eigenen beiden Söhne geboren wurden, war er hier in Florenz gewesen und seine Frau daheim in Syrakus, und er hatte sich mit einem Telefonat die Woche zufriedengeben müssen.
{9}Er seufzte, als die Tür sich hinter dem jungen Lorenzini schloss. Der Papierstapel lag noch immer auf seinem Schreibtisch, und er würde nicht von allein verschwinden.
Die Mittagsglocken läuteten, und ein angenehmer Duft nach Fleisch und Soße drang aus dem Mannschaftsquartier herunter, als der Maresciallo endlich den letzten Bericht beiseiteschob und dabei murmelte: »Kein vernünftiges Schloss an der Tür, im ganzen Haus Geld rumliegen lassen und dann kommen und mir etwas vorjammern, als sei alles meine Schuld …«
Der Duft dieser Soße weckte schlagartig seinen Appetit. Hatte seine Frau heute Morgen, als er ging, nicht Brotkrumen in der Pfanne geröstet? Also gab es zu Mittag sein Lieblingsessen, pasta alla mollica. Dieser Gedanke und der endlich erledigte Papierkram munterten ihn auf, auch wenn es noch anderthalb Stunden hin waren, ehe seine Jungen quer über die Piazza aus der Schule gestürmt kamen. Er stand auf und wollte eigentlich im Dienstzimmer bei dem jungen Carabiniere vorbeischauen, der allein war, solange sein Kollege oben kochte, da hörte er Stimmen vor der Tür, und als er sie aufmachte, stand Lorenzini davor und sah sich den Pass eines Mädchens an, das zusammenfuhr und ängstlich hochsah, als er heraustrat. Er streckte die Hand nach dem Pass aus und betrachtete das Mädchen dabei genau; ihre Gesichtszüge hinter der großen Brille wirkten leicht verschwommen. Sie musste sehr weitsichtig sein.
»Sie waren heute Vormittag schon einmal hier?«, fragte er, während er den Pass durchblätterte.
»Ja. Es ist wahrscheinlich nichts weiter, ich weiß nicht, ob ich Sie überhaupt belästigen sollte …«
{10}»Wann waren Sie denn hier?«
»Um welche Zeit? Ich weiß nicht … ich glaube, es war gegen neun.«
»Neun Uhr siebzehn, Maresciallo«, sagte Lorenzini, der nachgesehen hatte.
»Kommen Sie bitte hier entlang, Signorina« – er warf einen Blick auf den Pass –, »Signorina Stauffer.« Der Maresciallo öffnete die Tür zu seinem Büro und trat zur Seite, um sie vorgehen zu lassen.
»Also gut, wenn Sie meinen …«
»Nehmen Sie Platz.« Der Maresciallo setzte sich hinter seinen Schreibtisch und musterte sie schweigend. Ihr hellbraunes Haar war kurz geschnitten und glatt ins Gesicht gekämmt, so dass man durch die Brille, die ihre hellen Augen vergrößerte und verzerrte, nicht recht feststellen konnte, wie sie eigentlich aussah. Außerdem hatte sie den Kragen ihres dunklen Mantels hochgeschlagen bis an die Wangen, hielt ihn mit einer Hand zusammen und ließ ihn nur los, um die Brille hochzuschieben.
»Vielleicht möchten Sie gern Ihren Mantel ablegen«, schlug der Maresciallo vor.
»Nein, nein. Danke. Es ist schon in Ordnung so.«
Aber es war sehr warm in dem kleinen Büro.
Sie war nicht nur weitsichtig, stellte er fest, sie war auch ungemein schüchtern und ziemlich aufgeregt.
»Was wollten Sie mir denn sagen?«
»Es geht nicht um mich … das heißt … es geht um eine Freundin …«
»Und was ist mit dieser Freundin passiert?«, fragte der Maresciallo und überlegte, ob diese Freundin überhaupt {11}existierte. Viele Leute kamen mit langen, wirren Geschichten über irgendwelche erfundenen Freunde, die dann mit dem Satz endeten: ›Und was soll ich – äh, mein Freund – Ihrer Meinung nach jetzt tun?‹
»Wir wohnen zusammen.« Die Hand schob erneut die Brille hoch und verdeckte das Gesicht.
»So? Sie wohnen zusammen?« Kam sie vielleicht irgendwann einmal zur Sache? Dennoch verriet der Maresciallo keine Ungeduld, sondern blieb ruhig sitzen, die großen Hände auf der Schreibtischplatte, und beobachtete sie. Schließlich sah er, dass es hoffnungslos war, dass sie nicht weiterreden würde, und meinte: »Wo ist diese Wohnung, die Adresse?«
»Via delle Caldaie … das geht von der Piazza Santo Spirito ab.«
»Ich weiß, wo es ist. Welche Hausnummer?«
»Nummer neun. Oberstes Stockwerk.«
»Haben Sie Telefon?«
»Ja.« Sie gab ihm die Nummer, und er schrieb sie für alle Fälle auf den Block neben dem Telefon.
»Wie lange wohnen Sie schon hier?«
»Ich … wir – seit dem ersten Juli, seit wir aus der Schweiz hierhergekommen sind.«
»Aufenthaltserlaubnis?«
»Die habe ich nicht mit, ich dachte nicht, dass …«
»Haben Sie eine?«
»Ja. Und Monika auch. Für drei Monate. Im Dezember läuft sie aus.«
Das war doch ein Fortschritt. Die Freundin hatte jetzt einen Namen und war demnach wohl nicht erfunden.
{12}»Und zu welchem Zweck wurde der Aufenthalt bewilligt?«
»Zu Studienzwecken. Ursprünglich waren wir gekommen, um an der Scuola Raffaello zu studieren – es war mehr ein verlängerter Urlaub, aber dann haben wir beschlossen, noch etwas zu bleiben.«
»Es gefällt Ihnen hier, ja?«
»Sehr. Wir sind immer noch an der Schule eingeschrieben, obwohl ich keine Gebühren mehr bezahle, ich helfe im Sekretariat aus.«
»Ist das zu Hause Ihr Beruf?«
»Nein … nein, wir sind beide Lehrerinnen, und das werden wir auch weiter sein, wenn wir zurückgehen, nehme ich an, wenn …« Wieder wanderte die Hand an die Brille. Der Maresciallo war sich nicht ganz sicher, aber er glaubte, Tränen in den Augen des Mädchens zu sehen.
»Hören Sie, Signorina … Ich sehe zwar, dass Sie sich über irgendetwas Sorgen machen, aber wenn Sie mir nicht sagen, worum es geht, kann ich Ihnen nicht helfen, stimmt’s?«
»Das können Sie wahrscheinlich sowieso nicht.«
Der Maresciallo unterdrückte einen Seufzer. Doch diesmal fuhr das Mädchen unaufgefordert fort: »Ich habe mir gesagt, ich warte drei Tage – ich habe es nicht einmal in der Schule erzählt –, aber dann, heute Morgen, bin ich in Panik geraten. Sie ist manchmal tagsüber weg gewesen, aber über Nacht … sie hat nichts mitgenommen, wissen Sie, deshalb war ich –«
»Ihre Freundin ist also verschwunden?«
»Genau. Darum mache ich mir ja Sorgen.«
»Eben. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?«
{13}»Freitagnachmittag gegen vier.«
»Dann ist sie also seit Freitag verschwunden?«
»Nein. Also, vielleicht schon, aber ich war nicht da. Ich war in Rom, wissen Sie, mit einer Gruppe aus der Schule. Wir sind am Montagvormittag zurückgefahren. Ich habe nicht erwartet, dass Monika in der Wohnung ist, weil sie vormittags arbeitet, aber dann ist sie am Nachmittag nicht gekommen, und auch gestern Abend nicht – glauben Sie wirklich, dass sie vielleicht schon seit Freitagabend vermisst ist?«
»Wie sollte ich das wissen können, Signorina – aber nun machen Sie sich mal keine Sorgen. Wie alt ist Ihre Freundin Monika?«
»Fünfundzwanzig.«
»Dann ist sie alt genug, um selbst auf sich aufzupassen und, wenn sie Lust hat, einen Ausflug zu machen, oder?«
»Sie hat nichts mitgenommen.« Das Mädchen wurde rot vor Wut. Sie mochte ja schüchtern sein, aber sie war eigensinnig und verteidigte ihren Standpunkt.
»Wenn Sie das so genau wissen, dann können Sie mir sicher sagen, was sie anhatte?«
»Jeans, einen beigefarbenen Pullover mit Polokragen und darüber einen dickeren, handgestrickten Pullover auch in Beige, eine lange Steppjacke, rot, und kniehohe Lederstiefel, ihre alten. Das waren ihre Arbeitsklamotten. In diesen Sachen wäre sie sonst nirgends hingegangen, sie waren fleckig.«
»Fleckig? Was arbeitet sie denn?«
»Sie ist bei einem Künstler beschäftigt, in den Töpferwerkstätten.«
{14}»Moment mal.« Der Maresciallo zog sich ein Blatt Papier heran. »Dieses Mädchen hat eine Studienaufenthaltsgenehmigung, und jetzt sagen Sie mir, dass sie arbeitet. Sie sagen, sie sei Lehrerin, und jetzt stellt sich heraus, dass sie Töpferin ist. Können wir noch mal von vorn anfangen?« Da hatte man ihm erzählt, die Schweizer seien kühl und effizient. Na ja, dann waren das wohl die Deutschen …
»Also. Vergessen wir jetzt mal ihr Verschwinden und halten uns an die Tatsachen. Wie ist ihr Familienname?«
»Heer. Monika Heer. Warten Sie … ich habe für alle Fälle ihren Pass mitgebracht.«
»Gut. Größe: 1,65. Haarfarbe: blond. Sie ist sehr hübsch.«
»Ja.« Diese Bemerkung schien ihr nicht allzu sehr zu behagen.
»Alter: fünfundzwanzig. Nationalität: Schweizerin. Beruf?«
»Kunsterzieherin.«
»Aha. Und sie ist an dieser Schule eingeschrieben, wie hieß die noch?«
»Scuola Raffaello, an der Piazza della Repubblica.«
»Studienfach?«
»Italienisch. Drei Monate haben wir Ganztagskurse belegt, vormittags Italienisch und nachmittags noch Kunsthandwerk. Wir haben uns Töpferei ausgesucht, obwohl auch Lederarbeiten und Holzschnitzen angeboten werden. Ich war nicht so gut, aber Monika ist sehr talentiert. Als der Ganztagskurs zu Ende war, haben wir nur mit Italienisch weitergemacht, und Monika …«
»… hat bei diesem Künstler eine Arbeit gefunden. Wahrscheinlich schwarz.«
{15}Hatte sie sich deshalb gescheut herzukommen? Ihre Hand hielt wieder den dunklen Kragen fest, eine plumpe Hand mit kurzgeschnittenen Fingernägeln. Und sehr nervös.
»Es war kein richtiger Job … sie hat bei ihm gelernt. Sie möchte sich gern ein Atelier einrichten, wenn wir wieder zu Hause sind, statt weiter zu unterrichten.«
Na ja, sie war nicht die einzige Ausländerin, die schwarz hier arbeitete. Es war nur allzu leicht, und viele Arbeitgeber wollten Lehrlinge und Versicherungsbeiträge sparen. Der Maresciallo beschloss, die Sache erst einmal auf sich beruhen zu lassen.
»Und Sie?«
»Ich?« Das Mädchen wich seinem Blick aus. »Ich bin nicht so begabt wie Monika.«
»Aber Sie haben diesen Töpferkurs auch gemacht.«
»Nur, weil wir zusammen sein wollten. Wir waren gerade erst angekommen …«
»Und jetzt arbeiten Sie im Sekretariat der Schule – ich nehme an, auch das ist kein richtiger Job?«
»Nein. Ich helfe aus, und dafür habe ich meine Italienischstunden umsonst.«
»Hmm.« Ihm fiel plötzlich etwas ein. »Sie sind erst im Juli hierhergekommen und haben angefangen, Italienisch zu lernen. Dafür sprechen Sie aber bemerkenswert fließend.«
Nicht, dass sie nicht einen dicken Akzent gehabt hätte. Aber immerhin …
»Wir konnten schon Italienisch. Viele unserer Schüler sind Kinder von italienischen Gastarbeitern. Dadurch {16}sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, das hier zu machen.«
»Welche Sprache sprechen Sie zu Hause?«
»Schweizerdeutsch.«
»Beide?«
»Ja. Wir kommen aus demselben Kanton, Bern.«
»Aha.«
Der Maresciallo dachte kurz nach. Verlorengegangene Kinder waren eine Sache, Routine, da wusste man, wo man stand. Aber verlorengegangene Erwachsene waren etwas anderes. So etwas erforderte unter Umständen Nachforschungen, unter Umständen auch nicht. Dieses Mädchen wirkte ein bisschen seltsam mit ihrer komischen Art, sich hinter Brille und Mantelkragen zu verstecken, doch es war ihr offenbar ernst, und ernstlich besorgt schien sie auch.
»Diese Töpferei, wo Ihre Freundin arbeitet, wissen Sie, wo die ist?«
»Natürlich. Ich war dabei, als sie den Job bekommen hat – ich meine, als sie zum ersten Mal hingefahren ist. Es ist nicht direkt im Ort bei den anderen Töpfereien, sondern kurz davor, auf der linken Seite der Hauptstraße. Sonst ist da nicht viel, nur das Atelier vorne in einer Bauernkate und eine kleine Terrakottafabrik in der Nähe.«
»Wer ist denn der Besitzer des Ateliers?«
»Er heißt Berti.«
»Und seinen Vornamen wissen Sie nicht?«
»Nein. Ich weiß auch die genaue Anschrift nicht.«
»Hat er Telefon?«
»Nein, sonst hätte ich gleich angerufen, als sie Montagnachmittag nicht nach Hause kam. Genau genommen …«
{17}»Ja?«
»Nachdem ich heute Vormittag hier war, bin ich hingefahren.«
»Soso. Ganz schön weit draußen. Haben Sie ein Auto?«
»Nein. Ich habe den Bus genommen, mit dem Monika immer fährt. Ich wusste nicht genau, wo ich aussteigen muss, und bin vorbeigefahren, so dass ich zurücklaufen musste …«
»Und? Ist sie bei der Arbeit gewesen?«
»Er sagt nein. Er hätte sie seit Freitagmittag, als sie nach der Mittagspause gegangen sei, nicht gesehen.«
»Sie ist zum Mittagessen dort geblieben?«
»Er hat ihr das Essen in einem Lokal im nächsten Ort bezahlt. Es stimmt, dass es keine richtige Arbeit war – ich meine, er hat ihr das Essen bezahlt und die Fahrtkosten und manchmal, wenn er eine ihrer Arbeiten verkauft hat, dann –«
»Darauf müssen wir jetzt nicht näher eingehen. Wenn er Ihre Freundin seit Freitag nicht gesehen hat, glauben Sie dann nicht, dass sie wahrscheinlich irgendwohin gefahren ist und bald wiederkommt?«
»Sie hatte ihre Arbeitskleidung an«, beharrte das Mädchen.
»Gut.« Er holte eine kleine Karte aus einer Schublade seines Schreibtischs. »Hier ist meine Telefonnummer. Rufen Sie mich an, wenn Ihre Freundin auftaucht.«
Er stand auf. Das Mädchen rührte sich nicht.
»Wollen Sie nichts tun?«
»Ich schicke meine Kollegen hin, um festzustellen, ob sie gestern bei der Arbeit gesehen wurde, und ich lasse eine {18}Beschreibung von ihr in Umlauf bringen. Viel mehr kann ich nicht tun, Signorina.« Er hielt ihr die Tür auf. Sie ging mit gesenktem Kopf an ihm vorbei und murmelte leise: »Danke.«
Der Maresciallo fühlte Mitleid mit diesem seltsamen, eigensinnigen Wesen und legte ihm an der Tür väterlich die Hand auf die Schulter.
»Machen Sie sich nicht allzu viele Sorgen. Ich bin sicher, dass sie wiederauftaucht.«
Doch alles andere als dankbar für seine Geste, zuckte das Mädchen zurück und lief eilig und ohne ein weiteres Wort die Treppe hinunter.
Wieder in seinem Büro, plumpste der Maresciallo auf seinen Stuhl und überlegte einen Moment, bevor er die Nummer des Hauptquartiers am Borgo Ognissanti wählte und seinen Vorgesetzten, Capitano Maestrangelo, verlangte. Maestrangelo nahm die Personalien des Mädchens auf, gab aber zu bedenken:
»Sie ist über achtzehn.«
»Ja. Aber offenbar ist sie in ihrer Arbeitskleidung weggegangen und hat nichts sonst mitgenommen, deshalb …«
»Ich verstehe …« Der Capitano zögerte nicht lange; im Lauf der Jahre hatte er Guarnaccia so gut kennengelernt, dass er den Instinkten des Maresciallos mehr vertraute als seinen eigenen. »Also gut, wenn Sie es für nötig halten, könnten Sie ja mal rausfahren und sich die Sache ansehen, vielleicht mit dem dortigen Kollegen reden.«
»Pieri, nicht wahr?«
»Pieri? Nein, der ist doch gestorben, wussten Sie das nicht?«
{19}»Nein …«
»Herzattacke, vor etwa einem Jahr. Sie haben einen neuen Maresciallo, ein guter Mann. Reden Sie mit ihm. Wahrscheinlich kann er Ihnen etwas über diesen Töpfer sagen, für den sie gearbeitet hat – wie hieß er noch?«
»Berti! Allerdings kenne ich den. Welch eine Type!«
»Sie meinen, er ist vorbestraft?«
»Nein, nein!« Der Kollege röhrte so genüsslich ins Telefon, dass Guarnaccia den Hörer ein ganzes Stück vom Ohr weghalten musste. Dem Akzent nach war der neue Maresciallo ein Römer und sicherlich der fröhlichste Mensch, dem er je begegnet war. Was in aller Welt war denn da so komisch?
»Ein Schürzenjäger – und das in seinem Alter! Aber manche geben nie auf. Er ist bei uns hier wohlbekannt.«
»So? Also, das gefällt mir gar nicht, denn der Grund meines Anrufs ist eine junge Schweizerin, die für ihn gearbeitet hat, illegal wahrscheinlich, und die offenbar verschwunden ist.«
»Blondes Mädchen? Hübsch?«
»Stimmt. Sie kennen sie?«
»Natürlich kenne ich sie! Sie hat sich da einen schlechten Arbeitgeber ausgesucht – nicht, dass er wirklich Schlimmes anrichten würde, aber trotzdem, ich habe ihr geraten, auf der Hut zu sein. Sie sagt, sie kann auf sich aufpassen, nur sind diese Ausländerinnen manchmal ein bisschen naiv. Aber hübsch, sehr hübsch!«
»Wie haben Sie das Mädchen überhaupt kennengelernt?«
»Beim Essen. Im Restaurant. Alle essen dort, wir auch, {20}da wir keine Kantine haben. Sie werden es sehen, wenn Sie uns besuchen – wollen Sie herauskommen?«
»Ich weiß nicht recht … es ist außerhalb meines Bezirks. Andererseits wohnt das Mädchen hier, darum habe ich mir überlegt, der Sache nachzugehen. Ihre Freundin, mit der sie die Wohnung teilt, scheint anzunehmen, dass sie am Montagvormittag zur Arbeit gefahren ist, da die einzigen fehlenden Kleidungsstücke ihre Arbeitsklamotten sind. Sie haben sie gestern nicht zufällig gesehen?«
»Nein. Gestern nicht. Ich saß an meinem üblichen Tisch, aber sie ist nicht gekommen. Ich erinnere mich, dass ich eine Bemerkung darüber gemacht habe, weil sie schon seit ein paar Monaten herkommt, und ich glaube nicht, dass sie oft gefehlt hat. Heute war sie auch nicht da.«
»Ich nehme mal an, dass sie doch nicht zur Arbeit gegangen ist, oder ihr ist auf dem Weg etwas passiert – es kann nicht sein, dass Sie sich irren? Ist es ein großes Restaurant?«
»Groß? Ja, schon! Wie gesagt, alle essen da, aber ich kann mich nicht irren, weil sie immer mit bei uns am Tisch sitzt. Tozzi, der Wirt, hat darauf bestanden. Sie kam immer allein, wissen Sie, und das Lokal ist voller Arbeiter – es kommen nicht oft Frauen herein, außer gelegentlich mal Einkäuferinnen, die in den Fabriken unterwegs waren. Nein, ich irre mich bestimmt nicht.«
»Und was ist mit diesem Berti, wenn sie für ihn arbeitet, hat er da nicht auch mit ihr gegessen?«
»Der doch nicht! Der muss zum Essen nach Hause. Seine Frau kommt allen seinen Tricks auf die Schliche, die ist nicht von gestern. Er hat das Mädchen immer hier abgesetzt und ist dann weiter nach Hause gefahren.«
{21}»Nun, man kann nie wissen, vielleicht hat er ja gestern der Peitsche entrinnen können und sie woandershin zum Essen ausgeführt.«
»Damit käme er in einem so kleinen Ort nie davon – aber wie er sie immer angesehen hat, wenn er dachte, sie merkt es nicht, der alte Lüstling!«
Der Maresciallo überlegte kurz und sagte dann: »Ich denke, ich komme mal raus …«
»Sehr gut! Wir sind da – wir haben nie geschlossen! Abscheuliches Wetter, und hier draußen ist es noch zehnmal schlimmer.«
Dabei klang er so begeistert, als spräche er über herrlichsten Sonnenschein!
»Wann können wir mit Ihnen rechnen?«
Der Maresciallo hatte Lust, sofort loszufahren, der Tag war ziemlich langweilig gewesen, und er hätte nichts dagegen gehabt, eine Stunde mit diesem Mann zu verbringen, der vor guter Laune zu sprühen schien. Dennoch sagte er: »Morgen Vormittag. Vielleicht komme ich am besten mit dem Bus, den das Mädchen immer genommen hat, und frage mal, ob jemand sie gestern gesehen hat.«
»Gute Idee, ausgezeichnet! Und ich könnte inzwischen für Sie herausfinden, was unser Freund Berti zu sagen hat, ein bisschen in der Gegend herumschnüffeln, wie wäre das?«
»Vielen Dank«, meinte der Maresciallo etwas unsicher, »allerdings wäre es wohl besser, wenn Sie nicht sagen, dass –«
Der andere johlte vor Lachen. »Keine Angst! Von mir erfährt er kein Sterbenswörtchen, ich bin die {22}Verschwiegenheit in Person! Ich gehe mal guten Tag sagen und sehe mir seine Töpfersachen an – könnte erzählen, dass ich etwas für meine Frau zum Geburtstag suche. Sehr schlau! Ein kleiner Ausflug in diesen ekligen Nebel ist genau, was mir fehlt! Also, bis dann. Alles Gute!«
Als er aufgelegt hatte, lehnte sich Guarnaccia in seinem großen Stuhl zurück und gab einen kleinen zufriedenen Rülpser von sich. Er hatte wieder zu viel gegessen. Jeden Tag schwor er sich, es nicht zu tun, aber nach all den Strohwitwerjahren bei Brot und Käse war das angenehme Gefühl, einfach in seine Wohnung gehen zu können, wo warme Essensdüfte und beruhigende Geräusche der Kinder ihn empfingen, zu schön, da konnte er nicht widerstehen, und er aß immer mit größtem Appetit. Nun brannten seine Augenlider schwer, und er fühlte sein Gesicht in dem heißen kleinen Zimmer glühen. Um ein Haar wäre er hier am Schreibtisch eingeschlafen.
So ging es nicht. Sein Kopf fuhr hoch, und er blinzelte. So ging es ganz und gar nicht. Also, was hatte er noch erledigen wollen …?
Der Bus, das war’s, was er wissen musste. Er wählte die Nummer, die er auf den Telefonblock geschrieben hatte. Es klingelte nur einmal, bevor der Hörer am anderen Ende abgenommen wurde.
»Monika, bist du’s?«
»Signorina Stauffer? Hier spricht Maresciallo Guarnaccia.«
»Oh …« Sie war offenkundig enttäuscht, fügte aber ängstlich gespannt hinzu: »Haben Sie etwas in Erfahrung gebracht?«
{23}»Dafür ist es noch ein bisschen zu früh, Signorina, aber ich fahre morgen dahin, wo Ihre Freundin Monika gearbeitet hat, und wüsste gern, welchen Bus sie von Florenz aus immer benutzt hat, damit ich die Fahrgäste fragen kann, ob sie sie gestern gesehen haben, verstehen Sie?«
»Ja. Gut. Sie ist immer mit dem Bus zwanzig nach acht gefahren.«
»Immer?«
»Ja … Wenn Sie an der letzten Haltestelle vor dem Städtchen aussteigen, sehen Sie es gleich links an der Straße. Glauben Sie, dass ihr etwas passiert ist?«
»Ich habe keinen Anlass, das im Augenblick anzunehmen.«
»Es ist ihr etwas passiert, ich fühle es. Sie würde niemals … Aber vielen Dank für Ihre Mühe.«
Wieder tat sie ihm leid, aber bevor er noch etwas Tröstliches sagen konnte, hatte sie schon aufgelegt. Was für ein seltsames Mädchen. Er beschloss, noch eine Tasse Kaffee zu trinken. Selbst danach dauerte es eine Stunde, bis er sich wieder richtig wach fühlte, und er schwor sich, morgen weniger zu essen. Dann fiel ihm ein, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinem fröhlichen Kollegen in diesem Restaurant landen würde, und schon überlegte er, wie wohl das Essen dort war.
›Viareggio und Forte dei Marmi, Bussteig zwei. Viareggio und Forte dei Marmi …‹
Die Neonbeleuchtung im Warteraum des Busbahnhofs machte alles noch trister. Draußen nieselte es ununterbrochen, und die ganze Stadt wirkte grau, sogar das {24}quietschnasse Gras um den Betonbau des Bahnhofs gegenüber. Der Maresciallo saß auf einer harten Bank, umgeben vom Geruch nasser Kleidung, und zu allem Übel schüttelte die dicke Frau neben ihm immer wieder ihren Schirm, so dass die Wassertropfen an seinen Hosenbeinen herunterliefen. Die Espressomaschine an der Bar am anderen Ende des Raumes fügte der allgemeinen Feuchtigkeit und dem Zigarettenmief ihren Dampf hinzu. Ein Mann im schmutzigen Overall fegte Zigarettenkippen und Keksverpackungen auf dem nassen Fußboden zusammen. Wie konnte man im November ans Meer fahren, und auch noch an einem solchen Tag? Aber zwei oder drei Leute standen auf, als der Bus nach Viareggio angesagt wurde, und gingen hinaus zu den Plattformen, wo die blauen Busse warteten. Vielleicht wohnten sie ja dort … oder arbeiteten dort, oder mussten jemanden besuchen …
›Bussteig sechs, Lastra a Signa, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio. Bussteig sechs …‹
Das war er. Es war schon acht Uhr fünfundzwanzig, und der Fahrer saß im Bus und hatte den Motor laufen. Der Maresciallo wartete, bis alle eingestiegen waren, denn er wollte ein paar Worte mit dem Fahrer wechseln, ohne die Schlange zu behindern. Als letzter Fahrgast stieg die dicke Frau ein, die es tatsächlich schaffte, dem Maresciallo mit ihrem Regenschirm noch einen Stoß zu versetzen, während sie an ihm vorbeidrängte und sich die Stufen hochhievte.
»Also gut«, antwortete der Fahrer und schaltete den Scheibenwischer ein. Schmutzbäche liefen auf beiden Seiten daran herunter. »Ekelhafter Morgen.«
Der Bus war nur halb voll. Der Maresciallo steckte {25}seinen Fahrschein in die Entwertungsmaschine und quetschte sich auf einen Fensterplatz, während der Bus eine breite Straße entlang aus der Stadt holperte. Sobald sie das dichte Verkehrsgewühl hinter sich gelassen hatten, schaltete der Fahrer das Radio an, und laute Musik eines Lokalsenders übertönte jetzt das Stimmengewirr, das eingesetzt hatte, sowie sie aus dem Busbahnhof herausfuhren. Der Maresciallo holte den Schweizerpass aus der Tasche und zwängte sich aus seinem Sitz.
Er nahm sich die Passagiere einen nach dem anderen vor, beugte sich über die Sitze und zeigte ihnen das Foto im Pass. Es waren alles Frauen, bis auf einen älteren Mann mit schäbigem Regenmantel und speckiger schwarzer Baskenmütze. Wie er schon aus der Art und Weise geschlossen hatte, mit der alle sich gleich unterhielten, selbst wenn sie auf getrennten Plätzen saßen, fuhren die meisten diese Strecke regelmäßig und kannten das Mädchen. Dummerweise waren sie sich nicht einig, ob sie am Montag im Bus gewesen war.
»Mich brauchen Sie gar nicht erst zu fragen«, sagte die Frau mit dem Schirm nicht ohne eine gewisse Befriedigung. »Ich fahre nur mittwochs und freitags, da besuche ich meine Schwester im Krankenhaus.«
Jemand kicherte.
»Was ist daran so komisch? Widerlich ist das, über anderer Leute Unglück zu lachen!« Damit wandte sie sich zum Fenster, rieb mit ihrem braunen Wollhandschuh ein Guckloch in die beschlagene Scheibe und starrte mit zusammengepressten Lippen in den Regen hinaus.
Jemand stupste den Maresciallo in den Rücken, und er {26}drehte sich um. Es war der alte Mann mit der speckigen Baskenmütze.
»Sie meint«, flüsterte er, so dass der Maresciallo sich hinunterbeugen musste, um ihn bei dem Radiolärm zu verstehen, »sie besucht ihre Schwester im Irrenhaus.« Er brach ab und keckerte. »Und sie ist nicht die Einzige in diesem Bus … Ich selbst will auch dahin, wenn Sie’s genau wissen wollen, meinen Sohn besuchen, der nie ganz richtig im Kopf war. Seit seine Mutter nicht mehr ist, wissen Sie, hat sich keiner um ihn kümmern können, und er ist auf die schiefe Bahn geraten – na ja, besser als Gefängnis –, aber diese Signora ist die Einzige, die Krankenhaus dazu sagt. Glauben Sie mir, ihre Schwester hat einen ganz schönen Sprung in der Schüssel, und wenn Sie mich fragen, sie selber ist auch nicht viel besser.«
Der Maresciallo sah sich um, und seine Augen traten noch mehr hervor als sonst.
»Sie meinen, alle diese Leute …?«
»Na, nicht alle, aber ein Gutteil. Sie können’s mir ruhig glauben – aber sie geben es nicht alle zu.«
»Und was ist mit Ihnen?«
»Ich hab doch gesagt, mein Sohn …«
»Nein. Ich meine, erkennen Sie das Mädchen auf dem Foto?«
»Die erkenne ich genau. Ein hübsches Ding, nicht? Was ist mit ihr?«
»Ich weiß es nicht. Ist sie am Montag mitgefahren?«
»Montag war ich nicht im Bus. Ich fahre mittwochs und freitags, genau wie Ihre Hoheit hier. Warum fragen Sie nicht den Fahrer?«
{27}Die Leute, die am Montag im Bus gesessen hatten, waren sich immer noch nicht einig.
»Sie hat direkt vor mir gesessen!«
»Nein, Sie irren sich. Sie war im Bus, aber ganz vorn.«
Der Maresciallo hangelte sich in dem schmalen Gang nach vorn und bedeutete dem Fahrer, das Radio leiser zu drehen.
»Ich hätte gern mit Ihnen gesprochen, wenn Sie das nächste Mal halten.«
»Alles klar.«
Sie waren schon ein gutes Stück aus Florenz heraus und folgten dem Fluss und der sich daran entlang windenden Bahnlinie Richtung Pisa durch eine Reihe kleiner Städte, die bei dem Regen deprimierend wirkten. Im Zentrum einer der Städte hielt der Bus, und der Fahrer blickte auf.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Ich suche dieses Mädchen. Wissen Sie, ob sie Montag früh im Bus war?«
»Ja, das war sie.«
»Sind Sie ganz sicher?« Nachgerade schien das zu schön, um wahr zu sein. »Sie haben sie am Montagmorgen gesehen?«
»Stimmt genau.«
»Es könnte nicht letzten Freitag gewesen sein?«
»Nein, könnte es nicht. Letzte Woche hatte ich nachmittags Dienst. Sie ist jeden Morgen mit diesem Bus gefahren, schon seit einer ganzen Weile. Und am Montag hat sie ihre übliche Masche abgezogen und ist für ihre Haltestelle zu spät aufgestanden – an der ganzen Straße ist nichts, bis man um eine langgezogene Kurve kommt, und genau da ist die {28}Haltestelle. Sie hat sie immer verpasst, und ich hab sie oft ein ganzes Stück danach rausgelassen, obwohl ich das nicht darf. Sonst hätte sie in der Stadt aussteigen und zurücklaufen müssen. Ein ziemliches Stück und eine gefährliche Straße ohne Gehweg.«
»Aha. Danke. In dem Fall sagen Sie mir besser Bescheid, wenn wir zu ihrer Haltestelle kommen, sonst geht es mir noch genauso.«
»Wird gemacht.«
Er drehte das Radio wieder auf, und der Maresciallo torkelte zu seinem Platz zurück. Seine feuchten Hosenbeine wurden langsam heiß und juckten von dem warmen Luftstrom aus der Heizung im Bus. Er wischte sich ein großes Guckloch an dem beschlagenen Fenster frei, wie es die anderen Fahrgäste auch getan hatten.
Die kleinen Städte lagen hinter ihnen, und sie fuhren zwischen nassen Wiesen und geisterhaften Obstplantagen. Regen und Nebel wurden immer dichter, so hatte sein heiterer Kollege vielleicht gar nicht gewitzelt, als er meinte, das Wetter hier draußen sei zehnmal so schlimm. Wahrscheinlich war es die Nähe des Flusses. Rechts verdeckte inzwischen eine hohe, nasse schwarze Mauer die Eisenbahnlinie, und nur die Oberleitungen waren zu sehen. Der Bus fuhr jetzt schneller, und schwere Lastwagen mit eingeschalteten Scheinwerfern aus den vor ihnen liegenden Industriestädten kamen durch den Dunst auf sie zugedonnert. Der Fahrer hatte recht, es war eine gefährliche Straße, und zweifellos forderte sie ihren Tribut an tödlichen Unfällen.
Der Bus zischte um eine lange Kurve, wurde langsamer und hielt, anscheinend mitten im Nirgendwo.
{29}»Hier ist es, Chef!«
Der Maresciallo stieg aus. »Danke.«
»Gern geschehn.«
Er musste sich beinah flach gegen die nasse Mauer pressen, als der Bus losfuhr, und war dann gezwungen, eine Weile dort auszuharren, während Laster und Personenwagen in beiden Richtungen vorbeifuhren. Auf der gegenüberliegenden Seite sah er ein niedriges kleines Gebäude mit einem schlammigen Hof davor, eingerahmt von Gerümpel und Plastiktüten, gerade breit genug für das hellblaue Auto, das dort geparkt stand. Als er endlich die Straße überquert hatte, waren Mütze und Uniformmantel tropfnass. Offensichtlich war das Ganze, wie das Mädchen gesagt hatte, früher ein gewöhnliches Bauernhaus gewesen, wahrscheinlich recht einsam gelegen, bis man diese Straße als Verbindung zu den neuen Fabriken gebaut hatte. Hinter dem großen Fenster links, das mit löchrigem braunem Papier ausgebessert war, musste die Werkstatt des Künstlers sein. Durch die Risse sickerte Licht. Rechts tauchte kurz das Gesicht einer Frau hinter dem verschossenen Vorhang eines winzigen vergitterten Fensters auf und war gleich wieder verschwunden. Aus Neugier ging er auf dieses Fenster zu und linste ins Halbdunkel. Zuerst konnte er nichts sehen, aber er hörte das zufriedene Glucksen von Hühnern und ein unbestimmtes scharrendes Geräusch. Eine kleine schwarze Katze sprang von innen aufs Fensterbrett und rieb sich an den nassen Gitterstäben. Das Fenster war nicht verglast, nur der Vorhangfetzen hing schief davor. Der Geruch nach tierischen Exkrementen war fast übermächtig. Nach einem Weilchen konnte er die {30}Knopfaugen der Hennen ausmachen, die in ihrem Scharren und Picken innehielten und nach ihm äugten, ob er vielleicht mehr Futter brachte. Das scharrende Geräusch musste aus dem Weinfass dort kommen. Ein paar lange Ohren lugten immer wieder über den Rand, ein Hase wahrscheinlich, der dort gemästet wurde.
»Da drin gibt es nichts besonders Interessantes.«
Der Maresciallo drehte sich um. Der Künstler stand unter seiner Tür, in der Hand einen kleinen Pinsel, und beobachtete ihn.
»Reine Neugier.« Der Maresciallo betrachtete ihn von oben bis unten, etwas überrascht, Berti in einem grauen Mohairanzug anzutreffen, der einmal recht gut gewesen war, auch wenn er jetzt abgetragen und ganz schön staubig aussah. Vielleicht hatte er seinen Overall ausgezogen, als er jemanden kommen sah. Der Maresciallo war ziemlich sicher, dass er das Treiben auf der Straße durch die Risse in dem Papier im Auge behielt: »Ich wollte eigentlich zu Ihnen. Sind Sie Berti?«
»Stimmt. Wollen Sie nicht reinkommen, raus aus dem Regen?«
»Gern.« Er folgte Berti, der erheblich kleiner als er und ziemlich mager war, in die Werkstatt.
»Ich störe Sie sicher …«
Berti zuckte die Achseln. »Es kommen dauernd Leute.«
Ein Ölofen zischte in dem langgestreckten Raum, der größer war, als der Maresciallo erwartet hatte. Jeder Zentimeter Wand war mit Majolikatellern bedeckt, und der ganze Raum war vollgestopft mit Keramikarbeiten aller Art, einige davon auf krummen Brettern und {31}behelfsmäßigen Tischen und viele auf dem Fußboden, so dass der Maresciallo sich kaum zu bewegen wagte, aus Angst, etwas zu zerbrechen.
»Ich hole Ihnen einen Stuhl«, sagte Berti und schlängelte sich behende durch das Durcheinander zum hinteren Teil des Raumes, wo er einen Stapel Teller von einem staubigen Stuhl nahm und damit zurückkam, ohne auch nur einen Eierbecher verschoben zu haben.
»Danke.«
»Setzen Sie sich noch nicht …« Er wischte den Stuhl mit einem Lappen ab. »Das ist alles, was ich tun kann, aber Sie werden merken, es lässt sich gut abbürsten.«
Berti setzte sich ans Fenster, wahrscheinlich sein Stammplatz. Auf einem Tischchen neben ihm standen dichtgedrängt Töpfe voller Farben und Pinsel verschiedenster Form und Größe, und neben ihm auf dem Fußboden weitere ähnliche Töpfe. Der Maresciallo, der bestimmt gleich alles zertreten oder umgeworfen hätte, war verblüfft über die Wendigkeit des Mannes, die so mühelos und selbstverständlich wirkte. Gewöhnlich wanderte er in einer neuen Umgebung gern umher, um sich zu orientieren, wie ein Hund etwa, der in einem fremden Haus herumläuft und in den Ecken schnüffelt, aber hier beschloss er lieber stillzusitzen, oder er würde unversehens für eine Anzahl von zerbrochenen Teilen zahlen müssen.
»Wollen Sie sich nicht umsehen?« Berti schien seine Gedanken zu lesen, obwohl er nicht von seiner Arbeit aufsah.
»Ich fühle mich ganz wohl hier. Arbeiten Sie ruhig weiter, wenn Sie mögen.«
Tatsächlich hatte der Künstler schon einen weißen Teller {32}hochgenommen und ihn vor sich auf eine kleine Scheibe gelegt, die auf einen Ständer montiert war.
»Sie wollen also nichts kaufen?«
»Nein, aber ich würde Ihnen gern ein bisschen zusehen, wenn es Sie nicht stört.«
Berti zuckte die Achseln, als sei es ihm so oder so egal. Er drehte die Scheibe und justierte den Teller, so dass er in der Mitte lag. Dann nahm er einen farbgetränkten Pinsel aus einem der Töpfe neben sich, und gleich darauf erschien ein perfekter dunkler Streifen rund um den Tellerrand.
Der Maresciallo, der immer gern ein Handwerk gelernt hätte, aber zu ungeschickt dafür gewesen war, beobachtete ihn schweigend.
»Sie sind nicht aus der Gegend?«, bemerkte Berti, tauschte den Pinsel gegen einen anderen und zog einen neuen Strich, fein wie ein Haar, unterhalb des Ersten.
»Nein.«
»Ein Freund von Niccolini?«
»Niccolini?«
»Der Maresciallo aus dem Ort.«
»Ah …« Er hatte nicht daran gedacht, seinen heiteren Kollegen nach dem Namen zu fragen. »So könnte man es nennen.«
»Er war gestern hier und hat etwas für seine Frau gesucht.«
Guarnaccia antwortete nicht, warf aber unwillkürlich einen Blick zu dem verklebten Fenster, das nicht danach aussah, als ob der Töpfer eine Verkaufslizenz hätte und seine Ware hier an den Mann brächte.
»Tja, das ist Italien, Maresciallo, das ist Italien …« Berti {33}hielt inne und ließ seine runden, etwas wässrigen Augen auf dem Maresciallo ruhen, dem die Beschreibung seines Kollegen einfiel, der Berti als alten Lüstling bezeichnet hatte. Er war gewiss ein unsympathischer Typ, etwas spinnenartig, aber als junger Mann mochte er durchaus gut ausgesehen haben. Sein runzliges Gesicht war sehr ebenmäßig und sein graues Haar so voll und wellig, dass er fast kopflastig wirkte. Er drehte sich um und suchte einen anderen Pinsel aus, dessen Spitze er zwischen seinen dünnen Fingern zwirbelte.