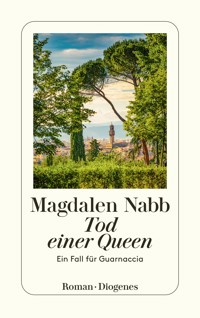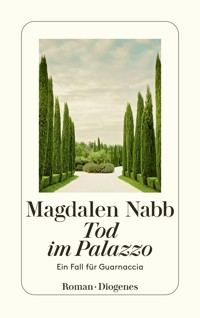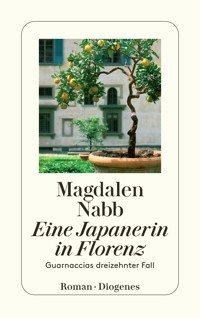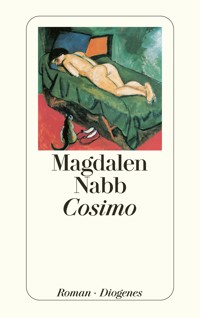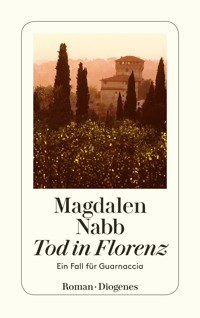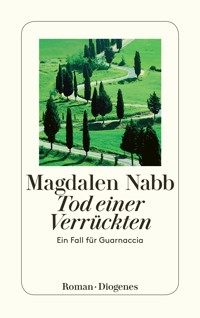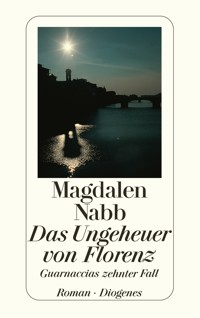9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maresciallo Guarnaccia
- Sprache: Deutsch
Überall in Florenz werden Touristen beraubt, Autos gestohlen, und in der Innenstadt gehen sogar Terroristen ans Werk. Dagegen sieht der Selbstmord eines holländischen Juweliers wie ein harmlos klarer Fall aus. Es gibt zwar ein paar Unstimmigkeiten, aber die einzigen Zeugen sind ein Blinder und eine alte Frau, die bösartigen Klatsch verbreitet. Trotzdem ist dem Maresciallo nicht wohl in seiner Haut – es wirkt alles ein bisschen zu einfach …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Magdalen Nabb
Tod eines Holländers
Ein Fall für Guarnaccia
Roman
Aus dem Englischen von Matthias Fienbork
Diogenes
{5}1
»Signora Giusti!«, protestierte Lorenzini, während er den Hörer vom Ohr hielt und die andere Hand verzweifelt gestikulierend in die Luft warf. Der rundliche Carabiniere mit dem rosigen Gesicht, der in der anderen Ecke des Zimmers saß und gerade ein Blatt Papier in die Schreibmaschine spannen wollte, hielt grinsend inne. Er bekam alles mit, was die erregte Stimme am anderen Ende der Leitung heraussprudelte, und als es wieder still geworden war, grinste er noch immer.
»Gestern dreimal und heute schon das zweite Mal.«
»O Mann«, brummte Lorenzini und legte den Hörer mit einer Grimasse auf, fügte aber noch hinzu: »Arme alte Klatschtante!«
Als sie ihn das letzte Mal so weit gekriegt hatte, dass er zu ihr gekommen war, hatte sie ihn fast den ganzen Vormittag festgehalten und ihm ihre Lebensgeschichte erzählt und jedes Mal, wenn er gehen wollte, sich unterbrochen und eine neue Beschwerde gegen den einen oder anderen Nachbarn vorgebracht. Die Florentiner hassten sie angeblich, weil sie aus Mailand war. Während sie von den Schikanen berichtete, die sie erdulden musste, rollten ihr dicke Tränen die Wangen herunter und fielen auf ihre kleinen Hände, die so dünn und bleich wie Spatzenbeine waren.
{6}»Und ich bin einundneunzig Jahre alt!«, jammerte sie dann. »Einundneunzig Jahre … Ich wollte, ich wär längst tot …«
»Ach was, Signora, ich bitte Sie, ich bitte Sie!« Und jedes Mal, wenn sich der bedauernswerte junge Mann wieder auf den Rand seines harten Stuhls setzte und beruhigend auf sie einzureden versuchte, hob sie wieder an und sprach von dem Streit, den ihre Verlobung ausgelöst hatte – vor dreiundsiebzig Jahren, aber es schien erst gestern gewesen zu sein –, während sie befriedigt mit den schmalen Händen gestikulierte und ihre Augen, aus Freude darüber, dass sie ihr Opfer wieder eingefangen hatte, teuflisch funkelten.
»Soll ich hingehen?«, fragte der Carabiniere mit dem rosigen Gesicht und stand auf.
»Nein, lieber nicht, du würdest mit der Situation nicht fertigwerden. Ich sage dem Maresciallo Bescheid – ist er noch unten?«
»Ja …, als ich hochkam, stritt er sich jedenfalls noch mit diesem amerikanischen Paar herum.«
Lorenzini rollte die Hemdsärmel herunter und schnappte sich seine Uniformmütze.
»Ich werde wohl selbst vorbeischauen müssen …« Er sah auf seine Uhr. »Es ist sowieso gleich zwölf. Ich nehme den Wagen und bring unser Mittagessen mit. Ciao, Ciccio!«
Ciccio hieß eigentlich Claut, Gino Claut, aber in Florenz nannte ihn niemand bei seinem richtigen Namen, vielleicht weil er deutsch klang. Er hatte eine ganze Reihe von Spitznamen. Gigi, Ciccio, weil er so dick war, Polenta (weil er aus dem Norden kam oder weil sein kurzes flachsblondes Haar die Farbe von Polenta hatte, dem beliebten {7}Nahrungsmittel dort oben) und Pinocchio, ohne besonderen Grund, obgleich sein strahlendes Gesicht und seine langsamen Bewegungen immer etwas Puppenhaftes hatten. Seine Uniform schien nie zu sitzen, sosehr er sich auch bemühte, und eine Kragenecke war meistens hochgeklappt. Er hatte sich zusammen mit seinem Bruder, der ein Jahr älter war und etwas größer und schmaler, ansonsten aber genauso aussah wie er, zu den Carabinieri gemeldet; beide hießen dort nur ›die Jungs aus Pordenone‹, ein Ausdruck, der stets von einem Schmunzeln begleitet wurde. In Wahrheit kamen sie gar nicht aus Pordenone, sondern aus einem kleinen Dorf zwanzig Kilometer weiter nördlich am Fuß der Dolomiten. Gino mochte alle seine Spitznamen. Sein Lächeln wurde immer breiter und sein Gesicht immer röter, je mehr die anderen ihn neckten. Auch jetzt lächelte er, als Lorenzini die Treppe hinunterpolterte. Lorenzini war immer laut, immer in Eile. Dann legte sich ein Ausdruck großer Konzentration auf sein Gesicht, er streckte die Zungenspitze heraus und begann, mit zwei Stummelfingern bedächtig zu tippen.
Unten in der Wache, dem kleinen, zur Straße hin gelegenen Dienstzimmer, stand Maresciallo Guarnaccia in seiner ganzen Breite vor dem vergitterten Schalter, durch den die Amerikaner ihre Beschwerde vorbrachten. Auf seinem Khakihemd zeichnete sich ein Schweißfleck zwischen den Schulterblättern ab, und immer wieder fuhr er sich mit einem Taschentuch über den Nacken. Erst hatte er den beiden in Zeichensprache und italienischen Einsilbern, auf die sie nicht reagierten, erklären müssen, dass sie sich bei einem Tabakhändler eine carta bollata besorgen sollten, {8}jenes Stempelpapier, das für den Behördenverkehr verwendet werden muss. Als sie schließlich mit dem Papier zurückkamen, schwitzend und wütend, da sie sich mit drei Barbesitzern gestritten hatten, die keine Stempel- und Tabaklizenz besaßen, musste er es für sie ausfüllen, wobei er ihnen jede kleine Angabe per Zeichensprache mühsam aus der Nase zog. Als man eine Stunde später bei der Beschreibung der gestohlenen Pocketkamera angelangt war, verkündeten sie plötzlich, der Diebstahl sei tags zuvor in Pisa passiert. Der Maresciallo warf den Stift mit rot angelaufenem Gesicht hin und drehte sich um, erfreut, dass Lorenzini ihn ansprach.
»Worum geht’s denn?«
»Signora Giusti, Signor Maresciallo.«
»Schon wieder?«
So war es immer: Manchmal hörte man sechs oder sieben Wochen lang nichts von ihr, dann rief sie täglich an. Einmal hatte sie im Lauf eines Tages sechsmal angerufen, und stets mit einer plausiblen Geschichte. Falls sie aber nur ein einziges Mal der Sache nicht nachgingen und der Frau etwas zustieß, würde ein Aufschrei durch die Presse gehen: »Einundneunzigjährige stirbt vereinsamt. Polizei ignoriert ihren Hilferuf.«
»Soll ich zu ihr gehen?«
»Ja, wär vielleicht besser – nein, warten Sie. Sie können doch ein bisschen Englisch, stimmt’s?«
»Ein bisschen. Nicht sehr gut, aber mit den beiden müsste ich schon fertigwerden …«
»Dann erklären Sie ihnen, dass sie den Diebstahl in Pisa hätten melden müssen. Sie haben mich den ganzen {9}Vormittag hier festgehalten, und ich habe noch immer nicht meine Hotelrunde gemacht. Ich werde auf dem Rückweg selbst bei Signora Giusti vorbeischauen …«
Eilig zog er sich die Jacke an, nahm die Uniformmütze vom Haken und trat hinaus. Er schämte sich ein wenig, dass er den Jungen mit den beiden Amerikanern alleingelassen hatte – bestimmt waren sie jetzt empört darüber, mit einem Rangniederen vorliebnehmen zu müssen –, wenn er aber ein paar Worte Englisch sprach, würde sie das vielleicht milder stimmen. Als er im steinernen Gewölbegang unter der großen schmiedeeisernen Laterne stehen blieb, um seine Sonnenbrille aufzusetzen, konnte er jedoch deutlich die Stimme des Amerikaners hören:
»Weil wir einen Tagesausflug dorthin gemacht hatten. Warum sollten wir das bisschen Zeit, das uns blieb, auf dem Polizeirevier totschlagen? Wir wohnen hier gegenüber – also, ich begreife nicht, warum wir den ganzen Vormittag hier vertrödeln müssen.« Und die ganze Zeit über das Gejammer seiner Frau: »Vielleicht haben wir sie im Bus liegenlassen …«
Auch wenn er kaum ein Wort mitbekam, schüttelte der Maresciallo nur den Kopf über diesen hoffnungslosen Fall.
Es war Juli, und der abschüssige Platz vor dem Palazzo Pitti war vollgestellt mit bunten Reisebussen, über denen die Luft flimmerte. Wenn er zwischen ihnen hinunterging, würde das Blut in seinen Adern bald zu kochen beginnen. Stattdessen ging er direkt am Palazzo entlang, bei den Ansichtskartenverkäufern vorbei und an dem Karren des Mannes, der Eis verkaufte, das träge zu schmelzen begann, noch ehe der Kunde bezahlt hatte. Er sah zwei Japanerinnen, die {10}sich, an ihren Eistüten leckend und schnell sprechend, von dem Eismann entfernten, und blieb stehen, um einem der Mädchen auf die Schulter zu tippen. Beide drehten sich um und schauten zu dem dicken Polizisten mit Sonnenbrille hoch, der ihnen wortlos den Reiseführer aushändigte, den sie auf dem Eiswagen hatten liegenlassen.
Sicher hätten sie beschlossen, ihn erst in Mailand als gestohlen zu melden, dachte der Maresciallo grimmig.
Am anderen Ende des Vorplatzes überquerte er im Schatten der hohen Mauer die schmale, nach unten führende Straße, drängte sich durch eine wartende Autoschlange auf die andere Seite. Einige Fahrer hupten und stöhnten, doch bei der drückenden Hitze hatte niemand Lust, auszusteigen und sich mit jemandem anzulegen.
Der Maresciallo trottete gemächlich von Hotel zu Hotel, bewegte dabei die Arme wie ein übergewichtiger Westernheld und warf einen unauffälligen Blick in jedes geparkte Auto, an dem er vorbeikam, in Autos mit anderen als Florentiner Kennzeichen einen etwas längeren Blick. Täglich außer donnerstags, an diesem Tag hatte er dienstfrei, verglich er die blauen Melderegister von Hotels und Pensionen in seinem Bezirk mit einer Namenliste gesuchter Terroristen, die DIGOS, der Staatsschutz, an sämtliche Polizisten verteilt hatte. Zu dieser Überprüfung war der Maresciallo nicht verpflichtet, und er wusste sehr wohl, dass terroristische Operationen von Privatwohnungen aus durchgeführt wurden, aber er tat es trotzdem. Mitunter kam auch etwas dabei heraus; wenn es nämlich nur um ein Treffen ging oder auch auf einer längeren Reise, benutzten sie durchaus Hotels, und wenn sie die in seinem Revier benutzten, {11}dann wollte der Maresciallo als Erster davon erfahren. Das war keine private Vendetta, nur ein persönliches Anliegen. Der Terrorismus war in seinen Augen ein Mittelschichtphänomen, das ihm fremd blieb. Er verstand Menschen, die sich einfach über Wasser halten wollten und deswegen zu Diebstahl und Prostitution griffen, und all jene, die aufgaben und auf der Via Tornabuoni bettelten. Auch die Jugendlichen, die aufgaben, noch ehe sie überhaupt angefangen hatten. Als er, unterwegs zum letzten Hotel vor der Mittagspause, die Piazza Santo Spirito überquerte, sah er zwei von ihnen auf einer Bank im Halbschatten der Bäume. Der Junge schien zu schlafen, während das Mädchen teilnahmslos zusah, wie eine dunkle Blutspur ihren Unterarm entlangsickerte. Eine dreckige Spritze, ein Teelöffel und eine ausgedrückte halbe Zitrone lagen auf der Erde neben der Bank.
»Tag, Chef!« Der Besitzer der Pensione Giulia stand in Hemdsärmeln unten im Hauseingang und sah zu, wie der Maresciallo sich einen Weg durch die Abfälle und die pickenden Tauben rings um die Marktstände bahnte, die auf der einen Seite aufgebaut waren.
»Seit gestern niemand Neues«, fügte er munter hinzu.
»Ich komme trotzdem mit hinauf«, sagte der Maresciallo höflich. Dass seine kleinen Besuche nicht beliebt waren, ließ ihn ziemlich kalt. Die Pension lag im dritten Stockwerk.
»Der hier …«, der dicke Finger des Maresciallos zeigte auf die letzte Eintragung im Gästebuch, »… stand gestern aber noch nicht da.«
»Gestern, nein … Es ist eine Person, die schon mal hier {12}war … vor einem Monat etwa … Ist dann auf Rundreise gegangen und hat mich gebeten, dasselbe Zimmer freizuhalten … Also, Sie werden Ihre Zeit doch nicht mit jemand verplempern, den Sie schon vor einem Monat überprüft haben …?«
»Vor einem Monat?«
»Vielleicht irre ich mich …, oder es war an einem Donnerstag, natürlich, wo Sie …«
»Ein Donnerstag?«
»Ich müsste mal nachschauen …«
»Tun Sie das!«
Nervös blätterte der Besitzer im Gästebuch, als hinter ihm eine Tür aufging und ein kleiner Mann in zerknittertem blauen Leinenanzug schwungvoll hereinkam. Als er den Besucher sah, blieb er wie angewurzelt stehen, schlenderte dann aber, die Hände in den Hosentaschen, weiter.
»Suchen Sie jemand, Maresciallo?«, rief er fröhlich.
Der Maresciallo betrachtete ihn kurz und meinte dann: »Sie!«
Der kleine Mann fuhr wütend den Besitzer an.
»Du Idiot! Du hast gesagt, du lässt ihn nicht rein!«
»Und du hast versprochen, du bleibst auf deinem Zimmer! Selber Idiot!« Der kleine Mann wandte sich an den Maresciallo, der beide mit ausdruckslosen Glupschaugen beobachtete, während er mit der Zentrale in Borgo Ognissanti telefonierte und einen Wagen anforderte.
»Nur noch sechs Monate musste ich absitzen, können Sie sich das vorstellen? Sechs Monate! Ich hätte gleich drinbleiben können …«
Der Maresciallo schwieg.
{13}Als der Wagen eintraf und drei Carabinieri die Treppe heraufgestürmt kamen, sagte er:
»Keine Panik, Jungs. Der Kerl ist ganz harmlos.«
Sie sahen den Maresciallo an und dann den kleinen Mann.
»Und wer ist das?«
»Keine Ahnung. Er sagt, er müsse noch sechs Monate absitzen, und ins Gästebuch hat er sich offenbar auch nicht eingetragen.«
»Also los, kommen Sie!«
Der kleine Mann wehrte sich und schimpfte laut, als sie versuchten, ihn abzuführen.
»Was ist denn los mit dir, verdammt? Vorwärts!«
»Er ist sauer«, sagte der Maresciallo, »dass er sich verraten hat. Anscheinend dachte er, ich wüsste, wer er ist.«
»Alles Egoisten«, bemerkte einer der jungen Beamten, als es ihnen schließlich gelang, den Mann hinauszuführen.
»Ja«, seufzte der Maresciallo, und er schämte sich ein wenig für seine List. »Dem ist wohl so.«
Dann drehte er sich um, stützte sich mit seinen mächtigen Fäusten auf den Rezeptionstresen und starrte den Besitzer so lange und so durchdringend an, dass es schien, als würden ihm die großen Augen im nächsten Moment aus dem Kopf fallen.
»Was hatten Sie gesagt? Diese Person war vor einem Monat schon mal hier?«
»Gestern Abend«, verbesserte sich der Besitzer mit leiser Stimme.
»Und mit unserem geflohenen Häftling hat es natürlich nichts zu tun, was?«
{14}»Nein, nein. Bloß eine Touristin. Ich wollte Ihnen einfach die Mühe ersparen …«
»Klar. Aber eines schönen Tages …«, der Maresciallo blickte auf und drohte mit dem Zeigefinger, »werden Sie um Hilfe rufen und dann erwarten, dass ich angerannt komme.«
Sein Finger kehrte zur letzten Eintragung zurück.
»Ein britischer Pass? Warum haben Sie das Ausstellungsdatum nicht notiert?«
»Habe ich nicht? Ich muss es vergessen haben …«
»War er schon abgelaufen?« Der Maresciallo beugte sich über den Tresen, so dass ihre Nasen sich fast berührten.
»Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich habe es irgendwo aufgeschrieben …«
»Dann werden Sie es mir zeigen, wenn ich morgen wieder vorbeischaue.«
Der Maresciallo trug den Namen Simmons und die Passnummer in sein Notizbuch ein, um es nicht zu vergessen.
»Eines schönen Tages …«, warnte er den Besitzer wieder.
»Es war doch nur für eine Nacht, Signor Maresciallo. Und es ist nichts passiert.«
Draußen auf der Piazza packten die Markthändler zusammen. Ein intensiver Geruch von Basilikum und reifen Tomaten lag in der Luft, Sommergeruch. Nur wenige Stände waren aufgebaut, denn es war Montagvormittag. Aus demselben Grund waren die Handwerksbetriebe geschlossen, nur die Bar, deren weißlackierte Eisentische draußen im Freien standen, hatte auf und lockte Scharen von Touristen an.
{15}Der übrige Platz leerte sich rasch, und durch die braunen Fensterläden, die zum Schutz vor der Mittagssonne geschlossen waren, zogen inzwischen ganz andere, neue Gerüche: von gegrilltem Fleisch, Knoblauch, Kräutern und Olivenöl. Der Maresciallo stellte fest, dass er hungrig war. Am letzten Marktstand, am Ende der Reihe, gab es noch eine Kiste mit etwa einem Dutzend großer, samtiger Pfirsiche, die auf frischem Gras ruhten.
»Tausendfünfhundert Lire das Kilo«, sagte der Händler mit der langen grünen Schürze, als er seinen Blick auffing, und griff schon nach einer Papiertüte. »Hier, kommen Sie, der ganze Rest für zweitausend. Geben Sie mir zweitausend, dann kann ich Feierabend machen.«
Der Maresciallo zog zwei Tausendlirescheine aus seiner Brusttasche. Die Pfirsiche würde er sich mit den Jungs zum Nachtisch teilen.
Er verließ die Piazza am äußersten Zipfel, bei der Kirche, und überquerte die Via Maggio. Die Straße war menschenleer, die Geschäfte geschlossen. Es war sicher schon nach eins. Er sah auf seine Uhr: zehn nach. Da fiel ihm Signora Giusti ein, und er blieb stehen. Er konnte die Pfirsiche riechen, die kühl und schwer in der Papiertüte lagen. Er war durstig, müde und verschwitzt, und sein Essen, von Lorenzini aus der Kantine geholt, würde kalt werden. Die Straße lag still da, nur gelegentlich hörte man gedämpftes Geschirrklappern und Frauenstimmen. Zwischen den dunklen Dachgesimsen zeigte sich ein schmaler Streifen blauer Himmel. Er dachte an die alte Dame, die einsam in ihrer Wohnung saß und wartete … Er kehrte um.
Sie wohnte neben der Kirche, in der obersten Etage des {16}Eckhauses. Im Erdgeschoss links befand sich eine Goldschmiedewerkstatt, rechts ein winziger Raum, in dem Blumen verkauft wurden, ein besseres Loch. Vor beiden Geschäften waren die Rollläden heruntergelassen. Er drückte auf die oberste Klingel und trat auf die abfallübersäte Straße zurück, denn er rechnete damit, dass sich, in Ermangelung einer Gegensprechanlage, am Fenster oben ein Gesicht zeigen würde. Doch die Tür sprang sofort auf – die Frau musste neben dem Drücker gewartet haben. Innen links befand sich eine Tür mit Milchglasscheibe und daneben ein Messingschild mit der Aufschrift GIUSEPPEPRATESI, Goldschmied und Juwelier. Den winzigen Blumenladen betrat man direkt von der Piazza aus. Gleichwohl mischte sich der Duft von Blumen in den Geruch von Metallspänen und Gasbrennern, als der Maresciallo, der sich vergeblich nach einem Lift umgesehen hatte, langsam das düstere Treppenhaus hinaufstieg. Ein von zahllosen Händen geglättetes Seil, das durch schwarze Eisenringe lief, die auf jedem Treppenabsatz in die löchrige Wand eingelassen waren, diente als Geländer. In jedem Stockwerk gab es zwei braun gestrichene Türen mit großen polierten Messingknäufen.
Sie stand schon in der Wohnungstür und erwartete ihn und begann zu weinen, sobald er, die Mütze in der Hand, auf dem letzten Treppenabsatz in Sicht kam. Vor lauter Atemlosigkeit brachte er kein Wort heraus, und er versuchte gar nicht erst, ihren Wortschwall zu unterbrechen, während er ihr hineinfolgte.
»Seit meinem Anruf sind schon Stunden vergangen, aber auf eine alte Frau hört ja niemand – inzwischen hätte man mich ausrauben können, mir meine letzten Habseligkeiten {17}wegnehmen können, aber diese Kuh wird mich nicht hinauskriegen! Die wissen nicht, was es heißt, alt und schutzlos zu sein …«
Er musste sich anstrengen, um mit ihr Schritt zu halten, denn der Rollator, der ihr als Gehhilfe diente, schoss auf dem gefliesten Korridor entlang, und die kleine Gestalt wankte plappernd und klagend hinterher. Die Wohnung war lang und schmal, die wichtigsten Zimmer gingen links vom Flur ab. Die Schlafzimmertür stand immer offen, so dass man das spärliche Mobiliar sehen konnte, aber alle anderen Zimmer, so viel wusste der Maresciallo von Lorenzini, standen leer. Die Frau hatte im Lauf der Zeit ihre wertvollen alten Möbel Stück für Stück verkaufen müssen. Schließlich erreichten sie am Ende des Korridors die Küche.
»Nehmen Sie Platz!« Die gebrechliche Frau hatte sich schon am Fenster in einen abgewetzten hohen Ledersessel gesetzt, der mit vielen bunten, blumengemusterten Kissen ausstaffiert war. Vor ihr, auf einem niedrigen Tisch, stand ein Telefon auf einem Häkeldeckchen, daneben lagen eine Liste mit großen roten Zahlen sowie ein Vergrößerungsglas. Sie zeigte auf den harten Stuhl gegenüber, auf dem er Platz nehmen sollte.
»Wofür soll denn die Sonnenbrille gut sein?«
»Entschuldigen Sie.« Er setzte sie ab und steckte sie in seine Tasche. »Eine Allergie … Meine Augen vertragen das Sonnenlicht nicht.«
»Aber doch nicht hier!«
Es war wirklich nicht sehr hell im Zimmer. Vom Fenster aus sah man in einen kleinen, dunklen Innenhof. {18}Bestimmt beobachtete sie den ganzen Tag über das Treiben ihrer Nachbarn, und manchmal zockelte sie mit ihrem Rollator bis ins Schlafzimmer, um das Leben auf der Piazza zu verfolgen. Diese Steintreppe, vier Stockwerke hoch … Es musste Jahre her sein, seit sie das letzte Mal draußen war.
Die alte Dame registrierte sofort das Mitgefühl in seinem Blick und nutzte es aus.
»Sie sehen ja, worauf das hinausläuft. Tag für Tag allein, und niemand kommt mich besuchen, nicht eine Seele. Über sechzehn Jahre bin ich nicht draußen gewesen, habe immer allein hier gesessen … Tag für Tag …«
Dicke Tränen kullerten aus ihren Augen, und sie zog ein Taschentuch aus ihrem Kleid hervor.
»Aber bestimmt kommt doch die Altenpflegerin, Signora! Erledigt sie nicht die Einkäufe für Sie? Und hilft sie Ihnen nicht beim Waschen, Anziehen und Kochen?«
»Dieses Miststück! Ich spreche von Freunden, die mich besuchen sollen, nicht von Angestellten. Glauben Sie, ich hätte zu Lebzeiten meines Mannes eine Frau wie sie ins Haus gelassen? Aber heutzutage darf man keine Ansprüche haben. Einmal hat sie Konserven mitgebracht, aber da habe ich klipp und klar eine Grenze gezogen. Ich habe ihr sofort erklärt …«
Von wegen. Der Maresciallo erinnerte sich, dass sie die kleine Dose Hühnchenfleisch der armen jungen Frau an den Kopf geworfen und ihr eine böse Wunde zugefügt hatte. Lorenzini, den Signora Giusti zuvor angerufen hatte, um sich über die Jugendlichen ein Stockwerk tiefer zu beschweren, die ihre Stereoanlage voll aufgedreht hatten, war mitten in den Streit hereingeplatzt. Die Altenpflegerin war {19}in Tränen aufgelöst und hielt sich ein nasses Handtuch an die stark blutende Schläfe. Lorenzini hatte die jungen Leute mitgebracht, damit sie ihm halfen, für Ordnung zu sorgen, und aus dem zweiten Stock war ein Ehepaar heraufgekommen, um nachzusehen, was der ganze Lärm sollte. Der Mann, der nachts bei der Straßenreinigung arbeitete, hatte versucht, ein wenig Schlaf zu bekommen. Für alle diese Leute war kaum Platz in der kleinen Küche, doch Signora Giusti, so berichtete Lorenzini, war in ihrem Element gewesen, hatte abwechselnd geschluchzt und drauflosgeplappert, zufrieden über das Interesse, das ihr, wie sie meinte, zustand.
Immerhin, dachte der Maresciallo, während diese winzige Gestalt mit piepsiger Vogelstimme endlos über die Schandtaten der Altenpflegerin schimpfte, immerhin war nicht zu leugnen, dass sie tatsächlich einundneunzig war und kaum hoffen konnte, ihre Wohnung je zu verlassen, außer in ihrem eigenen Sarg.
»… erklärt mir, ich soll dankbar sein! Dankbar! Dass der einzige Mensch, den ich den ganzen Tag zu Gesicht bekomme, eine Fremde ist, die glaubt, sie kann in meiner Wohnung machen, was sie will, und die mir vorschreibt, was ich tun und was ich essen soll … Sie hat mir sogar die Haare geschnitten, wissen Sie das? Mein wunderschönes Haar …«
Sie weinte jetzt wirklich, obwohl man bei ihr nie sicher sein konnte. Ihr Haar – sie hatte schönes weißes und für ihr Alter ziemlich kräftiges Haar – reichte tatsächlich knapp über die Ohren, wie bei einem jungen Mädchen.
»Vielleicht dachte sie, es wäre bequemer für Sie«, {20}murmelte der Maresciallo verdrießlich. Ihm fiel ein, dass man seiner Mutter nach dem Schlaganfall vor drei Monaten ebenfalls die Haare abgeschnitten hatte …, aber sie war jetzt auch wirklich im Zustand eines Kindes, und immerhin hatte keine Fremde es ihr abgeschnitten, sondern seine Frau. War es möglich, dass man mit einundneunzig noch immer eitel war?
An der gelb glänzenden Küchenwand hingen, neben einem billigen Farbporträt von Papst Johannes XXIII., das mit altem Lametta und einer roten Plastikrose geschmückt war, ein paar Familienfotos, gute Rahmen, wahrscheinlich aus Silber. Auf einem Foto war ein außergewöhnlich schönes Mädchen mit einem prächtigen schwarzen Haarschopf, einem hohen Spitzenkragen und schweren Perlenketten zu sehen. Der Maresciallo hatte das Bild einige Minuten lang versonnen bewundert, als ihm plötzlich klar wurde, dass es Signora Giusti sein musste. Im Mittelpunkt des Interesses zu stehen musste für sie wohl etwas ganz Normales gewesen sein, und jetzt … Dort, wo sich jetzt zwei ausgeblichene Stellen zeigten, hatten sicher zwei weitere Fotos gehangen. Hatte sie die silbernen Rahmen verkaufen müssen?
»Sie wird mich nicht herausbekommen. Ich lasse mich nicht aus meiner Wohnung rauswerfen wie ein Niemand, nur damit hier alles geplündert wird. Ich habe ihr erklärt, dass man mich ausrauben könnte, aber sie denkt nur an ihre Ferien – und solche Menschen muss ich in meine Wohnung lassen! Und für diese Behandlung soll ich auch noch dankbar sein – ich gehe aber nicht freiwillig, und sie kann mich nicht zwingen. Sie müssen es ihr sagen! Wenn Sie es ihr sagen …«
{21}Der Maresciallo war völlig verwirrt.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wer will, dass Sie wohin gehen?«
Ihr endloses Geplapper strengte ihn an. Er war hungrig und müde, aber sie war lebhaft wie eh und je, saß zerbrechlich, aber kerzengerade in ihrem Sessel, Augen und Hände in ständiger Bewegung, und redete ununterbrochen.
»Ich habe Ihnen schon mal erklärt, wenn Sie nur zugehört hätten, dass sie seit einem Monat versucht, mich loszuwerden, mich in ein Krankenhaus zu stecken, während sie Ferien macht …, wie wenn man einen Hund in eine Hütte sperrt …«
»Ach so, Sie meinen die Pflegerin. Aber dieses Krankenhaus –«
»Na ja, es ist genau genommen kein Krankenhaus, mehr eine Art Erholungsheim, oben in den Bergen. Soll dort kühler sein als hier in Florenz.«
»Wird wohl stimmen, wenn es in den Bergen liegt – und wissen Sie, Signora, diese junge Frau, diese Pflegerin … Wie heißt sie gleich …«
»Ich weiß es nicht«, log Signora Giusti schnippisch.
»Also, sie hat doch vermutlich Familie und muss ihren Urlaub nehmen, wenn die Kinder Schulferien haben.«
»Dann sollen sie mir jemand anderes schicken und mich nicht verfrachten wie ein Bündel Lumpen.«
Sie weinte wieder.
Der Maresciallo seufzte. Er hatte keine Ahnung, warum sie ihn in diese Geschichte hineinziehen wollte, aber die Pflegerin, die das jeden Tag durchmachen musste, tat ihm leid. Er probierte es mit einer anderen Methode.
{22}»Hören Sie, Signora …«, er beugte sich weit vor, »Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie in gewisser Hinsicht eine recht ungewöhnliche Person sind …«
Sie hörte auf zu weinen und begann, ihm zuzuhören.
»In Florenz gibt es noch mehr Menschen Ihres Alters, aber ich bezweifle, dass irgendeiner sich so gut gehalten hat wie Sie, noch immer wach und interessiert an den Dingen des Lebens – Sie wissen, was ich meine.«
»Hm«, sagte die Signora und schniefte. »Florentiner!«
»Im Sommer herrscht überall Personalmangel …« Er ging behutsam vor. »Und es gibt auch nicht so viele Plätze in den … Erholungsheimen auf dem Land. Man muss sich also genau überlegen, wem man diese Plätze anbieten will, man muss sich Leute aussuchen, die in der Lage sind, dieses Angebot auch zu nutzen …«
»Sehr gut. Sehr schön formuliert. Und wer bestimmt, wo Sie Ihre Ferien verbringen?«
»Ich …«
»Und ich bestimme, wo ich meine verbringe! Jedenfalls nicht in so einem Haus, das schwör ich Ihnen …«
»Aber woher wollen Sie wissen, solange Sie noch nie dort gewesen sind, wie –«
»Ich bin schon mal dort gewesen.«
»Ach. Wann denn?«
»Weiß nicht mehr. Aber ein Haus, das von einer solchen Frau geführt wird, betrete ich nicht.«
»Welche Frau?«
»Die Hausmutter.« Sie beugte sich vor und erklärte vertraulich: »Kommt aus dem Süden. Sie verstehen. Die sind anders als wir.«
{23}»Wir sind alle Italiener«, murmelte der Maresciallo, der aus Sizilien kam.
»Wir ja. Aber nicht die aus dem Süden. Die sehen zum Teil fast wie Schwarze aus. Oder wie Araber. Sie arbeiten nicht und leben wie die Tiere. Wo wollen Sie hin?«
Der Maresciallo war aufgestanden.
»Wenn Sie überlegen, wo Sie das hinstellen sollen – ich hoffe, es ist Obst, das ist das Einzige, was ich ohne Zähne gut essen kann, das und Kuchen –, aber Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, wie viele Leute mit leeren Händen zu mir kommen. Oder sie bringen hartes Zeug mit, das ich unmöglich kauen kann. Das sieht ja nach Obst aus.«
»Pfirsiche.« Der Maresciallo fügte sich in sein Schicksal. Es stimmte, er hatte nicht daran gedacht, ihr etwas mitzubringen, hatte fast vergessen, überhaupt zu kommen.
»Legen Sie sie in den Kühlschrank. Sie haben zu viel mitgebracht, sie verderben nur, bevor ich sie aufessen kann. Dort drüben, hinter dem Vorhang!«
Sie war wirklich unmöglich.
Er öffnete den wackeligen Kühlschrank, dem eine Reinigung gutgetan hätte. Im mittleren Fach stand ein Teller mit einem Rest gekochtem Spinat. In der Tür stand eine Tüte H-Milch. Sonst nichts. Er legte die Pfirsiche ganz unten in das Gemüsefach.
»Nicht dort!« Sie stand, auf den Rollator gestützt, hinter ihm. »So weit kann ich mich nicht hinunterbeugen.«
Er legte die Pfirsiche weiter oben hin. Neben dem Kühlschrank stand ein alter Gasherd, darauf ein schäbiger Topf mit dem Rest des Milchkaffees, den die Altenpflegerin morgens zubereitete.
{24}»Sie macht ihn«, erklärte Signora Giusti, »und ich wärme ihn mir nach dem Essen auf. Aber heute habe ich die Streichhölzer fallen lassen. Kalt wollte ich ihn nicht trinken. Ob Sie wohl …?«
Die Streichhölzer lagen zwischen Kühlschrank und Herd. Der Maresciallo hob die Schachtel auf und zündete das Gas an. Sie beobachtete ihn wortlos, vielleicht sogar besorgt, sie könnte zu weit gegangen sein, denn er sagte nichts.
»Nicht zu warm …«
Sie saß in ihrem Sessel, und er gab ihr den warmen Kaffee in einem Plastikbecher. Sie machte eine bemitleidenswerte Figur, sobald sie ihre barsche Art sein ließ.
»Tja, Signora, ich muss jetzt gehen.«
»Einen Moment …« Sie stemmte sich hoch und angelte sich ihren Rollator. »Ich muss Ihnen etwas zeigen.«
Sie tappte den Flur hinunter ins Schlafzimmer; der Maresciallo kam folgsam hinterher.
In dem großen abgedunkelten Raum stand nur ein hohes Holzbett, zu dem früher zweifellos ein zweites gehört hatte, und eine Kommode aus billigem Pressspanholz. Über dem Kopfende des Bettes hob ein staubbedeckter hölzerner Engel einen dicken Finger an die Lippen, als fordere er Ruhe. Das zweite Bett mit seinem Engel, der Kleiderschrank und der Toilettentisch waren offensichtlich verkauft worden, höchstwahrscheinlich auch die Teppiche, denn vor dem Bett lag eine billige Strohmatte.
Signora Giusti schob eine mühsam suchende Hand unter die Matratze.
»Helfen Sie mir doch!«
{25}Er hob die Matratze an, und ihre kleine Hand schnappte sich einen Lederbeutel. Sie hielt ihn dem Maresciallo unter die Nase und rief: »Da! Hunderttausend Lire! Aber nicht weitersagen!« Sie schob den Beutel wieder zurück.
»Das ist für meine Beerdigung. Ihnen kann ich bestimmt trauen. Sie haben Familie. Das ist das Einzige, was mir noch am Herzen liegt … eine anständige Bestattung. Sie wissen, was ich meine …«
Er hatte verstanden. Eine ›anständige Bestattung‹ bedeutete, in einem loculo, einer luftdicht abgeschlossenen Grabnische in einer eigens dafür errichteten Mauer bestattet zu werden, mit einer Erinnerungstafel und einem Grablicht davor. Der Preis für diese Ruhestätte, vor der bei Dunkelheit das Ewige Licht flackerte, variierte je nach Nische, aber teuer war es in jedem Fall. Wer sich das nicht leisten konnte, für den gab es die kostenlose Erdbestattung, wenn auch nur auf Zeit. Nach Ablauf von zehn Jahren wurde die Leiche exhumiert und identifiziert, und die Gebeine wurden in einer kleinen Urne in einem kleineren loculo eingemauert. Sofern noch immer kein Geld vorhanden war oder niemand erschien, um die Leiche zu identifizieren und für die Kosten aufzukommen, konnte das Gesundheitsamt die Gebeine wegschaffen lassen.
»Verstehen Sie …« Signora Giusti umklammerte seinen Arm. »Ich habe niemanden … Wenn ich nicht anständig begraben werde, was wird dann mit meinen armen alten Knochen passieren?«
Sie weinte wieder.
»Jetzt wissen Sie, wo das Geld liegt … Sie werden sich darum kümmern … werden ihnen sagen …«
{26}»Ich werd’s ihnen sagen.«
»Noch bin ich nicht völlig verarmt … Ach, wenn Sie gesehen hätten, wie schön ich als Mädchen war, würden Sie es verstehen. Ich möchte nicht auf einer Müllkippe enden … Sie müssen dafür sorgen, dass man das Foto verwendet, das in der Küche an der Wand hängt, vergessen Sie das nicht!«
Es war üblich, in die Grabplatte, neben das Lämpchen, ein auf Porzellan kopiertes Foto anzubringen.
»Ich werd’s schon nicht vergessen.«
»Sie sind eine Respektsperson, deswegen kann ich Ihnen vertrauen. Anderen werde ich lieber nichts erzählen, Sie verstehen, wegen des Geldes. Ich möchte nicht bestohlen werden.«
»Ich werde mich darum kümmern. Keine Sorge.«
Wie sollte er ihr klarmachen, dass sie völlig überholte Vorstellungen hatte, dass sie für eine ›anständige Beerdigung‹ heutzutage zwischen einer und zwei Millionen Lire bezahlen musste. Ihr sorgsam gehüteter Geldbeutel würde höchstens für den Blumenschmuck und die Fotografie reichen.
Er war unfähig, etwas zu sagen.
»Ich muss jetzt los …«
»Aber Sie werden mit dieser Frau vom Sozialamt sprechen? Sie werden ihr erklären, warum ich hierbleiben und meine letzten Lire zusammenhalten muss?«
»Aber damit habe ich doch nichts zu tun. Warum sollte sie mir überhaupt zuhören?«
»Sie muss Ihnen einfach zuhören, verstehen Sie nicht? Wegen des Herumtreibers in der Wohnung nebenan.«
{27}»Herumtreiber?«
»Ja! Deswegen habe ich Sie doch gerufen! Ich habe dem jungen Mann am Telefon doch alles erklärt – hat er Ihnen nichts ausgerichtet?«
»Doch, natürlich …« Er hatte ganz vergessen zu fragen. »Die Nachbarwohnung. Sie steht seit Jahren leer, nicht wahr? Und Sie glauben, es ist jemand drin?«
»Ich weiß es. Mein Gehör funktioniert noch gut.«
»Glauben Sie nicht, es könnte der Besitzer gewesen sein?«
»Ausgeschlossen. Wenn er zurückkommt, dann besucht er mich immer zuerst. Ich habe ihn praktisch großgezogen. Ich habe mich um ihn gekümmert, als seine Mutter starb, die Ärmste – ihr Mann war Ausländer, müssen Sie wissen, und so … Jedenfalls hat dieses Kind genauso viel Zeit bei mir verbracht wie zu Hause, und ich habe ihn gepflegt, als er Gelenkrheumatismus bekam – hat mammina zu mir gesagt, wirklich –, jedenfalls so lange, bis sein Vater wieder heiratete – also, versuchen Sie nicht, mir weiszumachen, dass er es war oder sie, die Stiefmutter, meine ich –, denn abgesehen davon, dass sie Ausländerin ist, allerdings keine Holländerin, er war Holländer, sie ist aus England, werde ich nicht zulassen, dass schlecht über sie geredet wird. Es war ein trauriger Tag für mich, als sie ihre Sachen packte und ging. Als sie noch nebenan wohnte, habe ich niemand von der Fürsorge gebraucht. Wenn sie zurückkommt, und ich wünsche es mir sehnlichst, dann würde sie nicht mitten in der Nacht heraufschleichen, sondern mich sofort besuchen kommen.«
Der Maresciallo ging müde hinter der kleinen Gestalt {28}her, den Korridor entlang zur Küche, zog dort ein Taschentuch heraus, mit dem er sich über die Stirn fuhr, und setzte sich wieder auf den harten Stuhl.
Sein Blick fiel auf die in großen Ziffern geschriebenen Nummern neben dem Telefon; zwischen seinem Namen und dem des Gemüsehändlers entdeckte er die Nummer 113, den Notruf. Er fragte sich, ob sie jemals bei der Polizei angerufen hatte statt bei den Carabinieri. Vielleicht abwechselnd …
Er zog Notizbuch und Kugelschreiber heraus.
»Sie haben nachts jemanden gehört. Wann war das?«
»Gestern natürlich! Ich würde kaum eine Woche warten, bis ich Sie rufe!«
»Gestern. Um wie viel Uhr?«
»Zuerst um kurz nach halb acht.«
»Das ist aber nicht mitten in der Nacht!«
»Langsam. Jemand hat kurz nach halb acht die Wohnung betreten. Ich habe die Tür gehört. Ich lag im Bett. Ich bin immer schon um halb acht im Bett, was gibt es denn sonst zu tun – einen Fernseher habe ich nicht, das würden meine Augen nicht vertragen, und außerdem könnte ich es mir nicht leisten. Also gehe ich zu Bett, trotz des furchtbaren Lärms draußen auf der Piazza, der überhaupt verboten gehört. Jedenfalls, etwas später – ich habe noch immer gelauscht, weil ich, ehrlich gesagt, hoffte, dass er es war oder seine Stiefmutter und dass es an meiner Tür klopfen würde, und dann hörte ich, dass noch jemand anderes in die Wohnung ging …«
»Sind Sie sicher, dass nicht dieselbe Person einfach herauskam?«
{29}Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
»Die zweite Person ist reingegangen, und kurz darauf gab es Krach.«
»Sie meinen, es ging lauter zu?«
»Nein, sie haben sich gestritten. Eine Auseinandersetzung. Ziemlich heftig. Gegenstände wurden umgestoßen, vielleicht sogar auf den Boden geworfen. Dann ging eine Person wieder hinaus. Und zwar die Frau, die zuletzt gekommen war.«
»Woher wissen Sie, dass es eine Frau war?«
Abermals ein vernichtender Blick.
»Hohe Absätze, Steinstufen. Wie Sie bemerkt haben, liegt mein Schlafzimmer gleich neben der Wohnungstür.«
»Und die andere Person?«
»Ein Mann. Ich habe gehört, wie seine Stimme während des Streits immer lauter wurde. Er ist übrigens noch immer drin. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, einfach nur gelauscht. Ich habe gehört, wie er bis spät in die Nacht Radau machte, als ob er wütend war.«
»Sind Sie aufgestanden? Haben im Treppenhaus gehorcht?«
»Kann ich nicht. Mit Hilfe eines kleinen Schemels und meines Rollators komme ich ins Bett, aber aufstehen kann ich nicht. Es ist zu hoch, und ich bin schon ich weiß nicht wie oft hingefallen. Können Sie sich vorstellen, was es heißt, die ganze Nacht auf dem Fußboden zu liegen? Eines Tages wird man mich tot auffinden … Ich muss warten, bis sie kommt. Sie hat einen Schlüssel. Den ganzen Vormittag bin ich in der Nähe der Wohnungstür geblieben – ich habe ihr nichts gesagt, habe Sie dann angerufen, nachdem sie {30}gegangen war, aber ich musste zweimal anrufen, bevor man überhaupt reagierte, vergessen Sie das nicht! So! Und was, wenn es Wohnungsbesetzer sind … junge Leute …, es ist ja möbliert, wissen Sie. Und wenn die dort reinkommen, dann kommen die auch hier rein, und das werde ich nicht erlauben. Ich werde nicht einen Monat woanders wohnen und zulassen, dass irgendwelche hergelaufenen Leute sich die paar Habseligkeiten, die ich noch besitze, unter den Nagel reißen … Und mein Begräbnisgeld …«
Sie holte ihr Taschentüchlein heraus.
»Beruhigen Sie sich, Signora, beruhigen Sie sich! An die naheliegendste Lösung haben Sie offenbar nicht gedacht – dass die Wohnung möglicherweise vermietet wurde.«
»Ohne dass man davon erfährt? Und überhaupt, er benutzt sie ja. In der Regel zwar nur ein paarmal im Jahr, aber er versäumt es nicht, mich zu besuchen. Und falls er beschlossen hätte, die Wohnung zu vermieten, dann hätte er mir Bescheid gesagt, wo er doch weiß, wie heikel ich in puncto Nachbarn bin …«
»Na schön, na schön. Wenn Sie sagen, dass derjenige noch drin ist, dann werde ich in dem Fall mal rübergehen und nachschauen.«
Sie trottete ihm bis zur Tür hinterher. Auf dem Klingelschild nebenan war der Name T. Goossens eingraviert.
»Sehen Sie«, rief Signora Giusti hinter ihm, »Holländer. Seine erste Frau war Italienerin. Er ist inzwischen tot. Es ist der Sohn, der immer wieder vorbeikommt. Ton heißt er, aber ich habe immer Toni zu ihm gesagt.«
Der Maresciallo drückte auf die Klingel.
Sie warteten eine Weile, doch es passierte nichts.
{31}»Ob ein Wohnungsbesetzer aufmachen würde?«, flüsterte Signora Giusti an seiner Seite.
»Ich bin nicht sicher«, sagte der Maresciallo. »Vielleicht nicht, wenn er mich hat kommen sehen. Ich persönlich glaube allerdings nicht, dass sich dort drinnen ein Wohnungsbesetzer versteckt.«
Er klingelte wieder und spähte dann durch das Schlüsselloch, doch man konnte unmöglich etwas sehen. Im Flur war es fast ebenso dunkel wie bei Signora Giusti.
»Das andere«, rief sie ungeduldig. »Das alte Schlüsselloch weiter unten. Eigentlich müssten Sie die ganze Wohnung sehen können.«
Das alte Schlüsselloch war mehrere Zentimeter groß. Er bückte sich und spähte hindurch. Er hockte sich auf die Fersen und guckte wieder. Der Korridor war, wie bei Signora Giusti, lang, schmal und düster. In dieser Wohnung gingen die Zimmer rechts vom Flur ab.
»Können Sie was erkennen?«
»Nein.« Er richtete sich wieder auf. »Dürfte ich mal Ihr Telefon benutzen?«
»Sie glauben mir also?«
»Ich glaube Ihnen.«
»Obwohl Sie nichts sehen können?«
»Ich habe aber etwas gehört. Können Sie sich vorstellen, dass der Besitzer verreist ist, ohne das Wasser abzudrehen?«
»Du meine Güte, nein! Er hat den Haupthahn zugedreht. Die anderen Leitungen auch.«
»Hm. Irgendwo läuft aber Wasser. Ich muss Ihr Telefon benutzen. Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich dort nicht einfach rein.«
{32}»Nein, aber ich. Allein wäre ich dort nicht reingegangen.«
Sie ging ein paar Schritte zurück und griff nach einem Schlüsselbund, der hinter ihrer Tür an einem Haken hing.
»Er hat mir einen Schlüsselbund dagelassen. Verstehen Sie jetzt? Er war wie ein Sohn zu mir. Ein, zwei Mal, als er zurückkam – er ist Juwelier, immer geschäftlich unterwegs –, hat er auch seine Frau mitgebracht. Sie kauft hier gern Kleider ein, wissen Sie, sie sind wohlhabend. Vorher hat er mich dann angerufen, und ich bin rübergegangen und habe die Fenster aufgemacht, ein wenig gelüftet. Sehr viel mehr schaffe ich heutzutage nicht. Meistens kommt er aber allein, und dann legt er keinen Wert darauf. Wenn er mir seine Schlüssel anvertraut, dann deswegen, damit ich ein wenig aufpassen kann. Und ohne Sie gehe ich dort nicht rein.«
Sie gab ihm die Schlüssel, und nach kurzem Zögern öffnete der Maresciallo die Tür, ohne sie zu berühren.
»Warten Sie hier! Nein, gehen Sie lieber in Ihre Wohnung zurück.«
Er wusste, dass sie wieder herauskommen würde, sobald er ihr den Rücken zugekehrt hatte.
Während er auf das Plätschergeräusch zuging, zog er seine Beretta. Er hatte nicht das Gefühl, dass sich ein lebendes Wesen in der Wohnung aufhielt, sondern nur, dass irgendetwas nicht stimmte. Im Badezimmer lief Wasser in das Waschbecken, es stand bis zum Überlauf, offensichtlich war der Abfluss mit Erbrochenem verstopft, von dem etwas auf der Wasseroberfläche herumschwamm. Der Inhalt des Badezimmerschränkchens lag auf dem Boden {33}verstreut, in der Badewanne und auf den grauen Fußbodenkacheln waren Glasscherben und Blutspritzer zu sehen. Der Maresciallo suchte ein Handtuch, nahm dann, als er keins fand, sein Taschentuch und drehte den Wasserhahn mit einem Finger zu.
Die Küchentür am hinteren Ende des Flurs stand offen, und er konnte selbst auf diese Entfernung sehen, dass auch dort ein großes Durcheinander war. Während er den marmorgefliesten Flur hinunterging, stieg ihm der Geruch von frischem Kaffee in die Nase. Vermutlich hatte jemand etwas verschüttet.