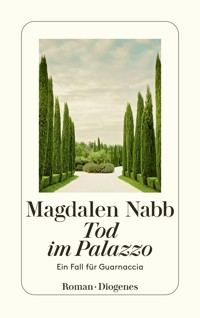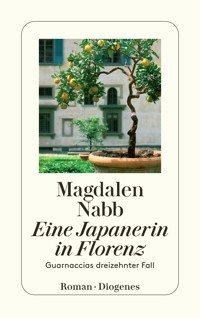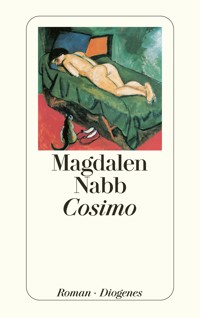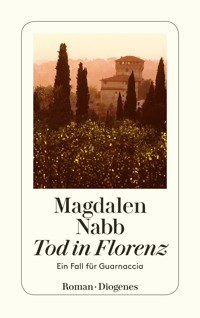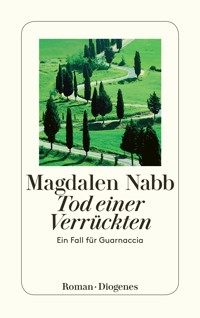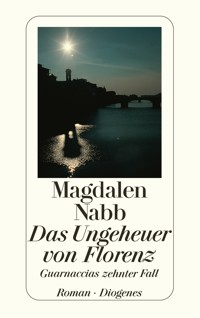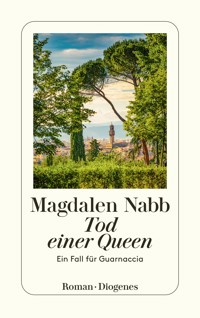
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maresciallo Guarnaccia
- Sprache: Deutsch
Der Parco delle Cascine am rechten Arnoufer war früher das Landgut der Medici. Heute verkehrt dort bei Nacht die Szene. Als eine Dragqueen ermordet aufgefunden wird, wollen alle an einen Schuldigen aus dem Milieu glauben. Doch Maresciallo Guarnaccia versucht nach Kräften – auch wenn die Welt des Todesopfers ihm fremd ist und er Schwierigkeiten hat, sie zu entschlüsseln –, jemanden, von dessen Unschuld er überzeugt ist, vor dem Gefängnis zu bewahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Magdalen Nabb
Tod einer Queen
Ein Fall für Guarnaccia
Roman
Aus dem Englischen von Matthias Fienbork
Diogenes
1
Die Herbstwoche, in der das neue Schuljahr beginnt, ist genauso schlimm wie Weihnachten. Jedenfalls war das die Meinung von Maresciallo Guarnaccia. Im größten Kaufhaus von Florenz war, wie immer, eine ganze Etage freigeräumt worden, und nun lagen dort Stapel von schwarzen, weißen, blauen und karierten Schulkitteln, und die Regale waren vollgepackt mit Schreibheften, Stiften, Schultaschen und anderen Dingen. Überall genervte Eltern und quengelnde Kinder, die von Stand zu Stand drängten und nach den knallbunten Packungen mit Filzstiften und Mickymaus-Radiergummis griffen. Mütter konsultierten ihre Einkaufslisten, um festzustellen, welches Kind dreizeilig linierte Hefte benötigte und welches doppelt linierte. Väter protestierten gelegentlich wegen der unnötig hohen Ausgaben, hatten aber wenig Hoffnung, beachtet zu werden. Es war heiß im Kaufhaus, und es herrschte ein ohrenbetäubender Lärm.
Der Maresciallo hatte bislang noch nicht protestiert. Genau eine Stunde und zehn Minuten trottete er seiner Frau und den beiden Jungen jetzt schon hinterher. Gerade erst hatte er auf seine Uhr gesehen. Um diese nachmittägliche Stunde lag er gewöhnlich mit der Zeitung auf dem Wohnzimmersofa und döste, während der Espresso auf dem kleinen Tisch daneben langsam kalt wurde. Dass er darauf verzichten musste, war für ihn ebenso wenig Grund zur Klage gewesen, doch inzwischen fragte er sich, ob er es rechtzeitig zur Carabinieri-Wache Palazzo Pitti schaffen und um fünf wieder an seinem Schreibtisch sitzen würde. Eine gute Viertelstunde standen sie schon in einer langen Schlange vor der Kasse, als sich plötzlich zeigte, dass sie irgendetwas vergessen hatten, woraufhin die drei wieder loszogen. Totò brüllte: »Hier! Sie sind hier!« Er wurde von Teresa ständig ermahnt, leiser zu sein. Wozu das gut sein sollte, war dem Maresciallo nicht klar, da alle anderen Kinder hier genauso brüllten. In dieser Menschenmenge konnte man nicht nachdenken, geschweige denn sich bewegen.
Sie waren wieder verschwunden. Er gab es auf, ihnen zu folgen, und blieb einfach stehen. Mit seiner Leibesfülle und in der schwarzen Uniform sah er aus wie ein gestrandeter Wal an einem belebten Strand. Ein leises »Uffa!« entrang sich ihm, während er nach einem Taschentuch suchte, um sich die Stirn abzuwischen. Ein Kind stolperte über seine großen schwarzen Schuhe, und eine Frau stieß ihn an: »Stehen Sie hier an oder nicht?«
Ohne ihr eine Antwort zu geben, löste er sich aus der Menschentraube vor der Kasse. Nirgends konnte er sich hinstellen, ohne irgendjemand im Weg zu stehen. Na ja, egal. Soweit er sich erinnerte, hatte er in die Schule höchstens einen Bogen liniertes Papier für den wöchentlichen Aufsatz mitgenommen. Bleistifte lagen in der Küchentischschublade oder wurden geborgt.
»Aber Mamma! Er ist viel zu lang!« Ein kleiner Junge hinter dem Maresciallo protestierte, als seine Mutter ihm einen schwarzen Kittel anhielt.
»Ich werde ihn kürzen. Im nächsten Jahr soll er ja auch noch passen. Halt endlich still!«
Dem Maresciallo fiel auf, dass kaum noch ein Kind mit der Satinschleife um den Hals herumlief, wie sie seinerzeit üblich gewesen war. Seine Mutter hatte immer viel Tamtam darum gemacht, hatte stundenlang, wie ihm schien, an ihr herumgezupft, bis sie richtig saß, während er sich wehrte und hinauswollte auf die staubige gelbe Straße, um unterwegs noch etwas Zeit für einen kleinen Streich zu haben. Die Mutter pflegte außerdem sein widerspenstiges schwarzes Haar mit Wasser zu frisieren – auch so etwas, was er nicht hatte leiden können. Und wenn er dann wie ein freigelassenes wildes Tier aus der Küche schoss, rief sie ihm hinterher: »Und spiel unterwegs nicht, sonst machst du dich schmutzig! Denk dran!« Immer hatte er unterwegs gespielt, und immer hatte er sich schmutzig gemacht, und seine Mutter hatte es gewusst, ihn aber trotzdem immer wieder ermahnt. Jetzt war es Teresa, seine Frau, die Tag für Tag zu Totò sagte: »Sei nicht so laut!«, obwohl sie wusste, dass er nicht anders als mit lauter Stimme sprechen konnte.
»Ich habe Nein gesagt!« Eine verzweifelte Frauenstimme riss ihn aus seinen Gedanken. Neben ihm stand ein kleines Mädchen schluchzend vor den Plastikranzen.
»Wir können’s uns nicht leisten – deine ganzen Schulbücher müssen wir auch noch kaufen!«
Die Stimme der Mutter hatte keinerlei Wirkung auf das schluchzende Kind. Die Kleine hielt sich mit aller Kraft an dem Regal fest, wollte nicht weggezogen werden. Ein etwas größeres Mädchen von etwa acht oder neun Jahren, das einen hellroten Plastikranzen an sich drückte, stand da und sah zu – ein bemerkenswert hübsches Kind mit langen blonden Haaren und braunen Augen. Der Maresciallo war fasziniert von ihrem Gesichtsausdruck, der zwischen Mitleid für die Lage des anderen Mädchens und Selbstzufriedenheit schwankte. Je mehr das kleinere Kind weinte, desto stärker presste sie mit strahlendem Blick den Ranzen an sich.
Der Maresciallo wandte sich ab. Seine großen, ein wenig hervorstehenden Augen schauten zwar immer noch ausdruckslos, doch die Stimmung des blonden Mädchens hatte er sehr wohl registriert. Er empfand einen ähnlichen Zwiespalt: Einerseits bedrückte ihn, wie viele Probleme minderbemittelten Familien durch all diese unnötigen Geldausgaben entstehen mussten, andererseits spürte er Selbstzufriedenheit und Erleichterung bei dem Gedanken, dass er es sich leisten konnte. Zumindest … Er zog seine Brieftasche heraus und schaute hinein, obwohl er keine Ahnung hatte, wie viel seine Frau inzwischen gekauft haben mochte. Es war ja richtig, was diese Frau eben gesagt hatte, dass noch Schulbücher gekauft werden mussten. Er hoffte, dass er auf diese Expedition nicht auch noch mitgeschleppt würde. Die Schlange draußen vor der Buchhandlung reichte die ganze Straße hinunter, und selbst wenn man bis an die Spitze vorgerückt war und seine Liste abgab, musste man noch lange warten.
Halb fünf. Er würde sich verspäten. Noch immer machte er keine Anstalten, seine Frau und die Kinder zu suchen. Sie würden ihn leichter sehen, wenn er sich nicht von der Stelle rührte. Er blieb noch eine Viertelstunde stehen, und dann fanden sie ihn, genauer gesagt, Totò war es, der brüllend auf ihn zugestürzt kam: »Mamma ist dran. Sie sagt, du sollst um Gottes willen kommen, sie hat nämlich kaum Geld dabei!«
»Ich werde mich verspäten«, sagte er, nachdem er bezahlt hatte.
»Hier, trag das … und das. Moment mal, hat sie mir richtig rausgegeben?«
»Es ist Viertel vor fünf.«
»Nein, nein, alles in Ordnung. Maul jetzt nicht rum, Salva, wir sind praktisch fertig.«
»Praktisch?«
»Ich will nur im unteren Stockwerk schnell noch was besorgen. Die Jungs brauchen Socken. Du übrigens auch. Totò! Brüll nicht so! Hier wird nichts mehr gekauft, und damit basta! Nimm Giovanni auf der Treppe an die Hand, und falls wir uns verlieren, gehst du direkt zur Abteilung Kindersocken. Hast du verstanden? Salva, wo bist du? Salva!«
Er stapfte hinter ihnen die Treppe hinunter, während seine großen Augen über die Köpfe der Menge weiter unten wanderten. Er entdeckte die langen blonden Haare des hübschen kleinen Mädchens, das still und geduldig dastand, während irgendetwas für sie gekauft wurde. Eine ebenso blonde, sehr hektische junge Frau, wahrscheinlich ihre Mutter, und eine gut gekleidete ältere Frau, die das Kommando zu führen schien, begleiteten sie. Er erinnerte sich an das andere kleine Mädchen, das traurig gewesen war, weil es keinen Ranzen bekam.
»Findest du nicht, dass wir genug eingekauft haben?«, murmelte er, als sie am Fuß der Treppe ankamen, aber seine Frau hörte ihn nicht.
Er hatte sich verspätet. Im Warteraum saß eine Frau, die sich halb erhob, als sie ihn sah, doch er nickte ihr bloß zu und ging weiter in sein Zimmer, wobei er im Vorbeigehen an die Tür der Wachstube klopfte. Mit etwas Glück würde Lorenzini, der junge Brigadiere, ihm eine Tasse Kaffee bringen. Er brauchte ein, zwei Minuten, um wieder zu Atem zu kommen. Seufzend setzte er sich an seinen Schreibtisch, sein Kopf dröhnte noch immer vom Lärm des Kaufhauses. Lorenzini klopfte und steckte den Kopf ins Zimmer.
»Immer hereinspaziert!« Und dann: »Wie hast du das erraten?«
Lorenzini hatte nämlich eine Tasse Kaffee in der Hand.
»Ich wusste, dass Sie einkaufen waren, und Sie sind spät dran, deshalb … Sie sehen nicht so aus, als hätte es Ihnen viel Spaß gemacht.«
»Spaß gemacht? Hör zu …«
Lorenzini hörte zu. Das war etwas, worauf er sich verstand. Der Maresciallo schlürfte von dem brühheißen, starken Kaffee und brummte vor sich hin.
»Und das Schlimmste ist«, meinte er schließlich, »kaum hat man die Ausgaben für die Schulsachen hinter sich, wird die Weihnachtsdekoration aufgebaut, und wieder heißt es: kaufen, kaufen, kaufen. Dein Kind ist noch ein Baby, aber du wirst bald wissen, wovon ich rede.«
Ihm war klar, dass er übertrieb, aber er konnte nicht anders. Er konnte Lorenzini auch nicht sagen, dass er sich in Wahrheit ein wenig schuldig fühlte, und zwar nur wegen eines kleinen Mädchens, das keinen Ranzen hatte, und eines hübscheren, das einen besaß.
»Das meiste taugt sowieso nichts. Sie brauchen gar nicht alles, aber wenn einer etwas hat, müssen alle anderen es auch haben, und das nutzen die Geschäfte aus … Wer ist die Frau im Wartezimmer?«
»Eine Signora Fossi.«
»Und was will sie?«
»Mit Ihnen sprechen. Hat nicht gesagt, worum es geht, nur, dass sie Ihren Rat will.«
»Na gut. Führ sie herein.«
Als die Frau das Zimmer betrat, erhob er sich und bot ihr einen Stuhl an. Sie nahm Platz, und während er hinter seinen Schreibtisch zurückging, ahnte er schon, dass er es hier nicht mit der üblichen Geschichte einer Mutter zu tun hatte, die voller Panik vermutete, dass ihr Jüngster drogensüchtig sei. Zum einen war sie dafür zu alt. So wie sie aussah, war sie bestimmt über sechzig. Zum anderen sah sie eher entschlossen als bekümmert aus. Er hoffte, dass es nicht eine dieser Streitereien unter Nachbarn war, mit denen er sich höchst ungern abgab. Sie war ganz der Typ dafür. Sie kam ihm bekannt vor, aber er konnte sie nicht einordnen.
»Also, Signora, was kann ich für Sie tun?«
»Ich komme wegen meines Sohnes.«
»Aha. Hat er irgendwelche Schwierigkeiten?« Ihr Sohn müsste mindestens vierzig sein.
»Vielleicht finden Sie es merkwürdig«, sagte sie, als könnte sie seine Gedanken lesen, »immerhin ist mein Sohn über vierzig, genauer gesagt fünfundvierzig – dass ich hier sitze und nicht meine Schwiegertochter. Aber … Wir sind uns immer sehr nahe gewesen, Carlo und ich, und ich weiß einfach, wenn irgendetwas nicht stimmt.«
O Gott, dachte der Maresciallo, sagte aber nur: »Was genau stimmt denn nicht?«
»Er ist weggegangen.«
»Weggegangen?«
»Verschwunden.«
»Verstehe. Seit wann?«
»Seit zwei Wochen … nein, länger. Es war ein Samstag, und heute ist Dienstag. Also fast zweieinhalb Wochen.«
»Sie glauben, dass er seine Frau verlassen hat?«
»Ich glaube nichts dergleichen, wenngleich …«
»Wenngleich was?«
»Ich wollte sagen, er hätte Grund … aber das ist was ganz anderes. Er würde sie nicht verlassen, nicht ohne mir vorher Bescheid zu sagen.«
Der Maresciallo unterdrückte einen Seufzer.
»Wohnen Sie bei Ihrem Sohn und Ihrer Schwiegertochter, Signora?«
»Ja und nein. Wir haben eine kleine Fabrik. Mein Mann hat mit dem Betrieb angefangen, und bevor er starb, haben wir umgebaut. Das Haus gehört zum Gebäudekomplex. Es ist ein großes Haus, und ich wohne in einer separaten Wohnung, die das gesamte obere Stockwerk einnimmt. Carlo wohnt mit seiner Frau und der Kleinen im Erdgeschoss.«
»Und er arbeitet in der Fabrik?«
»Wir alle arbeiten dort, alle drei. Seit dem Tod meines Mannes leite ich den gesamten Betrieb. Meinem Sohn untersteht die Produktion, und meine Schwiegertochter ist für Buchführung und Bestellungen zuständig. Wir stellen Geschenkartikel aus Silber her.«
»Und Sie sagen, Ihr Sohn ist seit über zwei Wochen verschwunden? Das muss doch zu erheblichen Problemen geführt haben. Ich verstehe nicht, warum Sie so lange gewartet haben … Er hat nicht zufällig die Angewohnheit, in gewissen Abständen zu verschwinden?«
»Ich … ähm, es ist schon vorgekommen.« Die Frau errötete, aber ihre Augen blieben kühl und entschlossen. Der Maresciallo war froh, dass sie nicht seine Schwiegermutter war. Dieser Gedanke brachte ihn auf die Frage: »Was sagt denn Ihre Schwiegertochter dazu? Sie haben sich doch mit ihr besprochen, oder?«
»Selbstverständlich.«
»Und?«
»Er ist noch nie so lange weggewesen, nie länger als drei, vier Tage. Dieses Mal ist es anders, zumindest darin sind wir uns einig.«
»In allem anderen aber nicht, hm?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Nein, nein … Ich hatte nur den Eindruck, dass Sie über die Ehe Ihres Sohnes nicht allzu glücklich sind … Wie alt war er, als er heiratete?«
»Siebenunddreißig. Ihr Eindruck ist völlig falsch. Ich habe die Ehe nicht nur gebilligt, sondern auch arrangiert.«
»Oh.« Der Maresciallo sah sie mit ausdruckslosen Augen an. »Ich hätte nicht gedacht, dass es arrangierte Ehen noch gibt.«
»Natürlich nicht. Sagen wir so: Ich habe meinem Sohn nach Kräften zugeredet zu heiraten. Meine Schwiegertochter arbeitete schon als Designerin bei uns. Ich dachte, sie würde ihm eine gute Frau sein.«
»Haben Sie Ihre Meinung seitdem geändert?«
Sie schien genau nachzudenken, bevor sie antwortete.
»Nein«, sagte sie schließlich, »sie arbeitet fleißig und ist eine gute Hausfrau. Trotzdem sollte ihr klar sein, dass ein Mann, der erst mit Ende dreißig heiratet, in seinem Lebensstil ziemlich festgelegt ist … Und außerdem kommt sie aus Finnland. Die Menschen dort sind anders als wir.«
»Sie spielen vermutlich auf seine Drei-Tage-Touren an«, sagte der Maresciallo sanft. »Sie können kaum verlangen, dass sie damit einverstanden ist. Wo war er denn immer?«
»Ich weiß nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, meine Nase in sein Privatleben zu stecken.«
»Obwohl Sie einander doch nahestehen?«
Sie presste die Lippen aufeinander und schwieg.
»Sie müssen doch eine Ahnung haben«, sagte er, »selbst wenn Sie nicht sicher sind. Gibt es eine andere Frau?«
»Ganz bestimmt nicht. Für derlei Geschichten hat er nie etwas übriggehabt.«
»Aha. Aber er muss irgendwo schlafen, wenn er unterwegs ist. Hat er irgendwo eine Wohnung, ein Versteck?«
»Nein. Ich hab Ihnen ja gesagt, dass meine Schwiegertochter sämtliche Konten verwaltet. Nicht nur die Geschäftskonten, sondern auch die privaten. Ohne ihr Wissen könnte er solche Summen nicht ausgeben.«
»Hat er einen größeren Geldbetrag mitgenommen?«
»Nein, nichts. Außer natürlich, was in seinem Portemonnaie war. Er hat auch keine Kleider mitgenommen, außer dem, was er auf dem Leibe trug. Das allein reicht doch schon für die Vermutung, dass ihm etwas zugestoßen sein muss.«
Es war alles andere als ausreichend. Er wäre nicht der Erste, der wortlos verschwindet und nie wiederauftaucht. Die Welt ist voll von Menschen, die genau das getan haben. Doch es wäre grausam, darauf hinzuweisen. Stattdessen fragte der Maresciallo: »Haben Sie sich bei den Krankenhäusern erkundigt?«
»Nein. Ich bin direkt hierher gefahren.«
»Nach mehr als zwei Wochen.«
»Bei einem Unfall hätte man uns Bescheid gesagt.«
Der Maresciallo spannte einen Bogen liniertes Papier in seine Schreibmaschine.
»Ich brauche seinen vollständigen Namen, die Adresse und eine Personenbeschreibung. Haben Sie ein Foto von ihm?«
»Nicht dabei.«
»Dann müssen Sie mir eins vorbeibringen. Name und Adresse?«
»Fossi, Carlo Emilio, Via del Fosso 29, Badia a Settimo, Scandicci.«
»Scandicci?« Der Maresciallo zog das Blatt heraus, zerknüllte es und warf es in den Papierkorb. »Signora, Sie hätten nicht hierherkommen sollen.«
»Wie meinen Sie das? Ich habe doch erklärt …«
»Sie müssen sich an die Carabinieri-Wache in Scandicci wenden. Ich kann mich damit nicht befassen, es fällt nicht in meine Zuständigkeit. Gehen Sie mit einem Foto Ihres Sohnes zu der Wache in Ihrem Bezirk, die Kollegen werden eine Suchmeldung veröffentlichen.«
»Und was ist, wenn mein Sohn Scandicci verlassen hat? Welchen Sinn hat es, die Meldung nur dort herauszubringen?«
»Nein, nein, Signora. Die Carabinieri in Scandicci werden die Information an die Quästur hier in Florenz übermitteln, die wird sie in den Computer einspeisen und an das Innenministerium weiterleiten. Die Suchmeldung wird im ganzen Land ausgehängt.«
»Wenn das so ist, dann verstehe ich nicht, warum Sie das nicht veranlassen können, wo ich schon mal hier bin.«
»Tut mir leid, Signora, aber das geht nicht. Ich weiß nicht, warum Sie überhaupt hierhergekommen sind, es gibt doch ganz in Ihrer Nähe eine Carabinieri-Wache.«
»Ich bin gekommen«, erwiderte sie schnippisch, »weil eine Freundin Sie empfohlen hat.«
»Mich empfohlen?« Als ob er ein Restaurant wäre!
»Eine ganz spezielle Freundin hier in Florenz. Sie wohnt in der Via San Leonardo, Sie haben mal einen Streit zwischen ihr und ihren Nachbarn wegen der Grundstücksgrenze geschlichtet. Da ich mit meiner Enkelin und meiner Schwiegertochter gerade in der Stadt war – wir haben Schulsachen für die Kleine besorgt –, habe ich die Gelegenheit genutzt, um noch eine Tasse Tee bei ihr zu trinken. Sie schlug vor, mich bei Ihnen zu melden. Sie sagte, Sie seien ein vernünftiger Mann …«
Der Satz blieb unvollendet, aber es war klar, was sie meinte. Der Maresciallo hatte sie inzwischen auch erkannt. Im Kaufhaus … die blonde Mutter und das Kind und die Großmutter, die alles organisierte. Das kleine Mädchen war doch nicht so glücklich, wie er sich vorgestellt hatte.
Zwei Stunden später, als die Frau schon längst gegangen war und er den Dienstplan für Mittwoch schrieb, brummte er noch immer vor sich hin. »›Eine ganz spezielle Freundin‹! Was für ein Mensch!«
Der schöne Herbsttag war zu Ende, und überall gingen die Lichter an. Von irgendwoher zog ein wunderbarer Essensgeruch heran. Guarnaccia hielt inne, um zu schnuppern. Er merkte, dass er hungrig war. Das Mittagessen war wegen der Einkaufsexpedition eine hastige Angelegenheit gewesen. Der Geruch kam nicht aus seiner Wohnung, sonst hätte er eines der Gerichte seiner Frau erkannt. Es musste Bruno sein, der oben in der Kantine für die jungen Kollegen kochte. Eigentlich sollten sie sich mit Kochen und Einkaufen abwechseln, wie mit allen anderen Pflichten auch, aber Bruno war ein guter Koch, und er weigerte sich, die Pampe zu essen, die von den anderen aufgetischt wurde. Der Maresciallo mochte sich nicht mehr einmischen. Der Junge würde ohnehin bald gehen, sobald es in der Offiziersschule einen Platz für ihn gab, und das war auch gut so. Mit Bruno, dessen Art ihn ganz hilflos machte, wurde er einfach nicht fertig. Teresa sagte immer: »Das liegt daran, dass er so klug ist …« Noch so ein unvollendeter Satz. Na ja, er selbst hatte nie behauptet, viel Grips zu haben, wenngleich er sich zumindest für einen vernünftigen Menschen hielt. Diese furchtbare Frau …
Ein gellender Schrei vom Wartezimmer her fuhr in seine Träume.
»Also …«
Er öffnete die Tür. Die Schreie stammten von einem etwa fünfjährigen Mädchen, das wütend auf einem Haufen Kleidungsstücken herumtrampelte, vermutlich ihren eigenen, und dessen Gesicht vor Anstrengung rot angelaufen war. Di Nuccio, einer der beiden Beamten, die die Kleine vermutlich mit dem Streifenwagen hergebracht hatten, versuchte sie zu beruhigen. Ein kleiner Schuh versetzte ihm einen kräftigen und gezielten Tritt gegen das Schienbein.
»Autsch!«, rief Di Nuccio.
»Beißen tut sie auch«, meinte der andere Carabiniere, der in sicherer Entfernung stand und sich die Hand rieb.
»Ihr interessiert mich nicht«, brüllte das Mädchen. »Ich will bei meiner Mamma sein, nicht bei euch. Verzieht euch, los, verzieht euch!« Wieder wollte sie einen Tritt austeilen, doch diesmal wich Di Nuccio ihr aus. Die Kleine wurde böse, riss sich den Schuh vom Fuß und schleuderte ihn quer durch das Zimmer. Er traf den Maresciallo, und erst jetzt bemerkte sie ihn. Vielleicht lag es an seiner Leibesfülle oder, wahrscheinlicher noch, an seinen großen Glubschaugen, die auf sie gerichtet waren – jedenfalls hörte sie auf zu schreien und blieb ruhig stehen. Dann marschierte sie auf ihn zu und griff nach seinem Hosenbein.
»Bist du sein Papà?«, fragte sie und zeigte vorwurfsvoll auf Di Nuccio.
»Wir haben sie aufgegriffen, als sie versuchte, ganz allein über die Straße zu gehen«, sagte Di Nuccio. »Wir haben aus ihr nur herausbekommen, dass sie im Palazzo Pitti zurückgelassen wurde. Vermutlich haben ihre Eltern sie im Gedränge aus den Augen verloren und suchen dort noch immer nach ihr.«
»Ich sag’s deinem Papà«, rief das Kind und drohte mit dem Finger.
»Ich habe dem Pförtner gesagt, dass wir sie hierherbringen, vermutlich wird also bald jemand kommen und nach ihr fragen. Sie muss versucht haben, nach Hause zu gehen, weil sie dachte, dass ihre Eltern sie vergessen haben, aber sie weiß ihre Adresse nicht.«
»Verschwindet!«
»Wir gehen besser wieder nach draußen …«
»Ich komme nicht mit, ihr seid blöd!«
»Wie dankbar die Menschen doch sind«, murmelte Di Nuccio, während er und sein Kollege hinausgingen, um ihren Streifendienst fortzusetzen.
»Ich bleibe bei dir, ja?«, sagte das kleine Mädchen selbstgefällig, zufrieden darüber, dass es einen kleinen Sieg errungen hatte.
»Nur wenn du deine Sachen anziehst.«
Mit einem Blick, der seine Autorität taxieren sollte, sah sie zu ihm hoch und beschloss dann, die Kleidungsstücke und ihren Schuh einzusammeln. Stumm reichte sie sie ihm.
»Zieh es an«, sagte der Maresciallo.
»Ich kann nicht.« Sie schien überrascht, dass er nicht verstand. »Ich habe nur gelernt, mich auszuziehen. Ankleiden musst du mich!«
Sie stieg auf einen Stuhl und streckte ihm einen Fuß entgegen.
»Hat deine Mutter dir nie gesagt«, fragte er, während er die Schnalle öffnete, sodass die Kleine einen Fuß hineinschieben konnte, »dass du deine Schuhe kaputtmachst, wenn du sie ausziehst, ohne die Schnalle aufzumachen?«
»Doch.« Sie stand kerzengerade auf der Sitzfläche und streckte die Arme in die Höhe, um sich den Kittel überziehen zu lassen. Die Bemühungen des Maresciallos waren zaghaft und unsicher, aber mithilfe der Anweisungen, die gedämpft aus dem Inneren des Oberteils drangen, gelang es ihm zumindest, den Kittel nicht zu zerreißen.
»Du hast es falsch herum angezogen«, bemerkte das Kind, das an sich heruntersah, »aber es macht nichts.«
»Bring deinen Mantel«, sagte der Maresciallo.
»Wohin gehen wir?«
Sie trottete neben ihm her, seiner Wohnung entgegen.
»Teresa kann sich um den Kittel kümmern.«
»Ist Teresa deine kleine Tochter?«
Teresa stand in der Küche und traf die letzten Vorbereitungen für das Abendessen. Die Jungen saßen mit all ihren neuen Büchern und Buntstiften am Küchentisch.
»Räumt das Zeug beiseite«, rief Teresa. »Ich bin gleich fertig. Salva, für dich gibt es außer dem Fleisch noch Pasta, du hast ja kaum was zu Mittag gegessen. Die Jungs wollen nichts davon haben – wer ist das denn?«
»Sie hat sich verlaufen«, sagte der Maresciallo, »wahrscheinlich im Museum. Jemand wird sie wohl bald abholen.«
»Du bist aber ein hübsches Mädchen!« Teresa beugte sich hinunter und strich über das honigfarbene Haar. »Wie heißt du denn?«
»Cristina.«
»Also, Cristina, komm her und setz dich an den Tisch, gleich wird es etwas Gutes zu essen geben!«
»Ich zieh mich rasch um«, sagte der Maresciallo.
Eingeschüchtert durch die Anwesenheit der beiden Jungen, die so viel größer waren und sie nicht zur Kenntnis nahmen, saß Cristina reglos da und sah zu, wie sie ihre Sachen einsammelten. Erst nachdem sie alles in ihre Zimmer gebracht hatten, rang Cristina sich zu der Frage durch: »Wo schlafe ich?«
»Schlafen? Du liebes bisschen«, sagte Teresa, »deine Mamma wird dich abholen, bevor es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Aber du wirst etwas essen, ja? Wir essen jetzt nämlich.«
»Die großen Jungen auch?«
»Die großen Jungen auch.«
Nach einer Weile runzelte sie die Stirn und fragte: »Wo ist er denn hin?«
»Wo ist wer hin, Schätzchen?«
»Der Mann …« Unruhig ballte sie die Fäuste. »Der Fettklops, der ganz schwarz angezogen ist.«
»Du bist ein komisches kleines Ding«, sagte Teresa und strich ihr über den Kopf. »Hier, das ist sein Teller, direkt neben deinem, dann kann er neben dir sitzen. In Ordnung?«
»Ja.«
Das Kind blieb die ganze Mahlzeit über stumm sitzen und beobachtete gespannt die beiden Jungen. Erst als sie fertig waren und Teresa ihr einen roten Apfelschnitz anbot, sagte sie: »Mir gefällt’s hier. Ich möchte nicht nach Hause, nur … Ich will zu meiner Mutter! Was soll ich tun?« Dann traten Tränen in ihre Augen.
Es klingelte an der Wohnungstür.
»Wurde auch Zeit«, sagte Teresa, »ich glaube, sie hat genug gehabt.«
Die gequält blickende Frau, die von Lorenzini hereingeführt wurde, hatte zwei andere Kinder im Schlepptau. Sie war zornig und erleichtert zugleich.
»Sie macht mich noch wahnsinnig«, sagte sie, nachdem sie den beiden Erwachsenen ausgiebig gedankt hatte. »Es ist immer dasselbe, wenn wir irgendwo hingehen. In der einen Minute ist sie noch da, und in der nächsten sehe ich mich um, und sie ist verschwunden. Kaum hat sie keine Lust mehr, macht sie sich allein auf den Heimweg. Wir haben alle Straßen in unserem Viertel abgesucht, bevor wir auf die Idee kamen, hierher zurückzukehren. Cristina, bedank dich bei diesen netten Leuten, dass sie sich um dich gekümmert haben, dann machen wir uns auf den Heimweg und lassen sie in Ruhe.«
»Ich hab aber meinen Apfel noch nicht gegessen«, sagte Cristina, zog den Mantel aus, den ihre Mutter gerade zugeknöpft hatte, und kletterte wieder auf ihren Stuhl.
Eine halbe Stunde später lag der Maresciallo auf dem Sofa im Wohnzimmer, eine kleine Lampe brannte, und der Fernseher lief. Er hörte die Jungen, die sich in ihrem Zimmer über irgendetwas stritten, und Teresa, die in der Küche hin und her lief und aufräumte. Wie üblich sah er sich den Film an, ohne die Handlung aufmerksam zu verfolgen, obwohl er wusste, dass Teresa, wenn sie hereinkam und sich neben ihn setzte, ihn bitten würde, ihr die Geschichte zu erzählen, und sich ärgern würde, weil es ihm nicht gelang. Das Telefon klingelte. Langsam stand er auf, den Blick noch immer auf den Bildschirm gerichtet. Teresa war vor ihm in der Diele draußen. Einen Moment lang blieb er stehen. Er hörte die Überraschung in ihrer Stimme, doch dann sagte sie: »Wie geht es Ihnen … und den Kindern?« Froh darüber, dass es nicht für ihn war, setzte er sich wieder.
Es war einer dieser rasanten amerikanischen Kriminalfilme, in denen ein merkwürdiges Italienisch gesprochen wurde, und der junge Polizist schien nichts anderes zu tun, als seine Vorgesetzten anzubrüllen oder mit der weiblichen Verdächtigen ins Bett zu gehen. Hin und wieder fand Guarnaccia den Film so spannend, dass er einen Grunzer der Verwunderung ausstieß, doch dann verlor er abermals den Faden. Was mochte das nur sein, was sie da im Auto aus Pappkartons aßen? In diesen Filmen schien das ganz normal zu sein, aber nie wurde gesagt, worum es sich handelte. Der Dampf, der in den Straßen aufstieg, kam von der Untergrundbahn, so viel wusste er. Einer der jungen Kollegen hatte ihm das erzählt. Eine U-Bahn könnte man auch in Florenz gut gebrauchen, aber er bezweifelte, ob der Bau überhaupt möglich war. In dem Moment, wo die Erdarbeiten anfingen, würden die Archäologen losschimpfen, und man würde jahrelang warten müssen, genau wie auf der Piazza della Signoria … Wie lange ging das nun schon? Wieder eine Leiche. Insgesamt vier schon, wenn nicht fünf. Fünf … Wer ist eigentlich der Typ mit dem Bart? Vielleicht der Mann, der zu Beginn des Films aus einem Hotel kam. Teresa wird es wissen wollen …
Aber Teresa telefonierte noch immer, auch wenn sie nicht viel sprach.
»Mmhh. Ja, ich … Nein, nein, überhaupt nicht. War ganz recht so. Mmhh … Mmmm … ja, machen Sie sich keine Sorgen.«
Als sie schließlich hereinkam und sich hinsetzte, fragte sie ihn nichts über den Film. Sie tat so, als verfolge sie die Handlung, aber er spürte ihre Unruhe, und wenn sie nicht einmal wissen wollte, um was es ging …
»Was ist los?«
»Nichts.«
Er wartete eine Weile. Als sie noch immer keine Fragen zum Film stellte, stand er auf, drehte den Ton leiser und setzte sich wieder hin.
»Also?«
»Nichts, es kann warten, bis der Film zu Ende ist …«
»Wer hat angerufen?«
»Eine Frau aus Syrakus, Maria Luciano.«
»Luciano …?« Er ging in Gedanken alle Freunde in der sizilianischen Heimat durch, aber der Name sagte ihm nichts.
»Die Arme, hat so viel Ärger gehabt, und dann noch die Kinder …«
»Diese Luciano, diese schreckliche Familie!«
»Es ist leicht, sie zu verurteilen, aber bei dem Leben …«
»Was ist los, sitzt er wieder?«
»Ich glaube nicht, sie hat nichts davon gesagt. Es ist ihr ältester Sohn, um den sie sich Sorgen macht.«
»Überrascht mich nicht. Er hat die Straßen unsicher gemacht, da war er noch nicht mal zehn.«
»Trotzdem, so schlecht ist er nicht. Er hat die jüngeren Geschwister praktisch allein aufgezogen.«
»Kein Wunder, bei so einer Mutter.«
»Sie musste doch leben. Ein Mann, der ständig sitzt, und all die Münder, die gestopft werden mussten.«
»Wenn sie sich Arbeit gesucht hätte, anstatt ihren Lebensunterhalt auf die leichte Art zu verdienen, dann brauchte sie jetzt nicht so viele Münder zu stopfen.«
»Wir haben leicht reden, Salva, aber sie hat doch nie eine Chance gehabt. Sie hat nicht einmal ihre eigene Mutter gekannt, und sie ist in einem Heim groß geworden.«
»Du scheinst ja eine Menge über sie zu wissen.«
Teresa sah ein wenig verlegen aus, wie immer, wenn sie jemandem heimlich geholfen hatte.
»Ich habe ihr öfter mal Kleidungsstücke von unseren Jungen geschenkt.«
»Hmm. Also, was wollte sie denn?«
»Ich hab doch schon gesagt, sie macht sich Sorgen wegen Enrico, das ist ihr Ältester. Anscheinend ist er hier in Florenz. Er muss etwa neunzehn sein. Sie sagt, dass er vor fast zwei Jahren heraufgekommen ist und einen Job in einer Bar gefunden hat.«
»Na, war bestimmt ganz gut, dass er weggegangen ist.«
»Er hat ihr Geld geschickt, nicht regelmäßig, aber immer mal zwischendurch, doch seit Weihnachten hat sie ihn nicht mehr gesehen.«
»Und was hat das alles mit mir zu tun?«
»Sie dachte, du könntest vielleicht …«
»Wenn sie wissen will, ob er sitzt, dann kann ich das herausfinden, aber wenn sie eine Vermisstenanzeige aufgeben will, dann muss sie es da unten machen.«
»Das habe ich ihr auch gesagt.«
»Ach?«
»Die Sache ist die: Als er Weihnachten das letzte Mal zu Hause war, trug er einen Gipsverband. Offenbar hatte er sich bei einem Verkehrsunfall drei Rippen gebrochen. Seitdem hat sie ihn nicht mehr gesehen. Er hat ein-, zweimal geschrieben und etwas Geld überwiesen, aber sie hat ihn zu den Sommerferien erwartet, und er ist nicht aufgetaucht. Was also, wenn er krank ist? Vielleicht braucht er Hilfe.«
»Sie hat ihm nie groß geholfen, als er noch zu Hause wohnte. Es ist wohl eher so, dass sie sein Geld braucht, und jetzt kriegt sie nichts mehr von ihm.«
»Sie ist doch aber seine Mutter, Salva!«
»Na gut, na gut. Ich erkundige mich bei den Gefängnissen und Krankenhäusern. Falls er aber beschlossen hat, dass er mit seiner Familie nichts mehr zu tun haben will – er ist über achtzehn, und in dem Fall kann ich nichts machen … Warum ist er eigentlich nicht bei der Armee?«
»Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie ihn nicht haben. Er war immer ein zarter Junge, der es auf der Brust hatte. Wirst du dein Möglichstes tun?«
»Ich hab’s doch gesagt.«
»Schließlich, wenn er in einer Bar arbeitet …«
»Ich kann nicht jede Bar in Florenz überprüfen.«
»Natürlich nicht. Ich werde nur einfach den Gedanken nicht los …«
»Welchen Gedanken?«
»Wenn er unser Sohn wäre … und er verschwindet einfach so in einer fremden Stadt, wie es uns dann ginge …«
»Na schön«, sagte er etwas freundlicher. »Ich sehe zu, was ich herausfinden kann.«
»Vielleicht hätte ich dir erst morgen davon erzählen sollen. Du hast einen langen Tag gehabt, und ein verlorengegangenes Kind reicht schon. Ich muss sagen, sie hat mich auf den Gedanken gebracht, wie schön es wäre, wenn wir eine kleine Tochter hätten – obwohl sie ja wirklich ein kleiner Wirbelwind war. Die Mutter schien ihr überhaupt nicht gewachsen zu sein. ›Fettklops‹!«
»Wie bitte?«
»So hat sie dich genannt.«
»Hmm.«
»So schönes Haar!«
»Sie war auch nicht das Einzige. Ich meine, das einzige verlorene Kind. Heute war eine Frau bei mir, die nach ihrem fünfundvierzigjährigen Sohn suchte. Unangenehme Person. Wenn ihr Sohn so ist wie sie … Na ja …« Er erhob sich und stellte den Ton wieder lauter, um die Spätnachrichten zu hören. »Es gibt die verrücktesten Leute auf der Welt …«
Bald sollte ihm klar werden, wie recht er damit hatte.
2
E