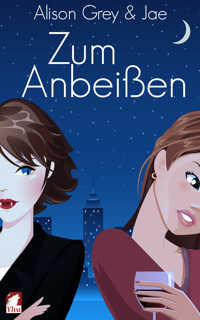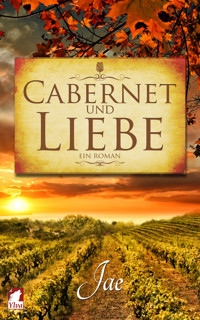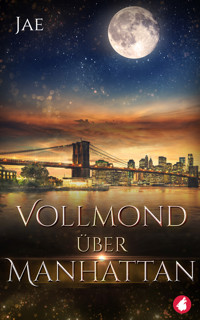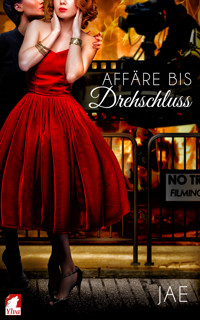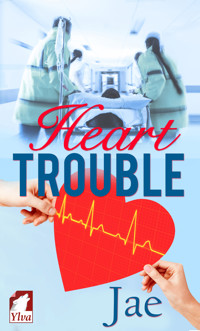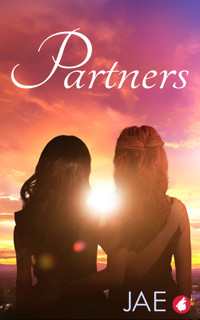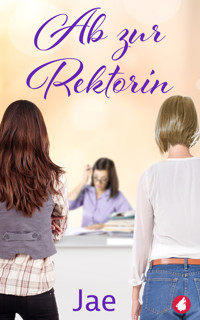Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Ylva VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die Medizin versagt, übernimmt das Herz. Dr. Hope Finlay liebt ihren Job als Ärztin in der Notaufnahme, besonders weil sie dabei immer nur kurz mit Menschen in Kontakt kommt. Schon als Kind hat sie durch den Tod ihrer Mutter gelernt, keine Bindungen einzugehen, da diese nie von Dauer sind. Kellnerin Laleh Samadi ist das genaue Gegenteil. Sie schließt rasch Freundschaften und liebt ihre große, turbulente persische Familie über alles, obwohl diese sich ständig in ihr Leben einmischt. Als Laleh mit plötzlichem Herzrasen in die Notaufnahme eingeliefert wird, rettet Hope ihr das Leben. Bevor sie den Schreck verwunden hat, häufen sich seltsame Vorkommnisse: Warum kennt Laleh auf einmal selbst die obskursten Krankheiten, während Hope fließend Farsi spricht? Laleh und Hope entdecken, dass eine mysteriöse Verbindung zwischen ihnen besteht und diese mit jedem Tag stärker wird. Verlieren sie den Verstand … oder ihre Herzen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Von Jae außerdem lieferbar
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
Über Jae
Ebenfalls im Ylva Verlag erschienen
Heart’s Surrender – ein erotischer Liebesroman
L.A. Metro – In nur einem Herzschlag
Demnächst im Ylva Verlag
All the Little Moments – Weil jeder Augenblick zählt
Wette mit Folgen
Von Jae außerdem lieferbar
Vorsicht, Sternschnuppe
Die Hollywood-Serie:
Liebe à la Hollywood
Im Scheinwerferlicht
Dress-tease
Affäre bis Drehschluss
Die Portland-Serie:
Auf schmalem Grat
Rosen für die Staatsanwältin
Umzugsfieber
Die Mondstein-Serie:
Cabernet und Liebe
Verführung für Anfängerinnen
Die Serie mit Biss:
Zum Anbeißen
Coitus Interruptus Dentalis
Die Gestaltwandler-Serie:
Vollmond über Manhattan
Herzklopfen und Granatäpfel
Jae
KAPITEL 1
Was für ein Tag! Laleh verharrte vor ihrer Wohnungstür und balancierte drei Styroporbehälter an ihrer Brust, während sie in ihrer Hosentasche nach ihren Schlüsseln fischte. Sie konnte es nicht abwarten, endlich aus ihren Schuhen und der Bluse zu schlüpfen, an der noch die Reste des Safranreispuddings klebten, den ein trotziger Dreijähriger nach ihr geworfen hatte.
Als sie den Schlüssel im Schloss drehte, merkte sie, dass die Tür bereits offen war. Einen Moment lang erstarrte sie. Die winzigen Härchen in ihrem Nacken richteten sich auf.
Dann huschte ihr Blick zur Straße.
Der alte Volvo ihrer Mutter stand vor dem Haus.
Laleh lockerte ihren Griff um die Schlüssel und stieß die Tür auf. »Maman! Du hast mich zu Tode erschreckt. Was machst du hier?«
»Begrüßt man so seine Mutter?« Der Duft von Zimt und Rosenwasser, den sie mit ihrer Mutter assoziierte, umgab Laleh, noch bevor sie in eine warme Umarmung gezogen wurde. Ihre Mutter küsste sie auf beide Wangen, trat dann zurück und betrachtete sie stirnrunzelnd. »Was ist das denn?« Sie zupfte an der bekleckerten Bluse.
»Einer unserer kleinen Gäste wusste Tante Nasrins Nachtisch nicht zu schätzen.«
Ihre Mutter schnalzte mit der Zunge. »Mit Essen werfen …« Sie schüttelte den Kopf. »Kein persisches Kind würde so etwas je tun.«
Laleh versuchte nicht, ihr Grinsen zu verbergen. »Ach nein? Erinnerst du dich nicht mehr daran, was Navid getan hat, als du versucht hast, ihn dazu zu zwingen, eingelegte Artischocken zu essen?«
Ihre Mutter winkte ab. »Du solltest die Bluse in kaltem Wasser mit ein wenig Ammoniak einweichen, sonst bekommst du die Flecken nicht raus.«
»Mach ich gleich.« Laleh streifte die Schuhe von den Füßen, schob sich in der winzigen Wohnung an ihrer Mutter vorbei und trug die Styroporbehälter zur Küchenzeile. Als sie den Kühlschrank öffnete, stieß sie auf mehrere Tupperdosen, die noch nicht da gewesen waren, als sie am Morgen zur Arbeit gegangen war. Sie schloss den Kühlschrank, drehte sich zu ihrer Mutter um und sah sie fragend an.
»Ich bin nur vorbeigekommen, um dir etwas Adas Polo zu bringen.«
»Du musst mir nichts zu essen bringen, Maman. Ich arbeite in einem Restaurant. Wenn ich Adas Polo essen möchte, dann gibt mir Tante Nasrin einfach eine Portion mit.«
Erneut winkte ihre Mutter ab, genau wie immer, wenn Laleh sie darauf hinwies, dass sie nicht kurz vor dem Hungertod stand. »Sie nimmt nicht genug Zimt. Ich weiß, dass du meine Variante lieber magst.«
Das konnte Laleh nicht abstreiten. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen, wenn sie nur an die leckere Kombination aus Reis, Linsen, Rosinen und Zimt dachte. Sie schob die größte Tupperdose in die Mikrowelle und machte ihrer Mutter einen Tee, während das Essen aufwärmte.
Ein paar Minuten später setzten sie sich an den kleinen Tisch.
Ihre Mutter trank Chai aus einem Teeglas und sah lächelnd zu, wie Laleh sich über ihr Essen hermachte. »Wusstest du, dass Sepideh heiraten wird?«
Laleh schluckte eine Gabel Safranreis. »Welche Sepideh?« In ihrer Großfamilie gab es zwei Frauen, die so hießen, und noch einige mehr im Freundeskreis ihrer Eltern.
»Die jüngste Tochter von Yasmin Hajimiri.«
Laleh erinnerte sich kaum an sie, deshalb brummte sie nur und spießte eine Rosine mit der Gabel auf.
»Sie heiratet einen persischen Arzt. Er hat seinen Abschluss summa cum laude in Harvard gemacht.«
Jetzt ahnte Laleh, worauf sie hinauswollte. Sie nickte nur und tat, als konzentrierte sie sich ganz auf ihr Adas Polo.
»Ist das nicht toll?«, fragte ihre Mutter, als Laleh schwieg.
»Ganz toll.«
Ihre Mutter sah sie weiterhin an und erwartete offensichtlich, dass sie mehr dazu sagte.
Laleh schob ihren Teller beiseite. »Versuchst du, mir etwas zu sagen?«
»Hichi, hichi«, sagte ihre Mutter.
Das glaubte Laleh keine Sekunde lang. Es war niemals nichts, wenn ihre Mutter über Hochzeiten sprach.
»Wirklich, ich will gar nichts andeuten. Ich wollte dir nur das Neueste von Sepideh erzählen. Mir ist es egal, ob du einen Arzt heiratest oder nicht. Du weißt doch, dass dein Vater und ich da sehr modern eingestellt sind. Du kannst jeden Mann heiraten, den du willst.«
»Solange er Arzt, Anwalt oder Ingenieur ist«, murmelte Laleh.
»Was ist denn so falsch daran, dich glücklich sehen zu wollen?« Ihre Mutter sah sie mit ihren großen, dunklen Augen an wie ein verwundetes Reh.
»Ich bin glücklich. Dazu brauche ich keinen Mann mit einem gut bezahlten Job … oder überhaupt einen Mann. Klar wäre es schön, wieder eine Beziehung zu haben, aber ich bin nicht unglücklich als Single.«
Ihre Mutter schnalzte erneut mit der Zunge. »Wenn du so weitermachst, wirst du noch torshideh.«
Laleh hasste dieses Wort, das wörtlich übersetzt eingelegt hieß. »Ich bin gerade mal siebenundzwanzig, Maman. Ich bin noch lange keine alte Jungfer mit einem Dutzend Katzen.«
»Katzen?« Ihre Mutter runzelte die Stirn. »Was haben Katzen denn damit zu tun?«
»Vergiss es einfach.«
»Du isst ja gar nicht.« Ihre Mutter wedelte in Richtung von Lalehs Teller. »Habe ich zu viele Rosinen reingetan?«
Laleh war der Appetit vergangen, aber sie zwang sich, zur Gabel zu greifen und weiterzuessen. »Nein, es ist perfekt, wie immer.«
Ihre Mutter strahlte und tätschelte Lalehs Hand. »Wenn du willst, kann ich Adas Polo machen, wenn du am Sonntag zum Essen kommst.«
Laleh schluckte den Happen Reis in ihrem Mund herunter. »Ich komme am Sonntag zum Essen?«
»Natürlich. Dein Vater hat einen Kollegen zum Tee eingeladen. Wenn es gut läuft, bitten wir ihn, zum Essen zu bleiben. Er stammt aus Shiraz, wie dein Baba, und aus einer sehr guten Familie. Er wäre der perfekte Mann für dich.«
»Ach, wie Mahmood, der Banker.«
Sie sahen einander an und lachten los.
»Okay, vielleicht war er nicht ganz so perfekt, wie er klang, als Bita mir vom Sohn ihrer Cousine erzählt hat.«
»Nicht ganz so perfekt? Maman, seine Vorstellung von Romantik war, stundenlang über Börsengeschäfte zu reden. Und er hat ständig an seinen zwei Haarsträhnen herumfrisiert, um seine kahlen Stellen zu verstecken.«
»Diesmal wird alles anders laufen«, sagte ihre Mutter. »Dariush hat Haare.«
Beide kicherten.
»Also? Du kommst doch, oder?«
Laleh seufzte. Ihr war bewusst, dass sie ihre Eltern bereits enttäuscht hatte, indem sie keinen Universitätsabschluss gemacht hatte. Für die beiden war ihre Arbeit im Restaurant ihrer Tante und ihres Onkels ein netter Ferienjob für einen Teenager, aber ganz sicher kein erstrebenswertes Karriereziel für ihre Tochter. Auch wenn sie nicht vorhatte, Dariush zu heiraten, nur weil er Iraner war und eine gut bezahlte Anstellung hatte, konnte es doch nicht schaden, ihn kennenzulernen, oder?
Gerade, als sie zustimmen wollte, begann ihr Herz in ihrem Brustkorb zu flattern wie ein kleiner, verängstigter Vogel. Sie hob ihre freie Hand und presste sie auf ihre Brust.
Ihre Mutter berührte sie sanft am Arm. »Was ist?«
»Ich hab Herzrasen.« Sie bemühte sich, ganz normal zu atmen.
»Du musst nicht nervös sein. Dein Vater sagt, Dariush wäre sehr nett.«
»Es ist nicht wegen Dariush. Es ist eine meiner kleinen Episoden.« Es war schon eine Weile her, seit sie zuletzt Herzrasen gehabt hatte, aber sie erinnerte sich noch an die Techniken, mit denen sie es stoppen konnte. Sie kniff sich die Nase zu, hielt die Luft an und presste.
Für gewöhnlich stoppte das ihr Herzrasen, aber diesmal half es nicht.
Ihre Mutter sprang auf, eilte zur Küchenzeile und kehrte mit einem Wasserglas zurück, das sie Laleh in die Hand drückte. »Hier.«
Laleh trank das kalte Wasser. Als auch dieser Trick nicht half, machte sie sich noch immer keine allzu großen Sorgen. Ihre seltsamen Anfälle dauerten selten länger als ein paar Minuten. Normalerweise hörten sie genauso schnell auf, wie sie begannen. Alles, was sie tun musste, war, kurz zu warten. Es war nur Stress, hatte ihr Arzt gesagt. Sie versuchte, sich zu entspannen, aber ihre ängstlich neben ihr verharrende Mutter machte das unmöglich.
Ein plötzliches Schwindelgefühl überkam sie. Klirrend landete ihre Gabel auf dem Teller, als sie sich am Tisch festklammerte.
»Laleh!« Ihre Mutter zog ihr Handy aus der Handtasche. »Ich rufe einen Krankenwagen.«
Das Schwindelgefühl ließ ein wenig nach. Laleh umklammerte die Hand ihrer Mutter. »Nein. Mir geht’s gut. Gib mir einen Moment.«
»Entweder lässt du zu, dass ich dich zur Notaufnahme fahre, oder ich rufe einen Krankenwagen.«
In der Zeit, die es dauern würde, zur Notaufnahme zu fahren, würde sich ihr Herzschlag vermutlich längst beruhigt haben und sie konnten einfach umdrehen und nach Hause zurück fahren, ohne das Krankenhaus auch nur zu betreten. In den vier Jahren, seit das Herzrasen zum ersten Mal aufgetreten war, hatte sie das schon zweimal erlebt. »Na schön.« Vorsichtig erhob sie sich und ging ein wenig vornüber geneigt zur Tür, um den Druck auf ihrer Brust zu lindern. »Dann auf zur Notaufnahme.«
* * *
Dr. Hope Finlay zog ihre ID-Karte durch das Lesegerät am Personaleingang und betrat die Notaufnahme des Griffith Memorial Hospital.
Die beiden Hälften der Glastür schlossen sich hinter ihr und schotteten sie ab vom Abgasgestank des dichten Verkehrs in Los Angeles und vom Duft der Hotdogs, die auf der anderen Straßenseite verkauft wurden. Stattdessen umgab sie nun das vertraute Aroma von Automatenkaffee und Desinfektionsmittel. Ein EKG-Monitor piepte und in einem der Behandlungszimmer stöhnte jemand, aber kein Sirenengeheul näherte sich dem Hintereingang. Auf dem Weg zu ihrem Spind warf sie einen Blick ins Wartezimmer.
Eine schnarchende Frau und ein Mann, der ein Handtuch um seine Hand gewickelt hatte, saßen auf den orangefarbenen Plastikstühlen. Ansonsten war die Notaufnahme ungewöhnlich leer für kurz vor sieben an einem Dienstagabend. Vermutlich würde es später voller werden. Nach Anbruch der Dunkelheit würden Drogenabhängige und Unfallopfer sie auf Trab halten und ihre Zwölf-Stunden-Schicht würde auf produktive Weise wie im Flug vergehen, so wie es ihr am liebsten war.
Hope betrat die Damenumkleide und schlüpfte in ihre hellblaue OP-Kleidung. Sie klemmte ihr Namensschild an die Brusttasche ihres weißen Arztkittels und schlang sich das Stethoskop um den Hals. Erst mit dem vertrauten Gewicht fühlte sie sich im Krankenhaus voll bekleidet. Ihre bequemen Turnschuhe quietschten auf dem Linoleumfußboden, als sie zur Schwesternstation ging.
Tom Coffey, der Kollege, der die Tagschicht abdeckte, saß an einem der PC-Arbeitsplätze an dem riesigen, u-förmigen Tresen, der das Herzstück der Notaufnahme darstellte. Ganz in der Nähe füllten zwei Krankenschwestern einen der Vorratsschränke auf.
Als Hope sie grüßte und zum Empfangstresen weiterging, sah Tom von der digitalen Patientenakte auf.
»Hi, Tom. Bist du so weit, Feierabend zu machen?«
Er grinste. »Und wie! Ich habe versucht, die Tafel abzuarbeiten. Fast hätten wir es geschafft. Janet kümmert sich um eine Schnittwunde in Behandlungsraum zwei und wir warten noch auf die Laborwerte von Mr. Hegland in Raum vier. Er stellte sich mit abdominellen Schmerzen vor, aber der Ultraschall sieht normal aus. Je nach Laborergebnissen könnte er ein CT brauchen.«
Hope sah auf die Anzeigetafel an der Wand. Dort wurden nur drei aktive Patienten aufgelistet. »Sieht nach einer ruhigen Nacht aus.«
Paula Delgado, die Stationsleiterin der Nachtschicht, stöhnte. »Na toll. Jetzt haben Sie uns das Pech auf den Hals geschickt, Doktor. Sie wissen doch, dass wir dieses Wort hier nicht aussprechen. Wir denken es nicht einmal.«
Hope glaubte nicht an Pech oder Unglück; sie glaubte an Fakten und die Wissenschaft. Aber sie wusste, dass einige der Krankenschwestern sehr abergläubisch waren, deshalb hob sie die Hände und machte eine Bewegung, als verschlösse sie ihre Lippen mit einem Reißverschluss. »Ich werde das Wort mit dem R nicht mehr erwähnen. Versprochen.«
In einem der Behandlungszimmer, die die Schwesternstation umgaben, begann ein Kind zu schreien.
Paula sah sie vielsagend an.
»Das ist Jonah«, sagte Tom. »Ein vierjähriger Junge, der sich eine Murmel in die Nase geschoben hat. Ich habe Scott reingeschickt, um sie zu entfernen.«
Na prima. Scott war Assistenzarzt im zweiten Jahr, hatte sie aber bisher weder mit seinen medizinischen Fähigkeiten noch mit seiner Arbeitsmoral beeindrucken können. Sein Umgang mit Kranken war auch nicht der beste und so konnte sie sich kaum vorstellen, dass er mit einem verängstigten kleinen Jungen zurechtkommen würde.
Das Weinen und Schreien aus Behandlungsraum drei wurde lauter. Es klang, als würde der Junge gefoltert werden. Nach ein paar Sekunden wurde der Vorhang vor der offenen Plexiglastür zurückgezogen und Scott Feltner marschierte auf die Schwesternstation zu. »Rufen Sie in der HNO an«, sagte er zu Paula und klatschte das Klemmbrett mit dem Aufnahmebogen des Jungen auf den Tresen.
Weder hatte er bitte gesagt, noch der Schwester in die Augen gesehen, als er ihr befohlen hatte, den Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten anzurufen.
Innerlich seufzte Hope. Nach über einem Jahr in der Notaufnahme hatte er immer noch nicht gelernt, den Krankenschwestern den nötigen Respekt entgegenzubringen. Sie würde ihn sich später vorknöpfen müssen. Als Fachärztin wurde von ihr erwartet, dass sie bei der Ausbildung junger Kollegen wie Scott half. »Wo liegt das Problem?«
»Ich kann die Murmel nicht greifen. Das Kind schlägt um sich und schreit wie am Spieß«, grummelte Scott.
»Was hast du benutzt?«
»Eine Hartmann-Zange.«
Hope schüttelte den Kopf. »Runde Gegenstände kann man damit schlecht greifen. Wenn du eine Zange benutzt, drückt sie die Murmel womöglich nur noch tiefer in die Naris. Hast du ein abschwellendes Nasenspray benutzt, bevor du versucht hast, die Murmel zu entfernen?«
Mit zusammengepressten Lippen nickte Scott.
Na, wenigstens hatte er eine Sache richtig gemacht. »Rufen Sie die HNO bitte noch nicht an«, sagte sie zu Paula. »Ich möchte es erst selbst versuchen.«
Scott stapfte hinter ihr her, als sie zu Behandlungszimmer drei ging.
Der Junge hatte aufgehört zu weinen, aber als sie den Raum betrat, begann seine Unterlippe zu zittern.
»Hallo, Jonah«, sagte sie heiter, während sie sich ein Paar Latexhandschuhe überzog. »Ich bin Hope.« Es war besser, sich nicht als Ärztin vorzustellen. Der Junge wirkte zu eingeschüchtert, nachdem Scott vergeblich versucht hatte, die Murmel mit der angsteinflößenden Hartmann-Zange zu entfernen. »Ich höre, deine Nase macht Probleme.«
Er schniefte und nickte.
Hope lächelte der blassen Mutter zu, zog einen Rollhocker neben den Behandlungstisch und setzte sich, damit sie mit ihren eins fünfundsiebzig nicht so bedrohlich auf das Kind wirkte. Sie legte die Hände auf ihre Oberschenkel, ohne schon jetzt zu versuchen, ihn zu berühren. »Sag mal, Jonah, hat deine Mama einen Staubsauger?«
Er nickte und seine Unterlippe hörte auf zu zittern.
Sie spürte, dass sie jetzt seine Aufmerksamkeit hatte. »Wir haben auch einen hier. Aber das ist ein ganz besonderer Staubsauger. Willst du ihn mal sehen?«
Argwöhnisch nickte er.
»Dr. Feltner, könnten Sie mir bitte den Absaugkatheter geben?«
Kommentarlos reichte Scott ihr einen sterilen Katheter aus einem der Vorratswagen.
Sie schloss ihn an die Absaugmaschine an und schaltete diese an. »Es kitzelt, wenn man ihn an den Arm hält.« Sie schob den langen Ärmel ihres weißen T-Shirts hoch und führte es an ihrem eigenen Arm vor. »Willst du es mal versuchen?«
Der Junge sah zu seiner Mutter, die ihm zunickte und lächelte. Zögernd hielt er Hope seinen Arm hin.
Sanft berührte Hope seinen Unterarm mit der weichen Spitze des Katheters.
Einen Moment lang hielt er still, dann wich er zurück.
»Siehst du? Es tut nicht weh, oder?«
Jonah schüttelte den Kopf.
»Weißt du, was dieser ganz besondere Staubsauger noch kann? Er kann die Murmel aus deiner Nase holen. Es kitzelt vielleicht ein bisschen, so wie an deinem Arm, aber es wird nicht wehtun.«
Erneut traten ihm Tränen in die Augen und er umklammerte die Hand seiner Mutter.
»Kannst du kurz für mich stillhalten? Dann darfst du dir auch einen Aufkleber aus der Sammlung der Krankenschwestern aussuchen und mit deiner Mama nach Hause gehen. Wie findest du das?«
Skeptisch sah er sie an. »Was für Aufkleber sind das denn?«
Hope lachte. »Ich weiß nicht. Die Krankenschwestern zeigen sie mir nicht. Sie sind nur für tapfere kleine Jungs und Mädchen.«
Er zögerte noch ein paar Sekunden, bevor er murmelte: »Okay.«
Hope bedeutete Scott, näherzukommen. Falls der Junge mitten in der Behandlung um sich schlug oder austrat, würde Scott ihn festhalten müssen, sonst würde sie ihn verletzen. Sanft hob sie Jonahs Kinn an und leuchtete ihm in die Nase.
Da war die Murmel. Sie steckte vor der mittleren Nasenmuschel auf der rechten Seite.
»Bist du bereit?«
Mit aufgerissenen Augen nickte Jonah.
Hope hielt mit einer Hand seinen Kopf still, während sie den Katheter in sein Nasenloch schob.
Jonah wimmerte und versuchte, seinen Kopf zur Seite zu bewegen.
»Ist schon okay. Nur noch eine Sekunde.« Sie berührte mit der Absaugspitze die Murmel und zog den Katheter dann zurück.
Eine rote, schleimbedeckte Murmel kam zum Vorschein.
Hope ließ sie in eine Plastikschale fallen, die Scott ihr hinhielt, und wischte etwas Rotz von Jonahs Oberlippe. Sie leuchtete ihm erneut in die Nase, um sicherzugehen, dass keine weiteren Fremdkörper dort festsaßen und er nicht blutete.
Gut. Die Nasenschleimhaut war nicht verletzt worden. Sie nickte und rollte ihren Hocker zurück. »Gut gemacht, Jonah. Wir sind fertig.«
Tränen liefen seine Wangen hinab, aber nun strahlte er. »Kann ich jetzt einen Aufkleber haben?«
Hope musste grinsen. »Aber klar doch.«
»Vielen Dank, Dr. Finlay.« Jonahs Mutter streckte ihr die Hand hin und schien dann erst zu bemerken, dass Hope mit Nasensekret verschmierte Handschuhe trug. Sie zog die Hand zurück und lächelte. Nach einem raschen, weniger freundlichen Blick in Scotts Richtung nahm sie ihren Sohn und trug ihn aus dem Behandlungsraum.
»Mann«, murmelte Scott. »Zum Glück bin ich nicht in die Pädiatrie gegangen.«
Ja, zum Glück – für die armen Kinder! »So schlimm war es doch gar nicht. Er war sogar ziemlich kooperativ für einen Jungen seines Alters.«
Scott verzog das Gesicht.
Hope konnte über ihn nur den Kopf schütteln. »Geh mal nachsehen, ob Mr. Heglands Laborergebnisse schon da sind.« Sie streifte die Handschuhe ab und warf sie in den dafür vorgesehenen Mülleimer neben der Tür, bevor sie Scott folgte.
Ein Blick auf die elektronische Anzeigetafel ließ sie innehalten. Jonahs Name war verschwunden, aber stattdessen waren fünf neue Patientennamen auf der Tafel erschienen. Ein weiterer erschien unten auf der Liste.
Die Krankenschwester, die die Ersteinschätzungen vornahm, marschierte auf den Ständer mit dem Schild wartende Patienten zu und ließ einen Armvoll Aufnahmebögen hineinfallen.
An der Schwesternstation begann das Funkgerät zu rauschen, über das sie mit dem Rettungsdienst in Kontakt standen. »Wir bringen euch einen achtundzwanzigjährigen Mann, der mit dem Auto gegen einen Baum gefahren ist. Er ist ansprechbar und orientiert, hat aber eine große Platzwunde auf der Stirn.«
Vermutlich war er nicht angeschnallt gewesen. Das hatte Hope schon tausendmal erlebt. Sie würden ein CT machen müssen, sobald er eintraf, um eine Hirnverletzung auszuschließen.
Janet Wang, eine Assistenzärztin im dritten Jahr, kam aus Behandlungszimmer zwei, sah auf die Patiententafel und blinzelte. »Was ist passiert?«
»Eine Person, die lieber unbenannt bleiben möchte, hat das Wort mit R erwähnt«, sagte Paula.
Das Heulen der Sirene wurde lauter und brach dann ab, als der Rettungswagen rückwärts in die Parkbucht gelenkt wurde. Blaulicht spiegelte sich in den Glasschiebetüren.
Hope ignorierte ihre abergläubischen Kollegen, schnappte sich einen Überziehkittel und eilte zum Rettungswageneingang.
* * *
Lalehs Herzrasen hatte noch immer nicht aufgehört, als ihre Mutter den Volvo auf dem Krankenhausparkplatz anhielt. Ihr Herz fühlte sich an, als würde es gleich aus der Brust springen. Bildete sie sich das nur ein oder schmerzte ihr Brustkorb auch?
Angst überkam sie und beschleunigte ihren Puls noch mehr.
Der Boden schien unter ihr zu schwanken wie ein Schiff im Sturm, als sie über den Parkplatz taumelte. Sie schleppte sich auf das riesige, blutrote Notaufnahmeschild über dem Eingang zu.
Ihre Mutter umklammerte stützend ihren Ellbogen. »Alles okay? Kannst du gehen? Soll ich einen Arzt holen?«
Schwach schüttelte Laleh den Kopf. Nur noch ein paar Schritte, dann wäre sie ohnehin in der Notaufnahme.
Die Glastüren glitten vor ihnen auf und sie gingen an einem Sicherheitsbeamten vorbei, der sie besorgt ansah.
Im Aufnahmebereich standen die Patienten Schlange. In einem winzigen Raum mit einer Plexiglastür wurde gerade der Blutdruck eines Mannes gemessen und ein Angestellter hinter dem Empfangstresen versuchte, Versicherungsdaten von einem Patienten zu erhalten, der kein Englisch sprach. Die Person, die er zum Übersetzen mitgebracht hatte, schien auch kaum kompetenter. Das würde sicher eine Weile dauern.
Oh nein. Laleh musste sich setzen. Jetzt sofort. Nach nur ein paar Schritten vom Parkplatz hierher war ihr bereits schwindelig. Sie hielt sich die Brust. Obwohl sie nicht religiös war, betete sie nun doch darum, dass ihr Herzschlag sich verlangsamen würde. Bitte, bitte, hör auf mit dem Unsinn.
Ihre Mutter hielt sie noch immer am Ellbogen fest, als sie sich in die Warteschlange einreihte. Ihr Puls trommelte in ihrem Hals. Ihr ganzer Körper schien im selben wilden Rhythmus wie ihr Herzschlag zu vibrieren. Sie bekam keine Luft und konnte keinen klaren Gedanken fassen.
Wie lange noch? Sie drehte den Kopf und sah zu der riesigen Wanduhr, aber die Zeiger verschwammen vor ihren Augen. Eine Welle der Übelkeit überkam sie. Der beigefarbene Linoleumboden begann, sich langsam um sie herum zu drehen. Sie umklammerte den Arm ihrer Mutter, um nicht umzufallen, aber ihre Knie gaben nach.
Ein Schrei hallte in ihren Ohren.
Plötzlich sah sie empor zu einem Dutzend verschwommener Gestalten um sie herum. Dann verblassten die grellen Lichter und alles wurde dunkel.
KAPITEL 2
Das Unfallopfer hatte zum Glück außer der Platzwunde keine Kopfverletzungen davongetragen. Nachdem Hope ihn behandelt hatte, ging sie zur Schwesternstation und nahm das nächste Klemmbrett vom Ständer. Ein Blick auf den Aufnahmebogen zeigte, dass der Patient an chronischen Magen-Darm-Beschwerden litt.
Toll. Vermutlich schleppte er das Problem schon seit Monaten oder Jahren mit sich herum und jetzt würde er erwarten, dass sie innerhalb von Stunden eine Lösung fand. Sie liebte ihren Job, aber zuweilen waren die unrealistischen Erwartungen mancher Patienten frustrierend.
Als im Aufnahmebereich ein Tumult ausbrach, drehte sie sich um.
»Dr. Finlay! Schnell! Jemand ist hier draußen zusammengebrochen.«
Hope warf das Klemmbrett auf den Tresen und rannte durch die Glasschiebetüren zum Aufnahmebereich.
Mit einem Blick erfasste sie die Szene vor dem Empfangstresen. Eine Schwester kniete über einer Person, die am Boden lag, während ein Pflegehelfer eine weinende ältere Frau festhielt, die aussah, als bräche sie gleich selbst zusammen. »Bitte, bitte, helfen Sie meiner Tochter!«
Hope schob sich durch die Menge starrender Menschen, die um den Patienten herumstanden. Jetzt konnte sie sehen, dass es sich um eine junge Frau handelte, die vermutlich ein paar Jahre jünger war als Hope selbst mit ihren einunddreißig Jahren. Unter ihrem olivbraunen Teint war sie bleich und bewegte sich nicht. Atmete sie überhaupt?
Die Krankenschwester legte ihre Finger auf die Halsschlagader. »Kein Puls tastbar.« Sie verschränkte die Finger, legte die Hände übereinander und platzierte sie auf dem Brustbein der jungen Frau.
Ein Adrenalinstoß durchfuhr Hope. Ihr Gesichtsfeld schränkte sich ein, bis sie nur noch die Patientin sah. »Jemand soll eine Trage bringen. Sie muss sofort in den Schockraum.« Sie winkte dem Sicherheitsbeamten zu. »Jake, schaff uns die Leute aus dem Weg.«
Gummiräder quietschten über das Linoleum. Janet und Paula brachten eine Rolltrage neben der Patientin zum Stehen.
»Auf drei.« Hope sah kurz zu jedem Mitglied ihres Teams, um sicherzugehen, dass alle bereit waren. »Eins, zwei, drei.«
Mit tausendmal geübten Bewegungsabläufen hoben sie die junge Frau auf die Trage.
Janet kletterte hinauf und kniete sich über die Patientin, um die Herzdruckmassage wiederaufzunehmen. Eine Schwester platzierte eine Beatmungsmaske über dem Mund der Frau und begann, in regelmäßigen Abständen den Beutel zu drücken, um Luft in ihre Lungen zu pumpen.
»Kennen wir ihre Krankengeschichte?«, fragte Hope, während sie mit der Patientin den Gang hinabeilten.
»Nein«, antwortete die Schwester von der Aufnahme. »Sie hatte noch keine Eingangsuntersuchung. Ihre Mutter sagt, sie hat schon seit Jahren gelegentliche Tachykardien, aber noch nie etwas Derartiges.«
Zwei Pfleger sprangen aus dem Weg und drückten sich gegen die Wand, um die Trage vorbeizulassen.
»Sie kommt in Schockraum zwei«, rief Paula.
Sie schoben die Trage in den Schockraum. Überall um sie herum brach Aktivität aus.
Janet sprang von der Trage und stellte sich daneben, um sofort mit den Thoraxkompressionen fortzufahren. Ein Atmungstherapeut übernahm den Beatmungsbeutel von der Schwester.
»Bringt den Notfallwagen hier rüber und schließt sie an den Monitor an«, sagte Hope.
Paula griff sich eine Kleiderschere und schnitt die Kleidung der Patientin auf.
Als die Bluse beiseite fiel, bemerkte Hope einen großen Fleck auf dem Stoff. Hatte irgendetwas die Patientin auf die Brust getroffen? Ein direkter Schlag im falschen Moment konnte durchaus den Herzrhythmus unterbrechen. Aber die Frau hatte kein Hämatom auf der Brust.
Eine der Krankenschwestern klebte die EKG-Elektroden auf die nun nackte Brust der Frau und verband die Kabel mit dem Herzmonitor und dem Defibrillator, während eine Kollegin einen Pulsoxymeter an ihren Finger klemmte.
»Hängen Sie eine Kochsalzlösung an«, sagte Hope von ihrer Position am Fuß des Behandlungstisches aus. Von da aus hatte sie den besten Überblick und konnte ihr Team am besten lenken.
Paula legte einen Zugang am Arm der Patientin, hängte einen Beutel Kochsalzlösung an und verband beides mit einem Infusionsschlauch.
Hopes Blick richtete sich auf den Monitor. »Zeit für eine Rhythmuskontrolle.«
Als Janet kurz mit den Kompressionen innehielt, zeigte das EKG eine wackelige grüne Zackenlinie.
»Kammerflimmern.« Die Herzmuskeln zitterten nur unkontrolliert, ohne Blut in den Körper und ins Gehirn zu pumpen. Wenn es ihnen nicht gelang, diesen dysfunktionalen Rhythmus zu unterbrechen, würde er rasch zur Nulllinie werden und dann bestand kaum noch Hoffnung, das Leben der Patientin zu retten.
»Laden auf zweihundert Joule«, sagte Hope.
Das schrille Pfeifen des Ladevorgangs drang durch den Schockraum.
Eine Krankenschwester platzierte orangefarbene Gelpads auf der nackten Brust der Patientin, eine unterhalb des rechten Schlüsselbeins, das andere mehr seitlich, unterhalb der linken Brust.
Komm schon, komm schon. Schneller! Wie lange war ihre Patientin jetzt schon bewusstlos?
Sobald Paula von der Defibrillatorkonsole »bereit« rief, nahm Hope die Defi-Paddles vom Notfallwagen. Zwischen Tisch und Wand war zur Linken nicht viel Platz, deshalb stellte sie sich auf die rechte Seite der Patientin. »Herzmassage unterbrechen«, rief sie Janet zu, die noch immer eine Herzdruckmassage durchführte. Sie beugte sich über die Patientin und musste sich strecken, um die Paddles auf den Gelpads platzieren zu können, ohne sich dazu mit der Hüfte gegen den Tisch lehnen zu müssen. »Alle weg!«
Die Krankenschwestern, die Assistenzärztin und der Atmungstherapeut traten vom Behandlungstisch zurück.
»Alle weg«, rief jemand.
Hope packte die Handgriffe fester und sah über die Schulter, um sicherzugehen, dass wirklich niemand die Patientin oder den Tisch berührte. Dann drückte sie die Auslöseknöpfe.
Ein Stromstoß jagte durch die Patientin. Ihr Arm flog nach oben und prallte gegen Hopes Brust.
Elektrizität traf Hope. Sie taumelte zurück und stieß gegen den Infusionsständer.
Wie aus weiter Entfernung hörte sie Paula rufen: »Wir haben einen Puls.«
»Dr. Finlay! Alles in Ordnung?« Janet umklammerte ihre Schultern.
Benommen sah Hope die junge Ärztin an. Verdammt. Das war dumm. Vermutlich hatte sie das rechte Paddle ein wenig zu sehr zur Seite platziert und dabei den Deltoideus erwischt. Was für ein Anfängerfehler! Du hast Glück gehabt, dass du nur einen Schlag auf die Brust abbekommen hast.
Hopes Brust und Arm kribbelten bis in die Fingerspitzen. Ihr Herz trommelte gegen ihre Rippen, aber sie wusste, dass es nur das Adrenalin war, keine Arrhythmie vom Stromschlag.
»Alles bestens.« Sie atmete tief durch und trat zurück an den Behandlungstisch. Statt der zittrigen Linie, die auf Kammerflimmern hindeutete, zeigte der Monitor nun normalen Sinusrhythmus.
»Blutdruck?«, fragte Hope.
Paula drückte den Knopf, der die Manschette um den Arm der Patientin herum aufpumpte. »Neunzig zu sechzig.«
Hope deutete auf die Infusion, die zum Glück nicht aus dem Arm der Patientin gerissen worden war, als sie gegen den Ständer geprallt war. »Drehen Sie die Infusion voll auf.«
Paula maß noch einmal den Blutdruck, der jetzt nach oben kletterte.
Der Atmungstherapeut entfernte die Maske vom Gesicht der Patientin.
Die Augenlider der jungen Frau begannen zu flattern, aber noch wachte sie nicht auf.
Hope beobachtete sie einen Moment lang. »Willkommen zurück.« Sie schob sich die Ohrstöpsel des Stethoskops in die Ohren, wärmte es in ihrer Hand und hörte dann die Lungen und das Herz der Patientin ab. Beide Lungenflügel klangen gut und es gab auch keine Herzgeräusche.
Mit einem zufriedenen Nicken zog sie die Ohrstöpsel heraus und schlang sich das Stethoskop um den Hals, um die Hände frei zu haben. Sanft zog sie erst das rechte, dann das linke Augenlid der Patientin in die Höhe und leuchtete ihr mit einer kleinen Stiftlampe in die Augen. Beide Pupillen zogen sich gleichermaßen zusammen.
Schließlich fuhr sie mit den Fingern über den Hinterkopf der Patientin und griff unter das lange, schwarze Haar, um sicherzugehen, dass sie sich nicht verletzt hatte, als sie zusammengebrochen war. Kein Anzeichen von Blut oder einer Schwellung.
Sie trat zurück, zog die Latexhandschuhe aus und widerstand dem Drang, sich den Arm und die Brust zu reiben. Vielleicht bildete sie sich das nur ein, aber es kribbelte noch immer. Sie zitterte am ganzen Körper. Himmel. So etwas war ihr seit dem zweiten Tag ihrer Assistenzarztzeit nicht mehr passiert, als ein übereifriger junger Kollege den Patienten defibrilliert hatte, ohne darauf zu achten, ob die anderen Behandler vom Behandlungstisch zurückgetreten waren. Sie nahm sich die Zeit, sich umzusehen und sich wieder in den Griff zu bekommen.
Wie üblich nach einer Reanimation wirkte der Schockraum wie ein Katastrophengebiet. Die zerschnittenen Kleider der Patientin und leere Verpackungen von Schläuchen, Infusionen und Gelpads lagen auf dem Boden. Die Medizinstudenten, die sich in den Raum gedrängt hatten, um sich die Wiederbelebung anzusehen, starrten sie an.
»Zurück an die Arbeit, Leute«, rief sie und war froh zu hören, dass ihre Stimme normal klang. »Paula, rufen Sie bitte die kardiologische Intensivstation an und sagen Sie denen, dass wir eine Aufnahme haben. Bringen Sie die Patientin zur Überwachung in ein Behandlungszimmer. Und während wir darauf warten, dass oben ein Bett frei wird, sollten wir ein EKG machen und Blut abnehmen für Blutbild, Herzenzyme, Blutgase und Elektrolyte. Lassen Sie einen Kardiologen runterkommen und bestellen Sie ein Echo.«
Paula marschierte zum Wandtelefon.
Hope schob die Glastür auf und trat aus dem Schockraum. Langsam ließ ihr Zittern nach, aber sie konnte noch immer nicht glauben, was eben passiert war. Sie wusste, dass sie später die ganze Reanimation im Kopf noch einmal durchgehen würde, um herauszufinden, wo ihr der entscheidende Fehler unterlaufen war. Aber bevor sie das tun konnte, hatte sie noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Zum Beispiel musste sie mit der Mutter der Patientin reden und sie wissen lassen, dass sich der Zustand ihrer Tochter stabilisiert hatte.
»Ist die Mutter der Patientin noch hier?«, fragte sie den Pflegehelfer, den sie zuletzt mit der weinenden Frau gesehen hatte.
»Ja«, sagte er. »Ich hab sie in das separate Wartezimmer gesetzt.«
»Wissen wir ihren Namen?«
Er zögerte. »Samadi oder so etwas. Es klang Japanisch.«
»Wohl eher Iranisch oder Syrisch«, sagte Hope, obwohl sie dem Aussehen ihrer Patientin kaum Beachtung geschenkt hatte. Nur vage hatte sie schwarzes Haar und hohe Wangenknochen wahrgenommen, es war also durchaus möglich, dass die Patientin Asiatin war.
Als der Pfleger mit den Schultern zuckte, ging sie zu dem kleinen Wartezimmer.
Janet eilte ihr hinterher. »Warte mal. Möchtest du, dass ich mit der Familie spreche, während du dich durchchecken lässt?«
Hope wusste das Angebot zu schätzen, aber sie schüttelte den Kopf. »Mir geht’s gut. Es war nicht sehr schmerzhaft. Mehr wie ein starker Stromschlag von einem Weidezaun. Ich war nur überrascht. Das ist alles.«
»Na schön«, sagte Janet zögernd. »Wenn du sicher bist …«
»Ich bin sicher.« Hope klopfte ihr auf die Schulter und ging weiter zum Wartezimmer. Bevor sie die Tür öffnete, hielt sie kurz inne und kontrollierte, dass ihr Namensschild gerade saß und sie keine Blutflecken auf der OP-Kleidung oder dem Laborkittel hatte.
Die beigefarbenen Sessel und die Couch waren leer. Die einzige Person im Raum war eine kleine Frau mittelöstlicher Abstammung, die unruhig im Raum auf und ab schritt.
Als Hope eintrat, blieb die Frau sofort stehen und sah sie an, als wüsste sie nicht, ob sie auf sie zustürmen und sie ausfragen oder davonlaufen sollte, um den schlechten Nachrichten zu entgehen, die Hope vielleicht überbringen würde.
»Mrs. Samadi?«, fragte Hope.
Die Frau nickte und schluckte hörbar.
»Ich bin Dr. Finlay. Ich habe Ihre Tochter behandelt.«
»Laleh. Ihr Name ist Laleh. Ist sie …?« Mrs. Samadi rang die Hände. Tränen standen ihr in den Augen.
»Sie ist im Moment stabil«, sagte Hope schnell.
Mrs. Samadi ließ sich auf die Couch fallen, als hätten ihre Knie nachgegeben. »Gott sei Dank!«
Hope setzte sich neben sie, damit sie auf Augenhöhe reden konnten, hielt aber respektvoll ein wenig Abstand.
»Was ist passiert?«, fragte Mrs. Samadi schließlich. Ihr schwacher mittelöstlicher Akzent ließ das a sehr nasal klingen.
»Ihre Tochter … Laleh litt an einem abnormalen Herzrhythmus, der verhindert hat, dass ihr Gehirn mit Blut versorgt wurde. Deshalb hat sie das Bewusstsein verloren. Zum Glück konnten wir rasch wieder einen normalen Herzrhythmus herstellen. Wir versuchen im Moment, die Ursache herauszufinden. Sind bei Ihrer Tochter Herzprobleme bekannt?«
»Nein.« Mrs. Samadi schüttelte energisch den Kopf. »Manchmal hat sie Herzrasen, aber der Arzt sagt, es liegt am Stress.«
Hope hatte ihre Zweifel daran, aber sie sagte nichts.
»Kann ich sie sehen?«
»Wir machen gerade noch ein EKG und ein paar andere Tests, aber sobald wir fertig sind, bringt Sie eine Schwester zu ihr. Haben Sie noch irgendwelche Fragen?«
Erneut schüttelte Mrs. Samadi den Kopf. »Ich will nur, dass meine Tochter wieder ganz gesund wird.«
»Wir tun unser Bestes«, sagte Hope. In den sechs Jahren als Notfallmedizinerin hatte sie gelernt, darüber hinaus keine Versprechungen zu machen. Sie verabschiedete sich von Mrs. Samadi und ging zurück zu den Behandlungszimmern, um nach ihrer Patientin zu sehen und den Papierkram für die Reanimation zu erledigen.
* * *
Grelles Licht durchdrang Lalehs geschlossene Lider. Irgendwo in der Nähe klirrte Metall auf ein Tablett. Leise Stimmen drangen in den Raum. Einen Moment lang dachte sie, sie wäre im Restaurant ihrer Tante, aber da roch es anders. Statt des aromatischen Geruchs von Basmatireis, Safran und Kardamom stach ihr der Gestank nach saurem Schweiß und Desinfektionsmittel in die Nase.
Was …? Wo …?Sie öffnete die Augen und kniff sie sofort wieder zusammen, als das Licht sie blendete.
Es dauerte ein paar Momente, bis der gekachelte, sterile Raum um sie herum nicht mehr verschwamm. Medizinische Geräte umgaben sie.
Ein Krankenhaus. Sie war wohl in der Notaufnahme. Laleh erinnerte sich noch daran, durch die Glasschiebetüren getreten zu sein, aber an nichts, was danach geschehen war. Hatte sie das Bewusstsein verloren?
Als sie die Hand hob und nach einem Rufknopf suchte, merkte sie, dass sie an einer Infusion hing. Ein kleines Gerät an ihrem Finger verband sie mit einem Monitor auf der anderen Seite des Betts.
»Sie sind wach.« Eine rauchige Stimme erklang neben ihr. Dann trat jemand in ihr Gesichtsfeld. Eine Frau beugte sich über sie. Ihr Blick wanderte von Lalehs Gesicht zum Monitor und wieder zurück. Das einzige Detail, das Laleh wirklich an ihr wahrnahm, waren ihre auffallend blauen Augen. Die Farbe passte zu der ihrer OP-Kleidung.
War die Fremde eine Krankenschwester?
Aber sie trug einen Laborkittel, von dem sich ihr kinnlanges, welliges, dunkelbraunes Haar abhob. Ihr Name war oberhalb der Brusttasche in großen blauen Buchstaben eingestickt: Dr. Hope Finlay.
»Ich bin Dr. Finlay«, sagte die Ärztin. »Wie fühlen Sie sich?«
Lalehs Hände huschten über ihre Brust. Ihre Bluse war verschwunden. Stattdessen trug sie ein Krankenhausnachthemd. Ihre Rippen schmerzten, aber ansonsten tat nichts weh und ihr Herz hatte aufgehört zu rasen. Sie musste sich räuspern, ehe sie antworten konnte. »Als hätte ich zwölf Runden mit einem Schwergewichtschampion hinter mir und hätte den Kampf eindeutig verloren.« Sie deutete mit der Hand, an der nicht die Infusion hing, auf ihren Brustkorb.
Ein leichtes Lächeln umspielte die Mundwinkel der Ärztin. »Das ist nicht ungewöhnlich. Wir mussten eine Herzmassage durchführen. Erinnern Sie sich daran, was passiert ist?«
Herzmassage? Laleh schnappte nach Luft. Sie konnte nicht glauben, dass ihr das passierte. Nach einem Moment nickte sie benommen. »Meine Mutter hat mich zur Notaufnahme gefahren, weil mein Herz nicht aufhören wollte zu rasen. Ich glaube, ich bin zusammengebrochen. Was stimmt denn nicht mit mir?« Sie konnte die Angst nicht aus ihrer Stimme fernhalten.
»Wir sind noch dabei, einige Analysen zu machen, deshalb können wir es noch nicht sicher sagen.«
»Aber wenn Sie raten müssten?« Laleh sah die Ärztin mit flehendem Blick an. Nicht zu wissen, was mit ihr los war, machte sie ganz wahnsinnig.
»Dann würde ich auf …«
»Dr. Finlay!«, rief eine Krankenschwester durch die offene Schiebetür. »Wir kriegen gleich einen Verkehrsunfall mit multiplen Verletzungen rein und Dr. Wang ist mit einem Verdacht auf Herzinfarkt beschäftigt.«
»Wie lange, bis sie hier sind?«, fragte die Ärztin.
»Der RTW biegt gerade aufs Klinikgelände ein.«
Schon Sekunden später erklangen hastige Schritte im Flur vor Lalehs Zimmer und irgendwo schrie ein Patient vor Schmerzen.
»Ich bin unterwegs.« Dr. Finlay sah zu Laleh. Trotz des Chaos auf der anderen Seite der Tür wirkte sie ruhig und konzentriert. »Ich komme später wieder. Ruhen Sie sich etwas aus.«
Dann schritt sie aus dem Raum. Ihr weißer Kittel wehte hinter ihr.
Laleh starrte ihr nach. Noch immer konnte sie kaum fassen, was passiert war.
* * *
Mann, was für ein Tag!Zusätzlich zu den zwei Reanimationen, die sie während der Nachtschicht durchgeführt hatte, überrannten jetzt auch noch Patienten mit Halsentzündungen, Bauchschmerzen und Schnittwunden die Notaufnahme. Hope hatte längst aufgehört, mitzuzählen, wie viele Patienten sie seit Schichtbeginn vor fünf Stunden behandelt hatte. In der Notaufnahme war so viel los, dass einige Patienten sogar auf Rolltragen auf den Gängen lagen, während sie darauf warteten, dass auf den normalen Stationen Betten frei wurden. Sie hatte keine Zeit gehabt, etwas zu essen oder auch nur zur Toilette zu gehen.
Jedes Mal, wenn sie an Behandlungsraum vier vorbeikam, blieb sie stehen und sah durch die offene Tür, um sicherzugehen, dass es Laleh Samadi nach wie vor gut ging. Der Monitor neben dem Bett zeigte normalen Sinusrhythmus. Die QRS-Komplexe sahen gut aus und Ms. Samadis Herzfrequenz und ihr Blutdruck waren stabil. Selbst die Infusion war entfernt worden. Die Patientin war orientiert und ansprechbar und unterhielt sich gerade mit ihrer Mutter.
Siehst du? Alles war in bester Ordnung. Die Patientin war jung und, abgesehen von gelegentlichen Tachykardien, gesund. Nichts deutete auf weitere Probleme hin.
Warum kam sie also immer wieder zu diesem Zimmer zurück, um nach dieser Patientin zu sehen?
»Dr. Finlay?«, rief Paula von der Schwesternstation.
Hope wandte Behandlungszimmer vier den Rücken zu und ging zu Paula hinüber.
»Ich sollte Sie doch wissen lassen, wenn die Laborergebnisse von Ms. Samadi da sind«, sagte Paula.
»Na endlich.« Das Labor war genauso überlastet wie der Rest des Krankenhauses. »Danke.« Froh, endlich ein paar Minuten lang nicht mehr auf den Füßen sein zu müssen, setzte Hope sich an einen der PC-Arbeitsplätze und loggte sich in den Computer ein, um sich die Laborberichte anzusehen.
Vielleicht würden diese ihr Anhaltspunkte dafür liefern, was Ms. Samadis Kammerflimmern ausgelöst hatte. Dann konnte sie endlich beruhigt sein. Aufmerksam sah sie sich jeden Laborwert an.
Die Kalium-, Kalzium- und Magnesiumspiegel waren alle normal. Ein gestörter Elektrolythaushalt konnte also schon mal nicht die Ursache der Arrhythmie sein. Die Herzenzyme waren auch bei der zweiten Messung genauso normal wie vor drei Stunden. Offensichtlich hatte die Patientin keinen Herzinfarkt erlitten. Nicht, dass sie das bei einer so jungen Patientin erwartet hatte. Die Ultraschalluntersuchung hatte keine strukturellen Schäden am Herzen offenbart und das EKG zeigte auch nichts Auffälliges. Nach den Blutwerten zu schließen, hatte Ms. Samadi nicht einmal eine Erkältung.
Trotzdem wurde sie das Gefühl nicht los, dass irgendetwas nicht stimmte.
Ach, komm schon! Seit wann vertraust du auf völlig unbegründete Bauchgefühle?
Sie schloss die digitale Akte, loggte sich aus und stand auf. Es war an der Zeit, mit der Patientin zu reden.
Sie klopfte an die offene Tür von Behandlungsraum vier und trat ein.
Mrs. Samadi war im Stuhl neben dem Bett eingeschlafen, aber ihre Tochter war wach. Ihre Augen, so warm und dunkelbraun wie der Kaffee, nach dem Hope sich seit Stunden sehnte, waren ein wenig glasig.
Kein Grund zur Beunruhigung, sagte sich Hope. Es war nach Mitternacht und nach allem, was Ms. Samadi heute durchgemacht hatte, war ihre Erschöpfung nicht weiter überraschend.
Ms. Samadi musterte sie. Eine Falte formte sich zwischen ihren dunklen Augenbrauen. »Stimmt etwas nicht? Mein EKG und die Laborwerte …?«
Na toll. Jetzt hatte sie der Patientin einen Schrecken eingejagt. Normalerweise setzte sie bei der Arbeit immer ihr Pokerface auf, aber scheinbar hatte der Stromstoß sie mehr aus der Bahn geworfen, als sie zugeben wollte. »Nein, damit ist alles in Ordnung«, sagte sie hastig. »Alle Tests, die wir durchgeführt haben, waren negativ. Wurde bei Ihnen schon einmal ein EKG gemacht?«
»Ja. Damals, vor vier Jahren, als das Herzrasen zum ersten Mal auftrat, bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Aber als ich dort ankam, hatte es längst aufgehört. Der Arzt sagte, das EKG sehe ganz normal aus und dass es nur vom Stress komme. Aber es steckt mehr dahinter, oder?«
Hope zog den Rollhocker neben das Bett und setzte sich. »Ja. Mit Sicherheit können wir es erst nach einer elektrophysiologischen Untersuchung sagen, aber wenn ich mir Ihre Symptome so anschaue, könnte es AVNRT sein. Das ist eine Arrhythmie, die von einer zusätzlichen Leitungsbahn im Herz ausgelöst wird.«
Ms. Samadi legte eine Hand auf ihre Brust, direkt über dem Herzen, und rieb die Stelle nachdenklich. »Wenn es wirklich AVNRT ist …« Sie wiederholte die Abkürzung, ohne sich zu verhaspeln. »Gibt es Medikamente, mit denen man es behandeln kann?«
»Das wäre eine Option, aber in Ihrem Fall hätten wir eine bessere Methode. Wir würden über eine Beinvene einen Katheter in Ihr Herz einführen und damit das Problem ein für alle Mal beseitigen. Wie klingt das?«
Im Stuhl neben dem Bett begann Mrs. Samadi zu schnarchen.
»Klingt großartig. Mein Problem zu beseitigen, nicht das Schnarchen«, fügte Ms. Samadi lächelnd hinzu. »Was passiert als Nächstes?«
»Wir verlegen Sie auf die CCU. Das ist die …«
»Die kardiologische Überwachungsstation.«
Hope sah sie neugierig an. Vielleicht war ein Freund oder Familienmitglied mal in der CCU gewesen und Ms. Samadi war deshalb mit dem Begriff vertraut. »Genau. Wir werden Sie dort für ein oder zwei Tage unter Beobachtung halten, bis wir einen Termin für die Katheterablation frei haben. Wenn alles gut geht, können wir Sie am Tag danach nach Hause entlassen.«
»Das klingt sogar noch besser. Nichts gegen Ihre Gastfreundschaft, aber … nun ja … das Krankenhaus ist nicht gerade mein liebster Ferienort.«
Hope lachte. »Ich verstehe.«
Mrs. Samadis Schnarchen brach ab. Sie setzte sich auf und blinzelte ins Licht. »Gibt es Neuigkeiten?«, fragte sie, als sie Hope sah.
»Ja. Zum Glück nur gute«, sagte ihre Tochter, noch bevor Hope antworten konnte. »Dr. Finlay glaubt, dass ich etwas habe, was man leicht beheben kann.«
Paula sah durch die offene Schiebetür herein. »Es ist endlich ein Bett in der CCU freigeworden. Wir bringen Sie jetzt nach oben, Ms. Samadi.«
Paula und eine Schwesternhelferin betraten den Raum und lösten die Kabel vom Monitor. Innerhalb von Sekunden hatten sie die Bremse gelöst, die die Räder der Liege blockierte, und schoben Ms. Samadi auf den Flur. Ihre Mutter folgte.
»Danke, Dr. Finlay«, rief Ms. Samadi durch die Tür zurück.
»Gern geschehen.« Hope sah zu, wie die Schwestern sie zum Aufzug schoben, dann gab sie sich einen Ruck und erhob sich vom Hocker. Andere Patienten und eine Menge Papierkram warteten.
KAPITEL 3
»Wir haben den Termin für die Katheterablation für morgen früh angesetzt«, sagte Dr. Myers.
Na endlich! All die Warterei und das Herumliegen trieben Laleh in den Wahnsinn. Fast ein ganzer Tag war vergangen, seit man sie auf die Überwachungsstation verlegt hatte und sie wollte endlich raus aus dem Krankenhaus.
Ihre Eltern, die neben dem Krankenhausbett standen, sahen genauso erleichtert aus, wie sie sich fühlte.
»Das Vorgehen ist eigentlich ganz einfach«, sagte Dr. Myers. »Wir werden …«
Das Klingeln von Lalehs Handy unterbrach den Arzt mitten in seiner Erklärung.
Mit brennenden Wangen griff sie nach dem Handy auf dem Nachttisch. Die Krankenschwestern sahen es nicht gern, wenn man Handys benutzte, aber sie wusste, dass es dabei nur um das ständige nervtötende Klingeln ging. Ihr Handy würde die medizinischen Geräte nicht stören. »Tut mir leid.«
Gerade als sie ihr Handy ausschalten wollte, fiel ihr Blick aufs Display.
Der Anrufer war Jill.
Mist. War sie zum Restaurant gefahren und hatte dort von Lalehs Tante erfahren, was passiert war? Falls ja, war sie jetzt vermutlich außer sich vor Sorge. »Ich muss rangehen. Dauert nicht lange.« Rasch nahm sie den Anruf an und hob das Handy ans Ohr. »Jill?«
»Laleh! Was ist passiert? Deine Tante sagte …«
»Mir geht’s gut. Wirklich.«
»Herzprobleme bezeichnest du als gut?«, fragte Jill.
»Es war ja kein Herzinfarkt oder Ähnliches, nur ein paar Arrhythmien«, sagte Laleh und versuchte, so beruhigend wie möglich zu klingen. Sie wusste, dass Jill später ein Vorsprechen haben würde. Falls Jill glaubte, dass Laleh sie brauchte, würde sie den Termin absagen und an ihr Krankenbett eilen. »Ich muss mich morgen nur einer klitzekleinen Prozedur unterziehen und schon bin ich wieder ganz die Alte.«
»Bist du sicher?«
»Klar bin ich sicher. Würden die mich sonst morgen schon nach Hause lassen?«
Jill holte hörbar Luft, vermutlich, um ihr zu sagen, dass sie trotzdem vorbeikommen würde.
»Jill, ich muss auflegen. Der Arzt ist gerade hier, um mit mir zu reden. Ich rufe dich an, sobald ich morgen wieder in meinem Zimmer bin. Viel Glück beim Vorsprechen.« Sie beendete den Anruf, bevor Jill widersprechen konnte, und lächelte Dr. Myers entschuldigend an.
Zehn Minuten später nickte sie zu all seinen Erklärungen und unterschrieb die notwendigen Papiere. Der Vorhang schloss sich hinter dem Arzt.
Ihre Mutter sah ihm stirnrunzelnd nach. »Warum können Ärzte nicht wie normale Menschen sprechen? Ich hab kein Wort von dem verstanden, was er über dein Herz gesagt hat.«
»Ist doch ganz einfach, Maman. Du weißt doch, dass jeder Herzschlag von einem elektrischen Signal ausgelöst wird, oder?« Sie sah von einem Elternteil zum anderen.
»Natürlich.« Ihr Vater nickte, obwohl er genauso ahnungslos aussah wie ihre Mutter. Als junger Mann im Iran hatte er an einer Universität Ingenieurswesen unterrichten wollen. Nie hätte er zugegeben, eine Erklärung nicht verstanden zu haben.
»In der Mitte des Herzens befinden sich spezialisierte Muskelzellen, die wir den AV-Knoten nennen«, fuhr Laleh fort.
»Wir?«, fragte ihre Mutter.
»Ähm, ich meine, die Ärzte.« Laleh musste über sich selbst lachen. Sie war erst seit einem Tag im Krankenhaus, aber scheinbar hielt sie sich bereits für einen Teil des Kliniksystems. »Wie dem auch sei, der AV-Knoten ist so eine Art Verkehrsampel, die die elektrischen Signale verzögert, damit die Herzkammern genug Zeit haben, sich mit Blut zu füllen, bevor sie sich zusammenziehen. Die Ärzte glauben, dass ich eine zusätzliche elektrische Leitungsbahn habe.«
»Zwei solcher Verkehrsampeln?«, fragte ihr Vater.
»Genau. Und die zusätzliche steht ständig auf Grün, deshalb kommen die elektrischen Signale viel zu schnell. Deswegen rast mein Herz dann. Morgen früh wollen die Ärzte diese überflüssige Verkehrsampel veröden.«
Ihr Vater nickte, als hätte er das alles bereits gewusst.
Lalehs Mutter starrte sie an. »Und das hast du alles verstanden, obwohl er nur Kauderwelsch gesprochen hat?« Sie deutete in die Richtung, in die der Arzt verschwunden war.
»Selbstverständlich.« Laleh zuckte mit den Schultern. »Ich schätze, mir ist vom Bio-Unterricht noch mehr im Gedächtnis geblieben, als ich dachte.«
»Siehst du?« Ihr Vater stupste sie sanft an. »Ich sage ja immer, du hättest studieren sollen. Du bist klug genug, um Ärztin zu werden.«
Laleh stöhnte. Na prima. Sie lag im Krankenhaus und ihr Vater nutzte die Gelegenheit, um sie daran zu erinnern, dass sie ihr Potenzial vergeudete, wenn sie keinen Uniabschluss machte.
»Lass doch.« Ihre Mutter legte ihm eine Hand auf den Arm und beugte sich zu Laleh hinab. »Hast du keine Angst vor morgen, Laleh joon?«, fragte sie im Flüsterton.
»Ein bisschen«, sagte Laleh. Okay, zugegebenermaßen war sie ziemlich nervös. Immerhin hatten die Ärzte vor, einen Teil ihres Herzens mit einem heißen Draht zu zerstören. Das war kein angenehmer Gedanke, doch sie beschloss, diese Ängste zu ignorieren und sich auf die Fakten zu konzentrieren. »Ich vertraue den Ärzten. Dr. Myers ist vielleicht nicht der Beste darin, wenn es darum geht, mit medizinischen Laien zu sprechen, aber ansonsten scheint er sehr kompetent zu sein. Mit fünfundneunzig-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird die Ablation mein Herzproblem beheben. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief läuft, beträgt nur drei Prozent. Das sind doch gute Aussichten.«
Ihre Mutter runzelte die Stirn. »Hat der Doktor das gesagt?«
Laleh dachte darüber nach. Sie konnte sich nicht an seine genauen Worte erinnern. Hatte er diese Zahlen genannt? »Muss er wohl. Wie könnte ich es sonst wissen?«
Ehe ihre Eltern etwas sagen konnten, zog eine Krankenschwester den Vorhang um Lalehs Bett beiseite. »Tut mir leid, aber die Besuchszeiten sind vorüber. Wir sollten die Patientin nun schlafen lassen. Sie können sie morgen direkt nach der Behandlung im Aufwachraum sehen.«
Tränen traten ihrer Mutter in die Augen, als sie sich über Laleh beugte und sie auf beide Wangen küsste. Sie hielt sie so fest, als wollte sie Laleh nie wieder loslassen.
»Wird schon alles gut gehen, Maman. Ich verspreche es. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache.«
Ihre Mutter umklammerte sie noch einen Augenblick länger und ließ dann los. »Ich bringe dir etwas zu essen mit«, flüsterte sie, bevor sie zurücktrat. »Bita war letztes Jahr in diesem Krankenhaus und sie sagt, das Essen sei schrecklich.«
Laleh musste lächeln. Typisch ihre Mutter, die ständig dafür sorgte, dass jeder genug zu essen hatte. Sie stellte sich vor, wie sie Dutzende von Tupperdosen ins Krankenhaus schmuggelte, als ginge es um eine geheime Mission.
Ihr Vater küsste sie ebenfalls auf beide Wangen und sah ihr dann einen Moment lang in die Augen. Er wirkte, als wollte er noch etwas sagen, doch dann drückte er nur Lalehs Hand und nickte ihr zu.
Das Letzte, das Laleh sah, war, wie ihre Eltern sich an den Händen nahmen, dann schloss sich der Vorhang hinter ihnen.
* * *
Hopes Schicht war schon vor einer Stunde zu Ende gegangen, aber bis sie ihren Papierkram erledigt und die Kollegen von der Tagschicht auf den neuesten Stand gebracht hatte, war es schon nach acht. Selbst die Schwestern der Nachtschicht waren schon gegangen.
Gähnend zog sich Hope einfach nur die Lederjacke über ihre OP-Kleidung und ging an der Schwesternstation vorbei. Statt schnurstracks zu ihrem Auto zu marschieren, fand sie sich vor dem Aufzug wieder. Es würde nicht lange dauern, kurz zur Überwachungsstation hochzufahren und zu sehen, wie es Ms. Samadi während ihrer Katheterablation ergangen war.
Spinnst du? Seit wann siehst du nach Patienten, die schon aus der Notaufnahme entlassen wurden?
Nur einmal hatte sie sich erlaubt, auf der Intensivstation nach einem kleinen Mädchen zu sehen, das von einem betrunkenen Autofahrer angefahren worden war. Normalerweise endete ihr Kontakt mit Patienten, sobald diese die Notaufnahme verließen. Hope mochte es so. Es war ein Teil dessen, was ihr an der Notfallmedizin gefiel. Manche Kollegen bedauerten es, Patienten nach Schichtende nicht weiter verfolgen zu können, aber Hope genügten die kurzen Patientenkontakte. Statt eine Langzeitbeziehung mit ihren Patienten aufzubauen, wie ein Hausarzt, konnte Hope sie entweder entlassen oder an den Operationssaal oder eine der Stationen weiterreichen, sobald die Patienten stabil genug waren. Wenn ihre Kindheit und ihre Beziehungen sie eines gelehrt hatten, dann dass es keine gute Idee war, sich allzu eng zu binden. Keine Bindung hielt auf ewig.
Genau. Also halt emotionalen Abstand. Geh nach Hause, nimm dir was vom Chinesen mit und schlaf dich aus.
Energisch schritt sie am Fahrstuhl vorbei in Richtung Ausgang.
Aber noch bevor sie das Krankenhaus verlassen konnte, trat ihr ein Mann in den Weg. »Entschuldigung. Können Sie mir zufällig sagen, wo sich die kardiologische Überwachungsstation befindet?«
»Klar.« Sie zeigte über die Schulter hinweg zu dem Aufzug, den sie gerade hinter sich zurückgelassen hatte. »Sie fahren in die dritte Etage und halten sich rechts. Sie können es gar nicht verfehlen.«
»Danke.«
»Kein Problem, Mr. Samadi.«
Sie wollte an ihm vorbeigehen, aber er versperrte immer noch den Weg und starrte sie nun an.
»Woher kennen Sie meinen Namen?«, fragte er.
»Ihren Namen?« Was zum Teufel faselte er da?
Er nickte so oft, dass er wie ein Wackeldackel aussah. »Ja. Sie haben mich eben Mr. Samadi genannt.«
Im Ernst?
»Kennen wir uns?«, fragte er.
Normalerweise hatte Hope ein gutes Gedächtnis für visuelle Dinge und auch für Gesichter. Sie war sich ziemlich sicher, ihn noch nie zuvor gesehen zu haben. Trotzdem wirkte er vertraut. Mit seinen schwarzen Haaren, den großen braunen Augen und der gebräunten Haut hätte man ihn für einen Italiener halten können, aber seine lange, gerade Nase und die hohen Wangenknochen deuteten eher darauf hin, dass er aus dem mittleren Osten stammte. »Nein, aber ich vermute, Sie sind Laleh Samadis Bruder.«
Er riss die Augen auf. »Woher wissen Sie das?«
»Ich war die Ärztin, die Ihre Schwester vorgestern in der Notaufnahme behandelt hat. Sie sehen ihr ziemlich ähnlich.«
»Ach ja?« Er fuhr sich mit den Händen durch die Haare. »Hm.«
»Außerdem haben Sie nach dem Weg zur Überwachungsstation gefragt, also habe ich eins und eins zusammengezählt.«
»Ach so.« Der verblüffte Ausdruck verschwand aus seinem Gesicht und er trat zur Seite. »Dann gehe ich jetzt mal meine Schwester besuchen und lasse Sie gehen.«
Sollte sie ihm Grüße an seine Schwester ausrichten? Nein. Sie war nie mit ehemaligen Patienten in Kontakt geblieben, auch nicht über Dritte. Außerdem hatte Ms. Samadi in den vergangenen Tagen vermutlich so viele Ärzte kennengelernt, dass sie sich gar nicht mehr an Hope erinnern würde.
Mit einem Kopfnicken ging sie an ihm vorbei in Richtung Parkplatz, ohne sich dabei zu gestatten, über die Schulter zurückzublicken.
KAPITEL 4
»Bist du sicher, dass du gehen willst?«, fragte ihre Mutter zum x-ten Mal. »Du bist doch kaum aus dem Krankenhaus zurück.«
Laleh seufzte. »Ich bin schon seit zwei Wochen wieder zu Hause, Maman. Mir geht’s gut. Keine Tachykardien mehr. Außerdem unternehme ich schließlich keine Trekkingtour nach Nepal. Ich gehe nur zu einer Filmpremiere mit meiner Freundin Jill.«
Ihre Mutter folgte ihr zum Badezimmer und sah zu, wie Laleh ihre Haare kämmte. »Willst du nicht etwas Lippenstift auftragen? Da werden sicher Fotografen sein.«
Aus irgendeinem Grund sagte ihre Mutter ihr in letzter Zeit ständig, dass sie Lippenstift tragen sollte, wann immer sie ausging. Vermutlich, weil sie jetzt in einem Alter war, in dem sie sich laut ihrer Mutter mehr anstrengen musste, um sich für potenzielle Ehemänner hübsch zu machen. Wie üblich ignorierte Laleh den Ratschlag. »Ja, aber die sind nicht da, um Fotos von mir zu machen. Jill und ihre Freundinnen sind die Filmstars, nicht ich.«
»Ist sie verheiratet?«
Was hatte das denn damit zu tun? »Nein. Aber sie ist in einer Beziehung.« In einer Beziehung mit einer Frau, aber das sollte sie besser nicht hinzufügen.
Vor dem Haus hupte ein Auto.
Laleh legte die Bürste weg und nahm ihre Handtasche. »Das muss Jill sein.«
»Warum bittest du sie nicht auf ein Glas Tee herein?«, fragte ihre Mutter. »Ich würde sie gern kennenlernen.«
Laleh schüttelte den Kopf. »Dafür ist keine Zeit.« Außerdem hatte sie nicht vor, Jill den Fragen ihrer Mutter auszusetzen. Zwischen Tee und Ajil, der persischen Version von Studentenfutter, würde ihre Mutter Jill über ihre Karrierepläne, ihre Familie und ihre Beziehung ausfragen. »Schließt du die Tür ab, wenn du gehst?«
Ihre Mutter nickte und folgte ihr zur Tür. Dort zog sie Laleh zu sich herum und musterte sie von Kopf bis Fuß. Stolz leuchtete in ihren Augen. »Du siehst hübsch aus.«
Laleh lächelte. Sie zog sich nicht oft so elegant an, aber sie genoss, wie sich die Seide ihres einfachen schwarzen Kleides auf ihrer Haut anfühlte. »Sogar ohne Lippenstift?«
»Sogar ohne Lippenstift«, gab ihre Mutter zu. »Khosh begzare.«
»Danke, Maman. Ich bin sicher, dass wir Spaß haben werden.« Zwei Küsse von ihrer Mutter und schon war sie aus der Tür.
Eine schwarze Limousine parkte am Straßenrand.
»Oh!« Ihre Mutter war ihr nach draußen gefolgt und starrte das Gefährt an. »Hast du nicht gesagt, sie sei nicht berühmt? Und trotzdem holt sie dich mit einer Limousine ab?«
Laleh unterdrückte ein Schmunzeln. Ihre Mutter ließ sich vom Glanz und Glamour Hollywoods leicht beeindrucken.
»Frag sie, ob sie mal zum Essen kommen möchte.«
»Mach ich.« Aber erst, nachdem sie Jill vor den Fragen und der Tonne Essen gewarnt hatte, mit denen sie überhäuft werden würde.
»Sie kann auch ihren Freund mitbringen«, fügte ihre Mutter hinzu.
»Äh, klar.« Sicher wäre es interessant zu sehen, wie ihre Familie auf ein lesbisches Paar reagierte.
Ihre Mutter umarmte und küsste sie erneut, dann eilte Laleh zur Limousine. Sie stieß einen anerkennenden Pfiff aus, als sie sich neben Jill auf den lederbezogenen Rücksitz gleiten ließ. »Mietet das Studio jetzt schon eine Limousine nur für dich allein, obwohl es gar nicht dein Film ist? Du arbeitest dich wohl langsam an die Spitze der Hollywoodhierarchie vor.«
»Hallo erst mal«, antwortete Jill grinsend. »Und nein, ich bin nicht zur Königin von Hollywood befördert worden. Das Studio hat die Limousine nicht gemietet. Das war Crash. Ihr tat es so leid, dass sie nicht zur Premiere kommen kann, weil sie in Vancouver dreht, und sie wollte nicht, dass ich fahren muss, falls meine MS wieder den Aufstand probt.«
Was für ein Schatz! »Ich hätte dich doch abholen können.«
»Ähm, nein, danke. Ich glaube, so ist es besser.« Jill tätschelte den beigefarbenen Ledersitz.
»Was, vertraust du meinen Fahrkünsten etwa nicht?«
»Oh, deinen Fahrkünsten schon«, sagte Jill. »Aber deinem Orientierungssinn nicht.«
Zugegeben, Laleh war schuld daran, dass sie letztes Jahr zu einer Party zu spät gekommen waren, weil sie sich trotz Navigationsgerät verirrt hatte. »Aber seit ich im Krankenhaus war, setzt mein Onkel mich ein, um Essen auszufahren, damit ich nicht den ganzen Tag auf den Beinen sein muss, und ich hab mich noch nicht ein einziges Mal verfahren.«
»Ach ja?« Jill zog die beiden Wörter in die Länge und klang dabei ein bisschen wie ihre Partnerin, Crash.
»Ja.«
»Na so was. Vielleicht haben die Ärzte nicht nur dein Herzproblem, sondern auch deinen schlechten Orientierungssinn behoben.« Jill wurde ernst und berührte leicht Lalehs Arm. »Wie geht es dir überhaupt?«
»Alles bestens. In zwei Wochen soll ich noch mal vorbeikommen, damit sie ein Langzeit-EKG machen können, einfach um sicherzugehen. Aber bisher sieht es so aus, als wäre mein Herzproblem behoben. Ab sofort gibt’s kein Herzklopfen mehr.«
»Es sei denn, du findest endlich deinen Traummann«, sagte Jill augenzwinkernd.
»Es sei denn, ich finde meinen Traummann«, wiederholte Laleh mit einem Nicken. »Aber bis ich meinen Ritter in glänzender Rüstung finde, kann ich meine Drachen auch sehr gut allein bekämpfen.«
»Wer sagt denn, dass du aufhören musst, Drachen zu bekämpfen, nur weil du in einer Beziehung bist?«
Laleh zuckte mit den Schultern. »Na ja, iranische Männer erwarten eben, dass sie diejenigen sind, die das Schwert schwingen.«
»Und du glaubst, dass du mal einen Iraner heiraten wirst?«
»Das erwarten meine Eltern jedenfalls«, sagte Laleh. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie mit Jennifer, der amerikanischen Frau ihres Bruders Navid, warmgeworden waren.
Eine winzige Falte entstand zwischen Jills Augenbrauen. »Sie wollen doch nicht etwa eine Ehe für dich arrangieren, oder?«
Laleh lachte. »Nein. Das hat für meine Eltern funktioniert, aber sie wissen, dass ich das nie mitmachen würde. Sie versuchen nur nicht gerade behutsam, mich auf Männer aufmerksam zu machen, die sie für gute Ehemänner halten.«
Jill machte große Augen. »Die Ehe deiner Eltern wurde arrangiert?«
»Meine Mutter besteht darauf, es eine ermutigte Ehe, nicht eine arrangierte Ehe zu nennen, aber ich kenne meine Großmutter. Die Frau hätte einen Fisch dazu bringen können, ein Fahrrad zu kaufen. Meine Mutter hatte keine Chance, Nein zu sagen.«
»Wow.«
Schweigen breitete sich in der Limousine aus.
Laleh presste die Lippen aufeinander. Sie hasste solche Situationen, in denen die beiden Kulturen, denen sie angehörte, aufeinanderprallten. Sie fühlte sich, als müsste sie die Ehe ihrer Eltern verteidigen. »Wenigstens hat meine Großmutter gut gewählt. Ich kenne nur wenige Paare, die nach zweiunddreißig Jahren Ehe noch immer glücklich miteinander sind.«