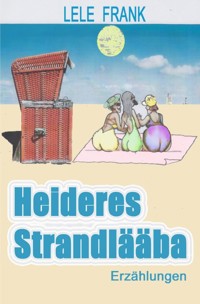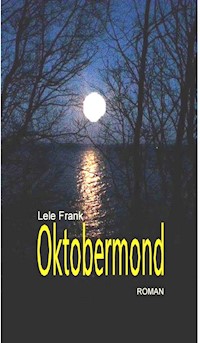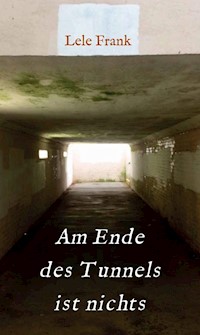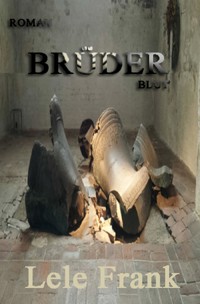Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach zweinunddreißig Jahren Ehe kommen Frauke langsam Zweifel an ihrem Leben. Ausgerechnet an ihrem sechzigsten Geburtstag stellt sie fest, dass sie doch für ihren Mann Claus eigentlich nur noch eine Requisite darstellt. Ihre beiden Söhne nehmen sie schon lange nicht mehr wahr, sie stehen auf eigenen Füßen und leben ihr Leben. Für sie ist sie einfach nur noch die Frau die Ihnen das Leben geschenkt hat. in der Nacht nach ihrem Geburtstagsfest fallen die Erkenntnisse über sie her, als hatten sie nur darauf gewartet. Unbemerkt war sie in der Lethargie ihrer Ehe so fest verankert, dass sie die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber verloren hat. Sie spürt sich nicht mehr, sieht nicht mehr hin, lebt selbst genau das was sie nie wollte. Die Selbstverständlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lele Frank
J … (L)etztendlich 60
Buch 4
Das Buch
Nach zweiunddreißig Jahren Ehe kommen Frauke langsam Zweifel an ihrem Leben. An ihrem sechzig-sten Geburtstag stellt sie fest, dass sie doch eigentlich für ihren Ehemann Claus nur noch eine Requisite darstellt. Ihre beiden Söhne nehmen sie schon lange nicht mehr wahr, sie stehen auf eigenen Füßen und leben ihr Leben. Für sie ist sie einfach nur noch die Frau die sie zur Welt gebracht hat. Frauke brüskiert einige ihrer Gäste, und es kommt zum ersten Eklat im Freundeskreis. In der Nacht nach Ihrem Geburtstagsfest fallen die Erkenntnisse über sie her, als hätten sie genau auf diesen Augenblick gewartet. Unbemerkt war sie in der Lethargie der Ehe so fest verankert, dass sie die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber verloren hat. Sie spürt sich nicht mehr, sieht nicht mehr hin. lebt selbst genau das, was sie nie wollte.
Die Selbstverständlichkeit.
J … (L)endlich 60
… es ist nie zu spät
Lele Frank
Impressum
© 2015 Lele Frank
Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN 978-3-7375-2747-7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Fang nie an aufzuhören,
hör nie auf anzufangen.
Marcus Tullius Cicero
„Liebling, machst du mir bitte mal den Reißverschluss zu?“ Ich stehe mit meinen schwarzen Pumps in der linken- und der Handtasche in der rechten Hand vor dem großen Sofa, und blicke auf meinen Mann herab. „Mh“... antwortet er mir geistesab-wesend, tief ins Innere seines i-pads vertieft. Dieses Stück Metall mit der verführerisch schwarzglänzenden Oberfläche, die innerhalb von Sekunden die ganze Welt ins Zimmer holt, ist natürlich viel sexyer als ich. Das ist mir natürlich bewusst. Den Kampf gegen dieses verfluchte Ding habe ich schon vor Jahren aufgegeben. Keine Chance. Ich stehe immer noch vor ihm auf derselben Stelle, eine ganze Weile schon. Vielleicht hat er ja den Inhalt meiner Frage nicht verstanden, denke ich leicht gereizt, und starte erneut einen Versuch ihn aus der Lethargie seiner Displaybesichtigung zu reißen. „Liebling, bit-te mach' mir den Reißverschluss zu, wir sollten uns nämlich langsam auf den Weg machen.“ „Mh“ ...! Es passiert wieder nichts. Ich rühre mich nicht von der Stelle und bleibe weiterhin ausharrend stehen. Endlich blickt er zu mir hoch, und erhebt sich unter jammervollem Ächzen aus den Tiefen der viel zu weich gepolsterten Sitzfläche. Schweigend drehe ich mich um, damit er mühelos den Reiß-verschluss griffbereit vor der Nase hat. Schweigend zieht er ihn zu, dreht sich um, wirft einen letzten sehnsuchtsvollen Blick in Richtung i-pad, und folgt mir weiterhin schweigend in die Diele. Mir war, als hätte ich einen leisen Seufzer vernommen. „Ich fahre schon mal den Wagen aus der Garage“, höre ich ihn nuscheln. Weg ist er. Ich stehe in der Diele und starre auf die Eingangstür die gerade ins Schloss gefallen ist. Ich starre immer noch als ich von einem aufdringlichen Hupton aus meiner Lähmung gerissen werde. Schnell schlüpfe ich in meine Schuhe, greife unsere Mäntel, werfe einen allerletzten Blick in den Spiegel, und eile zum wartenden Auto. Mein Mann sitzt am Steuer und macht ein Gesicht, als führen wir zu einer Beerdigung. Nichts Besonderes, denn es ist sein Alltagsgesicht. Ich kenne es ja nicht besser. „Hast du Geld eingesteckt“, frage ich. „Mh“... lautet die Antwort. Ergiebig, anders kann man nicht sagen. Er gibt sich wirklich Mühe. Zehn Jahre hat sie mich begleitet, die Fünf. Wenigstens hatte sie noch zwei Ecken, was man von der geschmeidigen sechs nicht gerade behaupten kann. Nur noch ein kleiner Zipfel ragt keck nach oben. Das war es dann auch schon was die sechs an Rebellion vorzuweisen hat. Der Rest ist biegsam und anpassungsfähig. Als wäre es damit nicht genug, folgt darauf die vollkommen homogene Null. Sie traut sich nicht aufzumucken, hält die Enden aneinander so fest, dass man keinen Anfang und kein Ende mehr erkennen kann. Sie tut
so neutral, und leitet doch einen neuen Abschnitt ein, die hübsch geschwungene 6. Harmlos verführt sie den Betrachter, verkündet aber unumgänglich: … „auf zur nächsten Runde.“ Ja, genau. Heute war mein sechzigster Geburtstag. Ich hatte mich tatsächlich auf diesen Tag gefreut, weil ich mir in tiefster Überzeugung einbildete, dass ich ab sofort die Resignation der ich mich die letzten Jahre hinge-geben hatte nicht mehr spüren will. Dass die Selbstverständlichkeiten endlich selbstverständlich würden, die Erwartungen an eine Wendung endlich ganz und gar verschwinden aus meinem Kopf. Die Kritik die ich mir selbst zuteilwerden ließ beim Blick in den Spiegel, sich endgültig in Luft auflöste. Der Tag an dem ich vollkommen über den Dingen stehen würde, der sollte heute sein. Heute an meinem Sechzigsten. Jetzt war ich losgelöst, unantastbar. Es ist wie es ist. Eine wundervolle Lüge der ich mich hinzugeben geschworen hatte.
Wir parkten den Wagen genau vor dem Haupteingang des Hotels in dem die Feier stattfinden würde. Vor dem Haupteingang standen zwei geladene Ehepaare und rauchten. Als sie uns vorfahren sahen, winkten sie als hätten wir uns Jahrhunderte nicht mehr zu Gesicht bekommen. „Falsches Pack“, dachte ich. Letzte Woche hat Bettina noch im Tennisclub erzählt, dass ich mir literweise Botox ins Gesicht schießen lassen würde. Auf die Idee würde ich niemals kommen, denn ich habe eine Spritzenphobie. Nur der Gedanke versetzt mich in helle Panik. Ingrid und Bettina waren herausgeputzt, als würden sie zu den Filmfestspielen nach Venedig gehen. Ich kam mir mit meinem „kleinen Schwarzen“ schon leicht im Nachteil vor. Aber um mich nach dem Geschmack meines Mannes zu richten, durfte ich es nicht übertreiben, er schätzte es nicht. Dezenz in jeder Hinsicht war nur eine seiner schwerfälligen Lebens-philosophien. „Wie schafft ihr es nur, nach so vielen Ehejahren noch immer ein so schönes Paar zu sein“, fragte Ingrid. Sie war charakterlich gesehen eine aufrichtige Frau, und meinte was sie sagte. Also konnte ich keinen Sarkasmus in die Frage hinein interpretieren. Wogegen die gleiche Frage von Bettina gestellt, schon ein ganz anderes Kaliber dargestellt hätte. „Viel mit-einander reden“, gab ich aus einem Reflex heraus zur Antwort, und kam mir auf der Stelle unsagbar schlecht vor. „Ja“, sagte Ingridchen. „Wem sagst du das. Ich bin schon froh, wenn mein Herr Gemahl sich überhaupt noch mit mir unterhält. Meine Themen interessieren ihn einfach nicht.“ Ich fasste sie kurz liebevoll um die Taille und hauchte ihr rechts und links ein Luftküsschen zu. Dieses Ritual musste ich zwangsläufig bei den anderen drei Per-sonen auch wiederholen, sonst käme es zu unwill-kommenen Eifersüchteleien und Mutmaßungen warum ich gerade Ingrid bevorzuge. Tatsächlich, leider muss man auf solche Petitessen achten. Der kleinste Fehler kann unüberschaubare Auswirkungen nach sich ziehen. „Du siehst wirklich zauberhaft aus, altes Mädchen.“ Holger nahm mich in den Arm, und drückte herzhaft zu. Ein Zeichen seiner natür-lichen Herzlichkeit. Eine Wohltat bei der man nicht nach Unaufrichtigkeiten suchen musste. Ich habe mich sehr über dieses Kompliment gefreut, und spürte eine leichte Röte in mir aufsteigen. Verlegen lächelnd begegnete ich dem Blick meines Mannes. Er rieb sich die Nase und hielt den Kopf ganz leicht gesenkt. Das macht er immer wenn er verlegen ist. Nach so vielen Ehejahren wusste selbst er was ich gerade dachte. Verstohlen taxierte er mich von oben bis unten, und wähnte sich unbeobachtet. Allerdings weiß ich auch wo er hinsieht, ohne ihn unmittelbar zu betrachten. Man befähigt sich dieser vor-teilhaften Spezialität, wenn man nahezu unsichtbar geworden ist. Lasse – der Mann von Bettina – klopfte meinem Mann kumpelhaft auf die Schulter, und beglückwünschte ihn als „alter Sack“ wie er ihn scherzhaft bezeichnete, zu einer Ehefrau wie mich. Im Blick von Bettina lag nicht die geringste Spur von Zustimmung. Sie war eifersüchtig, obwohl sie ihren Mann seit Jahren mit ihrem Kollegen betrog. Woher ich das weiß? Man hat es mir geflüstert, und dann habe ich sie sogar einmal mit ihrem Kollegen in vertrauter Position gesehen. Aber sie mich nicht, und so blieb ich Gott sei Dank von verlogenen Rechtfertigungen verschont. „Lasst uns reingehen, ich verspüre langsam ein wenig Appetit“, sagte ich, und marschierte voraus. Mein Mann trottete hinterher, als sei er einer der Gäste, und hätte kein Recht dazu an meiner Seite zu gehen. Das machte er immer so, einen gelangweilten Eindruck, zur Schau getragenes Desinteresse, aber wieso fiel es mir gerade jetzt auf. Ich fühlte einen Stich in der Herzgegend. Heute weigerte ich mich dieses Gefühl mit gespielter guter Laune zu verdrängen, nein, ich ließ es zu. Konsterniert drehte ich mich kurz zu ihm um, damit er mein seelisches Unglück registrieren konnte, aber er war schneller, und tat so als suche er etwas in seiner Jackentasche. Mein gefühltes Stigma war nicht an den Mann zu bringen, es blieb ungesehen.
Die anderen zehn Gäste warteten bereits an der Bar. Nur ein kleiner Kreis war geladen, was meinen Mann dazu veranlasste zu sagen, wir hätten das doch auch zu Hause machen können, dann wäre es nicht so kostspielig geworden. Geld war vom ersten Tag unserer Ehe, bis zum heutigen Tag immer ein Reizthema. Es musste gehortet, gespart, gesichert oder angelegt werden. Man könnte ja mit etwas Pech hundert Jahre alt werden, und dann höchst erfreut darüber sein, auf Vorräte zurückgreifen zu können. Das hier und jetzt war nicht von Belang. Ob ich selbst etwas davon gehabt hätte - wenn die Einladung bei uns zu Hause stattgefunden hätte - ebenso wenig. „Genießen“ war für ihn das Unwort der heutigen Neuzeit. Genießen war unanständig. Dazu ließen sich nur die Unterschichten hinreißen, nicht jedoch ein Haushalt mit einem hochdotierten Akademiker als Vorstand. Mein leidenschaftliches Hobby als Autorin brachte mir monatlich einen Betrag ein, der es mir ermöglichte eine solche Ein-ladung auszusprechen. Im Gegenzug blieb also sein Veto von mir ungehört. Ob ich nicht von diesem Geld etwas zum ohnehin teuren Lebensunterhalt beitragen könnte, fragte er mich eines Tages ernsthaft. Das hatte zur Folge, dass wir den ersten wirklich ernsthaften Streit hatten. Es wurde laut, was eine Woche langes schweigen nach sich zog. Ich schrie ihn damals an, und fragte ihn, ob er sich dann gefälligst auch seine Hemden selber waschen und bügeln würde, und kochen könne er dann auch gleich lernen, und putzen wäre auch nicht schlecht. Ein tiefer Riss war entstanden, die Annäherung nahezu unmöglich. Erst im darauf folgenden Urlaub – den ich ausnahmsweise bezahlte – ergaben sich wieder neutrale Gespräche über belanglose Dinge. Warum nur krallen sich solche Ereignisse im tiefsten Innern fest, und sprudeln bei der kleinsten Kleinigkeit mit Vehemenz an die Oberfläche? Es dauerte Jahre bis ich es begriffen hatte. Es war ja nie wirklich geklärt, nie ausgesprochen, nur weggeschwiegen. Nichts änderte sich, die Kommunikation hinkte, kränkte, oder war gar nicht erst vorhanden. Stille Anschuldigung trug man mit sich herum als wäre es ein Virus den es in Schach zu halten galt. Wer ihn zuerst benennt, wird unheilbar erkranken. Dann doch lieber totschweigen, und unter den Teppich damit. Die Zuneigung blieb dabei mit Salamitaktik auf der Strecke. Latent machen sich Schuldzuweisungen breit. Von den täglichen Pflichten des Alltags mit Beschlag belegt, wandern gravierende Kleinigkeiten in den Keller der Seele und wachsen dort zu einem Vulkan heran, der eines Tages nicht mehr an sich halten kann. So gedanklich stimuliert stand ich inmitten meiner Gäste, und hörte die Gespräche wie unter einer Käseglocke. Ich fühlte mich isoliert und unbestätigt. Auf keinen Fall wollte ich, dass meine Gäste davon Wind bekamen, und riss mich am Riemen. Smalltalk, Triviales, nicht ernst gemeinte Komplimente und Nichtigkeiten flogen durch den Raum wie demente Schmetterlinge. Das ein- oder andere Paar griff sich bei den oberflächlichen Gesprächen beiläufig an der Hand, oder berührte sich an einer anderen Körperstelle. Es wurde echt und falsch gelacht, gescherzt und attackiert. Kein Tiefgang. Die Berührungen, wenn auch beiläufig, schmerzten meine Seele. Mein Mann stand etwas entfernt von mir, und riskierte ab und an einen Blick in meine Richtung, bemüht dabei nicht entdeckt zu werden. Ich glaube er spürte dass es unter meiner dünnen Haut brodelte. Er machte einen ungewöhnlich verunsicherten Eindruck. So viel Sensibilität sollte ich ihm wohl doch zugestehen, wenn ich sie auch verloren geglaubt habe. „Wenn ihr alle leer getrunken habt, dann lasst uns jetzt zum Essen gehen“, rief ich in die Runde.
Saskia – meine beste Freundin – kam auf mich zu, und hakte mich unter. „Na, du reife Schönheit du, wann suchst du dir endlich einen heißen Lover? Dein Claus zerreißt ja keine gekochten Spagetti mehr“, scherzte sie. Dann legte sie noch einen nach, und meinte: „mit eurer Stimmung steht es heute aber auch nicht zum Besten, oder?“ Lachend gingen wir gemeinsam zum Lift um ins Aussichtsrestaurant zu fahren. „Was hast du den atemberaubendes zu deinem heutigen Ehrentag von deinem Herrn Gemahl bekommen?“ -„Einen neuen Laptop mit Fünfganggetriebe und Lachgaszündung. Dazu eine tiefgelegte Maus mit Bilsteinstoßdämpfern in AMG-Optik. Nur vom Feinsten. Aber Spaß beiseite, mein alter hat wirklich ein bisschen geschwächelt, und wenn ich sehr lange an meinem neuen Manuskript schreibe, dann streckt er mir schon mal die Zunge raus.“ Saskia sah mich
ohne zu lächeln an, und sagte: „ich sag´ dann jetzt mal nix.“ Sie dachte so laut, dass ich mir am liebsten mit beiden Händen die Ohren zugehalten hätte. Wir kannten uns schon so lange, da spürt man mehr als man manches Mal zu spüren bereit ist.
Unsere beiden Söhne Jan und Peer waren mit ihren Frauen schon oben um die Blumen auf den Tischen zu verteilen. Peer und Kim leben in Berlin, und sind beide ausgesprochene Workaholics. Kinder kommen für sie nicht infrage, sie wollen in jeder Hinsicht unabhängig sein. Gemeinsam betreiben sie eine gute Werbeagentur und gönnen sich kaum Freizeit. Heute hierher zu fahren ist für beide ein großes Opfer. Ich konnte meinen Sohn auch nicht davon überzeugen wenigstens eine Nacht hier zu bleiben. Nach dem Essen wollen sie unbedingt wieder nach Berlin zurück fahren. Fast ein ganzer Tag würde ja auch ausreichen, meinte mein Herr Sohn. Dabei sind sie erst knapp vor dem Mittagessen angekommen, und schlangen es herunter als hätten sie viele Tage keinen Bissen zu sich genommen. Mit Kim werde ich nicht warm, sie ist eine unterkühlte Person. Sie fühlt sich nur wohl wenn sie wichtigtuerisch über fachliche Dinge referieren kann. Eines Tages bot sie mir an, meine Bücher zu promoten, ich lehnte dankend ab. Peer kam ganz nach seinem Vater. Mit seinen einunddreißig Jahren macht er den verstaubten Eindruck eines alten Mannes. Ich habe dieses Kind nur selten lachen gesehen. Schon als kleiner Junge verkroch er sich lieber in irgendwelche Bücher die alles andere waren als altersgerecht, frische Luft und die Freiheit der Straße interessierten ihn nicht. Seine Umarmung heute Mittag war eher beiläufig als herzlich, wir haben kaum miteinander geredet. Lieblos überreichte er mir einen Stapel Bücher die ich mir gewünscht hatte. Ganz der Papa. Jan kam auf mich zu, und hob mich ein Stück in die Höhe. „Wie fühlt man sich mit sechzig“, wollte er wissen. „Warum fragst du das?“ Ich spürte einen Hinterhalt in dieser Frage. „Na, wenn es sich scheiße anfühlt, dann werde ich ganz schnell und intensiv leben, kurz vor Sechzig mache ich mir dann den Garaus. Ich möchte mich nicht alt fühlen. Aber eigentlich siehst du noch tipptopp aus, also kann es ganz so schlimm nicht sein.“ Schockiert blieb ich mit offenem Mund die Antwort schuldig, und befreite mich aus seiner Umarmung. Jan ist ein Jahr jünger als sein Bruder Peer, würde aber zeit seines Lebens ein Kindskopf bleiben. Er ist Lehrer an einer Schule für schwer erziehbare Kinder in Wilhelmshaven. Seine Frau Constanze stammt dort her. Jetzt wird er selber in vier Monaten Vater, und ich kann ihn mir in dieser Rolle auch unter Einsatz meiner ganzen Fantasie einfach nicht vorstellen. Die beiden ergänzten sich offensichtlich mit einer Art Weigerung erwachsen zu werden ganz gut. Froh darüber dass Peer schon lange vorher angekündigt hatte nach dem Essen wieder nach Hause zu fahren, wollen sie es genauso halten. Morgenfrüh ausschlafen, und dann den Tag ver-bummeln ist viel wichtiger als mir die Zeit zu widmen. Damit habe ich mich wohl abzufinden. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Wo war mein Leben geblieben? Was ist Liebe, was Dankbarkeit?
Der Kellner reißt mich aus meinen immer wieder abschweifenden Gedanken, und will wissen ob er denn jetzt den Aperitif servieren könne. „Er könne“, gab ich knapp zur Antwort. Aus dem Augenwinkel heraus sehe ich meinen Mann mit Jan diskutieren. Das gibt mir Anlass zur Sorge, denn diese Diskus-sionen endeten immer wieder in einem Desaster. Claus will seinen Sohn immer aufs Neue davon überzeugen, dass er sich mit seinem beruflich erreichten Ziel doch ganz unmöglich zufrieden geben könne. Ein Lehrer, was sei denn schon ein Lehrer? Es könnte doch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Peer habe es immerhin zum Wirtschafts-ingenieur gebracht. Seinen Master und Bachelor habe er auch noch obendrauf. Er könne doch nicht auf halber Strecke halt machen, und sich mit dem erreichten so abfinden. Jan zuckte dann oft mit den Schultern, was meinen Mann fast zum überkochen bringt. Eines Tages meinte er resigniert zu mir: „was
kann man da machen, er hat halt die Gene von beiden Seiten, und in seinem Fall waren deine Gene wohl die dominanteren.“ Ich schluckte damals meinen Zorn hinunter, und erwiderte: „es kann ja nicht jeder so schlau sein wie du, wer würde dann unsere Mülltonnen leeren.“ Aber tatsächlich war und bin ich tief verletzt, weil ich doch hier offensichtlich als schwachsinnig abgestempelt werde. Der Herr Mathematikprofessor ist an der Hamburger Uni eine angesehene Kapazität, aber gemocht wird er von niemandem, was ihn offenbar kalt lässt. Sympathien und Kumpaneien sind ihm zuwider. Geselligkeit ebenfalls eine Zerstreuung für die unteren Schichten. Lebensweisheiten hat er nicht zu bieten, er lebt ja nicht, er existiert und arbeitet so oft es eben noch zu vertreten ist. Ist die Arbeit getan, dann ist der Computer sein einziger Freund. Das einmal die Initiative zu irgendeiner Unternehmung von ihm ausgehen würde? Nein, reine Fehlanzeige. Solange ich mit der Erziehung der Kinder, und mit der Versorgung des großen Haushaltes beschäftigt war, wäre es mir nicht in den Sinn gekommen diese Tatsache zu bemängeln. Aber nachdem die Kinder das Haus verlassen hatten um zu studieren, erdrückte mich die große Stille mit einem Schlag. So fing ich eines Tages unter bemitleidendem Lächeln meines Mannes an, Bücher zu schreiben. Er fragte mit keinem Wort nach meiner Arbeit, er nahm sie keine Sekunde auch nur im Ansatz ernst. „Spielerei, reine Zeitverschwendung, suche dir lieber einen Job der was einbringt“, meinte er. „Klar, wenn man auch nur knappe zweiund-dreißig Jahre aus dem Beruf heraus ist, dann wird man sich um mich reißen.“ Mehr konnte ich ihm nicht entgegen halten. Es entsprach den Tatsachen. Als ich noch ein eigenes Leben hatte war ich Optikerin. Der Beruf hatte mir damals großen Spaß gemacht, aber ein Widereinstieg war und ist vollkommen ausgeschlossen, zumal ich wegen des großen Hauses nur zu einem Halbtagsjob bereit gewesen wäre.
Die Gäste haben bereits Platz genommen, und ich gehe auf die beiden Streithähne zu um sie zu trennen. „Wäre es möglich, dass meine Familie sich auch an der Feier beteiligt, oder soll ich lieber doch alleine feiern“, frage ich gereizt. „Ja gleich“, brummte mein Mann. Jan ist froh für die Unter-brechung. „Nein sofort, Claus, sonst kannst du am besten auf der Stelle nach Hause gehen und deinen Laptop begatten.“ Ich drehe mich auf dem Absatz herum, und lasse ihn stehen. Solche Töne kennt er von mir in all den Jahren nicht. Meistens bettelte ich wie ein devoter Hund um das was ich erreichen wollte, immer um Frieden bemüht, es jedem recht zu machen. Nur keine Missstimmung aufkommen lassen. Ich bin es so leid. „Wo bleibt denn das Geburtstagskind“, plärrt Gudrun durch den Raum. „Wir wollen endlich anstoßen, sonst wird der Champagner noch warm.“ Lächelnd und ohne einen Hauch von Ärger gehe ich zu den Gästen zurück, erhebe mein Glas, und sage: „auf alles was jetzt noch kommt, prost, liebe Gäste.“ Das Glas zittert ganz leicht in meiner Hand, aber niemand bemerkt es. In der Zwischenzeit hat sich auch mein lieber Mann neben mir eingefunden, und fragt ganz leise, für die übrigen Gäste nahezu unhörbar: „was kommt denn jetzt noch alles?“ Ich müsste lügen wenn ich behaupten würde, es hätte mir keinen Spaß gemacht, ihm die Antwort schuldig zu bleiben. Mein erstes Geheimnis seit über zweiunddreißig Jahren.
Das erste Handy klingelt, und meine halbwegs gute Stimmung droht sich in Luft aufzulösen. Dieses Diktat der ständigen Erreichbarkeit geht mir schon seit langem gegen den Strich. Was um Himmels-willen ist so extrem von Wichtigkeit, dass es am Samstagabend um neun-zehn Uhr keinen Aufschub duldet. Oliver, der Tennis-partner meines Gatten steht auf, und verlässt den Raum um draußen ungestört zu telefonieren. Erst nach geschlagenen zehn Minuten kehrt er wieder zurück, und vertilgt seine bereits kalt gewordene Vorspeise. Bei dem Gedanken in eine kalte Jakobsmuschel beißen zu müssen, schüttelt es mich für einen Moment. Kaum ist der letzte Bissen in seinem Rachen verschwunden, plärrt das Ding schon wieder aus seiner Tasche. Jetzt ist es vorbei mit meiner Contenance. Bevor er danach greifen kann, sage ich zu ihm: „hallo Oliver, sollte dieses Fest für dich eine Zumutung sein, darfst du auch gerne nach Hause gehen um deine wichtigen Telefonate in aller Ruhe zu führen. Ich bin dir da nicht böse, was sein muss, muss sein. Nur entscheide dich bald, denn es stört meine Feier.“ Neben mir bemerke ich wie mein Mann zur überhaupt kleinstmöglichen Körpergröße zusammenschrumpft. „Was ist denn in dich gefahren“, fragt er fast flüsternd. „Unsere Söhne tun es nicht, weil ich ihnen so viel Anstand doch noch beibringen konnte, und die gehören ja offensichtlich zur Familie. Dann erwarte ich mir von den übrigen Gästen so viel Höflichkeit, das sie ihr Handy mal für einen kurzen Abend auf leise stellen, oder ganz und gar im Auto lassen. Ist das zu viel verlangt?“ Mit einem zornigen Funkeln blicke ich ihm geradewegs ins Gesicht, und straffe meine Schultern. „Wo du recht hast, hast du recht“, höre ich vier Plätze weiter eine Frauenstimme rufen. Ruth, die Frau von Oliver gesellt sich überraschender Weise solidarisch auf meine Seite. Sie habe ihren Mann gebeten das Handy im Auto zu lassen, aber keine Chance. Ohne sei er vollkommen lebensunfähig und fühle sich nahezu nackt. Auch habe das Handy und der Computer ihr den Platz an erster Stelle in ihrer Beziehung streitig gemacht, und sie erkläre ihnen hiermit den Krieg. Ohne zu wissen wie mir geschieht, stimmten drei weitere Damen ein, und applaudierten dem Beitrag von Ruth. Oh mein Gott, was habe ich da angerichtet, jetzt habe ich sämtliche Männer am Tisch gegen mich. Nur mein Sohn Jan grinst Unverhohlen in die Runde. „Bravo Mutter“, ruft er. Lass mal die Sau raus, es wird auch allerhöchste Zeit.“ Bettina feuert einen tödlichen Blick in meine Richtung, sie war und ist ebenso eine abhängige, verfallene Techniknutzerin. Sie definiert sich über die neuesten Geräte die es auf dem Markt zu erstehen gibt, lächelte mitleidig wenn ich nicht weiß was es mit Bluetooth auf sich hat. Das ist mir nämlich scheißegal, ich benutze kein Handy zum Telefonieren, ich bin zu Hause erreichbar. Auch keine SMS, ich habe einen Mund den mir unser Schöpfer gegeben hat, und den gedenke ich zu benutzen solange er noch funktioniert. Eine wilde Diskussion ist in Gange als der Hauptgang aufgetragen wird. Oliver ist wie erstarrt sitzen geblieben, und hat seinen An-rufer offensichtlich weggedrückt. Die Zustimmung seiner Frau und mein Einsatz haben ihm die Sprache verschlagen. Eingeschüchtert greift er nach seinem Besteck, und beteiligt sich mit keinem Wort an der Diskussion über das Für und Wider der ständigen Erreichbarkeit, der omnipotenten Präsenz einer Person, für alle Welt jederzeit zum Zugriff zur Verfügung stehen zu müssen. Die nervigen Piepstöne oder was auch immer das lieb gewonnene Handy sonst noch so an Melodien von sich zu geben vermag. Zum unpassendsten Zeitpunkt natürlich, und die Mitmenschen ungefragt störend. Oder wie man in panische Hektik verfiel wenn der Akku sich dem Ende seiner Kräfte näherte, und das Ladekabel im Augenblick nicht griffbereit war, weil man es zu Hause vergessen hatte. Die unaufhaltsamen Schweißtropfen die sich auf der Stirn bildeten, in die Augen liefen, und zu allem Übel dann auch noch den Blick vernebelten. So kann man es nämlich ausnahmslos bei allen Nutzern beobachten. Derartiges kann schon mal den dringend erforderlichen Erholungsurlaub verhageln, oder einem bei einem anderen Ziel zur Umkehr zwingen. Welch ein umfassendes Diktat. „Ohne mich“, vertrete ich meinen Standpunkt, und disqualifiziere mich für den größten Teil der Menschheit, damit zur Hinterwäldlerin.
So hitzig habe ich mich in der Vergangenheit noch nie an einer Diskussion beteiligt. Mein ohnehin schweigsamer Mann blickt mich noch schweig-samer – falls das überhaupt möglich ist – von der Seite an. Möglicherweise bin ich ihm sogar peinlich, wäre nicht das erste Mal. Nur hier hat er keinerlei Fluchtmöglichkeiten. Zu Hause zieht er sich bei der kleinsten Disharmonie in sein Arbeitszimmer zurück, wo er auch meistens auf dem bequemen Sofa schlief, um mich angeblich nicht in meiner Nachtruhe zu stören. Von mir aus hätten wir auch konsequent getrennte Schlafzimmer haben können, es hätte mir mehr zugesagt als er für möglich gehalten hätte. Aber diesen Wunsch habe ich nie an ihn herange-tragen, da ich ja weiß wie verkümmert sein Selbst-bewusstsein in Wirklichkeit ist. Er hätte es als Ablehnung und Zurschaustellung seiner Impotenz – zu der er sich selbstverständlich nie bekennen würde - interpretiert. Außerdem wäre dann eines unserer in Vielzahl gelebten Klischees ins Wanken geraten. Wir achteten doch sehr darauf keines auszulassen, zumindest kein nach außen hin sichtbares. Für unseren Bekanntenkreis entsprechen wir dem Bild der perfekten Familie. Ganz beispielhaft. Vater erfolgreich, Mutter zu Hause als fürsorgliche Dienerin, zwei gelungene Söhne, wenn auch einer davon etwas hinterherhinkte, Haus, Garten, Hund und Katze, zwei Autos wovon eines – meines – eine vernünftige Familienkutsche ist. Der Wagen meines Mannes trägt selbstverständlich einen Stern als Identifikations-merkmal. Perfekt. Schöne, heile Welt. So kommen wir allen gesellschaftlichen Verpflichtungen nach, sofern es denn welche gibt. Auffälligkeiten oder Unordnung gibt es nicht. Sakrales tectum Familia. Genial, hätte es der Realität entsprochen.
Meine Mutter sieht etwas hilflos Ihre Freundin Elsbeth an. Mit ihren fünfundachtzig Jahren ist sie immer noch gut in Schuss, kann aber aus ihrem Bildungsstand heraus an solchen Debatten nicht teilnehmen. Sie denkt wir würden uns streiten. Sie tut mir leid, und ich bin froh als das Abendessen aufgetragen wird. Das trug erfolgreich zur Abkühlung der gegnerischen Parteien bei, die Stimmung beruhigt sich. Der verwitwete Vater meines Mannes, blieb meiner Einladung mit der Aus-rede er fühle sich nicht so, fern. Das war zu erwarten, denn es war all die Jahre zuvor – nachdem seine Frau verstorben war – kein Stückchen anders. Als meine Schwiegermutter noch lebte, musste er sich des lieben Friedens willen fügen, aber jetzt zeigte er mir offensichtlich und ohne Skrupel seine Ablehnung die er vom ersten Tag an gegen mich hatte. Für seinen Sohn hätte er sich doch im Mindesten eine Studienrätin er-wünscht. Ich war weit unter der Würde der wohl-habenden Familie. Er vermutete eine Frau in mir, die es nur auf die Sicherheit der finanziellen Versorgung abgesehen hatte, und veranlasste meinen Mann vor der Heirat einen umfassenden Ehevertrag konstru-ieren zu lassen. Demnach war ich nach Beendigung des Studiums unserer Kinder – wovon man schon damals ausgegangen ist, dass es nur studierende Kinder werden würden – im Falle einer etwaigen Trennung, arm wie eine Kirchenmaus. Es gab keinen nennenswerten Zugewinn. Das Haus in dem wir wohnen ist offiziell Eigentum vom Schwiegervater. Der ganze Verdienst von Claus – meinem Mann – ging angeblich für den Lebensunterhalt drauf. Ein Erbe wird vom Zugewinn ausgeschlossen. Alles ein abgekartetes Spiel von einem Mann der bis heute von seinem Vater bevormundet wird. Fällt er morgen tot um, dann sind die beiden Kinder Alleinerben des zu erwartenden Vermögens vom lieben Herrn Schwiegerpapa. Unbedarft und ohne juristische Kenntnisse war mir das Regulierte jedoch in keiner Weise bewusst. An den Fall der Trennung dachte ich nicht. Bis dass der Tod uns scheide. Klischee bis zum bitteren Ende. Nur ewig leben würde der „Alte“ ja dann auch nicht. Immerhin war er schon siebenundachtzig Jahre alt. Als einziger Nachkomme der hochwohlgeborenen Familie würde Claus ein beachtliches Vermögen erben müssen. Denn noch stand er in der Reihenfolge vor seinen Söhnen an erster Stelle. Die ewige Argumentation: „dafür haben wir kein Geld“, oder: „das ist viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten“, wäre somit hinfällig. Er stand also unter latent imperativem Druck, sich für die Zukunft etwas einfallen zu lassen. Ein Vorvermächtnis für die Kinder würde ich ihm zutrauen. Meine Zustimmung hätte er. Das weiß er.
Nur an meinem Leben würde sich nichts ändern. Kaufe ich mir ein paar neue Schuhe von meinem eigenen Geld, und er bemerkt es, fragt er süffisant: „na, die Alten schon wieder kaputt?“ Ich gehe über diese Bemerkungen hinweg, aber es trifft mich jedes Mal sehr schmerzvoll. Es ist nur ein kleiner Betrag über den ich durch Auszahlung meiner Tantiemen verfügen kann, aber er schenkt mir ein wenig Freiraum was diese Dinge betrifft. Es passt ihm überhaupt nicht in den Kram, das weiß ich. So habe ich in seinen Augen an dem Band der absoluten Abhängigkeit gezogen, und es etwas gelockert. Seine Macht ein winziges Stückchen angekratzt. Einen Schritt gewagt, der das perfekte Klischee in Frage zu stellen droht. Insofern ist er natürlich über den bescheidenen Erfolg meiner Schreiberei nicht unbedingt in Betrübnis gestürzt. Es gereicht ihm eher zu einem kleinen Amüsement, wenn er mich fragt: …„wann bist du denn mit deinem Weltbestseller endlich fertig?“
Das Essen ist verspeist, die Teller abgetragen, und wir können jetzt unsere Plätze verlassen. Die Stimmung ist gut bis befriedigend, aber friedlich. Ich gehe kurz zu meiner Mutter an den Platz, und frage ob alles in Ordnung ist. Sie wollte wissen warum wir eben gestritten hätten. „Das war kein Streit Mutter, nur eine Meinungsverschiedenheit wegen der störenden Handklingelei. Alles ist gut, mach´ dir bitte keine Sorgen. Amüsiert euch, gleich gibt es noch Nachtisch. Elsbeth sieht mich nickend mit roten Bäckchen an. Sie hat kein Wort verstanden, aber offenbar zu tief ins Weinglas geguckt. Ich gönne es ihnen von ganzem Herzen, denn das Leben ist in diesem Alter kein Kindergeburtstag mehr. Mir graust es davor, sind es doch nur noch fünf-undzwanzig Jahre bis ich selbst so dasitze. Für meinen Gatten sogar noch ein Jahr weniger, worüber er mit Gewissheit keinen Gedanken verschwendet. Lebensbewusstsein hat in seinem - mit komplizierten, arithmetischen Formeln aufgefüllten - Kopf offensichtlich keinen zugewiesenen Platz. Theresia, meine fünf Jahre ältere, aber zehn Jahre älter aussehende Schwester steht hinter mir, und klopft mir auf die Schulter. „Hast du mal einen Moment“, fragt sie mich. Ihr dritter Mann Gunwald ist eine Schande für die gegnerische Akademiker-familie. Er hatte ein Unternehmen für Kanal-reinigungen und machte in Haushalten Rohre frei, in denen sich nicht nur Scheiße verklemmt hatte. Ein Prolet durch und durch, aber herzensgut. Er trägt meine Schwester auf Händen, und liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Dreimal zu heiraten ist für die Hochwohlgeborenen ein absolutes „no go“, wie man heute zu sagen pflegt. Typische Unterschichtengepflogenheit. Jedenfalls konnte meine Schwester ihren Kassiererinnen Job endlich an den Nagel hängen. Geld war ausreichend da, und das zumindest stank ja nicht. Ich folge ihr an die kleine Theke im Nebenraum. Offensichtlich will sie mir etwas sagen.
„Schwester“, beginnt sie. „Wir waren uns ein Leben lang nie besonders nah, weil deine Familie unsere Anwesenheit nicht sonderlich schätzte. Allen voran dein Mann. Für ihn sind wir nur Fußvolk, das weißt du. Aber ich wollte dir als einer der Ersten sagen, dass wir uns ein kleines Häuschen auf Malle gekauft haben, und auswandern. Was würdest du davon halten, wenn ich Mutter mitnehme? Die Sonne würde ihr sicherlich gut tun. Mit ihrer Freundin Elsbeth habe ich auch schon gesprochen. Sie wird nicht mehr lange so alleine in dem großen Haus leben können. Und Mutter auch nicht. Seit sie kein Auto mehr fährt, ist sie ständig auf fremde Hilfe angewiesen. Das Haus neben unserem steht zum Verkauf, ist ebenerdig und geradezu genial für die beiden. Na, was meinst du dazu?“ Das waren ja neue Neuigkeiten, Donnerwetter. Ich weiß so aus dem Stand heraus nicht sofort was ich darauf erwidern soll. „Ich bin jetzt wirklich etwas überrumpelt“, sage ich zu ihr. „Ihr könnt ja selbstverständlich tun und lassen wonach euch der Sinn steht, aber Mutter? Ich weiß nicht so recht ob man einen so alten Baum noch verpflanzen sollte. Hast du denn schon mit ihr darüber geredet?“ „Ja und nein. Das habe ich Elsbeth erledigen lassen. Es sieht so aus, als wäre sie nicht abgeneigt. Zumindest will sie es sich einmal ansehen.“ Wenn ich an den fragenden und ängst-lichen Blick meiner Mutter von gerade eben zurückdenke, ist mir klar, dass sie sich nicht so recht traut mit mir darüber zu reden. Vor zwei Jahren hatte ich sie gefragt, warum sie denn nicht in ein Senioren-wohnheim gehen wolle, um sich das Leben zu er-leichtern. Daraufhin sind wir in einen Streit geraten. Sie unterstellte mir ich wolle sie abschieben, mich nicht um sie kümmern, und alt sei sie ohnehin noch nicht. Damit war für mich das Thema für alle Zeit erledigt. Dass meine Schwester sich jetzt kümmern wollte, war ganz was Neues. Aber Ausland? Das ging doch wohl zu weit. „Ich werde dazu keine Stellung nehmen“, lasse ich Theri - wie wir sie nennen – wissen. Ich habe mir schon einmal eine blutige Nase geholt bei der Frau Mama. Sie ist weiß Gott alt genug um für sich selbst zu entscheiden. Macht ihr das mal hübsch unter euch aus, ich werde mich der Entscheidung selbstverständlich fügen. Wenn Mutter das tatsächlich durchziehen will, dann ziehe ich wirklich den Hut vor so viel Courage.“ Meine Schwester scheint von meiner Reaktion positiv überrascht zu sein. Es war kein großes Geheimnis dass ich mich sehr schwer damit tat, etwas loszulassen. Wenn ich nur noch daran denke wie ich mich angestellt hatte, als beide Kinder den Wunsch hatten, weit ab von Zu-hause zu studieren, es war peinlich wie sehr ich klammerte, das sehe ich heute ein, wenn es mir auch heute noch immer nicht gut gelingt, mich von irgendwas oder irgendwem zu trennen. „Vielleicht schneidest du dir an ihr mal eine Scheibe ab, liebe Schwester“, sagt meine Schwester beim Hinausgehen. Sie hätte mir auch ein eiskaltes Messer zwischen die Rippen rammen können, die Wirkung wäre die Gleiche gewesen. Ich sehe mich außer Stande eine Antwort darauf zu geben. „Lass uns nächste Woche noch einmal in Ruhe alles zu Ende denken“, bitte ich sie. Damit ist das Thema vorerst, und für heute erledigt.