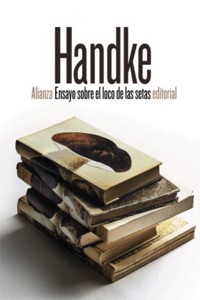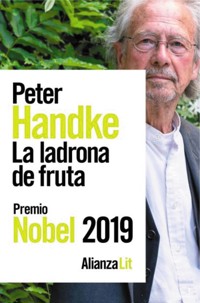14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die in diesem Buch versammelten Aufsätze, Notate und Reden aus den vergangenen zehn Jahren zeigen Peter Handke als leidenschaftlichen Kinogänger, Bildbetrachter und Leser beim »Beobachten, Betasten, Beschreiben, Vergleichen«.
Mit einem unbändigen »Appetit auf die Welt« läßt er sich ein auf die Werke von Kollegen, um sie »mit erfrischten Augen« neu zu sehen, sich selbst im Kunstgenuß als einen Veränderten und Bereicherten zu erleben. »Es war, als hätte ich mir durch bloßes Zuschauen die Welt verdient«, beschreibt Handke etwa in einer Rede auf der Viennale 1992 sein Kinoerlebnis mit Antonionis La Notte. Was wir erfahren von seinen Begegnungen mit Filmen von Jean-Marie Straub oder Abbas Kiarostami, dem iranischen Cineasten, mit Büchern von Marguerite Duras, Hermann Lenz, Karl Philipp Moritz, Ralf Rothmann, Erich Wolfgang Skwara, den Bildern und Gemälden Pierre Alechinskys, Emil Schumachers und Anselm Kiefers sind weltauftuende und scharfsichtige Beobachtungen, durch die immer der Blick auf das Umfassendere mitgeöffnet wird. Sichtbar werden Bilder – »bekannt als Bilder aus dem eigenen Leben – dem unbekannten eigenen Leben. Nur dem eigenen? Nein: dem unbekannten, größeren, in dem auch das des Betrachters mitspielt.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Handke
Mündliches und Schriftliches
Zu Büchern, Bildern und Filmen 1992-2002
Suhrkamp Verlag
Vorwort
Mündliches und Schriftliches? Nein, keine Gespräche, oder Interviews, oder Radiodialoge, oder dergleichen. »Mündliches« bezeichnet in diesem kleinen Textsammelband (zehn Jahre nach dem vergleichbaren Langsam im Schatten) eine Abteilung, deren Form sich in erster Linie dem, möglichst freien, Reden verdankt. Mir scheint nämlich, daß die Art und Weise der aus dem Sprechen, oder eben der Mündlichkeit, entsprungenen Texte in dem Band sich von den rein geschriebenen in einigem abhebt. Es handelt sich um vier Reden, zu Arbeiten von Hermann Lenz, Ralf Rothmann, Arnold Stadler und Georges-Arthur Goldschmidt. (Bezeichnend, oder auch nicht bezeichnend: daß sich dieses Mündliche um vier Schriftsteller oder Bücherschreiber dreht, oder daß es diese, eher, umkreist.) Die paar im Sprechen entstandenen Sachen haben als schriftliche Grundlage jeweils nur die und jene Skizze, oder Notiz, und sie sind nicht allein durch das Reden entstanden, sondern vielleicht stärker noch, im Sichumschauen und -umhören, im Abschweifen, vor und während des Redens. Die Schriftarbeit begann dann erst im Sichten der Tonband-»Abschriften« (nicht umsonst hier ein Anführungszeichen), und ich hätte mir da zuweilen gewünscht, meine Gedanken zu den Autoren, ohne den Umweg übers Mündliche, gleich unmittelbar festgeschrieben zu haben; der letzte der drei Schritte »Schriftlich-mündlich-schriftlich« war oft der eigentlich mühselige. Und trotzdem kommt gerade aus diesem Nichtfestgeschriebenen, Umweghaften, Abschweifenden vielleicht die Besonderheit. Mündliches und Schriftliches?
Wäre der Titel nicht zu mißverständlich oder rätselhaft, hätte ich für die Sammlung hier »Mündliches wie Schriftliches«, oder »Mündliches gleich wie Schriftliches« gewählt, frei nach der Formel des Horaz: »Ut pictura poesis« ‒ wie die Malerei so die Poesie ‒ Poesie auf der Grundlage, entsprechend der Malerei ‒ Poesie wie, oder gleich wie, Malerei.
P. H., Mai 2002
Appetit auf die Welt
Rede eines Zuschauers über ein Ding namens Kino
Ein Geher im Eis, ein Bezwinger der Kontinente, ein Bergsteiger, der, wenn das möglich wäre, nicht nur die Gipfel des Himalaya, sondern dazu noch den doppelt so hohen Olympus Mons auf dem Mars erklömme ‒ der Filmer Werner Herzog also hat mich, ehe ich mich an diese kleinen Andeutungen zum Kino machte, unabsichtlich gewarnt: wer einen Film drehe, müsse in allem bewandert sein, und wenn es nur das Aufkriegen, ohne Schlüssel, eines fremden Autos wäre, welches sein Bild stört.
Ich traue mir dergleichen nicht zu, und so sollen meine paar Worte auch nicht von einem Filmemacher kommen, sondern von einem Zuschauer. Dem war einmal von allen Dingen dem Herzen am nächsten ein Ding, das »Kino« hieß.
Verrate ich damit aber nicht ein anderes Ding, das mir »in jenen alten Zeiten« gleich nah war, das Ding namens »Buch«?
Mit den Büchern war's eine andere Nähe, und zudem läßt sich von dem Kino, wie es einmal war, etwas erzählen, das, weil es scheint's keinen aktuellen Gegenstand mehr hat, zugleich schon eine Art von Überlieferung ist; denn das Erzählen vom Kino, das einmal war, kann sich, vor den heutigen Kinogehern, einzig noch, vielleicht, an eine Nachwelt richten.
Doch nichts Nostalgisches soll dabei mitmischen, mein bißchen Erzählen nicht entkräftet werden von der knochenerweichenden Nostalgie. Überliefern heißt nicht, mit Verschwundenem privatisieren, vielmehr ein Vergangenes eben weitergeben an eine Öffentlichkeit ‒ und wenn die auch nur aus einem einzigen Wesen besteht ‒, in Gestalt eines Umrisses, einer Skizze, eines Musters, eines Maßstabs, eines Plans, das alles freilich hier und dort nach Kräften ausgeschmückt.
Was für ein Ding war mir das Kino einmal?
Anders wiederum als die Bücher, die, im Glücksfall, beim Lesen jeweils zum Ding der Möglichkeit ‒ der reinsten aller Lebensmöglichkeiten ‒ wurden, eröffnete das Kino sich dem Zuschauer immer wieder als Ding der Wirklichkeit, der allerweitesten der Wirklichkeiten, und als das einzige derartige Ding, damals, in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts.
Und sämtliche Kinos waren so, nicht nur dies oder jenes besondere. Jedes Kino verkörperte einen Ort, und einen wie herzhaften!, inmitten der Ortlosigkeit, oder der Verschlossenheit, oder Unzugänglichkeit, die einem, jedenfalls seinerzeit, aus den Straßen, Passagen und Kirchgassen ins Gesicht sprangen.
»Im Kino drinnen atmete er auf«, so konnte ich noch Ende der sechziger Jahre von einem meiner Helden erzählen, und das war schon fast der einzige Augenblick, in dem der ehemalige Tormann Josef Bloch mit der Wirklichkeit nicht entzweit, sondern mit ihr eins, oder einfach mit ihr war.
Und eins war mir damals auch Kino und Film, Lichtspieltheater und Lichtspiel. Das Wunderbarste am Kino, an den Kinos, so kommt mir jetzt vor, war es, daß dort (und dort im Auge-Gottes-Kino, und dort in den Grenzlandlichtspielen), ohne daß jene Örtlichkeiten sich einem extra als »Kulturstätten« entgegenkanteten, -wuchteten, -brüsteten, Kultur stattfand, wirkte, fruchtete, und, nicht und nicht die herzenskalte, monopolistische, befremdende Reinkultur, sondern immer und immer die Mischkultur, die allseits offene, menschenfreundliche, herzerwärmende.
Diese blühte, vielleicht vier, fünf kleine Jahrzehnte unsres Jahrhunderts lang, einzig in den Lichtspieltheatern, und darum war das Kino einmal eine Einzigartigkeit, eine einzigartige Herrlichkeit (bis vielleicht auf die Male, da dort, ob am Abend oder als Matinee, die wohl von nicht wenigen aus unserer Kinogehergilde gemiedenen, regelrechten »Kulturfilme« den Spielort blockierten). Kultur? Ja, das Kino, der Film war, zumindest für mich, indem er, es, mir einen anderen, einen zweiten, einen dritten, einen zusätzlichen Atem einhauchte, eine Seelenspeise.
In einem stinknormalen, noch nicht spezialisierten Kino sah ich 1962 oder 1963 Michelangelo Antonionis La Notte, Die Nacht. Nach dem Film stand ich im Zentrum von Graz an einer nächtlichen Straßenbahnhaltestelle und erlebte die steirische Stadt in eine Weltstadt verwandelt, monumental und zugleich duftig. Noch nie auch war die Nacht mir so wirklich erschienen, so elementar, und ich mir mit ihr. Damals mit La Notte erfuhr ich zum ersten Mal, weit über alle die Selbstgefühle hinaus, so etwas wie ein Weltgefühl.
Was jener Film an mir bewirkte, war, mit den Regeln der Kunst, die, seinerzeit jedenfalls, in den Kinos noch nicht als solche auftrat (oder auftreten mußte), ein Erwecken, ein märchenhaftes. Keine Rede von gleichwelcher geistiger Erweckung: wach waren vordringlich die Sinne.
Was für ein Wind an den Schläfen ‒ das Gegenteil vom »Schlafbein«, wie das beim Knochenforscher Goethe heißt ‒, und ein Atmen wie durch Nüstern. Es war, als hätte ich mir durch bloßes Zuschauen die Welt verdient (was mir inzwischen nur noch hin und wieder durch ein bestimmtes Arbeiten gelingt), und die Welt, ohne besondere nächtliche Vorkommnisse, stand nun da als ein Ereignis; »große Weltbreite«, gemäß dem Befund wiederum Herrn Goethes, der Weltreisende allein beim Bildtafelbetrachten daheim in seinem Zimmer.
In der dunklen Stadtrandstraße, wo ich dann meinerseits heim zu einem Zimmer ging, staunend-trödelnd, berührte mich am Horizont der gewaltige gelbe Vollmond über der Poebene.
Ebensolches ereignete sich, vielleicht ein Jahr später, nach John Fords Der Mann, der Liberty Valance erschoß, in dem längst verschwundenen Vorstadtkino von Graz-Puntigam, welches in meiner Vorstellung »Bräuhauslichtspiele« heißt. Dem Western fehlten große Stücke, die Aufklärung, daß nicht James Stewart, der Advokat mit der Küchenschürze, sondern in Wahrheit John Wayne den Banditen Liberty/Lee Marvin totschießt, habe ich erst bei einem wiederholten Anschauen des Films bekommen.
Und doch genügten die sprunghaften Fragmente, und die Bäume rauschten dann nachts vor dem Kino ‒ wahrscheinlich Bräuhauskastanien ‒, wie mir seit der Kindheit nie mehr Bäume gerauscht hatten. Was für ein Rauschen? Nur so ‒ die Bäume rauschten nur so. Damals trödelte ich auf dem Rückweg nicht, sondern sauste auf den Peripheriestraßen zwischen Puntigam und St. Peter »nur so« dahin, und wenn auch bloß auf dem Fahrrad.
Und ich habe jetzt noch ein anderes Wort für die von wieder einem Film wirklich gezauberte Welt: »appetitlich«. Ja, nach The Man Who Shot Liberty Valance bekam ich Appetit auf die Welt: den Wind, den Asphalt, die Jahreszeiten, die Bahnhöfe, und nicht allein der appetitlichen Speisen wegen, die der Aushilfskellner James Stewart serviert.
Noch von vielen Filmen könnte ich dergleichen erzählen, von Straubs Nicht versöhnt und Der Tod des Empedokles, von Pasolinis Accatone und Mamma Roma, aber es soll hier bei den Andeutungen bleiben.
Und eine weitere Andeutung: Wie das Kino einmal ein Ganzes war und auch so gesehen wurde, ein Seelendrama gleich einem Western gleich einem französischen Kriminalfilm gleich einer Komödie gleich einem altenglischen Horrorstreifen, und wie es inzwischen statt Zuschauer mehr und mehr Sektierer gibt: »nur kein Hollywood!«, »nur kein Europa!«, »Godard, der Einzige!«, »Greenaway ja, Wenders nein!« (oder umgekehrt), »Bresson und Straub, die Letzten!«, »Rohmer und Rivette, die einzig Reingebliebenen!«, »Kubelka, der einzige wirkliche Avantgardist!«.
Damals im Kino, bei La Notte wie bei John Wayne, bei Pierrot le fou ebenso wie bei Frankensteins Monster wußte ich, wer meine Leute waren. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Immer noch gehe ich regelmäßig ins Kino oder verirre mich eher regelmäßig dahin. Und vielleicht ist es eine Täuschung, wenn bei fast jedem Film jene Seelennahrung von einst mir verdorben scheint zum Seelenfraß, in dem doppelten Sinn des üblen Essens und des Wurmfraßes.
Der Kritiker, der neulich schrieb, das heutige Publikum würde bei Filmen wie etwa von Antonioni, wie man so sagt, »in Scharen« hinauslaufen, hat wahrscheinlich recht. Ich für mich kann es jedesmal wieder nicht fassen, daß, sooft ich im Fraß-Fall aus dem Kino flüchtend ‒ tristes Paradox ‒, das Weite suchte, noch nie irgendwelche Schar mit mir zog; nicht selten habe ich mich beim Hinausgehen umgeschaut nach meinen Mitkinogehern im Saal, auf vergeblicher Suche nach einer auch noch so kleinen Gefolgschaft und dann möchtegern-strafend, und, siehe, hundert ganz anders strafende Blicke waren dem Flüchtling schon längst zuvorgekommen. Doch zurück, in einem Wort, zu dem, was das Kino mir einmal war: Was für große Heimwege habe ich nach diesem und jenem Film erlebt, was für wunderbare Heimwege. Mit nichts auf der Welt hat es für mich solche Heimwege gegeben wie zuzeiten nach dem Kino, nach der Reise nach Tokyo von Ozu, nach Andrej Rubljow von Tarkowski, nach Mouchette von Bresson, nach El Nazarín von Buñuel.
Heimwege, wo das Daheim das Weggehen war, ziellose Heimwege, weiter und weiter. Psalm also des Zuschauers an die Kinogötter: »Weitere Filme für weitere Heimwege!«