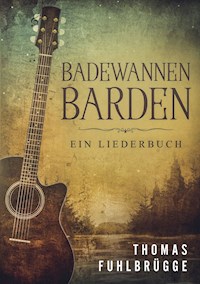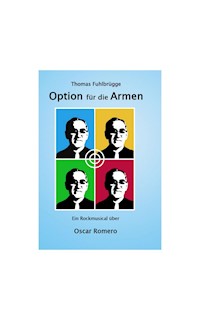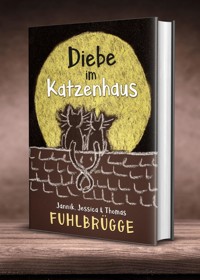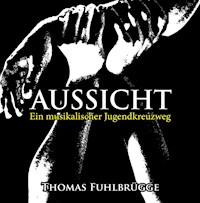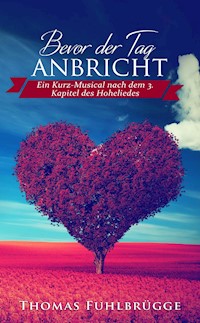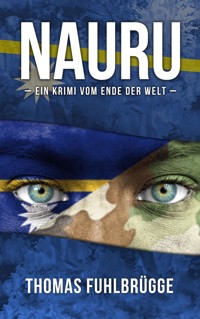
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Nauru ist mit seinen zehntausend Einwohnern das drittkleinste Land der Erde. Die Insel liegt im Pazifik und war dank des riesigen Phosphatvorkommens einmal die, an der Einwohnerzahl gemessen, reichste Nation. Doch das Geld ist längst weg. Jahrzehntelang verschwendet und verprasst. Das ganze Phosphat ist abgebaut. Es blieb eine mondähnliche Landschaft, die weite Teile Naurus bedeckt. Die einstmals so stolze Nation sank zurück zum Status eines Entwicklungslandes. Doch Nauru ist auch die Heimat des Polizisten Stephen Hix, der eines Nachts in der sonst so friedlichen Idylle an einen Tatort gerufen wird. Ein Ex-Präsident liegt tot in der Badewanne. Hix bleiben Zweifel am Selbstmord und er begibt sich auf die Suche nach Hintergründen, die auch sein eigenes Leben nachhaltig bedrohen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Jessica und Jannik.
Euch würde ich jederzeit mit
auf eine einsame Insel nehmen.
Auch nach Nauru.
Dessen Einsamkeit sich allerdings nur
auf die Entfernung zur nächsten
Nachbarinsel bezieht.
Thomas Fuhlbrügge
Nauru
Ein Krimi vom Ende der Welt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar.
3. Auflage, © 2022 -Verlag, Altheim
Umschlag: Germancreative
Lektorin: Silke Walz
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Nauru - geografisch
Übersichtskarte
10. September
Mit rasendem Herzen lud ich meine Pumpgun, die mir wohlvertraute Mossberg 590, nach. Schweißtropfen liefen mir über Stirn und Nacken. Schnell führte ich die Patronen ein und hatte jetzt wieder neun Schuss im Röhrenmagazin unter dem Lauf. Das war gut so. Die letzten fünf Geschosse hatten den Terroristen förmlich von den Beinen geholt. Er lag jetzt reglos mitten im Klassenzimmer.
Schnell schaute ich durch die geöffnete Tür hinüber zu Sid, meinem Kollegen und Freund. Ihn hatten sie als erstes erwischt. Schon als wir die Eingangshalle der `Nauru Secondary School´ betraten fanden wir ein Bild des Schreckens vor: Zwei erschossene Lehrer und drei Leichen von Jugendlichen lagen auf dem Boden. Wir überprüften sie noch schnell auf Lebenszeichen und forderten den Sani per Funk an. Gerade als Sid sich etwas aufrichtete, um bei unseren altertümlichen Walkie-Talkies einen besseren Empfang zu haben, lugte die Kalaschnikow aus der Tür des Klassenzimmers, in dem sonst Ökotrophologie unterrichtet wurde, zu uns. Noch bevor ich reagieren konnte, traf ihn eine ganze Salve in den Rücken.
Als das MG in meine Richtung drehte, schwang ich meinen ziemlich unförmigen Körper zur Seite und entkam so nur knapp den nächsten Kugeln. Doch nach nicht einmal drei Sekunden Dauerfeuer waren die Patronen verschossen. Der mit einer Sturmhaube vermummte Mann mit dem schwarzen IS-Kennzeichen auf der Tarnfarbenjacke fingerte fieberhaft ein neues Magazin aus der Seitentasche seiner Hose. Das war meine Chance.
Ich quälte mich hoch und rannte in das besagte Zimmer. Dort prallte ich gegen den Kämpfer, der anscheinend Schwierigkeiten hatte, das Kurvenmagazin in seine Waffe zu stecken. Ich drückte das erste Mal aus nächster Nähe ab. Vier weitere Schüsse folgten - nur um wirklich sicher zu gehen. Ein Plakat mit Tipps für eine gesunde Ernährung, das an der Wand hing, wurde dabei besudelt. `Esst gesund und treibt Sport´, und `Stoppt Diabetes´ stand dort. Dieser Drecksack würde jedenfalls keine mehr bekommen.
Wie gerne hätte ich nun Schrotmunition geladen! Jagdschrot brachte erwartungsgemäß eine hohe Deckung. Allerdings mit so wenig Energie der Schrote, dass die Eindringtiefe und zielballistische Wirkung auf größere Entfernung gering wurde. Doch selbst feiner Schrot wirkte auf Entfernungen bis zu fünf Metern verheerend, da die Schrotgarbe auf diese kurzen Distanzen zunächst als geschlossener Bleiklumpen, dann als dichter Schwarm flog. So wurde die Energie auf eine kleine Zielfläche konzentriert und zeigte sich dann als fast faustgroße Einschüsse mit Schrapnell-artiger Wirkung im Körper. Kein schöner Anblick - besonders auf der Austrittsseite. Zu meinem Pech durfte ich sie nur zum Öffnen oder Brechen verrammelter Türen oder anderer Barrikaden verwenden. Denn der Einsatz von solchen quasi Dum-Dum-Geschossen war nach der Haager Landkriegsordnung von 1899 gegen Menschen bedauerlicher Weise verboten. Hierfür standen uns Polizisten jetzt Stahlgeschosse, die sich nicht verformen, zur Verfügung. Herzlichen Dank! Als ob sich Terroristen um eine solche Regel scherten.
Der Notruf, der vor 23 Minuten in der Einsatzzentrale eintraf, sprach von einigen bewaffneten Eindringlingen. Dann hörte man Schusssalven und die Verbindung brach ab. Sid und ich waren als erste zur Stelle. Jetzt war ich also alleine, bis weitere Verstärkung eintreffen würde.
Ich blickte zurück in den Eingangsbereich. Draußen kamen tatsächlich mehrere Polizeimotorräder an. Jedoch schienen die werten Kollegen etwas unentschlossen zu sein und begannen erst einmal, die Gegend abzusperren.
Ich wusste allerdings, dass man in einem solchen Fall mit Verhandlungen und einer Hinhaltetaktik nicht viel erreichte. Man musste versuchen, so schnell wie möglich die Gefahrenquelle auszuschalten. Zumindest eine davon lag direkt vor mir. Dies erfüllte mich mit einer gewissen Genugtuung.
Doch wo mochte sich der Rest der Bande aufhalten? Ich kannte das Gebäude noch gut aus meiner eigenen Schulzeit. Immerhin gab es hier in Nauru nur eine weiterführende Schule. Jetzt ging meine Tochter Jenny hierher, war aber Gott sei Dank zurzeit zu Hause. Erst letzte Woche wurden Linda und ich mal wieder wegen ihr hierher bestellt. Vielleicht hatte der IS zur Abwechslung einmal eine gute Idee gehabt und die Schulleiterin erschossen. Das dachte ich mir so, als ich vorsichtig den Gang, der sich an die Eingangshalle anschloss und in Richtung der Verwaltung und der Mensa führte, entlang schlich. Das Gewehr hatte ich im Anschlag. An den Wänden hingen Schülerbilder in Glasrahmen, die ich nur zu gut kannte. Es waren die gleichen, wie vor 20 Jahren. Eins zeigte die `Kleine Raupe Nimmersatt´, dem Lieblingsbuch vieler hier auf Nauru. Die ganze Woche fressen, bis man fett ist und am Ende wird man ohne Sport oder Diät ein wunderschöner Schmetterling. Ich ließ die Kinderbilder hinter mir und ging die letzten Schritte in Richtung der Cafeteria.
Ein kurzer Blick durch das runde Glasfenster der Schwingtür in die Mensa verriet, dass sich hier der nächste Terrorist befand. Ich sah zuerst eine Jugendliche auf einem der knallorangen Plastikstühle sitzen, die Hände anscheinend gefesselt. Hinter ihr in zwei Metern Entfernung stand wieder so ein IS-Terrorist im Kampfanzug. Er hatte eine kleine schwarze Flagge auf dem Ärmel und eine Pistole in der rechten Hand. Was er in der linken hielt, konnte ich nicht auf Anhieb erkennen. Nur, dass von dort eine Schnur zur Geisel auf dem Stuhl führte. Sein Blick wanderte zum Kantinenbereich. Als wartete er dort auf jemanden. Sonst konnte ich niemanden im geräumigen Saal, in dem zur Mittagszeit gut 100 Schüler meist mit Fastfood gefüttert und gemästet wurden, erkennen.
Meine Ortskenntnis kamen mir zu Gute. Denn ich wusste von einer unscheinbaren Tür etwas weiter vorne im Gang, die erst in ein Hausmeisterlager und dann in den hinteren Bereich des Speisesaals führte. Vorsichtig prüfte ich, ob die Tür verschlossen war und trat schließlich ein. Ich erkannte hauptsächlich Toilettenpapier und grüne Einweghandtücher in dicken Packen in Regalen an den Wänden. Dazu kam noch Putzmaterial, wie dieser tückischen Schiebewagen mit Mopp. Ich bewegte mich trotz meiner Körpermasse lautlos durch den Raum und lauschte an der besagten Tür zur Mensa. Dann duckte ich mich, öffnete sie leise und befand mich nun im hinteren Bereich des Speisesaals, in dem viele Stühle gestapelt standen. Offenbar hatte mich niemand im Raum bemerkt. Auch das war gut so.
Ich kauerte mich, was mir sichtlich schwer fiel, tief gebückt hinter eine Säule und überlegte fieberhaft, was ich nun tun könnte. Der Schweiß brannte in meinen Augen. Teils wegen der Hitze. Es waren heute immerhin mal wieder weit über 30 Grad im Schatten. Außerdem natürlich wegen der Anstrengung und zugegeben auch teils wegen meines Übergewichts.
Von meiner Position aus konnte ich die Geisel nun deutlicher erkennen. Ein etwa 15-jähriges, mir unbekanntes Mädchen, mit dunklen Haaren. Es war etwa so alt wie meine Tochter. Ganz ruhig saß sie da, die Hände mit Gaffa-Tape zusammengeklebt. Am Hals hatte sie eindeutig eine Handgranate, die dort mit Kabelbindern befestigt war. Vom Splint der wahrscheinlich jugoslawischen M52, unzählige waren davon in den Wirren des Balkankrieges an `Freiheitskämpfer´ gelangt, ging die dünne Schnur zum Handgelenk des Terroristen. Würde er getroffen und zur Seite fallen, konnte nichts auf der Welt das Herausziehen des Sicherungsstifts aus der Granate verhindern. Auch wenn man sofort beim Opfer sein könnte, eine Befreiung von der tödlichen Fracht am Körper war ausgeschlossen. Die Sprengladung detonierte in fünf Sekunden. Unmöglich, sie in dieser Zeit vom Hals des Mädchens zu entfernen und möglichst weit wegzuwerfen. Wahrscheinlich waren am Ende die Geisel und man selbst tot, oder man verlor beide Hände.
Eigentlich hätte der Terrorist seine Gefangene einfach an uns vorbei durch ganz Nauru an der Leine spazieren führen können. Wie so eine kleine Promenadenmischung-Fußtröte. Keiner von uns hätte ernsthaft etwas unternehmen können, ohne das Leben des Mädchens aufs Spiel zu setzen. Was für eine teuflische Art, eine Geisel zu fesseln?
Was waren nun meine Möglichkeiten? Warten, bis die anderen endlich den Mut aufbrachten, mir zu folgen? Wahrscheinlich regelten sie gerade den Verkehr um die Schule herum und bestellten erst einmal Pizza. Nur für den Fall, dass sich das Ganze länger hinzog und die Terroristen oder sie selbst was zu essen wünschten.
Vielleicht könnte ich die Schnur mit einem gezielten Schuss durchtrennen? Dann schnell nachladen und den Terroristen mit dem zweiten Geschoss zu seinen 72 Jungfrauen befördern, bevor er seine Knarre auf mich gerichtet hat.
Eine Pumpgun ist nicht gerade eine Präzisionswaffe, muss man wissen. Aber meine Schießkünste sind auch nicht schlecht. So wollte ich es versuchen. Ich ging in die Hocke und zielte auf die Schnur. Ich hatte nur eine Chance, nur einen Versuch. Die Geisel saß ganz ruhig und unbewegt in ihrem Stuhl.
Ich dachte an meine Tochter. Die saß niemals irgendwo ruhig und unbewegt. Meist zickte sie den ganzen Tag rum, wegen irgendeinem Handy-Scheiß und nervte mich mit ihrer trotzigen, kreischenden Art, die sie von ihrer Mutter, meiner über alles geliebten Linda, geerbt hatte. Und von ihrer Großmutter. Wahrscheinlich ging das Gekreische schon bis zu den ersten Einbäumen zurück, in denen die Urbesiedler Naurus vor vielen hundert Jahren hier ankamen. Eine unbekannte Vorfahrin beschwerte sich bei ihrem Mann, dass es nach wochenlanger Irrfahrt durch den Pazifik hier nur Kokosnüsse und Vogelscheiße gab. Vielleicht sollten man Jenny auch mal eine Handgranate an den Kopf binden. Dann würde sie mal fünf Minuten die Klappe halten, dachte ich bei mir und ließ mich ehrlich gesagt, ein wenig aus der Konzentration bringen. Aber wo soll man hier auf Nauru eine Granate herbekommen. Kann man sowas im Internet bestellen? Bei Ebay ersteigern? Vielleicht auch so eine, mit einem Feuerzeug drin, die bekommt man bestimmt.
`Klick´… Während ich inzwischen meine Gedanken schweifen ließ, hörte ich hinter mir, direkt an meinem Ohr ein metallisches Geräusch. Als ich meinen Gefühlen über Jenny und ihre weibliche Ahnenreihe nachging, hatte sich ein zweiter Terrorist in aller Seelenruhe von hinten an mich herangeschlichen. Noch bevor ich meine Waffe herumreißen konnte, drückte er ab. Die Kugel traf mich mitten ins Genick.
***
»Ihr habt euch wie die allerletzten Pissnelken angestellt und gnadenlos versagt. Ich bin tief enttäuscht.« Peinlich berührt standen wir in einer Reihe. Mir lief immer noch die glibberige, gelbe Soße des Übungsgeschosses den Hals hinunter. Chief Superintendent Cooper, unser Ausbilder vom australischen `Special Air Service Regiment´, schaute belustigt auf unsere kleine Polizeieinheit, die wie begossene und irgendwie bunte Pudel vor der Schule Aufstellung bezogen hatten. Mich hatte es als zweiten erwischt. Danach folgten noch Mike, Frieda und Tom, bis der Einsatzleiter die Übung mangels weiterer Polizisten abbrach. Nur ein Terrorist war getötet worden. Immerhin hatte ich das erreicht.
Dort drüben stand er. Nun ohne Sturmhaube. Er hatte fünf rosa Farbkleckse auf der Brust und rauchte lässig. Ein paar blaue Flecke würden jedoch zurückbleiben. Auch die Treffer mit diesen Gallertkügelchen aus kurzer Entfernung waren durchaus schmerzhaft, was mich innerlich freute. Eigentlich könnten wir am Abend ein Bierchen zusammen trinken gehen, aber die australischen Kollegen blieben ja lieber unter sich und würden heute noch abreisen.
»Wie kann man nur so idiotisch sein, ohne Deckung, Verstärkung und Flankenschutz in ein unbekanntes, von Terroristen besetztes Gebäude zu stürmen?«, fragte der Drill-Sergeant in meine Richtung. »Spätestens, als ihr Kollege getroffen war, hätten sie abwarten müssen.«
»Sir, ich hielt schnelles Handeln für notwendig«, sagte ich mit fester Stimme in seine Richtung.
»Inspector Hix, wenn sie mal die hundert Meter mit Marschgepäck unter 20 Sekunden spurten können, dann erst sprechen wir in ihrem Zusammenhang von einem schnellen Handeln.« Er sah fast mitleidig auf meine Wampe. Tatsächlich gaben wir übergewichtigen Polizisten aus Nauru im Vergleich zu den austrainierten Elitesoldaten kein sonderlich athletisches Bild ab. Schon gar nicht mit den vielen Farbflecken, die verrieten, dass wir alle mehrere Treffer abbekommen hatten und eigentlich tot waren. Alle, bis auf Tom. Der bestand darauf, dass er später, als die Farbgranate in seinen Händen explodierte, nur die Arme und Beine verloren hätte und fühlte sich uns gegenüber als interner Sieger.
Nach dem letzten Sicherheitsabkommen zwischen Australien und Nauru wurden diese halbjährlichen Visiten der Militärausbilder eingeführt. Als wenn bei uns sowas nötig war, in der kleinsten Republik der Welt, mit ihren gut 10.000 Einwohnern. Wir wussten das und die Ausbilder wussten es wohl auch. Sie taten dementsprechend genervt ihren Dienst.
»Für wie wahrscheinlich halten sie es denn, dass IS-Terroristen um die halbe Welt reisen, nur um hier in Nauru eine Schule zu überfallen?«, fragte ich.
Unser Ausbilder funkelte mich übellaunig an. Fragen über den Sinn eines Einsatzes schien er gar nicht gerne zu hören. »Sie haben hier auf Nauru ein australisches Asylantenheim. Woher wissen sie, dass da nicht auch Terroristen drunter sind, die sich getarnt eingeschleust haben, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Denken sie nur an Deutschland, die Sache mit Schweden, Frankreich und Belgien, meine Herren.«
Auch wenn ich nicht wusste, was in Schweden passiert sein mochte, stimmte der Rest natürlich leider. Nauru war so pleite, dass sich unsere Regierung dafür bezahlen ließ, Bootsflüchtlinge zu internieren, die Australien aufgrund seiner strengen, ja fast hysterischen Einwanderungspolitik nicht im Land haben wollte. Ich dachte an diese armen Teufel. Oft waren es Frauen und Kinder, die ihre syrische, afghanische oder südost-asiatische Heimat unter Todesgefahr verließen, und ihr ganzes Vermögen irgendwelchen zwielichtigen Schleppern gezahlt hatten, mit dem Versprechen, sie ins gelobte Land Australien zu bringen. Dann wurden sie aufgegriffen und statt Down Under hieß es für sie nun: Nauru. Monatelanges Nichtstun, eingezäunt, ohne Perspektive auf ein geregeltes Asylverfahren und den erlösenden Weiterflug ins nächste Auffanglager. Meine Tochter hatte ihr altes Spielzeug dort vorbeigebracht. Wir sahen die dankbaren Augen der vielen Kinder, die hier in unserer Heimat und doch in ihrer eigenen Welt verstaut wurden, weil niemand sie haben wollte. Da sollten Terroristen dabei sein?
»Aber was hätten wir letztlich tun sollen, wenn also der IS, getarnt als Flüchtlinge, sich plötzlich, wie auch immer, mit MG´s und Handgranaten bewaffnet und unsere Schule stürmt?«, wollte ich ebenso genervt wissen.
»Am besten ruft ihr uns an«, war die prompte Antwort von Chief Cooper. »Es sind ja nur gut 2.000 Meilen von Brisbane bis Nauru. In sechs Stunden sind wir da. Ihr sperrt solange die Straße, besorgt schon mal Pizza für die Geiseln und die Terroristen und wartet, bis wir kommen und die Sache für euch lösen. Das steht auch alles in unserem nächsten Bericht an ihren Innenminister.«
Mit diesen Worten ließ er uns stehen. Er marschierte mit seinen Männern, die inzwischen kistenweise Übungsmaterial aus der Schule geschafft hatten, in Richtung unseres einzigen einsatzbereiten Polizei-Toyotas, den wir den Kollegen zur Verfügung stellen mussten und sie fuhren wenige Minuten später in Richtung Flughafen ab. Dort wartete bereits die zweimotorige Maschine der australischen Küstenwache auf die Einheit.
Während der Hausmeister fluchend versuchte, einige Farbkleckse von der Schulwand zu wischen und die wenigen jugendlichen Statisten, die sich an diesem Samstagfrüh für fünf Dollar die Stunde zur Verfügung gestellt hatten in Richtung Strand schlenderten, machten auch wir uns auf den Weg zur Polizeistation. Dort galt es zu duschen. Der Glibber und der ganze Schweiß mussten ja wieder ab. Dann zog ich die Paradeuniform an und setzte mich langsam in Richtung Friedhof in Bewegung. Immerhin war heute Beerdigung - worauf wir uns schon alle freuten.
***
Die Sonne brannte jetzt noch unbarmherziger und erneut lief mir der Schweiß in Sturzbächen über meinen fast kahlen Schädel unter meiner Polizeimütze hervor. Der Stoff unter meinen Armen und an meinem Rücken war auch schon durchnässt, was auf den offiziellen Fotos der Beerdigung später sicher nicht so gut aussehen würde. Aber das war normal hier auf Nauru, der Insel der Dicken, dem einstmals reichsten Land der Erde, meiner Heimat. Hier ist alles normal, was mit Übergewicht, Diabetes, Hitze und Schweiß zu tun hat. Ein geflügeltes Wort bei uns war: »Der gefährlichste Ort auf Nauru ist zwischen einem Nauruer und dem Buffet an einem Staatsbankett«. Das sagte schon einiges über uns aus. Viel Essen ist bei uns eben Normalität. So wie der ewige Sommer. Es gibt keine Jahreszeiten und deshalb nur geringe Temperaturschwankungen. Nachts sind es 30 Grad und tagsüber in der Regel weit über 40. So wie heute. So wie fast immer.
Normal war allerdings nicht, dass ich in meiner Ausgehuniform in einer langen Reihe anderer Offizieller über die staubigen Pfade unseres kleinen Friedhofs wanderte, um von unserem ehemaligen Präsidenten Edward Lawrence standesgemäß Abschied zu nehmen. Übergewicht, Diabetes, Herzinfarkt, die tödliche nauruische Dreieinigkeit, die schon so manchem hier zum Verhängnis wurde. Auch mein Blutwert lag manchmal über 200 und ich musste langsam aufpassen, nicht in die gleiche Falle zu tappen. Da tat ein bisschen polizeilicher Frühsport, wie heute Morgen bei der Anti-Terror-Übung in der Schule, sicherlich gut. Obwohl mich jetzt schon wieder der Hunger quälte. Nachher würden wir uns sicher wieder beim Chinesen treffen und den Polizeitag standesgemäß ausklingen lassen.
Vorher tippelten wir jedoch im Gänsemarsch hinter dem prächtigen Sarg her. Da er zu schwer zum Tragen war, hob man ihn glücklicherweise für alle potentiellen Sargträger auf ein rollbares Gestell. Das wurde nun von vier Kollegen der Präsidialgarde über den von saftigem Grün überwucherten Weg geschoben und hinterließ dabei tiefe Furchen im staubigen Schotter.
Ganz vorne schritt würdevoll unser katholischer Pfarrer Francis Abel mit einem Weihrauchfass in der einen und einem Weihwassergefäß in der anderen Hand. Er genoss sichtlich seinen großen Auftritt. Dann folgte der in den Farben Naurus, Blau und Gelb, mit einem weißen Stern geschmückte Sarg und anschließend kamen die Familienangehörigen in schwarzen kurzen Kleidungsstücken. Wer würde ihnen schwarze Shorts und kurze Hemden bei inzwischen 35 Grad und 82 Prozent Luftfeuchtigkeit schon verdenken?
Weiter hinten schritt die heutige Regierung, angeführt von unserem jetzigen Präsidenten Carl Lody, der sich ächzend auf seinen Gehstock stützte. Ein sichtbares Zeichen seines stattlichen Gewichts, das sich bei ihm wohl mehr in einer Kniearthrose niederschlug. Dahinter marschierte unser korpulente Polizeiminister, dann der Chef der Fluggesellschaft, der Vorsitzende der Phosphatminengesellschaft, die Bildungsministerin und so weiter. Die ganze aktuelle und ehemalige nauruische Führung einträchtig versammelt. Ausnahmsweise ohne die gewetzten Messer hinter dem Rücken. In ihrer fast echt wirkenden Trauer friedlich vereint. Hätten wir hier wirklich Terroristen, wie in der Übung, dann könnten die mit einem Streich die Elite eines ganzen Landes erledigen, was ehrlicherweise bei einem Land wie Nauru nicht ganz so schwierig ist. Immerhin sind wir hinter dem Vatikan und Monaco das drittkleinste Land der Erde. Aber wenigstens die kleinste Republik. Außerdem, wie gesagt, das dickste und früher auch mal das reichste Land. Und das abgelegenste. Mitten im pazifischen Nirgendwo. Vom Wasser umzingelt. Am Ende der Welt.
Endlich war die ganze Prozession am ausgehobenen Grab angekommen. Sie umringte das mächtige Loch, das gestern die Arbeiter zuerst in die sandige Bodenschicht gegraben, anschließend in den festen Korallenstein darunter gehackt und eher schlecht als recht gegen ein Nachsickern der Erde verschalt hatten.
Ich gesellte mich lieber etwas abseits der ganzen Meute zu meinen Leuten, die ebenso in der Sonne schwitzen und beförderte meinen Po lässig auf einen alten Grabstein. Dieser stammte noch aus der deutschen Kolonialzeit und fing unter meinem Gewicht zu wackeln an.
»Was ein Affentheater«, ächzte mir mein Kollege und Freund Sid Reilly zu. Er wischte sich mit einem ungewaschenen Taschentuch über den mächtigen, kurzgeschorenen Schädel, nachdem auch er seine klobige, dunkelblaue Dienstmütze abgenommen hatte. »Da, das Fernsehen ist auch da. Komm, wir quetschen uns mal näher ran, dann sieht man uns später in der Glotze und unsere Frauen werden ganz wuschig«, drängte er mich nun, meinen durchaus bequemen Grabsteinplatz wieder zu verlassen, um mich näher ans Geschehen heranzuführen. Sehr zum Leidwesen einiger bestimmt sehr wichtiger Personen, die ebenso versuchten, ins rechte Bild gerückt zu werden.
Soeben begann das rote Lämpchen an der Kamera aufzuleuchten. Es wurde also aufgezeichnet. Wir hatten inzwischen einen der vielen ehemaligen Präsidenten umschifft und bauten uns vor dem eher schmächtigen Finanzminister auf, der nun seinerseits versuchte, sich an uns vorbei zu stehlen. Dies gelang ihm allerdings aufgrund unserer Masse nicht so recht.
So kam es, dass Sid und ich tatsächlich voll im Bild waren, als Reverend Abel die Abschiedsworte sprach und noch einmal an die glorreichen Zeiten in den 70ern erinnerte, als der natürlich viel zu früh Verstorbene erst Richter, dann Abgeordneter, dann Justizminister und schließlich Präsident wurde. Er führte das Land in einer Phase der Nation, als uns der Wohlstand dank des allgegenwärtigen Phosphats so reich und dekadent machte, dass jeder vier Autos besaß. Viele warfen Münzgeld einfach weg, da man es vor lauter Geldscheinen, die aus den Portemonnaies quellten nicht brauchte. Heute sah das natürlich anders aus. Das Phosphat war weitestgehend abgebaut. Die ganze Kohle wurde verprasst und Nauru fiel wieder auf den Status eines Entwicklungslandes zurück und dies innerhalb von weniger als 20 Jahren.
Der Sarg verschwand endlich im Loch. Die Leibgarde ballerte ein paarmal in die Luft und die endlose Schlange stand an, um eine kleine Schippe voll Dreck ins Grab zu werfen. Was ein trostloser Abschied, dachte ich mir.
Da es jetzt nichts mehr zu sehen und zu filmen gab, zogen auch die Leute vom `Nauru Broadcasting Service´ wieder ab, um ihren Beitrag schnell noch für die Nachrichten zu schneiden. Eine tagesaktuelle Nachrichtensendung bei so wenigen Einwohnern wollte ja schließlich gefüllt werden. Dann wurde selbst Bingo zum sendenswerten Ereignis. Besonders wichtig war es hingegen, wenn ein ehemaliger Präsident das Zeitliche segnet.
Auch unsere Schuldigkeit war getan. Zum offiziellen Leichenschmaus waren wir einfachen Polizisten eh nicht eingeladen. So gingen wir zurück zu unseren Dienstmaschinen und ich stieg auf meine geliebte Honda VTX 1300, deren Chrom in der Sonne blitzte. Schnell noch die Dienstmütze gegen meinen Helm Marke `Westfront 1918´ getauscht. Darauf knatterten wir los, wie eine Rockergang auf dem Weg zum nächsten Gig. Wir waren jedoch die Hälfte der aktiven Polizeitruppe von Nauru.
***
Es zog uns derweil nicht zurück ins Revier oder gar nach Hause. Stattdessen trafen wir uns alle erst einmal, wie fast täglich, in `Xinjas chūnjuǎn´, unserem neuen Stammchinesen. Dieser lag direkt an der `Island Ring Road´, im Bezirk Orro in der Nähe der großen Verladekräne, die auf ihren Stelzen tief ins Meer ragten. Von dort wurde in der Vergangenheit Naurus Exportschlager verfrachtet und als bester Dünger der Welt in alle Kontinente, vor allem natürlich nach Australien, geliefert.
Naurus geografische Lage wurde letztlich zum Fluch. Denn mein Heimatland lag auf der Spitze eines früheren Vulkankegels und entstand nach und nach durch die Ablagerung der korallinen Kalkskelette. In 1.000 Meilen Umkreis gibt es keine andere Insel. Jeder Zugvogel in den letzten Millionen Jahren machte hier Rast und ließ seine Häufchen fallen. So wuchs die Insel in den Jahrtausenden zu einem riesigen Scheißhaufen an. Man sprach dabei von `Guano´, das klang irgendwie besser.
Erst vor 100 Jahren erkannte man, auf welcher Goldgrube unser kleines und ungebildetes Völkchen tatsächlich saß. Die Kette verhängnisvoller Ereignisse begann mit dem Australier Henry Denson, einem Kapitän der britischen Handelsgesellschaft `Pacific Island Company´. 1896 fand er während eines Landgangs auf Nauru einen seltsamen Stein, der wie versteinertes Holz aussah. Drei Jahre lang, so besagt es zumindest die Legende, benutzte Denson das Fundstück lediglich als Türstopper in seinem Büro, bis ein Arbeitskollege auf den Stein aufmerksam wurde und ihn analysieren ließ. Ein derart reines Phosphat fand sich sonst nirgends auf der Welt. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg lechzte die ganze Welt mit ihrer stetig steigenden Weltbevölkerung nach einer immer ertragreicheren Landwirtschaft und damit verbunden nach immer neuem Dünger. In Friedenszeiten trug unser Mineral zur Entwicklung der Landwirtschaft bei. In Kriegszeiten diente sie darüber hinaus zur Herstellung von Sprengstoff.
Wir wurden in den Boomzeiten zum drittgrößten Phosphatproduzenten weltweit und das mit gerademal zehntausend Einwohnern. Doch die Arbeit in den Mienen und das Abbaggern des Gesteins erledigten wir spätestens seit unserer Unabhängigkeit von Australien 1968 nicht mehr selbst. Wir ließen arbeiten und machten irgendwann keinen Finger mehr krumm. Großgrundbesitzer mit mehreren Hektar Land konnten nun zusehen, wie die `Nauru Phosphat Corporation´ ihre Gebiete über die Jahre hinweg aushöhlte. Im Gegenzug bekamen sie einen Scheck von der Regierung. Die Nauruer nannten diese Art der Einkünfte `Royalties´. In weniger als zehn Jahren wurden die größten `Landowners´ Millionäre und Privatiers und lebten von ihren Bodenschätzen. Der Staat nahm dabei trotzdem jährlich gut 450 Millionen australische Dollar ein.
Der Staat sorgte mithilfe der enormen Einnahmen aus dem Guano-Verkauf für alles. Es gab keine Steuern, eine kostenlose medizinische Versorgung in einem modernen Gesundheitszentrum, Schulbildung, Stipendien für nauruische Studenten im Ausland, besonders in Australien und Einkünfte ohne Ende für die Bevölkerung. Der Staat bezahlte den Einwohnern sogar eine Putzfrau und reinigte sozusagen selbst die Toiletten seiner Bürger. Es war das Paradies auf Erden. Denn niemand musste aufstehen und zur Arbeit gehen. Ein wahres Schlaraffenland. Die Chinesen und die anderen `Islanders´ arbeiteten an unserer Stelle. Die Nauruer lebten also vor allem für ihre Hobbys. Jeder besaß, wie gesagt, mehrere Autos. Auch wenn wir nur eine Straße in Nauru hatten, die einmal um die ganze Insel führte. In 20 Minuten konnte man sie umrunden. Was neben Krachmachen mit riesigen Lautsprecherboxen zum Lieblingshobby der Einwohner wurde.
Oft spielte sich vor einer der unzähligen Tankstellen mitsamt den angeschlossenen Restaurants, die fest in den Händen der chinesischen Einwanderer waren, eine merkwürdige Szene ab: Am Steuer eines gigantischen Geländewagens fuhr ein Nauruer vor und hielt an der Zapfsäule. Er ließ den Motor laufen und hupte. Eine Chinesin hüpfte herbei und nahm die Bestellung auf, während sie Unmengen von Benzin in den Tank füllte. Der Nauruer blieb die ganze Zeit in seinem Auto sitzen, ließ weiter den Motor laufen und wartete, bis einige Minuten später die Chinesin mit der Bestellung zum Mitnehmen erschien und Geldscheine großzügig den Besitzer wechselten. Der Nauruer fuhr schließlich los und nahm seine Mahlzeit am Steuer ein. Bis er es aufgegessen hatte, war er schon wieder an der Tankstelle vorbeigekommen. Manchmal hielt er an und holte sich gleich noch einen Nachschlag. Wir fuhren und fuhren. Auf Nauru funktionierte alles mit Benzin. Natürlich die Autos, aber auch die Elektrizitätswerke oder die Meerwasserentsalzungsanlage. Ohne Benzin schlug das Herz Naurus nicht mehr. Die Stille war eine Messlatte für die Vitalität der Insel. Früher summten die Generatoren und die Wagen kurvten ohne Unterlass um die Insel. Heute sieht das allerdings anders aus.
In den 70ern hatte sich unser damaliger Polizeichef sogar einen Lamborghini geleistet. Leider lag die Karosserie so tief, dass die auf die Straße gefallenen Kokosnüsse immer wieder die Ölwanne durchschlugen. Folglich blieb der Sportwagen in der Garage, bis er irgendwann für ein Butterbrot an einen Australier weiterverkauft wurde. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass unser übergewichtiger damaliger Chef ohnehin nicht mehr in den Schalensitz gepasst hätte.
Es war oft sogar nicht nötig, ein kaputtes Auto reparieren zu lassen. Man ließ es einfach am Straßenrand zurück und setzte sich ins nächste. Manche dieser Autowracks stehe heute noch neben den inzwischen schäbigen Wellblechhütten und verrotten in der salzhaltigen Luft.
Statt aber klug in die Zukunft zu investieren, feierte das Land eine Dauerparty. Die Nauruer reisten um die Welt, kauften im Ausland die teuersten Boote, Autos und Hi-Fi-Anlagen und bauten sich immer größere Villen. Es war haarsträubend. Manchmal liefen die Leute mit Aktenkoffern voller australischer Dollar herum, nur um ein Familienfest im China-Restaurant an der Ecke zu bezahlen. Sie kannten keine Grenzen mehr. Auf Partys waren sogar Dollarscheine als Klopapier benutzt worden.
Doch ab dem Jahr 2000 waren die Vorkommen erschöpft und das viele, schöne Geld verschwendet. Zwar hatte der Staat, der sich um alles kümmerte, zig Millionen, in Hochhäusern und Geschäften im Ausland angelegt. Das `Nauru House´ beispielsweise war ein 190 Meter hoher Wolkenkratzer in Melbourne. Es wurde von Nauru in den 1980ern erworben. Lokal war der Wolkenkratzer als `Birdshit Tower´ bekannt. Zum Zeitpunkt seiner Einweihung im April 1977 war es kurzzeitig der höchste Wolkenkratzer in Australien, ehe es nach drei Monaten vom `MLC-Centre´ in Sydney übertroffen wurde. 2004 wurde das Gebäude von Gläubigern der nauruischen Regierung besetzt, sodass diese ihre Institutionen wie eine Filiale der Air Nauru, das nauruische Konsulat und die Präsidentensuite räumen musste. Im November 2004 wurde das Nauru House für etwa 140 Millionen US-Dollar an die `Queensland Investment Corporation´ verkauft, nur um einen kleinen Teil unserer Auslandsschulden zu tilgen.
Auch der Rest unseres Vermögens wurde verschwendet. Manches klingt wie eine Satire, war aber nur zu real. Beispielsweise verlor unser Land Millionen in einem Musical-Projekt. Leonardo, mit vollem Name `Leonardo: A Portrait of Love´, war ein australisches Musical über das angebliche Liebesleben von Leonardo da Vinci mit der Mona Lisa. Es wurde 1993 im West End in London aufgeführt. Finanziert wurde es, weiß Gott warum, von unserer Regierung, welche 2,9 Millionen Dollar darin investierte. Ein Staat, noch dazu ein völlig unbekannter, finanzierte ein Musical. Das machte die Leute neugierig. Die britischen Medien berichteten über das Ereignis. Noch nie war in England so viel von Nauru die Rede.
Als nach vier Stunden der Vorhang fiel, hatten die meisten Zuschauer das Theater schon verärgert, ob der absurden Story und schlechten Musik verlassen. Auch den Kritikern verschlug es bei einem solchen Blödsinn die Sprache. Das Projekt wurde von der Theaterdirektion in London schon nach vier Wochen wegen mangelndem Erfolg abgesetzt. In London galt die ganze Sache bis heute als der spektakulärste Musicalflop der Geschichte. Es ist nur ein weiteres Beispiel für die Verschwendung des nauruischen Reichtums, welche unsere Regierung jahrzehntelang betrieb.
Oder unsere Fluglinie, die zeitweise etwa die Hälfte der jährlichen Einnahmen Naurus verschlang. Bei einer Auslastung von weniger als 20 Prozent war der Flugbetrieb niemals rentabel. Der damalige Präsident hielt es nicht für nötig, `Air Nauru´ zu bewerben. Es war nur wichtig, Nauru mit den anderen Ländern der Welt zu verbinden. Was zählten da schon die insgesamt 600 Millionen Dollar Verluste?
Manche australische Experten sprechen von insgesamt über zwei Milliarden Dollar, die wir im Laufe der Zeit mit unseren verschiedenen Versuchen, unseren Reichtum anzulegen, verpulvert haben. Nicht schlecht, für etwas mehr als 10.000 Einwohner.
Jetzt könnte man meinen, dass es bei diesen vielen Skandalen, den Vertuschungen und Verschwendungen einen Aufschrei in unserem Land gegeben hätte. Zumindest spätestens, als auch die letzten Reserven aufgebraucht waren und die `Bank of Nauru´ schließen musste. Auch wir Staatsdiener warteten teilweise monatelang auf unsere Besoldung. Aber nichts dergleichen geschah. Denn es waren trotz aller politischen Instabilität in den letzten Jahren immer die gleichen Politiker im Amt, die sich mit den besten Posten abwechselten. Eine Zeitlang wurden die Regierungen per Misstrauensvotum im Monatstakt abgewählt und neue eingesetzt. Es gab Minister, die schon mehr als vier Ressorts innehatten – mit Kompetenz für keines davon.
Nauru war ja eine parlamentarisch-demokratische Republik, sogar mit ihren 10.000 Einwohnern die kleinste auf der Welt. Worauf wir auch immer sehr stolz waren. Staatsoberhaupt und zugleich Regierungschef war der vom Parlament gewählte Präsident. Nach der Queen natürlich. Das Parlament von Nauru bestand aus 19 Abgeordneten, die für drei Jahre gewählt wurden. Es gab eine Wahlpflicht ab dem 20-sten Lebensjahr. Da jedoch kein festes Parteiensystem existierte, wurden zumeist erst nach den Wahlen Koalitionen aus Gruppen und Einzelkandidaten gebildet. Der Präsident wurde im Parlament gewählt und dieser ernannte sein Kabinett aus für ihn günstigen Personen. Er konnte aber auch mit Zweidrittelmehrheit wieder gestürzt werden. Dies war oft die Hauptbeschäftigung unserer Legislative.
Seit der Unabhängigkeit Naurus von Australien 1968 war das Land zunächst politisch durchaus stabil. Aber in den letzten 14 Jahren kam es zu 18 Regierungswechseln. Seit der Staatsgründung gab es insgesamt fast 40 Regierungen. Die wichtigste Aufgabe unseres kleinen Fernsehsenders war immer, neben der Ausstrahlung von Fußball und einem erotischen Nachtprogramm, die Bevölkerung über die neuesten Kabinettsumbildungen zu informieren. Oft gab es gerade in den Schulen eine große Verwirrung, welches Präsidentenbild aktuell im Büro des Direktors aufzuhängen war.
Nauru war also nach dieser ganzen Verschwendung faktisch bankrott und suchte nun verzweifelt nach anderen Einnahmequellen. Neben dem erwähnten Internierungsort für australische Asylbewerber mauserte sich die Insel eine Zeitlang zum Paradies für Briefkastenfirmen und Steuerflüchtlinge. Allein die russische Mafia soll hier 75 Milliarden Dollar gewaschen haben. Angeblich verkaufte die Regierung sogar Diplomatenpässe für jeweils 15.000 Dollar - auch an zwei mutmaßliche Terroristen. Unser vermeintliches Paradies stand nun plötzlich auf der Liste der `Schurkenstaaten´. In der UNO stimmte Nauru für den Walfang, und ließ sich dies von Japan in Form von regelmäßigen Benzinlieferungen bezahlen. Das einst reichste Land der Welt war zum Entwicklungsland, zur Dritten Welt, abgesunken. Unsere Bewohner mussten sich wieder von der Fischerei ernähren. Die Villen verfielen, die Autos verrosteten.
Ansonsten konnte man Nauru zwar nicht gerade mit Lummerland vergleichen - wir konnten noch nicht einmal zwei Berge unser Eigen nennen. Aber Nauru hatte den wenigen Touristen, die sich hierher verirrten, um das drittkleinste Land der Welt mit eigenen Augen zu sehen einiges zu bieten: Wundervolle Südseelandschaften mit malerischen Stränden, prachtvolle Architektur im Kolonialstil und Jahrzehnte der Hingabe an Kunst und Kultur, waren zugegeben kaum zu finden. Unser einziges Hotel war ziemlich heruntergekommen und nur die Preise hatten Sterne-Niveau. Es gab eher den rustikalen Charme alter Weltkriegsbunker, gepaart mit einer Kombination aus unberührter Natur und wilden Müllkippen. Aber dennoch, trotz 100-jähriger Ausbeutung der Natur und dem weitgehend vorherrschenden Wellblechstil der Häuser, war es meine Heimat, die ich wie jeder Bewohner Naurus umso mehr liebte.
Allerdings hatte sie sich verändert. Als ich klein war, konnte ich vom Klassenzimmer aus sehen, wie drei oder vier Frachter vor dem Hafeneingang warteten. Mit Laderäumen voller Phosphat fuhren sie zwischen Nauru und Australien hin und her. Am Flughafen sahen wir den Maschinen von Air Nauru beim Starten und Landen zu.
Jetzt lebten wir mit dem Niedergang und das, obwohl sich die Phosphatpreise gerade in den letzten beiden Jahren verdreifacht hatten. Grund dafür war die exponentielle Steigerung der Produktion für Biokraftstoffe auf der Welt. Die reichen Länder im Norden kippten den Mais scheinbar lieber in den Tank, als ihn zu essen oder zumindest den Ärmsten der Armen zu spenden. Deshalb wurde schon darüber nachgedacht, vielleicht die letzten Reserven auf der Insel noch zusammenzukratzen und die Produktion zumindest in reduzierter Form wieder anlaufen zu lassen. Vielleicht stand uns ja doch wieder eine reiche Zukunft bevor. Doch wahrscheinlich hätten wir auch dann nichts aus unserer Vergangenheit gelernt. Wäre unser materieller Wohlstand erst einmal wieder gesichert, vernachlässigten wir wieder unsere Kultur und wir pfiffen erneut auf die Umwelt. Wobei ich glaube, in diesem Punkt waren wir alle auf der Welt gleich, ob wir aus Nauru oder dem reichen Norden kamen.
***
Ich erzähle dies alles nur, um ein wenig zu verdeutlichen, in welch merkwürdigem Land ich, Stephen Hix, 36, seit 15 Jahren glücklich verheiratet mit Linda und ebenso lange Vater einer spätpubertierenden Tochter, lebte und arbeitete. Noch etwas länger war ich nämlich bei der Polizei, was mich wirklich stolz machte.
Auch wenn es für uns nicht wirklich viel zu tun gab. Mal einen Streit im Suff schlichten. Neben der Diabetes und dem damit verbundenen Übergewicht des Großteils der Bevölkerung, war der Alkohol das zweite Hauptproblem im Land. Saufen und fressen, das konnten wir. Da machte uns so schnell niemand was vor.
Wir schrieben auch gerne Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit. Man durfte ja nur 40 km/h schnell fahren, woran sich aber kaum jemand hielt. Natürlich im geliebten Linksverkehr. Wenn wir wirklich einen besoffenen Raser jagten, dann fuhr ein Motorrad hinterher, damit der Übeltäter nicht doch bei den wenigen Möglichkeiten abbog. Der Rest der Truppe konnte in Ruhe eine Straßensperre vorbereiten. Denn in etwa einer Viertelstunde war der Verkehrssünder ja wieder an derselben Stelle zurück. Er konnte in der Regel schnell verhaftet und in unser kleines Gefängnis neben der Polizeiwache gebracht werden. Das letzte Kapitalverbrechen lag schon mehr als 20 Jahre zurück. Solche Strafen wurden auch nicht bei uns vollstreckt, sondern nach einem Justizabkommen beider Länder in Australien.
***
Jetzt saßen wir also beim Chinesen im Imbiss und ließen uns das gut frittierte Essen in Riesenportionen munden. Dazu Cola und danach Eis. Nebenbei fütterte ich diese roten Fische im Aquarium, das rechts neben dem Eingang auf einem mit kitschigen, chinesischen Motiven bedeckten Tischchen stand, mit übriggebliebenem Reis. Selbst zu kochen, fiel uns in Nauru immer noch nicht ein und so gingen auch wir von der Polizei fast täglich Essen.
Diesmal schmeckte es besonders gut, was an Jonny lag, dem neuen Koch bei Xinja, der Besitzerin. Die stets gut gelaunte, ältere Dame, stand meist hinter dem Tresen und putzte pausenlos Gläser, oder unterhielt sich mit einer jugendlichen Aushilfe. Jonnys Kochkünste waren es, die uns Polizisten seit einigen Wochen hierher kommen ließen. Dazu kamen die funktionierende Klimaanlage, die günstigen Preise und die Riesenportionen.
Bald waren alle satt und Jonny gesellte sich wieder einmal zu uns und lauschte unseren Gesprächen oder beteiligte sich mit seinem starken chinesischen Akzent daran. Wir mochten den kleinen, drahtigen Mann unbestimmten Alters, mit den vielen Tätowierungen.
»Jonny, wo kommst du eigentlich her?«, wollte ich nun wissen, als er sich mir am Plastiktisch gegenübersetzte und mit seinem wenig sauberen Geschirrtuch den Schmutz und das Fett auf der Platte mit der grünen Kunststoffdecke drauf, ein bisschen verteilte. Denn seine Gesichtszüge waren nicht nur chinesisch.
»Ich aus Niihau, das seien eine Hawaiiinsel. Mein Vater sein chinesischer Matrose, meine Mutter von Insel. Ich mit Vater um halbe Welt gereist als Schiffsjunge und später als Koch, jetzt hier glücklich in Nauru. Vielleicht aber bald wieder auf Schiff unterwegs, wer weiß. Herrliche Motorräder, ich eins hatte in Java«, antwortete er und deutete auf unsere Maschinen, die in der Nachmittagssonne blitzten. Wenn wir schon in Punkto Verbrechensbekämpfung kaum etwas zu tun hatten, war die Pflege unserer Motorräder nicht nur Zeitvertreib, sondern Passion. Es waren ja auch nicht mehr die neuesten Modelle und Ersatzteile konnte sich der Staat nicht leisten.
»Wenn Du willst, dann drehen wir nachher mal eine Runde«, sagte ich ihm und überlegte, ob ich ihn zukünftig aus Spaß `Java-Jonny´ nennen sollte, entschied mich aber schließlich dagegen. Dieses Angebot der gemeinsamen Fahrt erfreute ihn sehr. Es bescherte mir später einen Riesennachschlag an Frittiertem zum Mitnehmen für die Familie, was mir neidvolle Blicke meiner Kollegen einbrachte.
Wir stiegen auf meinen Bock und ich startete den Motor. Um ein wenig anzugeben, ließ ich ihn mehrfach aufheulen, bevor ich losfuhr. Der Asphalt flimmerte in der Hitze. Nur der Fahrtwind verschaffte mir etwas Abkühlung. Nach 16 Minuten waren wir dank Blaulicht schon wieder da. Wir hatten die Insel einmal umrundet, mehrere Hühner von der Straße vertrieben und Jonny freute sich wie ein Kind, als er hinter mir auf dem Sozius hockte. Er bedankte sich überschwänglich und reichte mir meinen Nachschlag. Grinsend machte ich mich an meinen Kollegen vorbei, endlich auf den Weg nach Hause.
***
Als ich in meinem Eigenheim im Distrikt `Aiwo´ ankam, wurde ich von meiner Frau Linda wortreich und durchaus liebevoll begrüßt. Sie hatte meinen Waschbär-Körper wohl inzwischen schon im Fernsehen bei der Beerdigung gesehen und war mächtig stolz auf mich. Dies steigerte sich noch, als ich ihr die zahlreichen Styropordosen, mit dem noch warmen chinesischen Essen, überreichte. Damit war zwar ihr Plan, heute nochmal Essen zu gehen und anschließend zum Bingo in die City-Hall zu schlendern, etwas über den Haufen geworfen. Aber das schien sie nicht weiter zu stören.
Wir begaben uns in die nur selten benutzte Küche. Ich fütterte erst einmal unseren Kater Pepe, damit er nicht wieder versuchte, sich etwas von unserem Essen zu stibitzen. Dann machten wir es uns am Tisch bequem. Dabei redete sie unaufhaltsam. »Jenny ist bei Carol über Nacht und du sahst im Fernsehen großartig aus, so bei den ganzen hohen Tieren. Willst du nicht doch in die Politik, wie Onkel Frank? Deine Paradeuniform steht dir übrigens ausgezeichnet, viel besser, als die andere. Oh, da sind ja auch diese leckeren, frittierten Gemüsesticks mit drin. Gemüse ist gesund, musst du wissen. Heute Vormittag war ich bei Dave und habe ihn wegen der Reparatur fürs Dach gefragt. Er kommt nächste Woche mal vorbei.«
Noch bevor sie Luft holen konnte, küsste ich sie erst einmal und unterbrach damit ihren Redefluss.
»Wenn Jenny über Nacht weg ist, dann könnten wir doch später mal wieder ein bisschen fummeln«, sagte ich so vor mich hin.
»Aber was ist mit meinem Bingo?«, fragte Linda etwas pikiert. »Marcy und Pat kommen auch hin. Außerdem wollte mir Stacy noch was über Mary erzählen. Ich glaube, da kriselt es.« Sie sah meine sichtliche Enttäuschung und meinte dann etwas versöhnlicher: »Aber es wird sicherlich nicht so spät. Dann können wir ja noch was machen. Morgen ist immerhin Sonntag und Ausschlaftag.« Sie grinste mich dabei anzüglich an. »Soll ich uns noch eine DVD mitbringen oder wollen wir schauen, ob die Internetverbindung schnell genug für diesen Pornokanal ist?«
Ach, ich liebte einfach meine Frau und hätte sie manchmal noch einen Leiseschalter, wäre mein Glück perfekt. So verabschiedeten wir uns, nachdem auch ich beim Essen nochmal kräftig zugelangt hatte. Während sie unseren alten Toyota Starlet nahm, hockte ich mich mit einem kühlen Bierchen vor den Fernseher und ließ den Samstag gemütlich mit meinem Kater auf dem Bauch ausklingen. Ich zappte zwischen Catchen und einem schlecht synchronisierten Erotikfilmchen hin und her und suchte nebenbei in Ebay nach Feuerzeughandgranaten.
Später als gedacht, so um halb zwölf, kam auch endlich Linda zurück. Sie war bester Laune, steckte voller neuem Tratsch und wenigstens drei Gläschen Sekt zuviel. »Gevin hatte heute mit dem Neuen die Alkoholkontrollen auf der Main-Road gemacht. Mich hat er netterweise gleich durchgewinkt. Ich soll dich schön von ihm grüßen und fragen, ob du morgen mit zum Fischen kommst. Manchmal ist es wirklich nicht schlecht, mit einem Polizisten verheiratet zu sein.« Nur allzu gerne ließ sie sich von mir, während sie so daher plapperte, ins Schlafzimmer ziehen.
***
Die Rollläden waren geschlossen, unsere hässlichen Nachtischlampen, Hochzeitsgeschenke von der Schwiegermutter und damit sakrosankt, erloschen. Nur auf der Fensterbank blubberte eine Lavalampe und tauchte das Schlafzimmer in ein pulsierendes lila und rosa Licht, was ein wenig Puff-Atmosphäre verbreitete. Unsere Klamotten lagen in einem wüsten Haufen auf dem Boden. Im DVD-Player befand sich ein schmuddeliger Porno. Dort in der Glotze ließ gerade ein strippender, gut bestückter Polizist vor einer Horde liebestoller Frauen die letzten Hüllen fallen. Ich war nicht ganz so gut bestückt, aber mit ebensolcher Leidenschaft bei der Arbeit. Linda lag unter mir und quietschte wie ein kanadisches Rothörnchen bei Gefahr.
Da dudelte das Telefon. Und dudelte. Dann ging der Anrufbeantworter ran. Nun gehörten wir ehrlicherweise zu den Leuten, die es witzig fanden, einen doofen Spruch aufs Band zu sprechen. So hörten wir zunächst unseren Text: »Hallo? [Schüchtern klingend] Hier ist der... äh... automatische Kühlschrank, ich vertrete den Anrufbeantworter. Bitte hinterlassen sie mir eine Nachricht, ich werde sie dann mit einem von diesen gelben Zetteln auf meine Tür kleben. *beep*«. Dann meinen Kollegen Mike, der auf Band sprach: »Geh ran, Stepie. Wir haben einen Einsatz und dein fetter Arsch wird gebraucht!«
Nun gibt es in der Tat kaum etwas Abtörnenderes, als wenn beim Sex das Telefon bimmelt. Höchstens noch, wenn dein Kind plötzlich in der Tür steht und fragt: »Was macht ihr denn da?« oder wenn deine Frau sagt: »Ich nehme ihn heute mal ganz in den Mund. Das habe ich bei meinem Ex auch immer gemacht.« Jetzt also das Telefon. Da galt es Ruhe bewahren und sich nicht so einfach aus der Konzentration bringen zu lassen. Also machte ich zunächst weiter und der Anruf endete Gott sei Dank. Aber nur für wenige Sekunden, dann klingelte es erneut. Wieder war es mein Kollege. »Scheiße Stepie, mach schon, ich bin in zwei Minuten bei dir und hole dich mit dem Wagen ab. Die Kacke ist wirklich am Dampfen!«
Ich hatte überhaupt keine Chance, zum Höhepunkt zu kommen. In zwei Minuten? Ich ließ meine leicht genervte Frau im Bett zurück, sammelte meine verstreuten Klamotten vom Boden und zog mich in Windeseile an. Ich hatte gerade die Stiefel geschnürt, da quietschten Reifen in meiner Auffahrt. Ein Blick aus dem Fenster zeigte mir, dass unser Geländewagen, mit drei Kollegen besetzt war und vor meinem Haus hielt. Ich erkannte Frida, Tom und Mike. Was zum Teufel war los? Ich öffnete die Eingangstür, näherte mich dem Wagen und mein Kollege Tom stieg aus.
»Es gibt eine Leiche, vermutlich Selbstmord«, sagte er aufgeregt.
»Und dafür stört ihr mich mitten in der Nacht?«, gab ich zurück. »Warum habt ihr nicht einfach Doktor Spencer alarmiert?«
»Das haben wir ja. Aber der Tote ist unser Ex-Präsident Somerset Maugham«, gab mir mein Kollege als Antwort. »Er liegt in seiner Badewanne, mit aufgeschlitzten Pulsadern. Das willst du dir doch nicht entgehen lassen. Aber vielleicht solltest du dir noch vorher eine andere Hose anziehen. Ich glaube, die da ist von deiner Frau.«
11. September
Es war jetzt kurz nach Mitternacht. Wir fuhren mit Blaulicht, was, in Anbetracht der späten Stunde, nicht wirklich nötig war. Denn die einzige Straße war menschenleer. Aber es machte gleich viel mehr Spaß.
Nur knapp zehn Minuten würden wir zum Regierungsbezirk Yaren brauchen. In diesem standen neben dem Parlament und unserem kleinen, noch von den Japanern während des Zweiten Weltkrieges gebauten Rollfeld, auch die Villen der meisten Reichen.
Zwei tote Ex-Präsidenten innerhalb von weniger als einer Woche? Gestern bei der Beerdigung war der alte Knacker jedenfalls noch höchst lebendig. Ich hatte ihn deutlich erkannt, als ich mich ins Fernsehen drängte. Er stand etwas abseits und starrte immer wieder auf das pralle Dekolleté der Miss Nauru von 1995, die inzwischen in einem Ministerium Büroleiterin geworden war. Eine Tätigkeit, für die sie sich besonders mit zwei hervorstechenden Eigenschaften auszuzeichnen schien.
Wir erreichten die Hofeinfahrt zu einem schmucken Haus im Kolonialstil, das ein Stück zurückgesetzt von der Straße lag und von einem etwas verwilderten Garten mit einer recht hohen Mauer umgeben war. Ja, wer immer noch Geld hatte, konnte sich auch auf Nauru weiterhin ein sorgenfreies Leben leisten. Vor dem Tor wartete eine aufgelöst wirkende Angestellte auf uns und öffnete das schwere Eisentor. Wir fuhren rein und hinterließen beim Bremsen erst einmal deutliche Spuren im feinen Kies vor dem Eingangsportal. Dann stiegen wir aus und ich übernahm als dienstältester Beamter das Kommando.
»Wer hat die Leiche gefunden? Wann war das genau und wo waren sie während der letzten Stunden?«, bombardierte ich gleich die etwas hilflos wirkende Angestellte, die sich als Mrs. Lotz vorstellte. Sie geleitete uns ins Haus, nachdem wir alle unsere Schuhe säubern mussten. Die ältere Dame schien zumindest ihren Sinn für penible Sauberkeit nicht verloren zu haben.
»Ich bin vor einer Stunde vom Bingo gekommen. Da war alles ruhig im Haus. Sir Maugham war anscheinend im Badezimmer. Immerhin drang von dort noch Licht nach draußen. Es gibt dort eine Tür in den Flur und eine vom Schlafzimmer aus. Ich wollte zunächst nicht stören, aber mich doch zurückmelden und fragen, ob seine Exzellenz noch etwas wünschte. Deshalb klopfte ich an der Schlafzimmertür, wie jeden Samstagabend. Da ich aber keine Antwort erhielt, öffnete ich. Die Tür zum Bad stand weit offen.«
Die Dame begann zu schluchzen und vergrub ihr Gesicht in den hutzeligen Händen. Frida kümmerte sich um die Haushälterin. Sie konnte ganz gut mit älteren Leuten. Währenddessen stieg ich mit meinen Kollegen die geschwungene Treppe hinauf. Oben befand sich ein breiter Flur mit mehreren Türen. Fotos hingen an den Wänden, die ich mir später noch ansehen wollte. Eine Tür stand offen und wir betraten das Schlafzimmer, nachdem wir uns alle diese blauen Gummihandschuhe angezogen hatten. Wir wollten ja keine Fingerabdrücke verursachen oder Spuren verwischen. Ich zog sie zuhause auch an, wenn ich alle zwei Wochen samstags das Klo putzte.
Schon von der Tür des geräumigen Zimmers aus, mit Himmelbett, Schränken und Kommode, konnte man in das Badezimmer sehen. Zunächst war ein blutverschmierter Arm zu erkennen, der über den Rand der Wanne ragte. Vor der mit weißen Kacheln besetzen Badewanne, war ein gewaltiger Blutstrom auf dem Zimmerboden geflossen und hatte sich dort in einer Lache gesammelt.
Ich näherte mich vorsichtig und versuchte, nicht in das Blut zu treten. Während dessen schauten sich Tom und Mike schon einmal im Schlafzimmer genauer um und machten erste Fotos. Eigentlich war nur besagter Arm zu sehen, über dessen Handgelenk ein tiefer, senkrechter Schnitt führte. Die Person in der Wanne war in der blutroten Flüssigkeit fast versunken. Nur der spärliche Haarschopf ragte noch heraus. So konnte man den Ex-Präsidenten doch deutlich erkennen. Auf dem Beckenrand lag ein Apfelmesser, mit blutverschmierter Klinge.
Unten war inzwischen ein weiterer Wagen zu vernehmen. Kurze Zeit später hörte ich die mir wohl vertrauten, etwas schlurfenden Schritte von Doktor Spencer, der die Treppe heraufkam. Wir hatten hier nicht sehr viele Ärzte. Spencer kam ursprünglich aus Neuseeland und wurde in den 70ern vom Geld nach Nauru gespült. Er leitete viele Jahre lang unser einziges Krankenhaus, war ein guter Internist und seit nunmehr acht Jahren offiziell im Ruhestand. Was ihn jedoch nicht davon abhielt, weiter zu praktizieren und jedermann vor den Gefahren des Übergewichts zu warnen. Außerdem spielte er hervorragend Poker und kam wenigstens zwei Mal im Monat bei uns in der Polizeiwache auf ein Spiel und ein Gläschen nach Feierabend vorbei.
»Hallo Gerald, was eine Sauerei«, begrüßte ich ihn. Er gab jedem Kollegen und mir mit den Worten »Du hast wieder zugenommen, Stepie« die Hand. Darauf besahen wir uns den Toten genauer.
Spencer hatte inzwischen ein kleines Diktiergerät gezückt und quatschte einige wichtig klingende, medizinische Begriffe hinein. Er untersuchte den Toten noch vor Ort, konnte aber nur noch eine Öffnung der zweiten Pulsader am anderen Handgelenk feststellen.
»So, wie`s momentan aussieht, ist er bestimmt schon zwei Stunden tot«, raunte mir Dr. Spencer zu und ergänzte seien Standartspruch bei solchen Gelegenheiten: »Aber genauer kann ich das erst im Krankenaus feststellen.«
»Wie lang dauert es denn, bis man nach dem Aufschneiden der Pulsadern stirbt? Denn die Haushälterin war ja nicht so lange fort. Reicht die Zeit überhaupt?«, wollte ich wissen.
»Es ist entscheidend, wieviel Blut man verliert. Bei großer Verlustmenge, trübt man ein und verliert dann das Bewusstsein. Bei genügend Zeit ohne medizinische Hilfe, würde dies also ausreichen. Je nachdem wie lang, beziehungsweise tief der Schnitt ist, geht es natürlich schneller. In den ersten Minuten wirst du schwach, müde, deine Herzfrequenz nimmt zu, du erleidest einen hypovolämischen Schock. Irgendwann so nach zehn Minuten, wirst du dann bewusstlos.« Mit diesen Worten verabschiedete er sich und ich war nicht viel schlauer als zuvor.
Unten waren inzwischen weitere Personen angekommen. Sanitäter, der Staatsanwalt, ein Mitarbeiter des Innenministers, der Untersuchungsrichter und unser Polizeipräsident Gary Powers drängten sich im Schlafzimmer zusammen. Bald erschien ein Reporter von der Zeitung und machte solange Fotos, bis wir angehalten wurden, dies zu unterbinden. So geleitete ich den mir gut bekannten Reporter der `Nauru News Today´ nach draußen und wir rauchten erst einmal eine. Denn es war ob der vielen bedeutsamen Leute momentan unmöglich, hier weitere Spuren zu sichern, also unseren Job zu erledigen. Jeder machte sich wichtig und gab Anweisungen. Endlich wurde der Körper aus dem lauwarmen Wasser gezogen und mit einigen Mühen auf eine Bahre gehievt. Als erstes machte sich der Krankenwagen mit der Leiche und dem Doktor im Schlepptau von dannen. Es dauerte aber noch eine ganze Weile, bis sich auch der Rest der edlen Gesellschaft wieder aus dem Staub machte.
So quatschte ich noch eine Weile mit dem Reporter. Ralph Van Deman besuchte uns oft in der Wache und berichtete gerne über die wenigen Vergehen, die wir aufzuklären hatten. Er war sozusagen Naurus einziger Kriminal- und Gerichtsreporter. Der fast 60-jährige lehnte nun lässig an der Veranda und klickte durch die wenigen gelungenen Fotos, die er machen konnte, bevor wir ihn hinausgeleiteten.
»Da sind ein paar brauchbare dabei«, sagte er in meine Richtung und hielt mir seine Nikon vor die Nase. »Das mit dem vielen Blut in der Wanne macht sich sicherlich gut vor dem weißen Hintergrund. `Mit dem Obstmesser ins Jenseits´, das wäre doch ´ne gute Headline.«
»Die kannst du nicht einfach drucken«, entgegnete ich ihm und besah mir die weiteren Aufnahmen. »Da bekommst du bestimmt Ärger von der Familie oder dem Präsidenten. Warte doch erst mal die Untersuchung ab.«
»Ein Unfall war es jedenfalls nicht«, gab er zu Bedenken. »Das hier, wo die vier Sanitäter ihn mühsam aus dem Haus schleppen, das geht aber. Da sieht man nur das weiße Tuch über der Bahre und die angestrengt schwitzenden Träger. `Tod im Badezimmer´ und dann ein älteres Bild von ihm. Vielleicht das, als er der Queen die Hand schüttelte. Das hab ich noch irgendwo im Archiv.« Van Deman schien schon voll in seinem Element. Er grüßte kurz zum Abschied, ging zu seiner Vespa und knatterte in die pechschwarze nauruische Nacht davon.
Ich kehrte erst einmal wieder ins Schlafzimmer zu meinen Leuten zurück. »Kein Abschiedsbrief oder so«, sagte gleich Tom und blätterte in seinen Notizen. »Die Haushälterin berichtete zwar, dass er letztes Jahr die Diagnose Parkinson bekommen hatte. Aber die Medikamente zeigten wohl gute Wirkung, sodass es bisher kaum einer bemerkt hatte. Scheidet als Selbstmordmotiv also auch aus.«
»Vielleicht hatte er wieder einen Schub und es war in letzter Zeit schlimmer geworden«, antwortete ich ihm und besah mir derweil die Fotos oben im Flur genauer. »Das wäre für mich schon ein Motiv, wenn ich Angst haben müsste, vielleicht demnächst ein Pflegefall zu werden. War er eigentlich verheiratet?«
»Sogar drei Mal. Zwei leben noch auf der Insel. Die letzte ist allerdings schon vor acht Monaten gestorben. Die Kinder studieren wohl im Ausland. Zwei in den USA und die jüngste Tochter irgendwo in Südeuropa«, steuerte jetzt auch Frieda Informationen bei. Sie war das jüngste Mitglied unserer kleinen Polizeieinheit, gerade erst 24, mollig, mit einer enormen Oberweite, sodass ihre Uniformen extra umgenäht werden mussten. Sie hatte sich anscheinend bei einem Gläschen Cognac mit der Haushälterin unterhalten. »Er ging nicht mehr oft aus dem Haus, was mit seinen 81 ja auch nicht verwunderlich ist«, resümierte sie weiter.
Die Bilder an den Wänden zeigten ihn deutlich jünger, als Präsident mit verschiedenen, mir weitgehend unbekannten Staatsmännern beim Händeschütteln. Eine Aufnahme stammte vom Besuch der Queen auf Nauru im Jahre 1982, wovon es noch heute Briefmarken gab und als nationaler Höhepunkt galt. Sie kam standesgemäß mit der `Queen Mary II´ an und nannte Nauru wegen seines wirtschaftlichen Erfolgs, ein Beispiel für die Entwicklung von Staaten im pazifischen Raum. Elisabeth verlieh Maugham den Ritterschlag der britischen Krone. Die ganze Nation fühlte sich damals sehr geschmeichelt und wir Kinder bekamen drei Tage schulfrei.
Eine weitere Aufnahme war von einer Audienz beim damaligen Papst und die nächste zeigte ihn in noch jüngeren Jahren in einer nauruischen Polizeiuniform.
»Ich wusste gar nicht, dass er einer von uns war«, sagte ich ehrlich erstaunt. Die anderen kamen näher und wir besahen uns das leicht verblasste Schwarzweiß-Foto.
»Da hinter ihm, das ist doch dein Vater«, erkannte Mike plötzlich meinen alten Herrn auf dem Bild. »Frag den doch«. Ich hatte mich bisher nur auf den Toten und seine prominenten Begleiter konzentriert und gar nicht auf den Hintergrund des Fotos geachtet. Aber Mike hatte Recht. Dort stand mein Vater Paul Hix in jungen Jahren. Das Bild musste bestimmt schon über 40 Jahre alt, also noch vor meiner Geburt entstanden sein.
Der Polizistenberuf lag bei uns sozusagen schon in der Wiege. In jeder Generation gab es wenigstens einen Bullen in der Familie. Selbst in der deutschen Kolonialzeit diente mein Ur-Ur-Urgroßvater Moses Hix in der Polizeitruppe, was ein altes Bild im Familienalbum bewies: Dunkelhäutig, mit Lendenschurz, eine deutsche Polizeikappe auf dem Kopf, mit einem Vorderlader im Arm. Neben ihm knieten drei weitere Hilfspolizisten, die ebenso barbarisch aussahen. In der Mitte thronte ein weißer Offizier, mit einem mächtigen Schnauzbart, in einer strahlenden, kaiserlichen Marineuniform und einer Reichskriegsflagge vor mehreren Palmen.
»Oh, da werde ich ihn gleich nachher mal fragen. Ich wollte ohnehin mit ihm und Gevin zum Fischen raus«, erwiderte ich und sah auf meine Uhr. Inzwischen war es kurz nach drei in der Nacht.
Hier gab es für uns augenscheinlich nichts Interessantes mehr. Es konnten keine Einbruchs- oder Kampfspuren festgestellt werden. Das Messer würde wahrscheinlich gerade auf Fingerabdrücke hin untersucht werden. Hinter einem Pferdebild an der Wand neben dem Bett, fanden wir zwar noch einen schweren Safe. Aber ohne einen Beschluss des Richters gab es für uns keinen Grund, seinen Inhalt sehen zu wollen. Es deutete jedenfalls nichts darauf hin, dass er vor Kurzem erst geöffnet wurde. Beispielsweise, um einen Abschiedsbrief aufzunehmen. Trotzdem baten wir die Haushälterin, uns sofort zu informieren, wenn sich noch etwas Diesbezügliches einfinden würde.
Endlich wendeten wir unseren Polizeiwagen im Kies und ich wurde nach Hause zurückgebracht. Wir wollten uns alle gegen Mittag auf der Wache treffen, um gemeinsam den Bericht zu verfassen. In einem solchen Fall verlangte der Polizeichef bestimmt eine rasche und ausführliche Arbeit. Vielleicht lag auch dann schon Genaueres von Dr. Spencer vor.
Als ich endlich in meinem Bett ankam, blubberte zwar immer noch die Lava-Lampe, Linda schlief aber schon längst. Ich versuchte so leise wie möglich zu sein, um sie nicht zu wecken, legte mich auf meine Seite, verscheuchte noch den Kater aus dem Bett und schlief fast augenblicklich ein.
***
Als ich am späten Vormittag erwachte, konnte ich neben Katzenfutter schon den herrlich duftenden Kaffee aus der Küche riechen. Ich fand Linda dort, die mich anstrahlte und mir einen großen Pott einschenkte. Wir unterhielten uns über die Vorkommnisse der letzten Nacht, und dass ich mich schon auf die nächste Beerdigung freute, als ein Auto vor unserem Haus hielt. Meine Tochter Jenny stieg mit einer kleinen, pinken Reisetasche aus.
»Hey Dad, hallo Mom«, begrüßte sie uns und man sah ihr an, dass sie in dieser Nacht auch nicht viel zum Schlafen gekommen war. »Carol hat viel schnelleres Internet als wir. Das brauchen wir auch. Wir haben da mit einem süßen Typen von den Philippinen gechattet, der war voll cool. Er macht seine eigene Hip-Hop-Musik und will uns vielleicht mal besuchen.« Sie kraulte dabei Pepe.
»Ist wahrscheinlich in Wirklichkeit ein alter Sack, der sich als Jugendlicher ausgibt. Mit Schwabbelbauch. Der nur an Nacktfotos von jungen Mädels ran will«, erwiderte ich.
»Mensch, Dad«, zickte Jenny zurück, nahm sich zwei Donats aus der Schachtel und verzog sich schmollend in ihr Zimmer. Ich besprach meinen Anrufbeantworter neu, wässerte den Rasen, zog mich um und machte mich dann mit meinem Dienstmotorrad auf den Weg in die Polizeiwache.