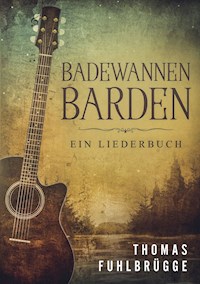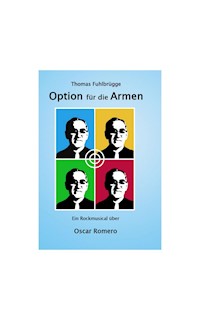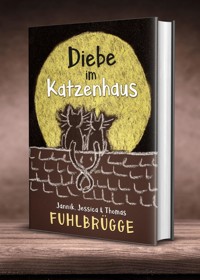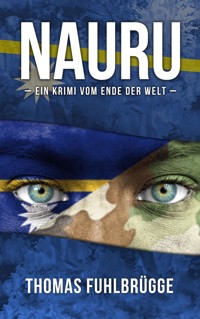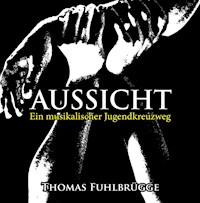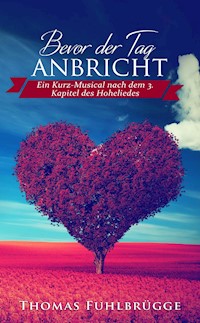Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Bei Bauarbeiten in Altheim werden menschliche Knochen gefunden, ein Massengrab. Bald wird klar, dass es sich um Tote aus dem Krieg von 1866 handelt. Als sich jedoch die Anzeichen verdichten, dass viele der Leichen einem Serienmörder zum Opfer gefallen sein müssen, beginnt Lokalreporter Matthias Heidemann die Vorkommnisse zu recherchieren. Wird es ihm gelingen, die Mordreihe von damals aufzuklären? Helfen heutige, modernste Laboruntersuchungen dabei, den oder die Täter zu ermitteln? Wer hat das Massengrab damals überhaupt angelegt und warum geriet es für 150 Jahre in Vergessenheit? Eine spannende Zeitreise zu einem dunklen Kapitel der Vergangenheit beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Jessica und Jannik.
Ihr seid die Geschichte meines Lebens.
Thomas Fuhlbrügge
Massengrab
Ein historischer Altheim-Krimi
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar.
3. Auflage © 2022 -Verlag, Altheim
Umschlag: Germancreative
Lektorin: Silke Walz
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Prolog
Gestank, bestialischer Gestank. Das war das erste, was ihr entgegenströmte, als sie das Scheunentor öffnete: eine ekelige Dunstfahne, ein Gemisch aus Chemikalien, Blut und Eiter, raubte ihr fast den Atem. Sie hielt angewidert inne. Alles in ihr schrie danach, das mächtige, etwas rissige Holztor wieder zu schließen und einfach fortzugehen. Wer sollte sie zwingen? Das Gerede der Dorftratschen würde sie schon ertragen. Wie schon ihr ganzes Leben lang.
Sie schloss die Augen und versuchte sich zu sammeln, denn wegzulaufen war eigentlich nicht ihre Art. Dann sah sie sich um. Neben dem Tor hing an zwei rostigen Nägeln ein knittriges, weißes Laken, mit einem krakeligen, an Blut erinnernden, roten Kreuz versehen. Sanft bewegte es sich im lauen Lüftchen, das die Nachmittagshitze auf der Straße etwas erträglicher machte und die Schweißperlen auf ihrer Stirn ein wenig kühlte. Dazu gesellte sich jedoch nun ein wehleidiges Gewimmer, welches sie aus der Scheune heraus hören konnte.
Sie atmete noch einmal tief durch, betastete ihr zusammengebundenes, sonst recht langes, blondes Haar, mit dessen Halt sie nie zufrieden war und dachte bei sich: »Großer Gott, steh mir bei!«, während sie Beklommenheit und Abscheu zu verdrängen suchte. Ihre zittrigen Knie verrieten ihr, dass es nicht recht klappen mochte. Neugierde und Pflichtbewusstsein siegten letztlich. Immerhin hatte Bürgermeister Willmann sie persönlich angesprochen. Dies war schließlich auch eine echte Chance, ihrem ihr oft unbedeutend scheinenden, kleinen Leben in der noch kleineren Kammer im Hause ihrer Hebammenlehrerin zumindest stundenweise zu entfliehen.
Sie fasste erneut nach dem eisernen Riegel und zog daran. Darauf betrat sie das Reservelazarett, das erst vor wenigen Tagen in der alten Scheune, mit dem unbewohnten Bauernhaus daneben, eingerichtet worden war. Es dauerte eine Weile, bis sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten.
Fast wäre sie beim Gehen über einen Verletzten gestolpert, der, wie sie zunächst vermutete, um an frische Luft zu gelangen, sein erbärmliches Lager dicht an das Scheunentor verlagert hatte. Fluchend zuckte dieser zusammen, als sie den blutigen Beinstumpf mit ihrem Rock berührte. Dort, wo sich normalerweise ein Fuß befand, hingen einige blutige Fetzen herum, an denen Stroh und Dreck klebten. Auch schien der sich eben schmerzverzerrt Wegdrehende nicht freiwillig seinen Platz hier am Eingang gewählt zu haben. Denn inzwischen erkannte sie, dass bis auf einen schmalen Gang in der Mitte der Scheune, fast jeder freie Zentimeter mit Verwundeten bedeckt war.
»Bist du die versprochene Hilfe aus dem Dorf?«, rief jemand plötzlich aus dem hinteren, wenig beleuchteten Teil der Scheune in ihre Richtung. Die Stimme klang wenig militärisch.
»Ja«, räusperte sie sich. »Mein Name ist Anna, Anna Katharina Funck. Bürgermeister Willmann schickt mich. Ich bin Hebammenschülerin. Aber fast fertig«, fügte sie hinzu und bemühte sich, ihre Stimme fest und selbstbewusst klingen zu lassen.
»Du scheinst noch recht jung zu sein.«
»Ich bin 17 und kann kräftig zupacken«, sagte Anna. Sie hatte sich eigentlich immer eingebildet, älter auszusehen.
»Prächtig«, kam es wieder aus dem Zwielicht. »Dann komm, ich brauche dich«, war die knappe Anweisung.
Vorsichtig, um nicht wieder jemandem weh zu tun, setzte sich Anna in Bewegung und versuchte, einen Weg durch die vielen Menschen zu finden. Noch nie hatte sie so viel Elend auf einem Fleck gesehen.
Die Gesichter vieler Soldaten waren von Mücken bedeckt, welche auch an den Wunden saugten. Ihre Blicke schweiften nach allen Seiten umher, ohne eine Antwort zu erhalten.
Mantel, Hemd, Fleisch und Blut bildeten bei einem jungen Mann in hessischer, blutgetränkter Infanterieuniform eine schaudererregende Mischung. Daneben sah sie einen vollkommen unkenntlich gewordenen Soldaten, dessen Zunge aus seinem zerrissenen und zerschmetterten Munde hervorhing. Er versuchte, sich zu erheben, schaffte es aber aus eigener Kraft nicht und streckte ihr flehend die blutverkrustete Hand entgegen.
Anna wurde bei diesem Anblick flau im Magen, das Mitleid schnürte ihr fast die Kehle zu. Sie wollte sogleich stehen bleiben, um ihm zu helfen. Da rief es abermals aus dem hinteren Bereich, in dem sie inzwischen einen mittelgroßen Mann mit einer einstmals weißen und nun blutgetränkten Schürze über einer Uniform aus einem Nebenraum kommen sah. Der Arzt dieses Höllenlazaretts. »Wo bleibst du denn?«
Schnell unterdrückte sie den Drang sofort zu helfen, wandte sich von dem Elenden am Boden ab und gestikulierte gleichzeitig in seine Richtung, dass sie sich nachher um ihn kümmern würde. Dann schritt sie voran. Weitere Arme streckten sich ihr entgegen, manche kraftlos, fast schon tot, andere mit der Energie, sie festzuhalten. Wehklagen nach Wasser und Hilfe drangen an ihr Ohr. Doch Anna zwang sich, den Blick geradeaus zu richten. Sie legte die letzten Meter bis zur offenen Tür, die von der Scheune mit einstigem Stall in die sich wohl dahinter befindliche Wurstküche führte zurück, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ihr Blick wurde dort wie magisch von einem eisernen Tisch angezogen, den man in die Mitte des Raumes aufgestellt hatte. Dieser hatte eine Rinne für das ausströmende Blut, die einmal um das ganze massige und irgendwie fehl am Platz wirkende Gerät führte. Es lief ihr trotz der pestilenzartigen, stickigen Hitze kalt den Rücken herunter, als sie realisierte, um welche Art Möbel es sich handelte.
»Der ist als nächstes dran«, sagte der Arzt in Richtung eines bärtigen Gehilfen und deutete auf ein wimmerndes Bündel gleich neben der Tür. Erst jetzt erkannte sie, dass es sich um einen Menschen handelte. »Hilf mal mit den Beinen«, sagte dieser in Annas Richtung, während der Mediziner sich eine Flüssigkeit aus einer braunen, gläsernen Flasche über die blutigen Hände goss. Karbolsäure stand darauf.
Anna blieb bei den Worten des Arztes keine Zeit für Vorstellungen oder andere Gedanken, wie Ekel oder gar nach Flucht. Das hatte sie schon gleich zu Anfang ihrer Hebammenausbildung gelernt: »Maul halten und weiterdienen!«, hatte ihre Ausbilderin ihr eingetrichtert. Besonders, wenn ihr das Kreuz wehtat.
Sie kniete sich mit ihrer eher zierlichen Gestalt neben den Soldaten, dessen hessisch-darmstädter Uniform rostrot durchtränkt war, auf die festgestampfte Erde und zog rasch die dünne Kolter in die Höhe. Das verwundete Bein war mindestens doppelt so dick geworden. An drei Stellen, offenbar Einschusslöcher, drang stinkender Eiter in Mengen hervor. Die bläulichen Flecken zeigten, dass eine Schlagader verletzt war. Das rechte Bein konnte nicht mehr mit Blut versorgt werden, und es gab darum wohl kein Mittel mehr, es zu erhalten. Man hatte nur den einen Ausweg, es am Hüftgelenk abzunehmen. Amputation´, dachte Anna mit wachsendem Entsetzen. Den Begriff kannte sie natürlich in der grauen Theorie. Aber jetzt galt er gleich für diesen unglücklichen, jungen Mann, der keine andere Aussicht mehr hatte als entweder den sicheren Tod oder die elende Existenz eines Verstümmelten.
Er hatte nicht einmal Zeit, sich auf sein Schicksal vorzubereiten: »Mein Gott! Was wollen Sie tun?« sagte er bebend. Der Chirurg antwortete ihm nicht. »Beeilt euch!«, sagte er in Annas Richtung.
Der Krankenwärter war neben sie getreten. Sein Äußeres war ungepflegt. Ob der seltsame Geruch von ihm persönlich oder von seiner zerschlissenen Arbeitsmontur her stammte, die nur entfernt an eine schneidige Uniform erinnerte, konnte sie nicht feststellen. Jedenfalls widerte er sie sofort an.
Ohne auf sie zu achten, fasste der Bärtige mit starken Armen den Verletzten unter den Achseln und zog ihn in die Höhe. Anna konnte beim Versuch, die zerschundenen Beine zu greifen, kaum mithalten. Ein jaulendes Geräusch, das Anna an einen leidenden Hund erinnerte, entfuhr der keuchenden Brust des Unglücklichen, als sie das verwundete, steife Bein ganz nahe an der Wunde gefasst hatte. Die einzelnen Knochenstücke waren in das Fleisch eingedrungen und hatten dem Soldaten neue, furchtbare Schmerzen verursacht. Diese nahmen noch zu, als sein herabhängendes Bein von der Bewegung des Tragens auf dem Wege bis zum Tisch fortwährend hin- und hergeschaukelt wurde.
Wie ein Schlachtopfer, das zum Tode geführt wird und genau weiß, was nun bevorstand, dachte Anna entsetzt. Endlich lag er auf dem Operationstisch. Neben ihm auf einer anderen Ablage, bedeckte ein speckiges Handtuch die Instrumente wegen der vielen Fliegen. Der Chirurg war nur mit den Vorbereitungen zu seiner Operation beschäftigt.
»Hast du schon mal mit Äther narkotisiert?«, fragte er in Annas Richtung, die bisher wie gelähmt auf das Gesicht des röchelnden Patienten gesehen hatte. Einige Sekunden rührte sie sich nicht. »Nun?«, fragte der Arzt und reichte ihr eine braune, fast leere Medizinflasche und ein schmuddeliges Tuch.
»Äh, nein.« Ihre Stimme brach. »Bei den Geburten verwenden wir es nicht. Meine Lehrmeisterin meinte…«
»Ist ganz leicht«, erwiderte der Arzt, während er in seinen Bestecken kramte. »Tuch über das Gesicht drücken, dann Äther drauf, bis die Muskeln erschlafft sind. Kann aber eine Weile dauern. Pass nur auf, dass er sich in der Zwischenzeit nicht erbricht oder an seiner Zunge verschluckt. Das Zeug riecht nicht so angenehm. Bekommst du schon hin.«
Anna sah auf die Flasche und das Tuch. »Was ist die richtige Dosis?«, wollte sie wissen.
»Wenn der Mann schläft, dann war es die richtige Dosis«, erwiderte der Arzt knapp und hielt ein Skalpell in den Händen. »Danach hilfst du mir mit dem Bein«.
Ohne weiter darüber nachzudenken, zog Anna den Korken aus dem Flaschenhals. `Schwefeläther´ stand in einer hübschen, schnörkeligen Apothekerschrift auf dem Schild. Die Augen des jungen Soldaten zuckten angstvoll in alle Richtungen. »Was habt ihr vor?«, fragte er kraftlos und versuchte vergeblich, sich gegen das Tuch zu wehren, welches ihm Anna nun auf das Gesicht drücken wollte. »Bitte nicht!«, flehte er in ihre Richtung. Tränen rannen über sein hübsches Gesicht. »Ich will nicht zum Krüppel werden.«
»Willst du lieber sterben?«, fragte ihn der Arzt ruhig, während er die Ärmel seines Hemdes bis zur Schulter zurückschlug. »Früher mussten wir das ohne Betäubung machen, da hatten wir nur einen Stock für zwischen die Zähne.«
Anna rang sich mit aller Kraft ein aufmunterndes Lächeln ab, obwohl ihr wegen der kommenden Operation viel eher nach Heulen zumute gewesen wäre. Aber es schien den jungen Soldaten zu beruhigen. Er fasste verzweifelt ihre Hand, ließ sie jedoch wieder los, als sie ihm gestikulierte, dass es nun Zeit sei, das Tuch über das Gesicht zu legen. »Versprich mir, dass ich lebe«, jammerte der Soldat in ihre Richtung.
»Ich verspreche es«, sagte sie rasch und goss inzwischen kleine Schlückchen der seltsam süßlich riechenden Chemikalie über das Tuch. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die Zuckungen des Soldaten nachließen.
Der Arzt, dessen Name Anna bisher noch nicht einmal kannte, hielt derweil das furchtbare Messer in der Hand. »Jetzt hilf mir bei dem Bein«, sagte er schlicht und Anna trat neben ihm. Mit einer einfachen Schere wurde die Hose gelöst und der Körper lag frei. Als die Bewusstlosigkeit vollständig eingesetzt hatte, umschlang der Chirurg mit seinem Arm das Bein des Soldaten und durchschnitt mit einem Zug die Haut rings um den ganzen Schenkel. Er bückte sich noch tiefer und begann, die Haut von den nun freigelegten Muskeln zu trennen. Er löste zu diesem Zwecke die Fleischteile und zog sie herauf. Dann durchtrennte er mit einem kräftigen Rundkreisschnitt alle Muskeln bis zum Knochen.
Das Blut quoll in Strömen aus den geöffneten Adern. Anna wurde davon im Gesicht bespritzt, und es floss auch auf den Boden. Sie konnte sich in diesem Moment vor Entsetzen nicht rühren und war nicht einmal in der Lage, sich über die Augen zu wischen. »Was ist los?«, raunte sie der Arzt unwirsch an. »Weißt du nicht, wie man die Pulsadern zuklemmt?« In Richtung des Gehilfen: »Bring mehr Späne!«, was dieser schließlich aus einem Sack in der Nähe tat.
Anna hatte noch keine Erfahrung mit Operationen und stand weiterhin regungslos vor stummem Entsetzen gelähmt da. »Du musst den Daumen auf die Blutgefäße drücken«, meinte er konzentriert. »Eine besonders große Hilfe bist du momentan nicht«, kam es noch in ihre Richtung.
Doch Anna war viel zu fassungslos von der Situation, in die sie in den letzten wenigen Minuten gestürzt war, um etwas zu erwidern. Auch wenn sie die letzten Worte des Doktors trafen. Sie wollte ja stark sein und helfen. Mit beiden Händen stocherte sie darauf in der roten Suppe herum, um halbwegs den Blutverlust zu unterbinden und fühlte sich schrecklich dabei. Nur die Hoffnung, mit ihrer Tat diesem jungen Mann das Leben zu retten, hinderte sie daran, einfach wegzulaufen. Nervenstärke gehörte in ihrem Beruf zu den grundlegenden Eigenschaften, die Anna durchaus besaß. Bei den Geburten gab es auch jede Menge Blut und Komplikationen gehörten fast zur Tagesordnung. Aber eine Amputation war doch etwas anderes.
Jetzt war der Moment der Säge gekommen. Bald vernahm sie die kreischenden Töne des Stahles, der in den lebendigen Knochen dringend, endlich das halbverfaulte Glied vom Körper trennte. Dann wurden die Weichteile wieder nach vorne gezogen und zusammen mit den Adern vom Arzt mit mehreren Stichen vernäht.
»Kannst du wenigstens einen Verband anlegen?«, fragte der Arzt darauf, während der griesgrämige Gehilfe das abgetrennte Bein nahm und damit durch eine Tür in Richtung des hinter dem Bauernhaus liegenden Gartens verschwand.
Anna löste sich aus ihrer Starre, blickte sich rasch um und nahm dann aus einer Kiste Charpie und Mullbinden, die sie etwas unbeholfen auf der Wunde verteilte. Blut rann aus den Nähten. Bei jedem Herzschlag des Soldaten ein weiterer Tropfen.
Während sie sich mit dem Beim abmühte, sah sie hin und wieder durch ein schmuddeliges Fenster hinaus. Anna beobachtete den Gehilfen, wie er etwa 50 Meter entfernt, das Bein, das er sich einfach, wie ein Gewehr über die Schulter geworfen hatte, in eine Grube schmiss und danach rasch zwei Schippen voll Kalk aus einem Fass darauf verteilte.
»Wird er es schaffen?«, fragte sie in Richtung des Arztes, der seine blutigen Instrumente mit Alkohol übergoss und sich bereits für die kommende Aufgabe einrichtete, während er mit der linken Hand die allgegenwärtigen Fliegen verscheuchte.
»Wer weiß das schon«, sagte er nur. Als er den sorgenvollen Blick in Annas Gesicht bemerkte, fügte er noch hinzu: »Wenn er die nächsten drei Tage überlebt, dann stehen seine Chancen recht gut.«
Das beruhigte sie ein wenig. Der Bärtige erschien wieder und gemeinsam hoben sie den immer noch betäubten Soldaten zurück auf sein elendes Lager. Eben wollte sich Anna den Verwundeten von vorhin zuwenden, da berührte sie überraschend sanft der Arzt an der Schulter. »Komm, die da können noch warten, andere brauchen unsere Hilfe dringender. Mein Name ist Johann Georg Heinrich Christian von Gahlen und ich freue mich übrigens, dass du gekommen bist. Und geblieben.«
»Kennen sie den Namen des Darmstädter Soldaten?«
»Nein«, sagte von Gahlen nur, stand dabei auf und reckte sich den schmerzenden Rücken. Dann vernahm sie Hufgetrappel und das Rumpeln eines Wagens vor der Scheune. Die Tür wurde mit einem lauten Quietschen aufgedrückt. »Oh!«, sagte Doktor von Gahlen mit emotionsloser Stimme. »Es kommen noch mehr.«
Kapitel 1
Günter und Manfred waren ein gutes Team. Der erste lenkte den Bagger, während der zweite lässig an seinem Laster stand, sich eine Kippe drehte und in die Baugrube sah. Das konnte er besonders gut. Dastehen und aufpassen, ob Günter mit dem Bagger alles richtig machte.
Später war es andersherum. Auf seinen 7,5-Tonner passten etwa zwei bis drei Kubik Erde, auf den Hänger doppelt so viel. Wenn der voll war, konnte Günter aufpassen, dass mit dem Rangieren hier in der engen Gasse alles glatt ging. Dann fuhr er nach Urberach zur Deponie. Dort alles abschütten und retour. Noch zwei Ladungen, dann konnten sie endlich Feierabend machen.
Freitagmittag noch zu arbeiten, war ohnehin eine Zumutung. Sonderschicht. Erst wurden sich die Bauherren und der Architekt nicht einig, dann verzögerte sich alles durch den Dauerregen im Oktober und nun sollte das Fundament bis zum ersten Frost fertig werden. Sie waren nun die Leidtragenden. Die 98er spielten heute Abend gegen Union Berlin. Anpfiff 18.30 Uhr. Da wollte er pünktlich vor dem Fernseher sitzen.
Wieder kam dunkler Dieselqualm aus dem Auspuffrohr des Baggers. Erneut hatte er eine Ladung Altheimer Erde in der Schaufel. Bedächtig wurde sie nach oben gezogen, dann drehte Günter das Gefährt Richtung Hänger. Eben wollte der die Schaufel neigen, um die lehmigen Brocken fallen zu lassen, da stutzte Manfred, der in fast meditativer Ruhe dem Geschehen Ladung für Ladung mit Blicken folgte. Wild fuchtelte er plötzlich mit den Armen.
»Was ist los?«, fragte Günter und streckte seinen Kopf aus dem, trotz der herbstlichen Temperatur immer geöffneten, Fenster. Manfred zeigte sprachlos nach oben. Als der Baggerfahrer seiner Geste mit den Augen folgte, sah er es: Oben, vom Zahn der Schaufel durchbohrt, steckte eindeutig ein Totenschädel.
***
»Gib mir die Hand, halt meine Hand. Unsere Hände schließen den Kreis«, kam es nicht immer ganz harmonisch aus zwei Dutzend Kinderkehlen. Sie standen im großen Flur der Regenbogenschule zusammen und sangen ihr Abschlusslied. Dabei fassten sie sich artig an den Händen, wobei die Kinder darauf achteten, dass Jungen und Mädchen eher unter sich blieben.
Drum herum saßen stolze Papas, Mamas mit filmenden Handys, Omas mit den kleineren, zappeligen Geschwistern auf dem Schoß und Opas mit Ikea-Kaffeebecher in den Händen. Die dritte Klasse hatte ihren Herbstnachmittag.
Da sich die Eltern weder auf ein gemeinsames Halloween-Fest noch auf eine Weihnachtsfeier einigen konnten (»Im Advent ist immer so viel los, da hat der Ignaz-Finn an jedem Nachmittag was!«) folgten sie schließlich dem Kompromissvorschlag der Klassenlehrerin: Ein Herbstnachmittag mit Imbiss, Arbeiten aus dem Unterricht und einem Gedicht (»die Clara-Jane liest wirklich schon wie eine Viertklässlerin!«). Auf einem Tisch standen sieben verschiedene Sorten Muffins, da man sich auch nicht auf die Einrichtung einer Doodle-Liste verständigen konnte. Was bei den Eltern zu tagelangen Kontroversen und Rücktrittsdrohungen des Elternbeirats führte, störte die Kinder nicht im Geringsten. Sie stellten mit Inbrunst den Gästen ihre zuvor in mühevoller Arbeit gestalteten Mappen zum Thema: `Das Eichhörnchen – Freund des Waldes´ vor, an denen manche Eltern noch bis gestern Nacht gebastelt, geklebt und gemalt hatten. Natürlich so, dass es wie eine echte Kinderarbeit aussah. Denn erst am Mittag ging es durch die WhatsApp-Gruppe, dass bis heute alles fertig sein musste. Nebenbei knetete der Muffinteig.
Das Handy von Matthias Heidemann summte. Er gehörte weder zur Elternseite, obwohl eine seiner Töchter nur wenig jünger und die andere kaum älter war als die Hauptdarsteller auf der improvisierten Bühne, noch war er Lehrer. Die hatten sich im Kreis zwischen die Jungen- und Mädchenfraktion gestellt, um den Frieden zu wahren. Er war Journalist, genauer freier Reporter, und er hatte den Auftrag, über dieses epochale Ereignis für das `Münsterer Anzeigeblatt´ zu berichten. Eltern liebten es, ihren Nachwuchs in der Zeitung zu sehen.
Vorhin war er noch in Klein-Zimmern gewesen und hatte den wahrscheinlich dicksten Kürbis der Welt, oder zumindest von Südhessen, fotografiert. Dabei hielt ihm der Hobbylandwirt noch ständig eine Kartoffel vor die Nase. Diese hatte vorne eine Ausbuchtung und es sah tatsächlich so aus, als besitze sie einen Schniedel. Der Gärtner fand das urkomisch, was nach Heidemanns Meinung schon einiges über Klein-Zimmern aussagte. Der Reporter hatte jedoch nur den Auftrag über den Kürbis, nicht aber über unanständiges Gemüse zu berichten und überzeugte davon schließlich auch den immer noch anzüglich grinsenden Mann.
Noch diese Grundschulsache. Viel lieber wäre er heute Abend zu den Lilien gefahren, so wie früher. Seit die jedoch in der ersten Liga waren, kümmerten sich die festangestellten Kollegen darum. Dafür durfte er am Sonntag über das Spiel vom TSV Altheim II gegen den SV Rohrbach II berichten. Sicher wieder ein echter Klassiker aus dem Bereich `Not gegen Elend´.
Begeisterter Applaus der versammelten Eltern- und Großelternschaft ertönte. Die Kinder hatten ihr Lied beendet und stürzten sich auf die Muffins.
Matthias Heidemann hatte genügend Fotos gemacht und Stichpunkte für die acht W-Fragen (wer, was, wann, wo, wie, weshalb und wie viel, manchmal kam noch die neunte: warum um alles in der Welt ausgerechnet ich? hinzu) in seinen A5-Block gekritzelt. Für den Artikel im Lokalteil mit rund 2.000 Zeichen (inklusive Leerzeilen) bekam er 20 Euro. Das war nicht viel. Da er das Foto gleich selbst machte, durfte er acht Euro dafür abrechnen. Wie üblich gab es für die Wege zum Termin und wieder zurück keine Fahrtkosten erstattet. Er wohnte ohnehin in Altheim. Da lag die Regenbogenschule auf dem Nachhauseweg.
Hastig zückte er sein summendes Handy und verließ damit am Ohr die Schule. Das geliebte Stück kam aus Fernost. Zwar war er noch nie in China, 75 Prozent seines Eigentums schon. Das Display verriet, es war die Redaktion. »Heidemann«, sagte er beim Abnehmen.
»Ah, Matze«, erwiderte eine etwas gestresst klingende Stimme. Chefredakteur Gramlich mochte es nicht, wenn er es mehr als dreimal tuten lassen musste, bis einer seiner Leute dran ging. »Hier ist Rudi. Sag mal, du wohnst doch in Altheim.«
»Du weißt, dass ich in Altheim wohne«, gab Heidemann zurück. »Du warst letzten Sommer zum Grillen bei uns.«
»Ja, ja, über Twitter kam gerade eine Mitteilung der Polizeipressestelle Darmstadt rein, dass in Altheim eine Leiche gefunden wurde. Das könnte ein Aufmacherthema werden.«
Der Reporter war sofort interessiert. Für eine solche Geschichte waren bis zu 100 Euro drin. »Weiß man schon, wer der Tote ist?«, fragte er zurück.
»Es geht wohl um ein Skelett. Untergasse zehn. Fahr mal hin, meine Leute sind heute alle bei den Lilien«, antwortete der Chef kurz angebunden.
Heidemann verzog das Gesicht, als er an die 98er dachte. »Untergasse zehn? Das ist bei mir um die Ecke, ich wohne in der Babenhäuser Straße. Da wird gerade bei einem alten Kumpel von mir gebaut«, sagte er.
»Jetzt wohl nicht mehr«, gab sein Redakteur als Antwort und legte auf.
***
Matthias Heidemann versuchte gar nicht erst, direkt bis zur Baustelle mit seinem grauen Mini vorzufahren. Er stellte den Wagen lieber gleich bei sich zuhause in den Carport und wollte das kurze Stück zu Fuß gehen. Zuvor begrüßte er seine Frau Meike und das kleine Töchterchen Nele, die gleich auf ihn zugestürmt kam, als er die Eingangstür aufgeschlossen hatte. Sein älteres Kind Rieke war anscheinend gerade beim Tanztraining und würde nicht vor Abend nach Hause kommen.
»Hallo Schatz«, rief er seiner Frau entgegen, nachdem er seine Kleine auf den Arm gehoben hatte. »Drüben bei Sepp scheint was los zu sein.« Er deutete zur Straße. Sebastian Streb war mit ihm zur Schule gegangen, dann verloren sie sich etwas aus den Augen. Erst dieses Frühjahr hatte dieser mit seiner Familie ein Grundstück in Altheim gekauft, um sich dort ein großzügiges Einfamilienhaus zu errichten.
»Ich kam gerade mit der Kleinen vom Kindergarten«, berichtete nun Meike Heidemann ihrem Mann, der inzwischen von der Tochter dazu genötigt wurde, den Wisch-Pulli von `Elsa´ auf diesen Schneemann zu wenden. »Und habe mit Nele über Hänsel und Gretel gesprochen. Das hatten die heute im Kindergarten. Plötzlich sagt deine Tochter doch wörtlich: Warum gehen denn die Kinder zu dem Vater zurück, da gibt es doch nichts zu essen. Die könnten doch in dem Hexenhaus bleiben, die Hexe ist doch tot. Und der Vater war böse. Da kamen erst ein Streifenwagen aus Dieburg und etwa eine halbe Stunde später noch zwei Transporter. Die Nachbarn scheinen das sehr interessant zu finden.« Schon von seiner Haustür aus konnte er mehrere Polizeiautos in der Nebenstraße sehen. Bei einem drehte sich noch das Blaulicht. Auch ein Dutzend Personen in Mänteln und Kappen, einer sogar in einem Bademantel schienen diese spannenden Aktivitäten zu beobachten. Wobei für viele Altheimer sogar die Kerb als `spannende Aktivität´, oder `Event´ galt.
»Ich muss auch mal hin, offizieller Auftrag sozusagen«, lächelte er Meike entgegen und ihr war klar, dass nun nichts mehr in der Welt ihren Mann aufhalten konnte, wenn es um seine Arbeit ging und er erst einmal `Blut geleckt´ hatte.
Seine Frau nahm dem Papa das Töchterchen ab. Letztere war gar nicht begeistert darüber, dass ihr Vater schon wieder wegmusste, statt ihre Filly-Pferdchen-Sammlung zu begutachten, die täglich wuchs, und die sie der Größe, beziehungsweise nach Farben geordnet, in einer Reihe aufgebaut hatte. »Du Papa«, fragte Nele noch, »warum müssen Pflanzen kein Pipi, wenn sie doch so viel Wasser trinken?«
»Das ist eine sehr gute Frage mein Schatz«, gab der Reporter zurück. »Wenn ich wieder da bin, erkläre ich dir die Fotosynthese.«
Heidemann legte den Fotoapparat, den er für die `normalen´ Aufträge benutzte in seinem Arbeitszimmer ins Regal und schnappte sich seine Ausrüstung. Wenn die Qualität stimmen musste, dann arbeitete er mit seiner professionellen Digitalkamera mit verschiedenen Objektiven, Stativen und Blitz. Anschaffungswert 15.000 Euro. Sie lag meist im Schrank oder wurde für seinen Nebenjob als Hochzeitsfotograf verwendet. Dann drückte er Frau und Tochter noch einen Kuss auf den Mund und lief die paar Meter zum Ort des Spektakels.
***
Die Baugrube war inzwischen mit einem Flatterband abgesperrt. Auch standen Polizeibeamte aus Dieburg davor. Dies hielt jedoch die Schaulustigen eher unzureichend davon ab, im Weg herumzustehen. Zur linken parkten ein Streifenwagen und zwei weiße VW-Transporter, bei denen nur das Blaulicht und die eher dezente Aufschrift Polizei etwas von deren Herkunft verrieten. Männer und Frauen in weißen Papieranzügen und Gummistiefeln waren in der Grube zu erkennen.
»Gehen sie doch bitte nach Hause«, sagte gerade ein Polizist zu dem Mann im Bademantel mit Engelsgeduld. »Hier gibt es nichts zu sehen.«
»Das sehe ich anders«, erwiderte der Angesprochene. »Was heißt hier, nichts zu sehen? Die da haben gerade einen langen Knochen aus der Erde gezogen.« Noch immer steckte der aufgespießte Schädel zwischen den Zähnen der Baggerschaufel. »Ich hole mir nur einen heißen Kaffee und einen Gartenstuhl«, brummte der Alte. »Ich bin Frührentner, da habe ich jede Menge Zeit.« Mit diesen Worten watschelte er von dannen und ging zu einem nahegelegenen, etwas heruntergekommenen, Haus.
»Matthias Heidemann von der Offenbach-Post«, stellte sich der Reporter dem Polizisten vor. Das klang immer besser, als wenn man was vom Münsterer Blättchen sagte. »Was können sie mir denn über den Tatort sagen?« Inzwischen hatte er seine Kamera gezückt und bereits eine Reihe von Bildern von der Baugrube und den Fahrzeugen geschossen.
»Wir wurden gegen 13 Uhr von den Bauarbeitern, die gerade Ausschachtungen vornahmen, informiert, dass sie eine größere Zahl, wahrscheinlich menschlicher Knochen, gefunden haben«, begann der Angesprochene. Heidemann notierte artig. »Als wir dies bestätigt vorfanden, ließen wir erst einmal die Arbeiten bis auf weiteres einstellen, sperrten ab und gaben Bescheid. Die Kollegen informierten dann das LKA, da die große Anzahl der Knochenfunde die Spusi in Darmstadt personell überfordert.« Immer neue Fragmente schienen sie zu Tage zu fördern.
Inzwischen waren auch weitere Fahrzeuge angekommen. Ein Streifenwagen, dem der Pressesprecher der Darmstädter Polizei, sowie der Staatsanwalt entstiegen und ein Wagen von Radio-FFH. Während der Polizist sich mit den Kollegen besprach und auch einen der Männer in den weißen Anzügen mit einbezog, begann der Radioreporter den Umstehenden sein Mikrofon vor die Nase zu halten. Alle gaben bereitwillig Auskunft. Nur der Staatsanwalt winkte ab und sprach etwas in sein Diktiergerät.
»Mein Name ist Paul Zielinski. Ich bin Frührentner und habe alles genau beobachtet«, sagte gleich der Nachbar ins Mikrofon. Er hatte sich inzwischen einen speckigen Mantel angezogen und einen weißen Gartenstuhl herbeigeschleift. In der Hand hielt er eine Tasse mit der Aufschrift: `Ziele habe ich genug im Leben - nur zu wenig Munition´, aus der es heiß dampfte.
»Was genau haben sie denn beobachtet?«, wollte der Radioreporter gleich wissen. Heidemann schob sich unauffällig ein wenig näher. Nur für den Fall, dass Herr Zielinski tatsächlich etwas wusste, was er für seinen Artikel brauchen konnte.
»Nun«, begann dieser wichtigtuerisch, »so eine Baustelle ist immer etwas Interessantes. Da gehe ich bestimmt viermal am Tag vorbei. Immer, wenn mein Schoko Gassi muss«, er deutete dabei auf einen braunen, kleinen Mischling, der gerade versuchte, dem Reporter vom Radio am Bein zu juckeln und dessen Abwehrversuche mit wildem Gekläffe und intensiveren Bemühungen quittierte. Heidemann fand das lustig und machte unauffällig einige Aufnahmen davon, die er später den Kollegen der Nachrichtenredaktion von FFH mailte. »Da bekommt man schon so einiges mit. Als dann die Polizei anrückte bin ich gleich raus. Da habe ich die vielen Knochen auch gesehen. Richtig gruselig.«
»Was befand sich denn vorher auf dem Gelände?«, fragte der Radiomann weiter und deutete dabei auf das tiefe Loch in der Erde, nachdem der Hund endlich von ihm abgelassen hatte.
»Nur eine uralte Scheuer und ein verwildertes Grundstück dahinter. Da hat schon seit Ewigkeiten niemand mehr gewohnt.«
Inzwischen waren die Offiziellen mit ihrer Beratschlagung am Ende. Ein weiterer Wagen verriet die Ankunft des Hessischen Rundfunks. Ein Kamerateam entstieg dem himmelblauen Vectra. Anscheinend ein Praktikant in einem etwas zu großen Parker, der die gleiche Farbe wie das Auto hatte, sowie ein älterer Kameramann bauten ihr Equipment auf. Der Pressesprecher bereitete sich indes auf seinen Einsatz vor. Kurz darauf wurden ihm zwei Mikrofone vor den Mund gehalten, während der Frührentner versuchte, sich ebenfalls ins Bild zu schieben.
»Meine sehr verehrten Herren von der Presse. Mein Name ist Willy Busch von der Polizei in Darmstadt und ich werde ihnen nun einige Erkenntnisse zu den bisherigen Ermittlungen in diesem Fall geben. Wir scheinen hier auf ein Massengrab gestoßen zu sein«, berichtete der mediengeschulte Polizist. »Inzwischen hat das LKA die sterblichen Überreste von mindestens sieben Personen lokalisiert, die hier in einer Tiefe von etwas über zwei Metern vergraben wurden.«
»Könnte es sich um ehemalige Insassen aus dem Lager Rollwald handeln, die hier bis Kriegsende als Zwangsarbeiter schuften mussten?«, fragte der Fernsehreporter, der seine Hausarbeiten anscheinend gemacht oder zumindest früher in der Schule Geschichtsleistungskurs hatte.
»Bisher können wir nichts ausschließen. Die Liegezeit und die Tatsache, dass das Gelände seit vielen Jahren brach liegt, könnten Anhaltspunkte dafür sein.«
Heinemann notierte sich die entsprechenden Aussagen und beschloss, später zum Thema Lager Rollwald zu recherchieren.
»Verrät die Anordnung der Leichen schon etwas über deren Todesursache?«, wollte nun der FFH-Reporter wissen.
»Da gibt es zum derzeitigen Ermittlungsstand noch keine Ergebnisse«, gab der Pressesprecher in die Mikrofone. »Die Experten von der Tatortgruppe, Abteilung 6 - `Kriminalwissenschaftliches und -technisches Institut´ im Hessischen Landeskriminalamt, setzen modernste Ermittlungsmethoden ein, dem Rätsel auf die Spur zu kommen.« Der Pressesprecher verwies in die entsprechende Richtung und der Kameramann begann, in die Baugrube hineinzufilmen. Dort waren einige Beamte inzwischen dabei, ein Stativ aufzubauen, während andere weiterhin mit Schaufeln und Besen in dem matschigen Untergrund stocherten.
»Die Tatortgruppe des Hessischen Landeskriminalamtes«, führte der Pressesprecher inzwischen routinemäßig aus, »versteht sich als Servicedienststelle für die hessische Polizei. Sie unterstützt die Erkennungsdienste der Polizeipräsidien auf Wunsch bei der Dokumentation, der Spurensuche und -sicherung, übernimmt die kriminaltechnische Untersuchung und führt die Tatortuntersuchung durch. Sie sichert Spuren und Vergleichsmaterial jeglicher Art, nimmt an Obduktionen teil und führt erkennungsdienstliche Behandlungen durch, was in diesem Fall nicht mehr in Frage kommt«, fügte er etwas leiser hinzu.
»Was genau sehen wir jetzt?«, mischte sich Heinemann in das Statement des Polizisten ein, der bei diesem Pressetermin natürlich auch mitreden wollte.
»Unsere neueste Errungenschaft ist eine 360-Grad-Spheron-Kamera, mit welcher der Tatort abgelichtet wird«, ergänzte dieser. »Das Gerät kostet 200.000 Euro, bietet eine Auflösung von 50 Millionen Pixel und einen 400-fachen Zoom. Mit ihm wird es möglich, selbst in komplett abgedunkelten Räumen feinste Details taghell darzustellen. Der Hessische Innenminister hat die Kamera erst vorige Woche persönlich in Frankfurt eingeweiht«, führte er stolz fort. »Ziel dieser daktyloskopischen Untersuchungen ist neben der Identifizierung von Spurenverursachern und dem damit verbundenen, möglichen Erkennen von Handlungsabläufen und Tatzusammenhängen auch die Identitätsfeststellung von Personen, sowie die Identifizierung unbekannter Toter.« Man hörte dem Mann an, dass er gerne über die neuesten Errungenschaften der Kriminaltechnik sprach.
Immer neue Knochen traten zum Vorschein. Sie lagen nicht nur neben- sondern auch untereinander und wurden vorsichtig in weiße Plastikkisten gelegt. Inzwischen war auch Baggerfahrer Günter in die Ermittlungsarbeiten miteinbezogen worden. Er ließ sein Gefährt wieder an und vergrößerte vorsichtig unter Anweisungen der LKA-Beamten das Erdloch.
Die Anzahl der Beobachter nahm nicht ab, selbst, als es langsam zu dämmern begann und Halogenscheinwerfer aufgebaut worden waren. Dazu leistete die Altheimer Feuerwehr, die nun auch anrückte, Amtshilfe. Ein Lichtmast wurde aus dem einzigen, kleinen und schon etwas älteren Fahrzeug herausgekurbelt. Wenige Sekunden später erstrahlte alles in einem gleißenden Schein.
Matthias Heidemann versuchte inzwischen, weitere Hinweise bei den Umstehenden zu erhalten, beispielsweise zum Lager Rollwald, und ob es hier in Altheim in der NS-Zeit wirklich Zwangsarbeiter gab. Viele brauchbare Informationen erhielt er diesbezüglich nicht. Zwar erinnerte sich Karla Hohmann, eine weitere Nachbarin, dass in ihrer Jugend tatsächlich russische Kriegsgefangene als Erntehelfer eingesetzt wurden. Von einer größeren Anzahl, von Toten oder einer Unterbringung in der Scheune wusste sie jedoch nichts.
Die Radio- und Fernsehreporter schienen inzwischen genügend erfahren zu haben und packten ihre Sachen zusammen. Wenig später fuhren sie davon, um ihre Neuigkeiten den Hessen zu verkünden.
In der Gasse blieb es auch ohne Rundfunkwagen eng, besonders, als ein stattlicher Audi Q7 den Weg entlangkam und die letzte freie Parklücke gänzlich füllte. Der Eigentümer des Grundstücks, Sebastian Streb, entstieg im Anzug, mit weißem Hemd und roter Krawatte. Als Abteilungsleiter für Vermögenscontrolling einer schweizerischen Großbank in Frankfurt, gehörte dies zu seiner Berufskleidung. Anscheinend wurde er bereits informiert, dass es auf seiner Baustelle einen Leichenfund gab, denn er steuerte zielsicher den Polizisten an der Absperrung an.
»Herr Streb«, begrüßte ihn dieser. »Schön, dass sie es sich gleich einrichten konnten. Sehen sie selbst.« Dabei deutete der Uniformierte in die Grube. Gerade hatte der Bagger eine weitere Schicht Erde vorsichtig abgeschabt und schon kamen noch mehr Knochen zum Vorschein. Entsetzt sah der Besitzer in den Abgrund. Heidemann ging näher heran und schüttelte dem sichtlich Betroffenen erst einmal die Hände.
»Hallo Sepp. Was eine verrückte Sache.«
»Ah, Matze, dass du hier bist, wundert mich nicht. Sieh dir das an. Nächste Woche sollte das Fundament gegossen werden.« Zum Pressesprecher gerichtet: »Wie lang wird denn das alles hier dauern? Ich habe Termine. Bis zum Frost muss der Rohbau stehen.«
Sein Entsetzen galt also weniger den Toten als dem Fortgang seiner Bauarbeiten, dachte sich Heidemann. Mitgefühl war noch nie die Stärke seines ehemaligen Klassenkameraden.
Unterdessen war der Staatsanwalt, der die meiste Zeit etwas abseits auf- und abgegangen war, herangetreten und wurde vom Pressesprecher, der sich neben ihn stellte, erst einmal vorgestellt.
»Das ist Herr Doktor Dienert, der leitende Staatsanwalt und das hier Herr Streb, der Besitzer des Grundstücks.« Beide schüttelten sich die Hände und gingen zum Gespräch ein paar Schritte aus der Hörweite des Reporters.
Inzwischen war der Bagger einige Meter weggefahren und hatte seinen Motor abgestellt, um bei weiteren Untersuchungen nicht im Weg zu stehen. Die Männer in den einstmals weißen und inzwischen schlammbedeckten Papieranzügen stiegen über eine herabgelassene Leiter aus der Grube und begannen, Gegenstände einzusammeln, Proben zu verpacken und ihre Kisten zu verladen.
Währenddessen gingen auch der Grundstückseigentümer und der Staatsanwalt zurück zur Grube. Sebastian Streb machte dabei keinen glücklichen Eindruck. Er verabschiedete sich noch und stand dann etwas ratlos vor seinem Loch.
Langsam kam der für Altheim typische Herbstnebel auf und die Temperatur war fast bis zum Gefrierpunkt gesunken. Matthias Heidemann trat neben seinen alten Mitschüler. »Willst du mit zu uns kommen? Da können wir uns aufwärmen. Meike hat bestimmt schon den Kamin angemacht.«
»Unserer sollte da drüben stehen«, sagte Streb und deutete an die Längsseite der Baugrube. »Darüber die offene Galerie, die zu den Kinderzimmern führt.« Vor seinem geistigen Auge schien der im Kopf gespeicherte Bauplan Realität zu werden. »Jetzt ist erst einmal Baustopp. Es kann Wochen dauern, bis alle Spuren gesichert sind, sagt der Staatsanwalt.«
»Tja, wenn man auf dem eigenen Grundstück seine Leichen verbuddelt«, fing der Reporter an zu witzeln, sah aber gleich, dass dem zukünftigen Nachbarn nicht zum Scherzen zu Mute war.
»Scheiß Knochen«, erwiderte dieser nur. »Sie scheinen zumindest nicht prähistorisch zu sein, sonst könnte ich mein Haus wohl auf ewig vergessen.«
»Eigentlich schade«, sagte Heidemann, »das wäre doch eine Sensation und du könntest Führungen machen, wie beim Ötzi. Vielleicht waren die Toten aus Groß- Zimmern, dann wäre das der GrZi«, versuchte es der Reporter wieder mit Humor. Erneut ohne Erfolg. Missmutig und mit schlammigen Edelschuhen stieg der Bauherr wieder in seinen SUV, grüßte nur noch einmal zum Abschied und brauste von dannen, dass die schlammigen Brocken spritzten.
Matthias Heidemann sah noch zu, wie die letzten Schaulustigen verfroren den kurzen Heimweg antraten. Auch die Spurensicherung und der Polizeiwagen fuhren davon. Morgen würden sie hier weiterarbeiten und erst einmal die genommenen Proben in die Gerichtsmedizin nach Frankfurt bringen. Dann erloschen die Scheinwerfer und tiefe, nebelige Dunkelheit breitete sich über dem Massengrab aus. Auch der Reporter ging die wenigen Meter in Richtung seines Hauses.
Er wusste, dass ihm am Abend noch einige Stunden Arbeit bevorstanden, bis der Bericht fertig war. Mord in Altheim?. Ja, das erschien ihm ein guter Titel für die Story zu sein.
Erst einmal musste er im Haus für Ruhe sorgen, denn seine Ältere war anscheinend vom Tanztraining zurück. Jedenfalls lag ihr Mountain-Bike quer in der Einfahrt und aus ihrem Zimmer dröhnte ohrenbetäubende Musik, obwohl sie gar nicht drinnen war. Sie wollte anscheinend noch einmal weg und diskutierte vor dem Spiegel im Bad stehend mit Heidemanns Frau Meike.
»Oh mein Gott, ich sehe ohne Schminke aus wie zwölf!«, sagte Rieke gerade aufgebracht.
»Du bist zwölf, mein Schatz«, antwortete seine Frau ruhig. »Und um zehn bist du wieder da!«
[Korrekturende!]
Kapitel 2
Die Uniformen der nassauischen Armee bestanden aus einem russischgrünen Rock und einer grauen Hose. Dazu ein fescher Tschako für den Kopf und das gelbe Lederzeug, das allerdings seit der Mobilmachung geschwärzt wurde.
Von dieser einstigen Pracht war bei dem jungen Soldaten, der vor Anna auf dem Boden lag, kaum etwas übrig. Alles war verschmutzt, zerrissen und mit Blut getränkt. Ihm war ein Teil des Gesichtes von einem Säbel weggehauen worden. Er war ohne Nase, Lippen und Kinn. In der Unmöglichkeit zu sprechen und halb erblindet, winkte er Zeichen mit der Hand. Dies wurde von gurgelnden Tönen begleitet.
Anna gab ihm zu trinken und ließ auf sein blutendes Gesicht einige Tropfen frisches Wasser träufeln. Es schien ihr ausgeschlossen, dass er die nächsten Stunden überleben würde. So wie sein österreichischer Nebenmann, mit weit geöffneter Hirnschale. Er sank in diesem Moment sterbend zuckend zusammen und sein Hirn floss über die Steinplatten der Scheune. Seine Unglücksgefährten stießen ihn darauf rüde mit den Füßen auf die Seite, weil er ihren eigenen Wunden zu nahe kam.
Die Hebammenschülerin stützte derweil den unbekannten Nassauer in seinem letzten Todeskampf und umhüllte sein armes, schmutziges Gesicht, das sich noch schwach bewegte, mit ihrem Taschentuch, bis er sich endlich in ihrem Armen nicht mehr rührte.
Die junge Frau schluchzte noch einmal und widerstand dem Drang zu weinen, das Elend und den Schmerz in die Welt hinauszuschreien. Aber das würde den Verwundeten nicht helfen, um die sie sich seit Stunden aufopferungsvoll kümmerte. Stattdessen erhob sie sich und gab dem Krankendiener ein Zeichen. Inzwischen wusste sie, dass er eigentlich Georg Reinhold Münzenberg hieß, alle ihn aber nur Schorsch nannten. Viel mehr hatte sie jedoch nicht über den bärtigen, kräftigen und ihr unheimlichen Mann herausgefunden. Er trug keine Uniform und nur ein abzeichenloses Militärhemd, schien also daher kein Soldat zu sein. Trotzdem nahm er die Befehle des Arztes und inzwischen auch von Anna entgegen und führte sie meist wortlos, ohne jegliche Gefühlsregung aus. So wie jetzt. Er packte den Leichnam und wuchtete ihn unsanft nach hinten auf den Operationstisch, der gerade frei war. Anschließend holte er vom Lager, was der Verstorbene noch besaß und brachte es ebenfalls in den Nachbarraum.
Anna überlegte, ob er einfach kein Herz hatte und deshalb dem unsagbaren Elend an diesem Ort reglos gegenüber stand. Oder es war die Routine, die ihn maschinenhaft selbst bei rührenden Fällen zupacken ließ. Sie hoffte und betete inständig zu Gott, dass es ihr nicht bald ebenso ging und sie dermaßen abstumpfte. Anna verachtete den Krankendiener wegen seiner kalten Art, mit dem er den noch vor wenigen Sekunden Lebenden und Leidenden auf den kalten Metalltisch plumpsen ließ, wie ein Schlachter, der eine noch warme, blutige Schweinehälfte zur weiteren Bearbeitung weglegte.
Auch sie ging zu dem Verstorbenen und wischte mit ihrem Rockzipfel über das Gesicht des Toten, dem Tränen tiefe Furchen in sein schmutzbedecktes Antlitz gegraben hatten. Dann begann Anna angewidert, wie ein Leichenfledderer, die Taschen abzusuchen und steckte alle Gegenstände, die sie fand, in einen alten Kartoffelsack, die es hier massenhaft gab. Da niemand den Namen des Toten wusste und es auch keinerlei Erkennungszeichen gab, schrieb sie ein `unbekannt´ in ein Schulheft. Dazu eine Nummer, mit der sie auch den Sack versah. Es war ihre Idee gewesen, die Namen der Toten aufzuschreiben und die persönlichen Gegenstände in Säcken zu sammeln. Der angrenzende, ehemalige Schweinestall, in dem es immer noch erbärmlich stank und der deshalb nicht für die Unterbringung von Verletzten genutzt werden konnte, wurde so zur Asservaten- und Waffenkammer. Denn auch die Gewehre, die Pistolen und Munition der verstorbenen Soldaten wurden hier gesammelt, damit sie nicht beim Umfallen noch losgingen und weiteres Unheil anrichteten.
Viel war es nicht, dass sich in den Taschen des toten Soldaten befand, und so wanderte eine Degenscheide, die Koppel, eine Patronentasche und ein Käppi in den schmuddeligen Jutesack. Um den Hals hatte der Nassauer ein Medaillon an einer dünnen Kette. Darin befand sich das Bild einer blonden, jungen Frau, die ihren Liebsten niemals wieder sehen würde. Vielleicht konnte es einmal helfen, den Toten doch noch zu identifizieren.
Schorsch hatte inzwischen den Leichnam wie einen Sack Äpfel auf eine Schubkarre verfrachtet und war hinten heraus in den ehemaligen Gemüsegarten gerollt. Dort warf er ohne viel Anteilnahme oder ein Gebet, den Körper in das etwa drei Schritt tiefe Loch. Dann schüttete er noch gegen den Leichengeruch zwei Schippen Kalk darüber und kam zurück.
Anna nahm sich vor dafür zu sorgen, dass die Gefallenen mit etwas mehr Respekt wenigstens in ihr Grab gelegt wurden. Es waren jedoch einfach zu viele die starben und sie konnte sich nicht um alles kümmern.
Sie verstaute die Habseligkeiten des Toten und kehrte zurück zu den Elenden, die teilweise seit zwei Tagen unbehandelt, auf dem Scheunenboden in Stroh und Dreck lagen. Sie wollte erst nach dem amputierten, hessischen Soldaten sehen, bei dessen Operation sie mithalf, als sie keine fünf Minuten in diesem Lazarett angekommen war. Bisher war er weder verstorben, noch erwacht.
Zeit, sich selbst auszuruhen, oder auch nur zu verschnaufen, nahm sich Anna nicht. Sie musste den Soldaten, die vor Hunger, Durst und Schmerzen schrien, zu essen und vor allem zu trinken geben. Sie wollte auch ihre Wunden verbinden, ihre blutigen, verschmutzten und von Ungeziefer bedeckten Körper waschen. Dies alles tat sie, inmitten von stinkenden und ekelerregenden Ausdünstungen, mit den unzähligen, grün schimmernden Schmeißfliegen. Sie arbeitete unter dem Klagegeschrei und dem Stöhnen der Verwundeten und in einer erstickend heißen und verdorbenen Luft, während sich der Arzt um die noch schlimmeren Fälle kümmerte und pausenlos operierte. Auch ihm ging sie soweit es möglich war zur Hand. Und wenn ihre Hilfe nur darin bestand, ihm hin und wieder selbst etwas Wasser aus seiner Feldflasche zu reichen.
Als sie zu dem ihr immer noch unbekannten, hessisch-darmstädter Soldaten kam, in dessen Blut sie zuvor bis zu den Handgelenken gesteckt hatte, konnte sie diesmal zumindest ein friedlicheres Schnauben von dem Strohlager vernehmen. Auch das Fieber schien nicht gestiegen zu sein, wie sie mit ihrer Hand auf der Stirn des Schlafenden spürte. Das waren gute Zeichen. Sie überprüfte noch einmal den Verband an der Amputationsstelle und bahnte sich, so zufrieden, wie es unter diesen Umständen ging, einen Weg zurück in den Operationsbereich.
***
»Der Bürgermeister hatte uns eine Versorgung mit Lebensmitteln zugesichert«, sagte Doktor von Gahlen zu Anna, als diese wieder einmal in die alte Wurstküche kam, um am dortigen Brunnen neues Wasser für die Verwundeten zu schöpfen. »Bitte geh doch mal ins Dorf und sieh nach, ob es dort etwas für uns hier gibt. Bisher ernähren wir uns von der `eisernen Ration´ der Soldaten. Eine kräftige Fleischbrühe wäre gut«, sagte er hoch konzentriert, während er einem badischen Dragoner den verkohlten und abgebrochenen Stock einer Brandrakete aus der rechten Seite zog. »Bevor du gehst«, sagt er noch, »zieh das hier an.« Er wies mit seiner blutigen Hand auf eine weiße Binde, die beim Fenster auf der Anrichte lag. Auf dem dünnen Stoff war ein rotes Kreuz gestickt. »Du gehörst jetzt zu uns und stehst somit unter dem Schutz der Genfer Konvention.«
Anna war insgeheim froh, dem Hospital in der alten Scheune, wenn auch nur für vielleicht eine halbe Stunde, zu entkommen. Sie empfand ein wenig Stolz, als sie sich das Stück Stoff um den rechten Arm band und verließ den Ort der vielen Qualen. Die warme Sommerluft tat ihr sehr gut. Mehrfach atmete sie tief ein und aus, um den Gestank von Äther und Eiter aus der Nase zu bekommen.
Nach wenigen Schritten war sie wieder in der Hauptstraße mit ihren typischen Leinweberhäusern. Dort schien alles so unwirklich normal. Es zogen gerade keine Soldaten durch Altheim, sondern Katharina Reeg scheuchte eine Gänsefamilie in Richtung Semme. Sie arbeitete als Magd in der Forstmühle, die etwas außerhalb des Dorfes in Richtung Dieburg stand. Der kleine Israel Morgenstern lief mit seiner Schwester Jette von der jüdischen Schule nach Hause. So wie immer um diese Zeit. Sie grüßten artig und sahen Anna mit ihrem roten Kreuz tuschelnd nach, als diese zum Rathaus ging.
Eben noch war sie mitten in Not und Tod und schon wenige Sekunden später hatte sie das dörfliche Leben wieder. Diese vielen Menschen, die sie nun in ihrem harten, bäuerlichen Alltag sah, hatten keine Ahnung davon, welche Tragödien sich nur wenige Meter weiter ereigneten. Für große Politik interessierte sich kaum jemand und auch sie verstand noch nicht alle Zusammenhänge, hatte aber vor, dies möglichst bald zu ändern. Insofern machte sie ihnen natürlich keinen Vorwurf. Der Kontrast in den letzten Minuten erschien ihr nun fast unwirklich.
Anna blickte die Straße entlang auf die Fachwerkhäuser. Mit ihren Giebeln standen sie etwas schräg zur Straßenseite. Die meisten hatten ein kleines Fenster an der Taufseite vor dem Hoftor, damit zusätzliches Licht auf den Webstuhl fallen konnte, der fast immer in der vorderen Stube stand.
Sie ging auf dem Kopfsteinpflaster und übersah beinahe Adam Dickhaut, der Arm in Arm mit seiner Braut Regine entgegenkam. Beide würden am kommenden Sonntag heiraten und auch Anna war eingeladen. Sie kannte die Braut immerhin seit Kindertagen.
»Wie schön, dich zu sehen«, sagte Regine. »Du kommst doch am Sonntag?«
»Selbstverständlich«, sagte Anna rasch, noch ganz in Gedanken. Die Bilder aus dem Lazarett gingen ihr durch den Kopf.
»Ich hätte dann nämlich nach der Hochzeit noch etwas mit dir zu besprechen«, sagte die Braut und Anna ahnte bereits seit einiger Zeit, dass es um sehr praktische Dinge bezüglich ihres Hebammenberufs ging.
Die beiden bemerken die merkwürdige Binde an Annas Arm. »Was ist das denn?«, fragte Adam. »Gehst du ins Kloster?«
»Was? Kloster?«, stammelte Anna irritiert und sah nun selbst zu ihrem Arm. »Nein, ich helfe seit heute im Lazarett mit. Dort liegen so viele…« Wieder drangen die Bilder von Tod und Elend in ihre Gedanken.
»Seit wann gibt es denn bei uns ein Lazarett?«, fragte Adam.
»Seit ein paar Tagen, glaube ich«, erwiderte Anna. »Der Krieg und die Preußen haben…«
»Solange die uns nicht die Hochzeit vermasseln«, seufzte Regine ihren Verlobten zu, ohne richtig zuzuhören. »Komm, wir müssen noch die Sache mit dem Braten klären«, sagte sie und drängte ihren Adam in Richtung des `Hessischen Hofs´. »Der Gauner will doch tatsächlich für das Pfund Rindfleisch 13 Kreuzer, dieser Halsabschneider.« Sie grüßten knapp und waren bereits außer Hörweite verschwunden. Anna war das nur recht. Gedanken an eine Hochzeit ertrug sie bei den vielen jungen Männern, die nie zu ihren Lieben nach Hause kommen würden, momentan nicht. Deutlich sah sie das Medaillon mit dem Bild der jungen Frau vor sich. Sie versuchte, sich wieder auf ihre Aufgabe zu konzentrieren und ging die Stufen zum Rathaus empor.
Der zweigeschossige Steinbau mit flachem Walmdach wurde erst vor vier Jahren in klassizistischer Form errichtet und war neben der Kirche Altheims ganzer Stolz.
Bürgermeister Willmann, im Hauptberuf Gewürzhändler, kam gerade die hölzerne Treppe hinunter und war etwas überrascht, Anna hier zu sehen.
»Entschuldigung, Herr Willmann«, sagte sie und deute dabei auf ihre Armbinde. »Ich bin offiziell beauftragt, das Mittagessen für das Lazarett zu holen. Welches Gasthaus ist denn damit beauftragt?«
»Ich habe Rinderbrühe im `Goldenen Stern´ geordert«, sagte er etwas verlegen. Anna wusste, dass es sich dabei um die billigste Wirtschaft in Altheim handelte. Der alte Knauser konnte jedoch Annas Eifer nicht trüben. »Wie geht es denn im Lazarett?«, fragte er nach. »Gestern kamen schon wieder 500 Hessen durch und verlangten Spanndienste bis nach Aschaffenburg. Wer soll denn das alles bezahlen? Wahrscheinlich droht uns bald Einquartierung«, sagte er noch. Anna war ohne eine Erwiderung einfach gegangen.
Die Gaststätte `Zum goldenen Stern´ befand sich nur wenige Dutzend Schritte weiter die Hauptstraße entlang. Sie wurde von Moses und seiner Frau Johannette Altheimer geführt. Anna mochte die beiden. Natürlich auch den Sohn Falk, mit dem sie seit Schultagen eine besondere Freundschaft verband. Einige aus dieser Familie waren bereits nach Amerika ausgewandert und sie vermutete, dass die beiden auch schon mit dem Gedanken spielten. Wahrscheinlich sparten sie nur auf die erst beste Gelegenheit.
Es war noch nicht so lange her, als alle jüdischen Einwohner des Großherzogtums per Gesetz gezwungen wurden, sich einen Nachnamen zuzulegen. Viele nannten sich daher einfach nach Berufen, die sie ausübten, oder den Orten, in denen sie wohnten. So gab es mehrere `Altheimer´ hier, die nicht unbedingt miteinander verwandt waren.
Als sie die schlicht eingerichtete Stube betrat, lächelte sie die Wirtin herzlich an. »Ich wollte gerade unseren Falk zum Lazarett schicken« und deutete dabei auf einen schweren Henkeltopf mit Deckel. »Ab heute kommt täglich etwas. Auch Brot.«
»Ich kann gerne mit anpacken«, sagte Anna und begrüßte herzlich den gleichaltrigen Sohn der Gastleute. Als Kinder hatten sie viel miteinander gespielt und sogar mehr als das. Von ihm hatte sie schon vor Jahren ihren ersten Kuss bekommen, was sie mit acht damals ziemlich ekelig fand. Auch wenn keine Zunge im Spiel war.
Zusammen wuchteten sie nun den Kessel erst die Treppe herab und dann die Strecke bis zum Lazarett entlang, was gar nicht so einfach war. Oft schwappte der dampfende Inhalt, einmal ergoss sich ein kleiner Schwall heißer Suppe auf das Kopfsteinpflaster.
»Bist du jetzt eine richtige Krankenschwester?«, fragte Falk, als sie die Hauptstraße verließen.
»Nun, eigentlich bin ich Hebamme«, sagte Anna mit einem leichten Anfall von Stolz in der Stimme. »Momentan werde ich von Doktor von Gahlen im Hospital gebraucht und helfe bei den Operationen, besonders bei den Narkosen mit Äther.«
»Diese alte Scheune ist ein Hospital?«, fragte Falk etwas erstaunt.
»Ich gebe zu, wir sind eher ein Hilfslazarett, aber haben einen richtigen Arzt und einen sehr guten noch dazu.« Anna dachte an ihn. Ihr kamen die vielen Verwundeten, die um ihr Leben kämpften und noch auf ärztliche Hilfe warteten, in den Sinn. Neue Patienten würden sicherlich bald dazu kommen, das wusste sie.
Endlich hatte die Schlepperei ein Ende und sie erreichten das Scheunentor. Falk half noch dabei, den schweren Topf sicher bis in die ehemalige Wurstküche zu bringen, vorbei an den vielen Verstümmelten. Er konnte seinen Blick gar nicht von den Wunden und dem Blut abwenden. In dem großen Raum, dessen sonst weiß gekalkte Wände inzwischen von rostroten Spritzern bedeckt waren, wurde gerade wieder operiert. Auf dem Tisch lag ein Soldat der 1. Schützen-Kompagnie der Großherzoglich-Hessischen Division und besah sich angstvoll die aufgeschwollene und gleichzeitig verwelkte rechte Hand mit dem Doktor. Sie hatten anscheinend gerade den Verband entfernt, der bisher die Wunde bedeckte. Ein Säbelhieb hatte die Hand zwischen Zeige- und Mittelfinger gespalten. Nun war alles brandig.
»Bitte nehmen sie mir das Ding ab«, flehte der angstvolle Soldat. »Ich will nicht am Wundbrand krepieren.«
»Hilf mir bitte. Die Suppe kann warten«, sagte der Arzt und Anna wusste inzwischen genau, was zu tun war. Während sie routiniert den Äther auf ein Tuch träufelte, wurde es Falk Altheimer immer schlechter. Er hielt sich würgend die Hand vor den Mund und rannte aus dem ehemaligen Bauernhaus, während Anna beruhigend auf den Soldaten einredete und ihm die Betäubung auf die Nase drückte.
***
Endlich waren die meisten mit Suppe versorgt und die Soldaten mussten sich nicht mehr an der eigenen, eisernen Ration vergreifen. Diese bestand aus Schiffszwieback und einem viertel Pfund Speck. Letzteres wurde meist schon nach wenigen Tagen heimlich vertilgt, obwohl das Anrühren dieser Ration eigentlich nur nach ausdrücklichem Befehl gestattet war. An dem Zwieback verging sich hingegen so leicht niemand, da man ihn weder beißen noch brechen vermochte und er sowieso nach Nichts schmeckte. Man konnte ihn höchstens mit dem Bajonett zerteilen, zur Not selbst als Waffe benutzen oder minutenlang lutschen. Allein der Gedanke daran ließ viele Soldaten den Hunger vergessen.
Anna stellte den Napf beiseite und wendete sich den nächsten Verwundeten zu. Da lag ein österreichischer Offizier. Seine Hüften waren von einer Kartätschenladung durchschossen. Wie zerfetzt war sie nun, von den eisernen Splittern. Das rote, zuckende Fleisch lag offen da. Der Rest seines geschwollenen Körpers war schwarz und grünlich. Er schien weder sitzen noch liegen zu können. Nach dem Anlegen eines Verbandes tauchte Anna Büschel von Charpie in frisches Wasser, in dem Bemühen, ihm ein etwas bequemeres Lager zu bereiten.
Pausenlos eilte Anna hin und her. An der Ostmauer lagen etwa 20 bayrische Grenadiere nebeneinander in zwei Reihen. Sie waren alle bereits verbunden und hatten schon ihre Suppe fertiggegessen. Manche fütterten sich gegenseitig, wie es die Verletzungen zuließen. Ruhig und friedlich folgten sie Anna mit den Augen. Ihre Köpfe wendeten sich nach rechts, wenn sie nach rechts ging und nach links, wenn sie dorthin eilte. Viele hatten sich, mangels Decken, in ihre Mannschaftsmäntel gehüllt. Um die Montur gleichmäßig abzunutzen, konnte der Mantel links und rechts geknüpft werden. Natürlich wurde das jeweils befohlen. Alles beim Militär wurde befohlen. Hier im Lazarett kümmerte das hingegen niemanden.
Andere waren bleich und verstört. Besonders diejenigen, die am stärksten verstümmelt wurden. Sie sahen vor sich hin und schienen nicht zu begreifen, was man zu ihnen sagte. Mancher war zu schwach, die vielen Schmeißfliegen zu vertreiben, die sich auf die Wunden setzen wollten. Manche Maden, die sich in den Wunden bewegten verrieten, dass die Fliegen bereits Eier in das faule Fleisch gelegt hatten.
Wieder andere verhielten sich eher unruhig, die Nerven waren völlig erschüttert und sie zuckten immer wieder krampfhaft zusammen. Manche, deren offene Wunden sich bereits entzündet hatten, waren wie von Sinnen vor Schmerzen.
»Bitte erschieß mich«, sagte ein kurhessischer Artillerist immer wieder von seinem Lager aus zu jedem in seiner Nähe und auch zu Anna, als sie an ihm vorbeikam. Sein Geschütz bekam vorgestern von einer preußischen Sprenggranate einen Volltreffer. Dabei wurde ihm das linke Bein weggerissen. Dann verlegten seine Kameraden die anderen Kanonen seiner Einheit in wilder Panik weiter nach hinten außer Reichweite. Er lag jedoch im Weg. Ohne sich um den Schreienden zu kümmern, wurden die schweren Geschütze bewegt und durch die Räder, die über ihn hinwegfuhren, sein linker Arm und das andere Bein noch zermalmt. Er hielt seine Pistole in der rechten, noch unverletzten Hand. Diese war offenbar nicht geladen. Er zielte unablässig auf seine eigene Schläfe und drückte ab.
»Wenn du mit der Dienstpistole M/43 jemanden verletzten willst«, sagte ein etwas entnervter Kamerad zu seiner linken, »dann benutze sie als Schlag- oder Wurfgerät und zieh sie dir selbst über die Rübe.«
»Immerhin eignet sie sich für Feldposten als Signalgerät zur Alarmierung ruhender Truppen«, fügte der Soldat auf dem rechten Strohlager kenntnisreich hinzu. Zum Kampf schien sie wenig geeignet.
»Geben sie mir bitte die Pistole«, sagte Anna sanft, als sie erneut vorbeikam.
»Wollen sie es für mich beenden?«, fragte der Soldat und ein hoffnungsvoller Glanz huschte über seine Augen.
»Nein, ich lege sie weg«, antwortete sie und nahm ihm vorsichtig die Waffe aus den zitternden Fingern. »Viele ihrer Kameraden hatten nicht so viel Glück wie sie und liegen schon in der Grube.«
»Das nennen sie Glück?« Er hielt Anna seinen Armstumpf entgegen. »Ich bin doch kein Mensch mehr.«
»Jedes Leben ist kostbar. Ich verspreche, ihnen wenigstens etwas Schnaps gegen die Schmerzen zu bringen und der Doktor sieht nach ihnen, sobald er Zeit hat.«
Auf dem Weg nach hinten, zum improvisierten Magazin, wurde sie von einem blonden Soldaten in einer ihr unbekannten Uniform an der Hand festgehalten. Der junge Korporal, der nur unwesentlich älter als Anna sein konnte, mit einem sanften, ausdrucksvollen Gesicht, war von einer preußischen Kugel in die linke Seite getroffen worden.
»Bitte, der Kamerad braucht dringend den Arzt«, flehte er sie an. Das zuckende Bündel nebenan wand sich im Starrkrampf. Sie nickte und eilte, noch bevor sie das Magazin aufsuchte, zu Doktor von Gahlen, der gerade eine preußische Kugel aus der Lunge eines hessischen Leutnants geschnitten hatte. Der kam auch gleich mit und besah sich den Verwundeten, während Anna den versprochenen Schnaps reichte. Dann schüttelte er vorsichtig den Kopf.