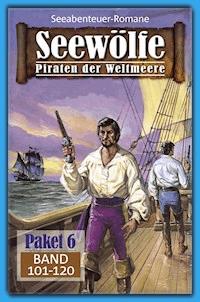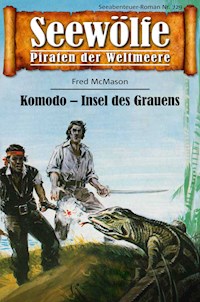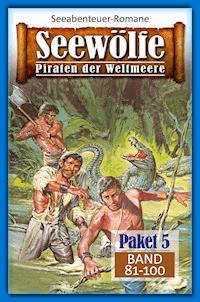
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Sie waren von der Teufelsinsel geflohen, hatten die tobende See durchschwommen und den Strand von Guayana erreicht. Aber jetzt lag vor ihnen der Dschungel, undurchdringlich, geheimnisvoll, feindlich. Von drüben, von der Teufelsinsel, näherten sich die Verfolger. Die Männer um den Seewolf hatten nichts weiter als eine Axt und ein paar Messer - und ihren Mut. Und sie zeigten, daß sie nicht nur auf See zu kämpfen verstanden...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2644
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2015 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-494-4Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Nr. 81
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 82
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 83
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 84
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 85
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 86
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 87
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 88
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 89
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 90
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Nr. 91
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 92
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 93
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 94
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 95
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 96
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 97
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 98
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 99
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 100
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
Inmitten des schäumenden Hexenkessels, im Gischt der entfesselten See, trieben wie Strandgut die Köpfe der Seewölfe, dunkle verlorene Punkte im Weiß der Schaumkämme.
Weit aufgerissene Münder schnappten nach Luft. Salzwasser brannte in Augen, aus denen nackte Verzweiflung sprach. Kettengewichte zerrten an Armen, die unermüdlich gegen Wellen kämpften.
Während Hasard und Ferris Tukker noch Grund unter den Füßen spürten, mußte der Kutscher bereits schwimmen. Wie ein junger Hund paddelte er durch das Chaos. Sein Gesicht drückte die Angst aus, die ihn beherrschte. Er war der schlechteste Schwimmer der Crew und schwamm wirklich um sein Leben.
Old O‘Flynn ruderte wie wild mit seinem Holzbein und klammerte sich krampfhaft an Carberry.
„Das Ding muß dir doch mächtig Auftrieb geben!“ brüllte der Profos voll gallebitterem Galgenhumor und meinte damit die Prothese des alten Rauhbeins. Er stemmte sein Rammkinn wie einen Schiffsbug gegen die See. „Wozu brauchst du mich eigentlich? Du trägst doch das Rettungsfloß immer bei dir!“
Aber natürlich achtete der Profos fürsorglich darauf, daß sein Schutzbefohlener hinter ihm blieb und sich am Halseisen seines Helfers festklammerte wie an einem Rettungsring, auch wenn Carberry dabei fast erwürgt wurde und ihm die Luft ausblieb.
„Wir schaffen es beide – oder überhaupt nicht“, gelobte der rauhe Profos mit aller Kraft seiner Lungen.
Dabei hörte Old Donegal kein Wort. Der Sturm riß Carberry jede Silbe von den Lippen und trug sie ungehört davon. Aber der alte Donegal begriff auch so. Er wußte, daß er sich auf den Profos verlassen konnte – bis zum letzten Atemzug.
Die Verbindung zwischen den einzelnen Schwimmern riß immer mehr ab. Aufs Geratewohl kämpfte sich jeder in die einmal eingeschlagene Richtung weiter und hoffte, irgendwann wieder festen Boden unter die Füße zu kriegen. Sehen konnte niemand das Festland. Nicht einmal Dan. Und der schaute sich wirklich die Falkenaugen aus nach einem winzigen Hoffnungsschimmer an der Kimm, einem noch so undeutlichen Zeichen, daß das Festland nahe war und damit die vorläufige Rettung.
Er hoffte, etwas in dieser Art zu entdecken, ehe ihn eine tückische Strömung umriß, ein Strudel verschlang oder ein Haifisch über ihn herfiel. Eine Steigerung ihrer Qualen hielten sie alle nicht mehr für möglich!
Und doch trat sie ein!
Denn die Dons boten alles auf, was sie hatten, um die Flucht der Männer zu stoppen. Musketen krachten in rascher Reihenfolge, aber sie wurden blindlings abgefeuert, denn niemand konnte in diesem Inferno ein Ziel erkennen.
Gehacktes Blei zwitscherte Hasard und seinen Männern um die Ohren und trieb sie zu noch verzweifelteren Anstrengungen an.
Sie konnten es vielleicht schaffen, wenn nicht eine Ladung durch Zufall genau in ihren Reihen einschlug.
Inzwischen waren sie alle zum Schwimmen gezwungen und kämpften gegen die Wellen, die sie immer wieder zurückzuwerfen drohten, den Spaniern vor die Mündungen. Es war, als habe sich die Natur selbst mit den Gegnern verbündet!
Mancher geriet in Versuchung, einfach aufzugeben, sich gehenzulassen. Ein Abgleiten ins Nichts, und die Qual hatte ein Ende. Wind und Wellen würden den Körper an Land zurücktragen.
Aber da war ihre Wut auf die Folterknechte, die immer neue Kraft spendete. Sie gönnten diesen aufgeblasenen Dons nicht den Triumph, am Ufer kaltblütig die Köpfe der erledigten Feinde zu zählen und eine Strecke auszulegen wie auf einer Hasenjagd.
Weiter kämpften sich die Seewölfe vorwärts, entschlossen, niemals aufzustecken. Vielleicht machten sie irgendwann schlapp. Aber kapitulieren würden sie nie, sondern Hasard folgen, wenn es sein mußte – in den Tod.
Und der rückte schneller auf sie zu, als sie ahnten. Irgendwie hatten die Spanier inzwischen eine Drehbasse am Ufer in Stellung gebracht. Die erste Ladung fetzte zwischen die fliehenden Seewölfe. Zufallstreffer, aber trotzdem verheerend.
Ein Schrei gellte durch die Nacht. Da war niemand, der nicht die Stimme erkannt hätte: Smoky war getroffen!
Als die Trompeten Alarm bliesen, taumelten die wachfreien Posten schlaftrunken hoch, ergriffen ihre Waffen, stürzten auf den Exerzierplatz und formierten sich mürrisch und verdrossen. Sie waren nicht nur um ihre Nachtruhe gebracht worden, es goß auch noch in Strömen. Und der Sturm, der über der Insel wütete, nahm ihnen den Atem. Was, zum Teufel, war eigentlich los?
Die Wut der Spanier kannte keine Grenzen, als sie von Andrés Catalina, dem Inselkommandanten, erfuhren, daß die Seewölfe ausgebrochen seien.
„Sie haben uns alle überrumpelt!“ donnerte der Inselkommandant. „Ich habe euch immer gewarnt. Diesen Burschen ist nicht zu trauen. Schlafmützen haben gegen die keine Chance. Jetzt ist die Bescherung da.“
„Mit Ihrer Erlaubnis, Capitan“, meldete sich El Verdugo zu Wort, der schlimmste Folterknecht, der je auf der Teufelsinsel sein Unwesen getrieben hatte. „Die Kerle können nicht weit gelangen. Sie tragen noch unsere schmukken Ketten. Wohin sollten sie sich auch wenden? Die Insel ist nicht groß. Ein Boot haben sie nicht. Im Laufe des Tages werden sie alle wieder eingefangen.“
„Ich traue den Seewölfen alles zu. Die bringen es fertig und versuchen das Unmögliche. Sie stürzen sich tollkühn ins Wasser und versuchen, das Festland zu erreichen. Egal, ob sie dabei draufgehen oder nicht. Aber wir werden ihnen die Suppe versalzen. Ich will jeden einzelnen Mann wiederhaben, tot oder lebendig!“
Der Capitan, ein schneidiger Mann aus Kastilien mit einem schwarzen Knebelbart, haßte den Gedanken, während eines solchen Unwetters durch den Schmutz der Teufelsinsel zu waten, um Kettensträflinge einzufangen. Aber es mußte sein. Sonst verlor er sein Gesicht und den letzten Fürsprecher am spanischen Hof. Er wollte schließlich auch irgendwann ein besseres Kommando antreten. Erging es einem hier etwa besser als den Opfern? Das Klima war für alle gleich. Diese mörderische Hitze, wütende Tropengewitter, der miserable Fraß, das schlechte Wasser. Wer wollte das ewig aushalten?
In Windeseile teilte Catalina die Jagdkommandos ein. An der Spitze sollte der Hundeführer marschieren. Die Bestien zerrten bereits jaulend und kläffend an ihren Leinen. Die Spur, die diese auf Mann gedrillten Bluthunde nicht fanden, gab es überhaupt nicht.
„Ich werde ein Boot ausrüsten und den Strand absuchen“, schlug El Verdugo vor.
Er haßte den Gedanken, unter dem Kommando des Inselkommandanten durch die Nacht zu stolpern und womöglich noch in einen Hinterhalt der Engländer zu geraten. Die Seewölfe würden ihn mit Vergnügen in Stücke reißen, wenn sie ihn erwischten. Er hatte sie bis aufs Blut gepeinigt. Und außerdem waren ihm die eigenen Landsleute nicht grün. Wie leicht löste sich ein Bleihagel aus der Muskete – in dunkler Nacht, bei diesem Gelände. Wer wollte nachher Absicht beweisen?
In einem Ruderboot aber blieb die Lage immer überschaubar, auch wenn das Meer noch so bewegt war.
Der Capitan nickte großzügig.
„Schafft eine Drehbasse an den Strand, damit wir die Kerle unter Beschuß nehmen können, wenn sie nicht freiwillig umkehren“, befahl der Offizier, und schon stürmte er mit dem ersten Trupp los, den Seewölfen nach, die es gewagt hatten, ihm, Andrés Catalina, ein Schnippchen zu schlagen.
El Verdugo bewies am Ende die bessere Spürnase.
„Legt euch in die Riemen, Leute“, befahl er finster.
Er hockte auf der Achterducht und hielt das Steuer, um wenigstens halbwegs den Kurs bestimmen zu können.
Die acht unglücklichen Musketiere, die ihm zugeteilt worden waren, pullten wie wild. Aber ständig nahmen sie Wasser über. Sie mußten verteufelt aufpassen, daß sie ihr Pulver trocken hielten.
Die beiden Suchtrupps trafen etwa zur selben Zeit am Schauplatz des Geschehens ein. Und El Verdugo entdeckte den ersten Flüchtling.
„Da ist einer!“ schrie er heiser und deutete auf einen dunklen Punkt in der brodelnden See. „Vorwärts, Leute! Pullt, daß die Fetzen fliegen! Sonst lasse ich euch die Kehlen mit flüssigem Blei ausgießen, sobald wir zurück sind. Und ich pflege zu halten, was ich verspreche. Ihr kennt mich!“
Die Leute duckten sich. Sie alle haßten El Verdugo. Sie fürchteten ihn aber auch. Auflehnung gab es nicht. Wohin hätten sie fliehen sollen? Sie waren ebenso gefangen auf der Teufelsinsel wie die englischen Freibeuter, deren Schiff gestrandet war. Und sie hatten kein kühnes Vorbild wie diesen Seewolf, der seine Leute direkt durch die Hölle führte, um die Freiheit wiederzuerlangen, und lieber sterben würde, als sich unter die Knute der Spanier zu beugen. So haßten sie Hasard und bewunderten ihn zugleich.
Das würde sie nicht hindern, ihre Musketen einzusetzen. Schließlich ruhte der mißtrauische Blick des Henkers auf ihnen. Und wehe, wenn El Verdugo wirklich jemanden aufs Korn nahm.
Nur die Blitze beleuchteten unregelmäßig und für Sekunden die bewegte Szene. Es blieb kaum Zeit, um richtig zu visieren. So pufften die Schüsse meist ungezielt in die Dunkelheit. Es dauerte eine Weile, bis sie in der tanzenden Nußschale nachgeladen hatten.
So trat nach der ersten geschlossenen Salve, deren Wirkung niemand abzuschätzen vermochte, eine Pause ein. Schlimmer noch: die Schützen, die luden, konnten nicht mitpullen. Der Rest der Soldaten legte sich gewaltig in die Riemen. Aber das Boot trieb ab.
El Verdugo schäumte vor Wut.
Er beruhigte sich erst, als er beim nächsten gleißenden Blitz erkannte, daß er mitten zwischen der Schar der Seewölfe trieb, die mit dem Mut der Verzweiflung um das nackte Leben kämpften.
Dann legte am Strand die Drehbasse los.
Schlagartig ließen die Leute an den Riemen alles fahren. Auch El Verdugo hechtete in Sicherheit. Fluchend wartete er das Ende der Salve ab. Der Schrei, der aus dem Wasser herüberklang, erfüllte ihn mit Zufriedenheit und mahnte ihn zugleich, daß er selbst noch keinen durchschlagenden Erfolg zu melden hatte.
Kaum war die größte Gefahr vorbei, da jagte El Verdugo die Soldaten wieder an die Riemen, und weiter ging die blinde Jagd.
Der Henker hielt es für geraten, aus der Notausrüstung eine Fackel zu nehmen. Er befestigte sie neben sich auf der Achterbank und hoffte, Lopez werde nicht gerade auf die eigenen Leute feuern.
Tatsächlich verstummte die Drehbasse.
Befriedigt stellte der Henker fest, daß selbst der Capitan es nicht wagte, ihn zu gefährden.
Immer weiter entfernten sich Jäger und Gejagte von der Insel, die bald nicht mehr inmitten der Regenschauer zu erkennen war, selbst dann nicht, wenn ein Blitz über das Himmelszelt züngelte.
El Verdugo hockte achtern und schaute sich unruhig nach allen Seiten um. Wenn er zu nahe an die Kerle geriet, ohne sie rechtzeitig zu sehen, zog er am Ende den kürzeren.
Für ihn selbst war das Wagnis, bei diesem Wetter mit einem Boot draußen zu sein, ebenso riskant wie der Versuch, das Festland schwimmend zu erreichen, wie die Seewölfe es offenbar vorhatten.
Hirnverbrannte Idioten!
El Verdugo schwor ihnen blutige Rache. Aber erst mußte er sie in diesem Hexenkessel finden.
Das Boot nahm immer mehr Wasser über. Automatisch begann El Verdugo zu schöpfen.
Noch immer bestimmte er den Kurs. Er wollte die geflohenen Gefangenen überholen, ihnen den Weg versperren und sie zur Insel zurücktreiben. Töten wollte er nur ein paar der Bastarde, als Abschreckung für die anderen und damit selbst der Seewolf begriff, daß es kein Entkommen gab. Dann würde er sie am Strand einsammeln, Mann für Mann, und unter seine Fittiche nehmen.
Das grausame Gesicht des Henkers verzog sich zu einem gemeinen Grinsen. Für einen Augenblick ging die Phantasie mit ihm durch. Alle sollten seine Rache spüren. Die Hölle würde ein angenehmer Ort sein gegen die Teufelsinsel, sobald sie die Seewölfe wieder beherbergte.
„Da sind sie!“ schrie El Verdugo gegen den Sturm und deutete nach Steuerbord voraus, wo die dunklen Punkte im Wasser sich mehrten.
2.
Hasard warf sich entschlossen herum. Er schwamm in die Richtung, aus der er den Schrei gehört hatte. Nur ein Gedanke beherrschte ihn: er mußte Smoky, dem Decksältesten, helfen.
Sie waren eine verschworene Gemeinschaft.
Keiner der Crew, der bemerkt hatte, daß es Smoky erwischt hatte, setzte einfach seinen Weg fort, auch wenn die Kräfte noch so sehr erlahmten oder man mit dem Gefährten anschließend elend ertrank.
Big Old Shane, der Schmied von Arwenack, Ferris Tucker, der Schiffszimmermann, und Dan O‘Flynn schwammen zurück und taten instinktiv das gleiche wie Hasard, ihr Kapitän.
Selbst Edwin Carberry, der bullige Hüne, bereits mit Old Donegal im Schlepptau, wollte dem Kameraden helfen.
Der alte O‘Flynn hatte in diesem Moment erschöpft losgelassen.
Er fing ihn wieder ein, brachte seine Hand zurück an den eisernen Halsring, den die Spanier den Gefangenen verpaßt hatten, und gurgelte: „Halt dich fest! Ich lege noch etwas zu. Smoky hat‘s erwischt.“
Mühsam spuckte Old Donegal eingedrungenes Wasser aus, verzog schmerzlich das Gesicht und blieb brav beim Profos. Er versuchte mit lahmen Schwimmbewegungen, Carberry zu entlasten, der wie eine stolze Brigg durch das Wasser rauschte, anscheinend nicht kleinzukriegen, unverwüstlich, ein Kerl aus Eisen.
Smoky hatte einen Streifschuß eingefangen. Wie gelähmt hing sein Arm herunter. Und es blieb weder Zeit, ihn zu versorgen, noch sich von der Schwere der Verletzung zu überzeugen.
Gerade hatte Big Old Shane den Decksältesten in Schlepp genommen, da zerriß ein Blitz die Dunkelheit, erhellte weithin die Gegend und zeigte den Flüchtenden, wie ernst die Lage wirklich war: El Verdugo und acht Spanier hockten in einem Boot, das zwar wild auf den Wellenkämmen ritt, aber Kurs auf sie hielt.
Schon griffen die Spanier nach den Waffen. Musketen richteten sich auf die Gruppe.
Hasard schrie seinen Männern zu, wegzutauchen. Er selbst versuchte, dem Boot entgegenzuschwimmen, unsichtbar, unter Wasser. Sehen konnte er nichts, aber seine suchenden Hände ertasteten nach endlosen Sekunden den Kiel des Bootes.
Hasard hatte automatisch nach der Devise gehandelt, die sein Leben beherrschte: Angriff ist die beste Verteidigung. Er wollte sich irgendwie wehren und sich nicht im Wasser abknallen lassen.
Es zeigte sich, wie gut die Crew sich verstand. Nicht Hasard allein griff den Feind an. Ohne ein Wort der Verständigung hatten doch alle begriffen, die bei ihm gewesen waren.
Zuerst handelte Ferris Tucker.
Nur ein Mann wie er brachte es fertig, die Zimmermannsaxt mit dieser Wucht zu führen. Von unten, mit einem verzweifelten Streich, hinter dem jedes Quentchen Kraft steckte, schlug er zu.
Die messerscharfe Schneide klopfte nicht nur an, sondern durchbrach den Boden des Bootes. Sie erwischte knapp noch den Fuß des Henkers.
Den Schrei, den El Verdugo ausstieß, hörten nur jene, die nicht weggetaucht waren.
Hasard richtete sich auf, stemmte den Rücken unter den Kiel des Bootes und wunderte sich, wie leicht er das Gewicht hochdrückte.
Aber mit ihm arbeiten die anderen. Und zwei von ihnen hatten das Glück, Boden unter den Füßen zu haben, eine Sandbank, wie sie zwischen Insel und Festland nicht eben selten waren und die Schiffahrt zu einem lebensgefährlichen Abenteuer werden ließen. So manches spanische Versorgungsschiff, das von Cayenne aus Kurs auf die Teufelsinsel genommen hatte, war auf diesen tückischen Bänken schon aufgelaufen.
Das Boot der Spanier wurde angekippt und schlug nach der Backbordseite um. Die Spanier flogen kopfüber ins Wasser. Sie landeten mitten zwischen den Engländern. Das konnte natürlich nicht gutgehen.
Prompt landete denn auch ein schmächtiger Spanier in Reichweite des wütenden Profos, der sich nur knapp umschaute, ob Old Donegal noch an ihm hing.
Old Donegal schluckte, prustete und schnappte zwischendurch nach Luft. Auch wenn man in dieser ägyptischen Finsternis keine Einzelheiten sehen konnte: sicher war er blau wie ein Tintenfisch, angelaufen von Luftmangel. Was hatte er den gesunden Lungen des mächtigen Profos‘ schon entgegenzusetzen? Immerhin verrieten die würgenden hustenden Laute, daß er noch lebte. Und schon versuchte er zwischendurch, seinen muskulösen Freund anzufeuern. Denn er hatte wohl erkannt, daß der Spanier, der da mühsam den Kopf über das Wasser reckte, vor Angst tollkühn angriff.
„Komm her, du Rübenschwein!“ grollte der grimmige Profos.
Carberry streckte die Pranken aus und erwischte den Spanier an der Gurgel. Liebevoll zog er ihn mit einem Ruck heran. Die Fäuste des Spaniers prallten wirkungslos vom Rammkinn des Profos‘ ab. Carberry grinste gelangweilt, ließ den zappelnden Kerl frei und verpaßte ihm einen Hammerschlag mitten auf den Kopf.
Der Spanier verschwand unter Wasser.
Carberry schloß sich den anderen an, die wieder Kurs nahmen. Sie bewegten sich alle in die Richtung, in der sie das Festland vermuteten. Aber Gewißheit gab es bei diesem Hundewetter für keinen. Der Gedanke, daß man mit aller Kraft immer weiter ins offene Meer hinausschwamm, hatte etwas Lähmendes.
Trotzdem gab niemand auf. Sie schleppten sich weiter. Lieber ein Ende mit Schrecken, als unter der Knute des Henkers, den alle in Gedanken verfluchten, qualvoll einen höllischen Tod zu erleiden. Im übrigen gab es kein Zurück mehr. Denn niemand konnte gegen den Strom anschwimmen, der an der Teufelsinsel vorbeitrieb.
Das Festland schien noch fern. Stets wenn sie die müden Köpfe über die Schaumkämme reckten, um nach dem Land Ausschau zu halten, wurden sie enttäuscht. Endlos und wild bewegt dehnte sich die Wasserfläche vor ihren suchenden Blicken.
Hätte es nicht hin und wieder die Sandbänke gegeben, sie alle wären ertrunken. So aber konnten sie von Zeit zu Zeit etwas Kraft sammeln und sich in der Hoffnung wiegen, vielleicht doch nicht allzuweit vom Land entfernt zu sein.
Kraft zur Verständigung hatten sie längst nicht mehr.
Immer wieder war es Hasard, der das Zeichen zum Aufbruch gab und losschwamm, ohne allerdings die beruhigende Gewißheit zu haben, wann sie in angemessener Entfernung wieder eine Ruhepause einlegen konnten.
Was bedeutete es da, daß sie die spanischen Verfolger zunächst abgeschüttelt hatten? Am Ende schien doch der Tod auf sie zu lauern.
Hasard selbst mußte seinen ganzen Mut zusammennehmen. Er wußte selbst keine Antwort auf die Frage, ob er diese Flucht ins Ungewisse angetreten hätte, wenn ihm auch nur ein Bruchteil der Schwierigkeiten und Strapazen bekannt gewesen wären, mit denen sie jetzt konfrontiert wurden.
Das Seewasser fügte den Qualen eine weitere zu. Wer offene Wunden hatte – und das war bei den meisten der Fall –, litt furchtbar. Das biß und fraß, daß man kaum die Arme beim Schwimmen zu bewegen vermochte.
Smoky, der immer noch an der Schulter blutete, schnappte sich ein Stück Treibholz und schlug seine Zähne hinein, um seinen Retter nicht durch sein Stöhnen zu verunsichern.
Dabei plagte ihn die gräßliche Vorstellung, seine blutende Wunde könne den mordgierigen Haien eine Fährte legen. Das würde das Aus für sie alle bedeuten. Mit den Spaniern konnten sie fertig werden, aber gegen Haie hatten sie keine Chance. Da konnten sie nur noch beten.
Die Nacht schien kein Ende zu nehmen. Kein Silberstreif über der Kimm flößte den Verzweifelten neue Hoffnung ein. Sie wußten nicht mehr, wie lange sie unterwegs waren. Ihr Zeitgefühl war längst erstorben. Das Leben bestand nur noch aus den zermürbenden Bewegungen der Arme und Beine, die den Körper anscheinend um keinen Inch vorwärtsbrachten.
Was wollte es da schon heißen, daß der Sturm abgeflaut war und kein Regen mehr fiel? Dieses Grau um sie herum und über ihnen, diese endlose Monotonie brach auch die Widerstandskraft des Stärksten.
Wozu sich noch anstrengen, wenn doch alles umsonst war? Sie hatten den Kurs verloren, kein Zweifel. Seit über einer Stunde hatten sie keine Sandbank mehr erreicht und damit keine Gelegenheit gehabt, sich ein wenig zu verschnaufen. Ihre Arme und Beine waren schwer wie Blei. Entzündete Augen hatten es aufgegeben, nach Land zu suchen.
Die Möglichkeit, daß sie sich immer weiter im Meer verloren, nahm erschreckend zu. Mancher der Seewölfe, glücklicher Besitzer eines Messers, spielte bereits mit dem Gedanken, sich die Klinge über beide Handgelenke zu ziehen und anschließend in den Bauch zu rammen. Das mußte eine Erlösung sein gegenüber der Qual des Schwimmens.
Dann wagte sich zum ersten Male der Mond hinter Wolkenbänken hervor. Sein mildes Licht fiel auf die sanft gekräuselte Wasserfläche. Sie erkannten Nachbarn und Leidensgefährten. Sie hatten sie die ganze Zeit neben sich gewußt, aber nicht deutlich erkannt. Jetzt unterschieden sie Gesichter und sahen, daß der andere ebenso schlecht dran war und mit dem letzten Funken Kraft gegen den Untergang kämpfte. Das spornte an. Wieso schaffte der es noch? Da konnte man nicht aufgeben. Nicht eher, als bis der andere auch aufgab.
Die Seewölfe kämpften sich stumm und verbissen weiter vorwärts. Wohin? Wo in diesem elenden Meer war vorn, wo hinten? Wo offenes Meer, wo die Küstenlinie, die sie herbeisehnten?
Niemand wußte es.
Jeder sah Hasard da vorn und folgte ihm. So war es immer gewesen. Sie waren nicht schlecht dabei gefahren. Sie hielten sich auch jetzt an ihn.
Ohne es zu ahnen, trug Hasard die Hoffnungen seiner Männer. Er wußte nur, daß er kein Recht hatte, aufzugeben. Nicht, solange er noch Atem schöpfen konnte. Und wenn die Arme ihm abfielen – er mußte weiterschwimmen. Denn er hatte diese Flucht befohlen.
Er trug keine geringe Verantwortung. Er konnte sich alles leisten, nur durfte er seine Männer nicht enttäuschen. Das war ihm klar. Das gab ihm Kraft, auch dann, als er glaubte, er habe keine mehr.
Mit der Gleichmäßigkeit seiner Bewegungen flossen auch Hasards Gedanken. Immer wieder stellte er sich vor, was er auf der Teufelsinsel gelitten hatte. Das hinderte ihn daran, aufzugeben.
So seltsam es klang: El Verdugo, der Henker, den hoffentlich die Haie geholt hatten, größter Feind und Peiniger der Seewölfe, wurde in diesen einsamen Stunden Hasards stummer Verbündeter. Der Gedanke an ihn und seine grausamen Schikanen erfüllten ihn mit einer solchen Wut, daß er davon mehr vorwärtsgetrieben wurde, als würde er ein Dutzend Hiebe mit der neunschwänzigen Katze empfangen. Schmerzen, wenn sie überhand nahmen, stumpften ab und hinderten niemanden daran, zusammenzubrechen. Ganz anders der Haß. Er weckte die Lebensgeister und fachte erlahmende Kräfte wieder an.
Hasard stellte sich immer häufiger die ekelhafte Schinderfratze des spanischen Henkers vor. Er schwamm auf sie zu, um seine Faust in diese Totenfratze zu rammen und ihm die häßlichen Zähne einzeln einzuschlagen.
Mit Entsetzen erkannte Hasard, schon so weit fertig zu sein, daß sich sein Geist verwirrte und seine Phantasie übermächtig wurde. Vielleicht lebte er schon gar nicht mehr? Vielleicht bildete er sich auch das nur ein? Schwamm er gar nicht mehr im Wasser? War er niemals von der Teufelsinsel aufgebrochen ins Ungewisse, das immer gewisser wurde? So gewiß wie der Tod?
Hasards Lippen waren aufgeplatzt. Eine dicke Salzkruste bedeckte sie. Seine Augen, geschwollen und entzündet, sahen nichts als Wasser. Welch ein Hohn, er schwamm in einem Meer und hatte Durst. Er sehnte sich nach einem Schluck frischen Wassers und hätte seine Seele dafür verpfändet.
Hinter ihm ertönte ein heiseres Krächzen.
Hasard hörte den Laut, der kaum etwas Menschliches hatte, aber er brachte es nicht mehr fertig, den Kopf zu wenden. Seine Halsmuskeln waren viel zu verkrampft. Sein Schädel drohte von der Anstrengung zu zerplatzen.
Nur keine überflüssige Bewegung!
Hasard schwamm weiter, mit zähen, langsamen Bewegungen. Es gab keine Rettung mehr aus der Monotonie des jetzt langgedehnten Auf und Ab. Die See war nicht mehr kabbelig. Die lange Dünung lullte einen ein. Man wurde zu einem unbedeutenden Fleck auf der Weite des Ozeans.
Etwas stieß Hasard an.
Er erschrak bis ins Mark, war aber unfähig, entsprechend zu reagieren. Das Gehirn signalisierte Gefahr. Haie vielleicht? Die Augen weiteten sich reflexhaft, aber der zermürbte Körper gehorchte nicht.
Unendlich langsam drehte Hasard den Kopf und starrte auf einen abgerissenen Ast, der ihn berührt hatte. Es dauerte eine Ewigkeit, bis es bei Hasard dämmerte. Ein Ast bedeutete Landnähe. Ein Vorbote der Rettung!
Hasard erwachte aus todesähnlicher Lethargie. Fast schmerzhaft empfand er Freude. Es war ein Gefühl, das ihm den Brustkorb sprengte, das er schleunigst abschütteln mußte, wollte er nicht daran erstikken.
Hasard ruderte mit den Armen, versank, ging unter, kämpfte sich wieder hoch, strampelte vor Freude und trat das Wasser, daß sein Körper sich erhob.
„Land!“ schrie er und wunderte sich, daß die Stimme nicht mehr gehorchte. Er meinte, sein Schrei könne Tote erwecken, und doch erreichte er kaum die Ohren derer, die ihm unmittelbar gefolgt waren: Carberry und Big Old Shane, beide mit Schicksalsgenossen im Schlepp, der eine Old Donegal, der andere Smoky.
Verwirrt stierte Hasard auf die weit auseinandergezogene Kette seiner schwimmenden Männer. Verstand ihn denn niemand? Die Leiden hatten ein Ende! Land in Sicht! Geschafft!
Da sah Hasard, wie in der Ferne Dan O‘Flynn, der Scharfsichtige, verzweifelt nach vorn deutete, als habe er eine Botschaft von höchster Dringlichkeit. Er sah, wie sich der Mund Dans dauernd öffnete und schloß. Aber kein Laut drang an sein Ohr. Darin war nur das ewige Geräusch des Meeres und der Wellen wie in einer leeren Muschel.
Aber Hasard tat Dan den Gefallen. Er veränderte noch einmal die Position. Und da sah er es auch: ein feiner dunkler Strich an der Kimm. Fast nicht zu erkennen im Dunst des nahenden Morgens.
Sie hatten die Küste vor sich.
Alle Ängste verflogen. Sie hatten sich nicht immer weiter in das offene Meer vorgearbeitet. Sie wurden nicht grausam genarrt durch ein unerträgliches Geschick. Sie hatten ein Glückslos gezogen.
Nicht die Spanier, nicht die Haie, nicht der Sturm und nicht das Meer hatten sie bezwungen. Sie waren Sieger geblieben.
Hasard mußte sich dazu zwingen, jetzt nicht durchzudrehen. Er mußte auch weiterhin seine Kräfte einteilen. Er schätzte die verbleibende Strecke, die sie noch zurücklegen mußten, auf eine gute Seemeile. Das war nicht viel gegenüber der Distanz, die sie hinter sich gebracht hatten. Aber es war nach dieser höllischen Nacht kaum zu bewältigen.
Hasard bezähmte den Trieb, das letzte aus sich herauszuholen. Aber seine innere Unruhe kriegte er nicht mehr in den Griff. Jeder Schwimmzug war ihm zuviel. Die Zeit verstrich jetzt viel zu langsam. Die Entfernung wollte nicht schwinden.
Mehr als zwei grausame Stunden kämpften die erschöpften Männer, zumal sich unter Land die Strömungen änderten und sie wieder zurücktrieben. Es war eine letzte furchtbare Prüfung – dann taumelte Hasard an Land. Die Ketten schienen doppelt soviel zu wiegen wie im Wasser. Arme und Beine waren wie abgestorben, als gehörten sie nicht mehr zu seinem Körper.
Hasard hielt sich an den Luftwurzeln einer Mangrove fest. Er taumelte und schloß erschöpft die Augen.
Dann bewegte er sich weiter, um den anderen nicht diesen guten, aber winzigen Landeplatz im Gewirr der Ufervegetation zu sperren. Dabei stolperte er und schlug der Länge nach hin.
Einen Augenblick dachte er, nie wieder aufstehen zu können. Unendlich langsam kämpfte er sich hoch. Erst kniete er. Dann richtete er sich auf. Vor seinen Augen flimmerten und zerplatzten Sterne und Kreise. Alles in ihm sträubte sich gegen die geringste Anstrengung. Er wollte nur noch liegen und ausruhen.
Hasard bezwang den Schwächeanfall.
Er klammerte sich an einer der rissigen Baumwurzeln fest und wandte unendlich langsam den Kopf. Ihn quälte der Gedanke an seine Gefährten. Wie viele waren einsam gestorben auf dieser furchtbaren Strecke zwischen Insel und Festland?
Hasard beobachtete das erschütternde Schauspiel der Landung. Mann für Mann kämpfte sich ans Ufer. Ketten klirrten, entzündete Augen starrten blind in das Grün der Büsche, die bis an den Strand vorgedrungen waren.
Was war aus den stolzen Seewölfen geworden? Ein maroder Haufen. Die Fronarbeit für die Spanier, die Schrecken der Flucht von der Teufelsinsel, die Strapazen des langen nächtlichen Kampfes mit Wind und Wellen hatten tiefe Spuren hinterlassen.
Kaum daß einer ein gequältes Grinsen fertigbrachte wie Big Old Shane, der alte Waffenmeister von Arwenack, oder Ferris Tucker, der Schiffszimmermann, oder der Riese Edwin Carberry, Profos der „Isabella“. Wobei der Profos wenigstens noch einem Gefährten das Leben gerettet hatte. Treu und brav schleppte er Old Donegal. Ferris Tucker trug seine Axt wie eine Fahne an Land.
„So etwas möchte ich nie wieder erleben“, stöhnte er und schlug in den Sand. Er brauchte lange, bis er wieder soviel Kraft hatte, Hasard zu helfen.
Im Licht des dämmernden Morgens riefen sie Versprengte zu sich heran und halfen den Erschöpften ans sichere Ufer.
Hasard beruhigte sich erst, als er alle wieder um sich versammelt hatte. Ja, sie hatten es alle geschafft, keiner war zurückgeblieben oder hatte sich aufgegeben.
Da lagen sie, mit nackten Oberkörpern, in Ketten, erschöpft und zerschunden, auf dem schmalen Sandstreifen, im spärlichen Schutz der Mangrovenwurzeln, die sich wie ein Netz über ihnen spannten.
Kein anderer Laut drang an ihre Ohren als das leise Plätschern der Wellen, die sich am Ufer totliefen.
„Auf, Leute!“ befahl Hasard unerbittlich.
Noch waren sie nicht in Sicherheit. Es war unwahrscheinlich, daß sich die Spanier darauf verließen, die Ausbrecher seien ertrunken. Sie wollten Beweise haben, Beweise, daß der Seewolf und seine Männer den Silberschiffen der Spanier nie mehr gefährlich werden konnten.
Der Morgen dämmerte.
Die Dons würden ein weiteres Boot ausrüsten und auf die Suche schikken. Entweder nach den Leichen der ertrunkenen Seewölfe oder – wenn sich die Teufelskerle wider Erwarten ans Festland gerettet hatten – um sie wieder einzufangen und auf die Teufelsinsel zurückzuschleppen.
Es gehörte nicht viel Phantasie dazu, sich den nächsten Schritt der wütenden Spanier vorzustellen.
Ein unwilliges Stöhnen und Murren antwortete Hasard.
Der Seewolf ging von Mann zu Mann, sprach ihn mit Namen an und half ihm auf die Beine. Obgleich er keine Kraftreserven mehr hatte, schaffte er es noch einmal. Er trieb seine Männer zu einer letzten Anstrengung.
„Weiter im Landesinneren sind wir sicherer. Wir brauchen Ruhe, um uns halbwegs zu erholen. Aber der Strand ist der denkbar ungeeignetste Ort dafür. Die Spanier würden uns mit Sicherheit entdecken. Und dann beginnt die Hetzjagd. Eine Jagd, der wir nicht mehr gewachsen sind. Also los, Leute.“
Inzwischen halfen Tucker und Carberry ihrem Kapitän.
Einige der unsanft Wachgerüttelten waren zwar brav, wie im Unterbewußtsein, hochgetorkelt, als sie die Kommandostimme Hasards hörten, waren aber nicht recht wach geworden und wieder umgefallen. Jetzt lagen sie wieder schnarchend am Strand.
Eine Dusche Wasser, ein gezielter Tritt brachte sie wieder hoch.
Alle hatten begriffen, worauf es ankam. Und es war nicht ihre Art, jemanden zurückzulassen. Sie hatten die Knute der Dons zu lange gespürt, als diese Behandlung auch nur ihrem ärgsten Feind zu wünschen.
Langsam setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Aufeinandergestützt, mit leeren Gesichtern, taumelnd vor Erschöpfung, kämpften sich die Seewölfe weiter, zogen sich an den Luftwurzeln der Mangroven hoch und schleppten sich dem Saum gezackter Palmkronen entgegen, die den nahen Urwald anzeigten.
Schon einem Gesunden hätte ein Marsch durch das sumpfige unwegsame Gelände einiges abverlangt. Die Seewölfe wollten mehr als einmal aufgeben. Jedesmal trieb sie Hasard unerbittlich weiter.
Die Verwundeten wurden getragen. Die Schwachen stützten sich auf die Starken.
Hasard selbst half zweien seiner Männer, die sich an ihn klammerten.
Nur Bill, der schmächtige Schiffsjunge, zeigte Nehmerqualitäten. Er schlug manchen hartgesottenen Seemann um Längen, was Zähigkeit und Ausdauer betrafen. Er stromerte um die Gruppe wie ein Schäferhund um die Herde, lief auch mal voraus und erkundete den Weg, um der Crew die beste Richtung angeben zu können.
Hasard wunderte sich gehörig über den Burschen.
Immer wieder blieb einer der Männer stehen und blickte flehentlich auf den Kapitän, ob die Qual nicht endlich ein Ende habe.
Jedesmal schüttelte Hasard stumm den Kopf. Nur in hartnäckigen Fällen fügte er hinzu: „Wir sind noch lange nicht in Sicherheit. Willst du, daß alle Opfer, alle Anstrengungen umsonst waren? Die Dons könnten uns in unserem jetzigen Zustand mit nassen Handtüchern erschlagen. Wir müssen uns verstecken wie gehetztes Wild. Uns bleibt nichts anderes übrig. Erst wenn wir wieder ausgeruht sind, können wir unserer Wut freien Lauf lassen und uns den Spaniern zum Kampf stellen. An mir soll es nicht liegen. Was ist mit dir? Bist du dabei?“
Solche Appelle hatten immer Erfolg.
Der an seinem Ehrgeiz Gepackte grinste zwar müde, aber doch schon kampflüstern. Einem Spanier an den Kragen zu gehen, einem der Dons, die das alles verschuldet hatten – eine solche Vorstellung belebte die Lebensgeister besser als Speise und Trank. Schon spürte man neue Kräfte, auch wenn es nur ein kurzes Aufflackern war.
Bald aber konnte Hasard weder im Guten noch im Bösen etwas ausrichten. Sie hatten den Rand der grünen Hölle erreicht. Ein Eindringen schien unmöglich. Die Männer schreckten zurück vor der Unnahbarkeit dieses grünen Meeres. Sie waren an Land ohnehin hilflos wie die Schildkröten. Jetzt auch noch wie die Affen zwischen Lianen und Orchideen, Baumriesen und Farnkräutern herumzufegen – das ging gegen ihre Natur.
Sie ließen sich fallen, wo sie standen.
Da nahm auch Hasard erschöpft Platz. Lethargie befiel auch ihn.
Wohin wollten sie eigentlich? Ohne Werkzeuge, ohne Proviant, weitab von ihrem stolzen Schiff? Sie waren gestrandet. Und was das gekostet hatte! Sollte das der Preis sein, hier im Dschungel elend umzukommen oder sich zu verirren?
Da war es der Kutscher, der wieder Leben in das Camp der Verlorenen brachte. Er hatte sich die ganze Zeit bereits rührend um Smoky gekümmert, den Decksältesten. Jetzt störte ihn das Stöhnen des Verwundeten in seiner Ruhe. Seine Kunst wurde gebraucht.
Also zwang er sich, aufzustehen.
Er schimpfte und fluchte, nachdem er die Wunde Smokys mit Seewasser gereinigt hatte. Smoky lag die ganze Zeit flach auf dem Rücken und stöhnte vor Schmerzen.
„Es ist nur ein Streifschuß“, tröstete ihn der Kutscher. „Du hast ‘ne Menge Blut verloren, aber an dem Kratzer geht niemand zugrunde.“
„Dein Wort in Gottes Ohr, Kutscher“, knurrte Smoky. „In den Tropen kann die winzigste Verletzung das große Aus bedeuten. Erzähl mir nichts. An mir soll es nämlich nicht liegen. Ich werde auch weiterhin die Zähne zusammenbeißen, solange ich noch die Kraft dazu habe. Wenn ich es aber nicht mehr schaffe, Kutscher, mußt du mir einen Gefallen tun!“
„Ich bin Medizinmann, kein Schlächter!“ Der Kutscher winkte ab. Er wußte genau, auf was der Decksälteste hinauswollte. Bei dem bloßen Gedanken sträubten sich ihm schon die Nackenhaare.
„Aber es ist deine Christenpflicht. Willst du, daß die Spanier mich fangen? Oder die Würmer mich bei lebendigem Körper auffressen, Mann? Was wäre in solchem Fall wirkliches Mitleid? Du mußt es tun. Versprich es mir, sonst stehe ich nicht mehr auf.“
„Ja, zum Teufel. Aber ehe das eintritt, kämpfe ich wie ein Löwe. Ich werde dich pflegen wie eine Mutter. Und du tust mir den Gefallen und läßt dich nicht gehen. Gemeinsam werden wir es schaffen.“
Smoky nickte und fiel wieder hintenüber. Für einen Augenblick hatte er sich aufgerichtet, den Kutscher am Arm gepackt und ihn wild angestarrt.
Der Kutscher ahnte bereits, wie es weitergehen würde: das Fieber würde über den geschwächten Körper Smokys herfallen. Mit einem Blatt, das er von einer Palme abschnitt, verschloß er notdürftig die Schulterwunde. Mehr hatte er nicht. Ein paar biegsame Zweige mußten den Notverband halten. Das war besser als gar nichts. So konnte nicht jeder Schmutz ungehindert in die offene Wunde eindringen. Und der Patient hatte das Gefühl, daß etwas getan wurde.
„Hol‘s der Satan“, schimpfte der Kutscher.
Er hinkte zu Hasard, der sich bei seinem Nahen sofort aufrichtete, als habe er nie den Schlaf des Erschöpften genossen.
„Was soll jetzt werden?“ fragte der Kutscher. „Wir haben Verwundete. Willst du warten, bis hier ein englisches Schiff vorbeisegelt? Ich fürchte, solange leben wir alle nicht. Bis dahin sind wir verhungert und verdurstet. Die Nahrungsmöglichkeiten sollen im Urwald noch schlechter sein als auf der Teufelsinsel, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst.“
„Ich gebe niemals auf, soweit solltest du mich schon kennen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich träume davon, meine ‚Isabella‘ wieder in Besitz zu nehmen.“
„‚Deine Isabella‘?“ erkundigte sich der Kutscher streitsüchtig. „Wenn schon, dann unsere ‚Isabella‘.“
„Leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Wenn es dich beruhigt: es war nicht so gemeint“, erwiderte Hasard und grinste.
Der Kutscher stand mit dem Gesicht zum Meer.
„Ich habe auch etwas, das dich interessieren wird“, sagte der Kutscher leise, und seine Augen weiteten sich. „Dort hinten ist eine Schaluppe aufgetaucht. Ich will verdammt sein, wenn ich nicht lauter spanische Helme sehe.“
Hasard sprang wie von der Tarantel gestochen auf. Gefahr belebte ihn. Herausforderung reizte ihn. Er hätte nicht den Kampf mit den Spaniern gesucht. Jetzt noch nicht. Aber wenn es denn sein mußte …
Hasard entdeckte unschwer die Schaluppe.
An Bord befand sich die halbe Wachmannschaft der Spanier. Am Bug stand, den Kieker vor dem Auge, Capitan Catalina, Kommandant der Teufelsinsel. Systematisch suchte er den Uferstreifen ab.
„Woher weiß dieser Hurensohn, daß wir das Festland erreicht haben?“ fragte der Kutscher. „Es könnten uns doch auch die Haie gefressen haben.“
„Er will sichergehen. Noch einen Fehler kann er sich nicht leisten. Wenn er uns nicht findet, geht er davon aus, daß wir nicht mehr leben, und kann Madrid melden, was ihm paßt. Er braucht nicht einmal zu erwähnen, daß es vorher einen Massenausbruch gegeben hat.“
„Kann er sich so auf seine Leute verlassen?“ fragte Ferris Tucker, der sich ebenfalls erhoben hatte und zu den beiden trat.
„In diesem Punkte schon. Jeder einfache Wachsoldat müßte es büßen, wenn am Hofe ruchbar wird, daß wir entwischen konnten“, erwiderte Hasard. „Also läßt er nichts unversucht, um die Wahrheit herauszufinden. Denn wehe, er behauptet, wir seien tot, und wir tauchen irgendwo wie aus dem Nichts wieder auf und jagen die Spanier, als ob wir nie aus dem Geschäft gewesen wären. Sie würden Catalina hängen.“
„Gönnen würde ich ihm das schon“, sagte der Kutscher rachsüchtig.
„Da sind noch mehr Spanier. Sie gehen am Ufer entlang!“ rief Ferris Tukker erregt. Er hatte den Stamm einer Palme bis zur halben Höhe erklommen, um einen besseren Überblick zu haben.
Jetzt rutschte er schleunigst herunter, um nicht entdeckt zu werden.
„Sie suchen unsere Spuren. Und sie werden sie finden“, sagte der Kutscher erschrocken. „Wenn sie im Spurenlesen geschickt sind, stellen sie sogar fest, daß unsere Crew noch vollzählig ist. Dann kennt ihre Wut keine Grenzen.“
Wie zur Bestätigung knallte am Ufer eine Muskete.
Augenblicklich steuerte die Schaluppe auf den Strand zu.
„Paß auf, was sie tun!“ rief Hasard, lief mit dem Kutscher von Mann zu Mann und scheuchte seine Leute hoch, während Ferris Tucker wieder den Ausguck besetzte.
Die Jagd war eröffnet. Kein Zweifel!
„Sie lassen zehn Mann zurück und bringen eine Drehbasse in Stellung, zum Schutz der Schaluppe!“ rief der Schiffszimmermann.
Keine andere Botschaft hätte den Rest der Crew schneller auf die Beine bringen können. Alles wimmelte durcheinander. Die drohende Gefahr verscheuchte die Müdigkeit. Keiner sah einen Ausweg. Ratlosigkeit herrschte.
„Ruhig Blut, Männer“, mahnte Hasard. „Wir sind mit größeren Schwierigkeiten fertig geworden. Kein Grund, jetzt durchzudrehen!“
„Dann erzähl mal, wie‘s weitergehen soll“, sagte Old Donegal.
„Abhauen können wir kaum. Wir sind zu schwach. Die Spanier haben Macheten, um sich einen Pfad zu schlagen“, stöhnte Smoky.
„Wir haben die Axt von Ferris“, sagte Hasard gelassen.
Er blickte sich suchend um.
„Das Gelände paßt besser in unser Konzept als in das der Spanier. Die würden uns lieber auf freiem Feld hetzen, um uns schneller einholen zu können. Los, Leute! Hinein in den Dschungel. Ferris und Batuti werden euch den Weg mit seiner Axt bahnen. Löst sie rechtzeitig ab. Big Old Shane, Stenmark, Al Conroy, Ben Brighton und ich bleiben hier. Gebt jedem von uns ein Messer.“
Hasard hatte die besten und kräftigsten seiner Männer ausgesucht. Denn es blieb nicht viel Zeit, höchstens eine halbe Stunde. Sie mußten sich beeilen, daß sie ihr Werk vollendeten, ehe die Spanier eintrafen.
„Wollt ihr damit vielleicht die Musketiere abschlachten, ihnen die Schaluppe wegnehmen und das Weite suchen?“ fragte Old Donegal. „Wie wär‘s, wenn ich auch dabliebe und mein Holzbein als Keule benutzte?“
„Verschwindet“, befahl Hasard scharf. Dies war nicht der Augenblick, zu diskutieren und Kleingläubige zu überzeugen. Er wußte genau, was er tat. Er würde den Spaniern einen heißen Empfang bereiten. Ihm fehlte es an Waffen, aber nicht an Erfindungsgeist.
3.
Die Seewölfe brachen auf. Sie tauchten unter im Grün der Bäume und Lianen. Die üppige Vegetation verschluckte sie, als habe es sie nie gegeben. Und doch gab es Leben im Urwald. Kreischend stiegen bunte Papageienschwärme auf und zeigten die Fluchtrichtung der Ausbrecher an. Die Spanier waren schließlich nicht blind und lebten lange genug in diesem Teil der Welt, um die Zeichen der Natur richtig zu deuten.
Hasard biß die Zähne zusammen. Es mußte trotzdem klappen.
In fliegender Hast erläuterte er seinen Gefährten den Plan.
Big Old Shane und er hoben eine Fallgrube aus. Sie arbeiteten wie die Wilden. Die Messerklingen bohrten sich leicht in das lockere Erdreich. Sie gingen nicht zu sehr in die Tiefe, rammten aber in den Grund der Grube einen angespitzten Pfahl. Er würden den Spanier, der den Fehltritt tat, nicht gerade töten, ihn aber hindern, weiter den Ausbrechern nachzusetzen. Kaum war eine halbe Stunde vergangen, da gab es entlang des Pfades eine ganze Reihe teuflischer Überraschungen.
Hasard und seine Begleiter folgten in mäßigem Tempo ihren Gefährten und bauten von Zeit zu Zeit eine Falle ein. Sie legten einen Verhau von harmlos erscheinenden Lianen an, die sich wie zufällig über den Pfad ringelten, in Wirklichkeit aber über einen hohen Ast liefen und einen schweren Stein in der Höhe festhielten. Wurden sie durchgehackt, fiel der Brocken senkrecht herunter.
Sie bauten einen primitiven Bogen mit einem ansehnlichen Pfeil auf der Sehne aus einem tauähnlichen Schlinggewächs, spannten das ganze mit einer Liane und sorgten dafür, daß die Spanier den Auslöser nicht verfehlten.
Daß ihre Methode erste Erfolge brachte, erkannten die Gehetzten sehr schnell. Schreie verkündeten, daß eine der Fallen zugeschnappt war.
Das Tempo der nachrückenden Spanier wurde merklich langsamer. Vorsichtig und mißtrauisch zogen sie durch den Urwald, denn sie kämpften gegen einen unsichtbaren Feind.
Zwischendurch blieb immer wieder einer der Seewölfe zurück.
Der Mann lag, das Messer in der Faust, auf einem starken Ast oberhalb des Pfades. Er ließ die schwitzenden, fluchenden Spanier unter sich hindurchziehen. Mit Vergnügen beobachtete er, wie die Verfolger immer neue Fallen witterten, sich weigerten, an der Spitze zu marschieren und das Tempo verschleppten. Sie wären am liebsten umgekehrt, hätte die Radschloßpistole ihres Offiziers sie nicht vorangezwungen.
Wenn dann ein Nachzügler auftauchte, ließ der Seewolf sich einfach fallen, riß den Überraschten um und stach mit dem Messer zu.
Nach einer Weile hatten die Dons die Taktik des Gegners durchschaut. Catalina selbst wunderte sich, daß er plötzlich am Ende des Zuges ging.
Sie arbeiteten sich im Gänsemarsch durch das Dickicht, weil die Leute vorn genug damit zu tun hatten, einen schulterbreiten Pfad mit der Machete zu schlagen.
Catalina, völlig verunsichert, fühlte sich als letzter Mann gar nicht mehr so wohl. Ständig drehte er sich um, die Pistole schußbereit in der Faust. Vergeblich suchte sein Auge den Feind im Gewirr der Pflanzen.
Sobald der Mann, der auf Hasards Weisung an einem bestimmten Punkt zurückgeblieben war, sein blutiges Werk beendet hatte, schnappte er sich die erbeuteten Waffen, überholte den feindlichen Trupp in einem weiten Bogen und stieß wieder zu den anderen.
Das kostete eine ungeheure Kraft.
Dafür bereitete es aber doppelt Freude, wenn die Dons plötzlich aus ihren eigenen Musketen frontal angegriffen wurden und Zunder kriegten, daß sie kopfüber Schutz suchten, möglichst in Nesseln und anderen ekligen Pflanzen, die eine Berührung nicht gerade zu einem Quell der Freude werden ließen.
Einmal wurde der Feuerüberfall so gekonnt eröffnet, daß den Spaniern entweder der Pfad blieb oder ein Satz in den Morast. Zwei Soldaten, in Helm und Harnisch, versanken kläglich. Ihr Geschrei marterte noch lange die Nerven der anderen Soldaten, die von Catalina brutal weitergetrieben wurden, obgleich sie lieber ihren unglücklichen Kameraden geholfen hätten.
Aber der Capitan duldete nicht die kleinste Verzögerung. Die trat erst ein, als es Catalina selbst erwischte.
Hasard hatte kaum erkannt, daß das weitere Vordringen der Spanier allein von dem Capitan abhing, da baute er seine Falle auf.
In Windeseile kappten sie einen mittelschweren Baum neben dem Pfad so, daß er noch von zwei Lianen in seiner Stellung gehalten wurde. Hasard selbst legte sich auf die Lauer.
Genau im richtigen Augenblick zerstörte er die beiden Lianen.
Langsam kippte der Baum und neigte sich dem Pfad zu, zu einer Zeit, als die Spanier sich bereits weiter vorgearbeitet hatten und annahmen, in ihrem Rücken drohe keine Gefahr.
Der Baum rauschte durch Unterholz und warnte die Verfolger in letzter Sekunde. Aber es war bereits zu spät. Ein mörderisches Prasseln und Splittern von Ästen ertönte, dann folgte ein heller Schmerzensschrei. Catalina lag begraben unter der Krone.
Der stürzende Baum hatte ihm übel mitgespielt, aber er war nicht tot.
Seine Leute, die ihn zu befreien suchten, brüllte er an, sich zu beeilen. Er hatte große Schmerzen, wie er hinzufügte. Zum Schluß wurde er ausgesprochen umgänglich.
Seine Soldaten befreiten ihn und mußten ihn tragen. Sie traten den Rückzug an und kehrten auf demselben Weg zurück, den sie gekommen waren. Jeder andere Weg hätte neue Strapazen und einen Zeitverlust bedeutet.
Catalina schrie und jammerte. Offenbar waren seine Beine gebrochen.
Auf dem Rückmarsch nahmen die Spanier ihre Toten und Verletzten mit und leider auch die Vorräte an Pulver und Blei, die Hasard nur zu gern erbeutet hätte. Die den Spaniern geraubten Musketen wurden damit wertlos. Es lohnte sich nicht, sie mitzuschleppen.
Hasard und seine Männer zerschlugen die Schießprügel an Bäumen und zogen weiter. Die frisch abgeschlagenen Zweige und Äste, Lianen und Farne wiesen ihnen den Weg.
Die Wiedervereinigung fand eine knappe Meile weiter statt.
Die Tatsache, daß sie blindlings in den Urwald gestürmt waren und nicht mehr ein noch aus wußten, dämpfte die Freude über das gelungene Rückzugsgefecht.
Der Trupp, der den Spaniern das Fürchten beigebracht hatte, war am meisten geschlaucht. Es dauerte lange Zeit, bis sich Hasard und seine Männer so weit erholt hatten, daß sie Bericht erstatten konnten.
Sie fanden nur wenige Zuhörer.
Die meisten Seewölfe lagen wie tot auf dem feuchten Urwaldboden, ungeachtet der giftigen Spinnen und Schlangen. Sie hatten nur den einen Wunsch: sich auszuruhen, Atem zu schöpfen und endlich einmal wieder Kräfte sammeln zu können.
Die Spanier hatten sich wohl aus dem unheimlichen und ihnen so gefährlichen Urwald zurückgezogen. Aber das bedeutete nicht viel. Vielleicht hofften sie, Hunger und Durst werde die Flüchtlinge an den Strand zurücktreiben, und sie brauchten die englischen Freibeuter nur wieder einzusammeln.
„Was sollen wir tun?“ fragte denn auch Old O‘Flynn.
Der Einbeinige sah zum Fürchten aus. Bisweilen hatten seine unermüdlichen Helfer ihn im Geschwindschritt und ziemlich rücksichtslos hinter sich hergeschleift, besonders wenn ihnen die Spanier zu dicht auf den Fersen gesessen hatten und der geringe Vorsprung beängstigend zusammengeschmolzen war. Jetzt war sein Körper von den Folgen solcher Brachialgewalt gezeichnet.
„Zunächst einmal werden wir unsere Ketten ablegen“, erwiderte Hasard gelassen. Die gewonnenen Scharmützel hatten sein Selbstbewußtsein verdoppelt und seine Hoffnung nicht unbeträchtlich erhöht, daß noch lange nicht alles verloren war.
„Vor allem werden wir Posten aufstellen, für den Fall, daß die Spanier immer noch nicht genug haben und einen neuen Vorstoß unternehmen“, fügte der Seewolf hinzu und teilte Wachen ein, um von den Spaniern nicht überrascht zu werden.
Danach senkte sich Stille über die Männer im Dschungel.
Der Rest des Tages und die Nacht verstrichen ohne weitere Zwischenfälle. Weder ließ sich ein Spanier blicken, noch störte sonst etwas die Nachtruhe der Erschöpften. Die Seewölfe schliefen auf dem blanken Boden, traumlos und schwer wie Tote. Da war keiner, dem nicht die Strapaze der wilden Flucht in den Knochen saß.
Bisweilen trat die Wache leise an einen Mann heran und weckte vorsichtig die Ablösung. Der Betroffene fuhr hoch und starrte verständnislos um sich. Blitzartig erinnerte er sich dann aber an alles, was er während des Schlafes für ein paar Stunden begraben hatte: sie steckten mitten im Urwald von Guayana, verloren wie ein Haufen Schiffbrüchiger, mit Ketten an den Händen, die allerdings weit genug waren, um die Bewegungen nicht allzu sehr zu behindern. Schließlich hatten sie Fronarbeit für die Spanier verrichten sollen.
Der nächste Posten zog auf, während sein Vorgänger fast fiel und auf der Stelle in einen totenähnlichen Schlaf versank.
Der Wachposten umrundete vorsichtig die Lagerstelle, eine winzige Lichtung in der grünen Hölle. Nur hier fiel ungehindert das Mondlicht ein, funkelten die Sterne.
Ein tröstlicher Anblick.
Denn nichts gab es sonst, was einem Hoffnung einflößen konnte. Die Lage war verzweifelt. Sie hatten sich weiter von der gestrandeten „Isabella“ entfernt als jemals zuvor. Die Aussichten, das Schiff wieder in Besitz zu nehmen, waren gering. Sie hatten keine Waffen.
Da blieb nur die Hoffnung auf einen Geistesblitz Hasards, der in so vielen gefährlichen Situationen bewiesen hatte, daß er nie mit seiner Weisheit am Ende war.
Der Posten, der jetzt zum ersten Male seit der Flucht den Hunger spürte, lehnte sich an einen Baumstamm. Alles hier war feucht und glitschig, ein betäubender Moschusgeruch ging von dem Holz aus.
Abstoßende Insekten schwirrten durch das Mondlicht und stießen einem ins Gesicht. Man sah keine Einzelheiten, und doch herrschte überall reges Leben. Viele Tiere im Dschungel erwachten erst jetzt und gingen auf Beute aus. Einmal erklang nahebei das heisere Fauchen eines gereizten Jaguars. Aber er folgte wohl einer anderen Spur. Vielleicht hatte er es auf einen Tapir abgesehen oder ein Pekari, eins jener gefährlichen, stets in Rudeln auftretenden Wildschweine, denen man eine ungeheure Angriffslust nachsagte.
Pete Ballie, Rudergänger der „Isabella“, bewachte den Schlaf seiner Gefährten. Aber er konnte nicht behaupten, daß er sich dabei wohl fühlte. Er vermißte die Weite des Meeres und eine frische Brise. Hier gab es nur den Geruch der Fäulnis und eine Wärme wie in einem Treibhaus, die einem die Luft abschnürte und jede Bewegung zur Qual werden ließ.
Noch einer fand keine Ruhe in jener Nacht: Smoky, der Decksälteste. Die Wunde, die er davongetragen hatte, war nicht lebensgefährlich. Auf dem Schiff, unter der Obhut des Kutschers, hätte er die Schramme leicht auskuriert. Aber hier im Dschungel stellten sich bedenkliche Folgen ein. Er kriegte Fieber.
Unruhig wälzte er sich hin und her, vorsichtig, um ja nicht an die verletzte Schulter zu stoßen. Die Wunde puckerte und arbeitete. Sie fühlte sich glühendheiß an.
Schweißnaß lag Smoky am Boden, todmüde und doch nicht in der Lage, ein Auge zu schließen.
Das Blut sang in seinen Ohren. Er richtete sich ein wenig auf. Stumm lauschte er in die Nacht.
Es waren nicht die Tierstimmen, sondern dieses dumpfe Pochen und Dröhnen, das er hörte. Merkwürdig! Als ob jemand eine Signaltrommel mit bloßen Händen bearbeitete.
Es war Smoky, als passe sich sein Herzschlag dem fremden Rhythmus an, als übernehme die Trommel die Führung. Sie bestimmte seinen Pulsschlag. Sie füllte seinen armen Kopf, der im Fieber glühte.
Fast wurde er süchtig nach diesem Klang. Er legte sich wieder zurück und nahm das Geräusch in sich auf wie eine Heilsbotschaft.
Langsam entspannte er sich.
Ferner und ferner klangen die Trommeln, die zu unbekannten Wesen sprachen, die irgendwo hier in der grünen Hölle hausten. Nicht drohend hörte sich der Ton an, sondern sanft, einschläfernd, von hypnotischem Zwang.
Smoky gelang es sogar, einzuschlafen. Sein Schlaf blieb flach und unruhig. Seine aufgewühlten Sinne tobten sich im Traum aus. Die Bilder hetzten einander. Es gab keinen Zusammenhang, keine Logik, nur Fieberphantasien.
Er sah sich selbst gefesselt in einer Pfahlbauhütte. Unter sich, durch das schadhafte Netzwerk des Schilfrohrbodens, konnte er deutlich den Fluß sehen, der stumm und kühl dahinströmte. Dabei hatte er entsetzlichen Durst. Aber er konnte nicht an das Wasser gelangen, weil etwas seine Hände zusammenschnürte.
Er kämpfte verzweifelt, denn er glaubte sich von aller Welt verlassen. Keine Menschenseele ließ sich blikken. Nur von Ferne, aus der Fieberhölle des dampfenden Dschungels, ertönte ganz leise der Wirbel einer Trommel.
Der Durst steigerte sich. Smoky glaubte zu ersticken.
Mit einem leisen Schrei fuhr er auf. Wild blickte er sich um. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte er, sein Angsttraum sei wahr geworden. Denn zuerst fiel sein Blick auf das grüne Dach der Baumkronen. Zwischen den Ästen und wild gezackten Palmblättern stahl sich bleiches Mondlicht. Ein Spinnengewebe, gegen den hellen Hintergrund, wirkte riesengroß und schien sich wie ein Fangnetz über Smoky zu legen.
„Bleib ruhig, Smoky! Es ist nichts“, flüsterte eine Stimme.
Pete Ballie beugte sich über den Decksältesten.
Smoky stöhnte, Er wischte sich den Schweiß vom Gesicht und sank ermattet zurück.
„Gib mir Wasser, Pete“, bettelte er.
„Wir haben keins.“
Smoky bäumte sich auf. Aus fieberglänzenden Augen starrte er auf seinen Gefährten.
„Hier glänzt alles vor Nässe und du sagst, wir haben nichts zu trinken, verdammt? Willst du mich verkohlen?“
„Schon gut, Smoky. Ich versuche, etwas aufzutreiben. Und bleibe ruhig, bis ich wieder da bin. Die anderen brauchen ihren Schlaf.“
Pete Ballie ging davon.
Merkwürdig, er bewegte sich völlig geräuschlos. Der weiche Waldboden schluckte jedes Geräusch. Nicht ein Ast brach unter seinem Fuß. Wie ein Wesen aus einer anderen Welt watete Ballie durch hüfthohes Farnkraut. Das Mondlicht trug nicht gerade dazu bei, die überhitzte Phantasie Smokys abzukühlen.
Er vergaß alles um sich her. Sein Blick verwirrte sich. Er führte stumme Selbstgespräche. Seine aufgesprungenen Lippen bewegten sich ständig. Die Hände zuckten durch die Luft und führten unkontrollierte Bewegungen aus.
Als Pete Ballie unvermittelt wieder im Blickfeld des Kranken auftauchte, hatte er sich erschreckend verändert. Seine Haare, hell, wirkten im direkten Licht des Mondes plötzlich wie eisgrau. Er schien um Jahre gealtert. Seine Kiefer bewegten sich knackend. Plötzlich grinste der Totenschädel. Smoky brüllte wie am Spieß.
Überall fuhren die Schläfer hoch. Wütender Protest und ungehaltenes Gemurmel ertönten.
Wer erkannte, daß es sich um Smoky handelte, der da geschrien hatte, sank sofort wieder zurück, drehte sich auf die andere Seite und wollte weiterschlafen. Hatte nicht Hasard befohlen, die Wache sei für das Wohlergehen des Verwundeten verantwortlich?
„Was hat er?“ fragte Hasard matt und rieb sich den Schlaf aus den Augen.
„Er will Wasser.“
„Wir haben keins.“
Auch Hasard begab sich wieder zur Ruhe.
Smoky hatte die vertraute Kommandostimme gehört. Dieses Urteil erschien ihm endgültig. Für ihn schien es ein Todesurteil. Er begann zu schluchzen.
„Wir werden alle in dieser grünen Hölle krepieren“, jammerte er.
Pete Ballie setzte sich neben ihn. Beruhigend legte er ihm die Hand auf die Schulter. Seine Kette klirrte leise bei dieser Bewegung.
„Bring mir doch Wasser. Ich verbrenne“, stöhnte Smoky. „Ich kann nicht mehr hoch. Manche Pflanzen saugen sich damit voll. Man muß sie nur abschlagen. Besorge mir was, Pete.“
Seufzend gab Pete Ballie nach.
Argwöhnisch beobachtete ihn Smoky. Er lag halb auf der Seite, den Oberkörper mit dem gesunden Arm abgestützt und hielt Blickverbindung. Er wollte nicht wieder den Anschluß an die Wirklichkeit verlieren. Sein Herz hämmerte wie rasend.
Pete Ballie suchte und suchte.
Plötzlich brüllte er wie am Spieß und wälzte sich am Boden.
Diesmal fuhr auch der letzte Schläfer hoch und sprang auf.
Sie stürzten zu Pete Ballie und halfen ihm, die Quälgeister loszuwerden. Pete Ballie hatte genau in das Kugelnest eines Volkes roter Feuerameisen gegriffen, als er zwischen zwei engstehenden Bäumen durchgeschlüpft war. Die Biester waren über ihn hergefallen und hatten sich mit ihren Kopfzangen überall im Fleisch festgebissen.
Für eine ganze Anzahl von Seewölfen bedeutete das ein paar Stunden Schlaf weniger. Keiner schloß sich aus. Pete Ballie war ein beliebter Mann. Jeder wollte ihm helfen.
Smoky blieb sich selbst überlassen.
Er taumelte hoch, rannte vorwärts, stolperte und blieb mit seiner Handschelle im Unterholz hängen. Dabei stieß er seine verletzte Schulter. Sein Schmerzensschrei alarmierte wiederum alle Männer.
„Himmel, Arsch und Zwirn!“ fluchte Ferris Tucker. „Kriegt man denn überhaupt keine Ruhe in diesem Tollhaus? Was denkt ihr, habe ich die vergangenen Stunden getan? In der Koje gelegen und mich verholt?“
„Du bist von der Teufelsinsel getürmt – wie wir alle“, erwiderte Dan naseweis.
„Bin ich das? Ist nichts Besonderes, wie? Habt ihr alle gemacht, oder? Mann, nachher, als ihr nur noch auf euren krummen Latschen durch den Urwald zu stolpern brauchtet, ihr Blindfische, habe ich einen Pfad durch den verdammten Dschungel geschlagen und mindestens zehn Pfund von den Rippen geschwitzt. Deshalb brauche ich jetzt Ruhe!“
Der rothaarige Riese stand wie ein wütender Büffel da, die riesige Axt in der Hand, die er gerettet hatte.
„Aber gut, wenn ihr mich nicht schlafen laßt, bin ich bereit, als aufrechter Christenmensch auch die andere Wange hinzuhalten: ich werde mich nützlich beschäftigen.“
„Indem du uns die Schädel einschlägst?“ stichelte Dan.
„Indem ich dir deine verdammten Fesseln abnehme“, brummte der Schiffszimmermann. „Besorg mir einen Stein.“
Ein paar Männer liefen los.
Sie alle waren heilfroh, endlich diese spanischen Armbänder loszuwerden, mit denen man sich zwar bewegen konnte, deren Manschetten einem aber ständig die Handgelenke aufscheuerten. Unter dem runden Eisen sammelte sich der Schweiß und reizte die Haut noch mehr.
Drei Mann schleppten einen brauchbaren Stein heran, der hart genug war, um als Unterlage zu dienen.
„Wer will noch mal, wer hat noch nicht?“ rief der Hüne und winkte einladend.
Nach und nach fand sich jeder ein und legte die gefesselten Hände auf den provisorischen Amboß.
„Wenn wir ein Feuer anzünden könnten, ginge alles viel schneller“, brummte Ferris Tucker.
Er hieb zu. Mächtig schwang er die Axt. Die Schneide zerspellte die Kette, die beide Manschetten verband. Soweit spielte jeder noch ungerührt mit. Es war keine Kunst, das Ziel zu treffen.
Aber dann folgte die Feinarbeit. Da wurde dem einen oder anderen schwummerig vor Augen. Er schloß sie lieber, als zu sehen, wie der Schiffszimmermann Maß nahm.
Der Schlag mußte genau die wie ein Lippenpaar vorspringenden Schäkel treffen, an denen die Kettenreste baumelten.
Selten genügte ein Hieb.
Sobald sich das Eisen bog, mußte der Delinquent die Hand drehen, damit Ferris Tucker es von der anderen Seite versuchen konnte. Zweimal unsanft verbogen, gaben die Eisenlamellen meist nach. Aber es gab auch hartnäckigere Fälle. Dann stoben die Funken.
Heller Hammerschlag klang durch den Urwald und vertrieb scheue Nachttiere aus der unmittelbaren Nachbarschaft des provisorischen Lagers.
Einige Langschläfer unter den Seewölfen, die es nicht besonders eilig zu haben schienen, die Ketten der Spanier loszuwerden, verzogen sich schimpfend und grummelnd ins Dikkicht.
Ferris Tucker arbeitete wie ein Berserker. Später löste ihn Big Old Shane ab.
Es dauerte Stunden, bis alle von den Handfesseln befreit waren.
Jeder spürte die Erleichterung, die Hände wieder frei bewegen zu können und die Gewichte los zu sein.
Nur an die Halseisen wagten sich Ferris Tucker und Big Old Shane nicht heran. Nicht mit einer Axt.
„Dazu brauche ich eine Zange“, sagte Big Old Shane bedauernd. „Diesen Schmuck müßt ihr noch eine Weile tragen. Es sei denn, ihr wollt beides gleichzeitig verlieren: die spanische Halskrause und euren Kopf.“
Gegen Morgen hatten sie es mit vereinten Kräften geschafft.
„Und jetzt?“ fragte Ferris Tucker, der bereits griesgrämig festgestellt hatte, daß die Schneide seiner geliebten Axt ruiniert war und Scharten aufwies, die selbst ein neuer Schliff nicht mehr völlig beseitigen würde.
„Wollen wir etwa immer weiter durch diesen lausigen Wald laufen?“ fragte Big Old Shane erbittert. „Soviel Land, wie ich in den letzten Stunden gesehen habe, möchte ich für den Rest meines Lebens nicht mehr betreten. Ich gehöre auf See.“
„Du sprichst uns aus der Seele. Wir müssen die ‚Isabella’ wiederhaben. Koste es, was es wolle“, erwiderte Hasard. „Ich habe nie geplant, ziellos durch den Urwald zu stolpern. So groß ist unsere Angst vor den Spaniern nun auch wieder nicht, oder?“
Höhnisches Gelächter wurde laut.