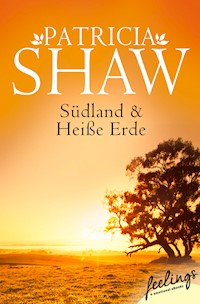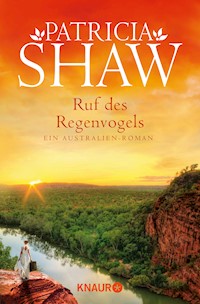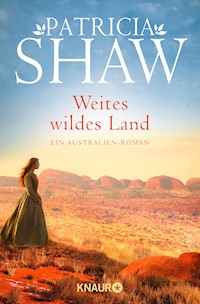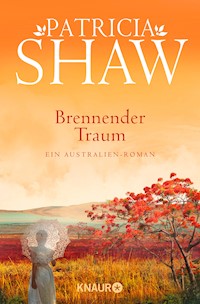6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Als Austin Broderick in den Westen Australiens zieht, um eine Schafzucht aufzubauen, wagt er nicht zu hoffen, dass er eines Tages ein gemachter Mann sein wird. Dreißig Jahre später ist Austin der stolze Besitzer von Springfield, einer der größten Schaffarmen des Kontinents. Doch sein Erfolg hatte einen hohen Preis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Ähnliche
Patricia Shaw
Sterne im Sand
Ein Australienroman
Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
»Sie kamen über den Hügelkamm dort drüben«, sagte er und deutete mit seinem Stock in die Richtung. »Ein ganzer Haufen Schwarzer, um die fünfzig Leute, alle in voller Kriegsbemalung und mit langen, ziemlich fies aussehenden Speeren. Hat uns ’nen ganz schönen Schrecken eingejagt, das können Sie mir glauben.
Kelly und ich zäunten gerade eine Koppel für unsere Pferde ein. Natürlich stand hier damals noch rein gar nichts, es war unsere erste Schafweide, und wir lebten in einer Blockhütte unten am Fluß, da, wo sich jetzt die Anlegestelle befindet. Wir hatten nur fünfhundert Schafe und einen alten Hirten namens Claude …«
»Aber wie sind Sie überhaupt in diese gefährliche Situation geraten?« wollte die Frau wissen.
»Land, meine Liebe, Land. Es gehörte niemandem, man brauchte einfach nur zuzugreifen. Wir trieben die Schafe von Brisbane aus einige hundert Meilen nach Westen, bis wir uns weit hinter dem bis dahin kartographierten Gebiet befanden. Nachdem wir diesen Fluß entdeckt und uns entschieden hatten, wo wir uns niederlassen wollten, steckten wir für den Anfang einige Meilen Land ab und zeichneten unsere eigenen Karten. Zunächst erschien es auch gar nicht gefährlich. Die Schwarzen waren eher neugierig als schwierig, blieben einfach an unserem Lager stehen und schauten uns an, als seien wir vom Mond gefallen. Wir gaben ihnen etwas von unserer Verpflegung ab, und sie machten sich davon. Dann entwickelten sie sich allmählich zu einer Plage, waren eine Spur zu freundlich, glaubten, sie könnten sich bei uns nach Herzenslust bedienen. Einerseits brachten sie uns Wildhonig, Nüsse und Fische, doch gleichzeitig machten sie sich mit unseren Sachen davon, Dingen, die wir dringend brauchten.«
»Diebe«, höhnte Reverend Billings. »Sind berüchtigt dafür.«
»Das würde ich nicht sagen!« gab Austin Broderick scharf zurück. »Es ist einfach Bestandteil ihrer Kultur, das Lebensnotwendige miteinander zu teilen.« Er lächelte. »Außer es geht um das Land ihres Stammes. Da verstehen sie überhaupt keinen Spaß. Offensichtlich haben wir jede einzelne ihrer Regeln gebrochen, doch was blieb uns anderes übrig? Wir warfen einen Blick auf dieses unendliche, ungenutzt daliegende Weideland und beschlossen, hier eine Schaffarm zu gründen. Irgendwann gelangten sie zu der Ansicht, wir hätten ihre Gastfreundschaft mißbraucht, und fingen an, unsere Schafe zu töten – nicht, um sie zu essen, sie schlachteten sie mutwillig ab. Auf unsere Drohungen reagierten sie mit ausdruckslosen Mienen. Selbst als wir ihnen zeigten, was Schußwaffen so alles anrichten können, änderte sich nichts; noch immer stießen wir auf tote Schafe.«
Er sah in die Ferne. »Sie hatten ein großes Lager an der Flußbiegung, ein paar Meilen von unserer Hütte entfernt. Eines Tages waren plötzlich alle Männer von dort verschwunden.«
»Auf Wanderschaft in den Busch gegangen?« erkundigte sich der Reverend.
»Nun … das behauptete zumindest Claude. Er kannte sich ganz gut aus im Busch, aber wie sich herausstellen sollte, hatte er die Sache doch unterschätzt. Wenige Tage später waren sie wieder da, tauchten in voller Kriegsbemalung mit hohem, gefiedertem Kopfputz auf dem Hügelkamm dort drüben auf.
Von uns aus gesehen wirkten sie, als seien sie drei Meter groß. Sie gaben keinen Laut von sich.
Obwohl es vierzig Jahre her ist, erinnere ich mich daran, als sei es gestern gewesen. Der Tag war etwa so wie dieser, heiß, glühend heiß, kein Lüftchen regte sich, und wir arbeiteten schwer. Alles war wie immer, der Busch mit seinen Geräuschen, der Geruch nach Schweiß und Staub, das ständige Zwitschern der Vögel, das Zirpen der Zikaden – und dann Stille. Totenstille, eine Art von unheilvoller Erwartung hing in der Luft.
Zunächst dachte ich an einen Raubvogel über uns, einen Adler oder Falken, doch dann berührte Kelly meinen Arm und deutete mit dem Kopf zum Hügelkamm.« Austin rieb sich den Nacken. »Ich spüre jetzt noch, wie mir damals die Haare zu Berge standen. Wir wußten, jeder Gedanke an Flucht war sinnlos, wir würden es nie bis zur Hütte oder zu den Pferden schaffen. Also legten wir ganz ruhig die Werkzeuge nieder und gingen langsam auf die Hütte zu, erwarteten jeden Moment einen wahren Speerregen auf unsere Rücken niedergehen. Doch nichts geschah. Als wir uns umdrehten, waren sie verschwunden. Wir sind vielleicht gerannt!«
»Alles Bluff, was?« Der Reverend verzog den Mund zu einem schwachen Lächeln. »Wollten nur Dampf ablassen.«
Austin Broderick fragte sich, weshalb er sich mit diesen Leuten, diesen verfluchten Missionaren, überhaupt abgab. Ohnehin war er nur mit ihnen spazierengegangen, weil seine Frau darauf bestanden hatte. Sie waren uneingeladen auf Springfield auftaucht, doch auf den großen Farmen galt Gastfreundschaft als das oberste Gebot. Jeder wurde aufgenommen, ohne Ansehen der Person oder seiner gesellschaftlichen Stellung. Also hatten auch Billings und seine Frau ein Anrecht darauf, daß man ihnen in seinem Haus höflich begegnete.
»Irgendwie schon«, antwortete er nur, denn er hatte das Interesse an seiner Erzählung verloren. Die dramatische Szene, deren Zeuge er geworden war, hatte in Wirklichkeit nämlich überhaupt nichts von einem Bluff gehabt, sollte vielmehr als Warnung dienen. Man hatte ihnen eine letzte Frist gesetzt.
»Da sieht man es wieder«, wandte sich Billings erklärend an seine Frau, »eine feige Rasse, falls man sie überhaupt als Rasse bezeichnen kann. Können es mit den weißen Männern in keiner Weise aufnehmen.«
»Sie können es mit Schußwaffen nicht aufnehmen«, erwiderte sein Gastgeber knapp. »Sie gaben uns Zeit, uns zu verziehen, doch wir nutzten sie nicht. Statt dessen verbarrikadierten wir uns mit Claude in der Hütte und luden unsere Gewehre. Sie griffen in jener Nacht an. Speere gegen Gewehre. Bevor sie den Rückzug antraten, hatte wir sechs von ihnen erschossen, unglücklicherweise Männer, mit denen wir befreundet gewesen waren. Dies entfachte einen Krieg mit ständigen Blitzüberfällen, der sich über Jahre hinzog, bis sie sich schließlich unterwerfen mußten. Doch zuvor übten sie furchtbare Rache. Wir holten mehr Männer und mehr Schafe her und bauten die Farm weiter aus, während sie uns plagten, wo sie nur konnten. So ging es einige Jahre.
Dann fand ich eines schrecklichen Tages meinen Kumpel Kelly, er hieß in Wirklichkeit Kelvin Halligan, draußen im Busch. Man hatte ihn mit fünf Speeren, die mit Honig beschmiert waren, um Bullenameisen anzulocken, an einen Baum genagelt. Gott sei seiner Seele gnädig. Danach rückten Truppen an, und das war dann das Ende.«
»Wie entsetzlich!« rief Mrs. Billings aus. »Diese wilden Bestien! Genau wie die Maoris bei uns zu Hause.«
»Und trotzdem lassen Sie es zu, daß Schwarze auf Ihrem Anwesen leben?« fragte Billings.
Austin sah ihn überrascht an. »Der Krieg ist vorüber.«
»Aber es sind noch immer Wilde, und sie leben wie Tiere. Ich habe ihr Lager gesehen.«
»Es sind die Letzten ihres Stammes. Sie in Frieden nach ihren alten Traditionen leben zu lassen ist das mindeste, was wir tun können.«
»Ihr Freund Kelly würde es vielleicht anders sehen.«
»Kelly gehörte einer anderen Zeit an«, erwiderte Austin ungeduldig. »Doch als echter Christ würde er ihnen wohl kaum noch grollen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Tennisplatz.« Er stapfte davon in Richtung Holzbrücke. Sie überspannte einen flachen Wasserlauf und führte zu einer weiten Rasenfläche, die das imposante Herrenhaus von Springfield umgab.
Bei dem Gedanken an Kelly fragte sich Austin, was sein verstorbener Partner wohl von diesem Anwesen gehalten hätte. Ursprünglich hatten sie zehn Quadratmeilen erstklassigen Landes am Fluß für sich abgesteckt. Dann waren sie aber tiefer ins Landesinnere vorgedrungen und hatten ihren Claim erweitert, indem sie Bäume niederbrannten und einen privaten Landvermesser kommen ließen, der die Gegend kartographierte, um drohenden Auseinandersetzungen mit künftigen Nachbarn vorzubeugen. Kurz bevor Kelly starb, hatten sie beschlossen, ihren Anspruch um weitere Ländereien am anderen Flußufer zu erweitern, damit ihrem Landvermesser nicht die Arbeit ausging.
»Verdammte Schande«, murmelte er vor sich hin. Die Springfield Station war Kellys Traum gewesen, nicht seiner. Sogar den Namen hatte er vorgeschlagen. Nun war Springfield berühmt und Herzstück eines Besitzes von über 300 000 Morgen Land, der in drei Abschnitte unterteilt war, um die Verwaltung zu vereinfachen.
Dem Unternehmen war weitaus mehr Erfolg beschieden, als er es sich je erträumt hätte. Die Pachtkosten waren minimal, da die damalige Regierung eifrig auf die Landerschließung bedacht gewesen war. Auf jedem Abschnitt weideten nun 60 000 Schafe. Doch die größte Bewunderung hätte Kelly dem Haus entgegengebracht. Was ihre Behausung betraf, hatten sich die beiden Männer von der Hütte zu einem langgestreckten Holzschuppen hochgearbeitet, den sie mit ihren Viehhütern teilten. Schuppen, Ställe und die Schmiede der sich selbst versorgenden Enklave schossen ringsherum aus dem Boden.
Etwa zu dieser Zeit war Kelly getötet worden. Springfield war noch primitiv, sie befanden sich noch in der Orientierungsphase, interessierten sich mehr für die kostbaren Schafe als für den Hausbau. Doch als der erste Wollscheck eintraf, hatten Austin und Kelly sich zwei Tage lang betrunken. Der Wollpreis war in astronomische Höhen geschossen, und plötzlich schwammen sie im Geld! Sie wußten genau, daß sie ihr Einkommen aufgrund des natürlichen Wachstums im folgenden Jahr verdoppeln oder verdreifachen konnten, wenn sie die fruchtbaren Weiden weiterbestückten. Genauso sollte es kommen, doch Kelly erlebte diese Entwicklung nicht mehr mit.
Austin baute sich dann ein Cottage, das seiner Stellung als Boß eher entsprach. Als er fünfzehn Jahre später mit einer gewissen Ehrfurcht begriff, daß er es zum Millionär gebracht hatte, verkündete er, er werde nun ein angemessenes Haus für sich errichten.
Inzwischen war er verheiratet und hatte drei kleine Söhne. Seine Frau Charlotte wirkte beunruhigt, als sie die von ihm gezeichneten Pläne sah: Pläne für ein wunderschönes Sandsteinhaus, auf einem Hügel gelegen, mit Empfangs-, Privat- und Gästezimmern und einem eigenen Flügel für den Hausherrn selbst, dessen Fenster nicht auf den Fluß, sondern auf das Tal hinausgingen, das er so liebte.
»Können wir uns das denn auch leisten?« fragte sie unglücklich.
»Das und noch mehr«, erwiderte er lachend.
»Aber es ist so groß, Austin …«
»Und wenn schon! Die Leute in Brisbane leben doch auch in solchen Häusern.«
»Du meinst wohl Villen. Wir brauchen hier draußen keine Villa. Es sind ganze vierzig Meilen bis zu unseren nächsten Nachbarn. Was sollen sie von uns denken?«
Er grinste. »So wie ich ihn kenne, wird Jock Walker es uns vermutlich gleichtun.«
Schließlich hatte Charlotte Gefallen an dem Haus gefunden und sich bei ihrem Kampf um makellose Ordnung in eine gestrenge Zuchtmeisterin verwandelt. Austin war froh, daß er seinen eigenen Flügel gebaut hatte, in dem er ungestört arbeiten konnte, wo er Zuflucht und Erholung fand, seine Stiefel abstreifen und liegenlassen konnte, wie es ihm gefiel. Kelly hätte dieses Haus geliebt – als sichtbaren Beweis dafür, daß er von Anfang an recht gehabt hatte.
Der Tennisplatz war von einem hohen Holzzaun umgeben.
»Klingt, als würde gerade gespielt«, sagte Austin am Tor zu seinen Gästen. »Das müssen Victor und Louisa sein. Möchten Sie zuschauen?«
Ihr entsetztes Stirnrunzeln erinnerte ihn daran, daß die Missionare dieses Spiel mißbilligten. Er drehte sich lächelnd um.
»Meine Schwiegertochter spielt recht gut. Manchmal, wenn sie ein bißchen zu schnell über den Platz flitzt, rutscht sie auf dem Gras aus und landet auf dem Allerwertesten. Wollen Sie wirklich nicht zusehen?«
»Nein, nein. Nein!« antworteten seine Gäste wie aus einem Munde und wandten sich ab.
Nachdem Austin das Ehepaar Billings im Gartensalon abgeliefert hatte, wo der Teetisch bereits gedeckt war, wollte er sich in seine Höhle zurückziehen, doch Charlotte fing ihn ab.
»Was hast du vor? Du willst dich wohl drücken.«
»Nein, ich habe zu tun. Würdest du Minnie bitten, mir Tee und Kuchen ins Büro zu bringen?«
»Wo sind Mr. und Mrs. Billings?«
»Ich habe für heute meine Pflicht getan. Sie warten schon auf den Tee. Werden mich nicht vermissen, solange genügend Essen auf dem Tisch steht. Sie fressen wie die Scheunendrescher.«
»Sei nicht so unfreundlich.«
»Wer ist hier unfreundlich? Du hast selbst gesagt, sie seien langweilig.« Er sah aus dem hohen Fenster am Ende des langen Flurs. »Da kommen die Tennischampions, sie werden für mich einspringen. Wo ist Teddy?«
Charlotte lächelte. Ihr Enkel war Austins Augapfel. Er liebte Teddy mehr als seine eigenen Söhne, verwöhnte ihn maßlos und verbrachte so viel Zeit mit ihm, daß seine Mutter sich beklagte, er unterminiere die elterliche Disziplin. Aber Louisa fand ja immer etwas, worüber sie sich beschweren konnte.
»Teddy ist bei Nioka, also laß ihn in Ruhe. Er spielt mit Bobbo und Jagga, ihrem kleinen Jungen.«
»Wer ist Bobbo?«
»Ach, Austin, das weißt du ganz genau. Minnies Sohn.«
Er grunzte. »Teddy wird bald besser Abo sprechen als Englisch.«
»Fang nicht wieder davon an. Nioka ist ein gutes Kindermädchen, und er hat nun mal keine anderen Spielgefährten in seinem Alter. Wenn es seine Mutter nicht stört, warum sollte es dich stören?«
»Seine Mutter? Sie will ihn doch nur bei sich haben, um ihn als Mädchen verkleiden zu können. Nicht einmal ein Pony gönnt sie ihm!«
»Sie hält ihn mit seinen sechs Jahren für zu jung dafür, das mußt du respektieren. Geh jetzt lieber in dein Büro. Der Postbote war da, zur Abwechslung mal eine Woche zu früh als eine Woche zu spät, wie sonst immer. Victor hat mit ihm gesprochen, weil er meint, wir sollten unsere Post einmal pro Woche anstatt nur alle vierzehn Tage zugestellt bekommen. Er hat die Briefe auf deinen Schreibtisch gelegt.«
Schon war er weg. Charlotte sah ihm nach – noch immer der kräftige Mann, in den sie sich vor so langer Zeit verliebt hatte. Das Licht, das durchs Fenster fiel, schmeichelte seiner Figur, ließ das zerzauste weiße Haar dunkler erscheinen und verbarg die leichte Beugung der Schultern. Sie liebte ihn, doch all diese schmerzhaften Jahre waren schwer zu ertragen gewesen. Als seine Frau war sie immer an zweiter Stelle gekommen, hinter all dem, was für ihn zählte. Und die Dinge, die für ihn zählten, nahmen kein Ende. Als ehrgeizigem Mann fehlte es ihm nie an Plänen und Projekten, die sich stets um die Vervollkommnung von Springfield drehten. Er mußte das schönste Haus haben; seine Schafe mußten Qualitäts-Merinos sein, seine Wolle erstklassig – und so ging es weiter, bis seine Söhne alt genug waren, auf Geheiß des Vaters das Vermögen der Brodericks zu mehren.
Charlotte ging in die Küche, überbrachte Minnie, dem schwarzen Hausmädchen, Austins Wunsch und trat mißgestimmt auf die Veranda hinaus. Austin war stets gut und freundlich zu ihr gewesen, und sie nahm an, daß er sie auch liebte, doch hatte es in ihrem gemeinsamen Leben nie echte Romantik gegeben. Sie bildeten eher eine Art Zweckgemeinschaft. Charlotte seufzte und versuchte sich einzureden, daß es albern sei, solchen Jungmädchenträumen nachzuhängen. Doch es tat weh zu wissen, daß er ihre Gegenwart von jeher als selbstverständlich hingenommen hatte.
»Selber schuld«, sagte sie sich. »Tief in deinem Herzen wußtest du, daß er dich nur aus Loyalität Kelly gegenüber geheiratet hat. Damals hat es dich nicht gestört. Du warst so hingerissen von ihm, so überwältigt, hast dich einfach hineingestürzt …«
Ihr eigener Vater hatte ihre Mutter so sehr geliebt, daß ihr Leben eine einzige Freude gewesen war. Bis zum Schluß hatte er seiner Frau den Hof gemacht. Charlotte hatte automatisch angenommen die gleiche Aufmerksamkeit von Austin zu erhalten, doch bisher hoffte sie vergebens darauf. Als ihre Mutter starb, folgte Mr. Halligan ihr bald ins Grab. Die Leute erzählten sich, er sei an gebrochenem Herzen gestorben. Charlotte duldete diese Erklärung nicht; sie wehrte sich entschlossen dagegen und beharrte darauf, daß er, wie auf dem Totenschein vermerkt, an Herzversagen gestorben war. Die andere Version war zu traurig, kam der Wahrheit zu nahe. Sie bezweifelte, daß Austin sich zu Tode grämen würde, wenn seine Frau ›den Zwang des Ird’schen‹ abschüttelte. Trotz ihrer gedrückten Stimmung huschte ein Lächeln über ihr Gesicht.
»Er wäre viel zu sehr damit beschäftigt, die prunkvollste Beerdigung der Welt zu arrangieren, wie es sich für die Herrin von Springfield geziemt«, murmelte sie.
»Wenn ich dann noch hier bin«, fügte sie im stillen hinzu. Sie hatte nämlich zuweilen bereits mit dem Gedanken gespielt, das Anwesen zu verlassen und nach Brisbane zu ziehen, um sich ein eigenes Leben aufzubauen, solange noch Zeit dafür war. Doch sie wußte, es würde immer nur ein schöner Traum bleiben. Wie könnte sie ihre anspruchsvolle Rolle als Hausherrin und Gastgeberin von Springfield auch aufgeben für eine kleine Behausung und die Freuden des Stadtlebens?
Sie hatte bereits einmal in Brisbane gelebt, und die Stadt hatte ihr zugesagt. Doch damals waren sie und ihr Bruder Kelly auch viel ärmer gewesen. Als ihr Vater starb, hatte Kelly darauf bestanden, daß sie Sydney verließ und mit ihm nach Queensland ging.
Ein ›Land voller Möglichkeiten‹ hatte er es genannt. Zunächst hatte es sich ihnen freilich anders präsentiert. Sie mieteten ein Haus im Süden von Brisbane und mußten ums Überleben kämpfen. Kelly übernahm Handlangerarbeiten und weigerte sich, die wenigen hundert Pfund anzutasten, die ihnen Paddy Halligan hinterlassen hatte.
»Das ist unser Notgroschen«, erklärte er. »Unser Fahrschein ins schöne Leben, wenn ich erst einmal die richtige Investitionsmöglichkeit gefunden habe.«
Jede Nacht studierte er die Karten der besiedelten Gebiete rund um Brisbane und schmiedete Pläne, die seiner Schwester schlicht und einfach wahnwitzig erschienen – bis er dann eines Tages einen zweiten Träumer namens Austin Broderick anschleppte. Er war gutaussehend, groß und blond, und seine blauen Augen leuchteten aufgeregt, als Kelly ihm seinen Vorschlag unterbreitete, Land im Westen zu pachten. Plötzlich erklärte Charlotte sich zur Überraschung ihres Bruders damit einverstanden.
Und dann waren sie weg. Sie hatte sich im Stall von ihnen verabschiedet, von wo aus sie mit ihren Packpferden aufbrachen. In Austins Gegenwart war es ihr zu peinlich gewesen, ihren Bruder darauf anzusprechen, daß er ihr nur sehr wenig Geld dagelassen hatte, gewiß nicht genug zum Leben. Bis zur letzten Minute hatte sie gehofft, er werde ihr noch ein paar Pfund zustecken, doch er küßte sie nur auf die Wange, tätschelte ihren Kopf, sprang aufs Pferd und ritt mit seinem neuen Partner davon.
Auf dem Heimweg sprach Charlotte in einer Stiefelfabrik vor und erhielt eine schlechtbezahlte, mühselige Arbeit an einer Maschine. Zudem konnte sie dort nur halbtags arbeiten. Kelly hatte fest versprochen zu schreiben, doch Charlotte gab nicht viel auf seine Worte, da er nie ein großer Briefeschreiber gewesen war. Und wenn die beiden nun tatsächlich die Grenzen der Zivilisation hinter sich ließen, wie sollten sie von dort Briefe schicken?
Sechs Monate später kehrte er in großem Stil heim, wie ein siegreicher Eroberer. Sie hatten es geschafft! Sie hatten ihr eigenes Land abgesteckt, wunderbares Weideland, so weit das Auge reichte, und nun würden sie ihr Glück machen.
»Wir werden reich sein, Lottie! Reich! Tut mir leid, daß du arbeiten gehen mußtest, aber es dauert nicht mehr lange und du wirst nie wieder einen Finger rühren müssen. Du kannst dann auf Springfield leben.«
»Warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen?« hatte sie gefragt und selbst in diesem Moment mit bangem Herzen an Austin gedacht, der bis dahin womöglich jemand anderen kennengelernt haben würde.
»Geht nicht. Wir leben ganz primitiv in einer Hütte. Wir sind jetzt nur in die Stadt gekommen, um noch mehr Schafe zu kaufen.«
»Wo willst du das Geld dafür hernehmen?«
»Wir haben noch ein bißchen Bargeld und nehmen ein Darlehen bei der Bank auf. Austin hat das arrangiert.«
Selbstsüchtig wie er war, hatte er für seine Schwester nur zehn Shilling übrig. Daher war sie wütend auf ihn, als er wieder aufbrach. Wie sollte sie auch wissen, daß sie ihren Bruder nie wiedersehen würde?
Sie erhielt zwei Briefe voller Versprechungen. Bald würde er sie nachkommen lassen. Bald. Charlotte suchte sich eine andere, weniger beschwerliche Arbeit in einer Hemdenfabrik. Als diese jedoch zum Jahresende den Betrieb einstellte, mußte sie an Kelly schreiben und ihn um Geld bitten. Energisch erinnerte sie ihn daran, daß sie bisher herzlich wenig von ihrem gemeinsamen Notgroschen gesehen hatte. Schließlich kam Austin nach Brisbane, umklammerte mit ernster Miene seinen Hut und überbrachte ihr stammelnd die schreckliche Nachricht. Mit Tränen in den Augen versuchte er sie zu trösten.
Charlotte war am Boden zerstört, vor allem als ihr einfiel, daß sie Kelly in ihrem letzten Brief getadelt hatte. Sie warf sich vor, nicht fest genug an ihn geglaubt zu haben, denn Austin berichtete, daß die Schaffarm Wirklichkeit geworden war und stetig an Bedeutung gewann.
Er nahm alles in die Hand, organisierte eine Totenmesse für Kelly und machte bei ihren wenigen Freunden die Runde. Charlotte war überrascht, als sie sah, wie viele ihr zum Teil unbekannte Menschen in die kleine Vorstadtkirche strömten. Sie hatte eine Messe mit jämmerlich kleiner Trauergemeinde erwartet, doch alles war so feierlich, daß sie erneut in Tränen ausbrach. Auf den Altarstufen lagen herrliche Blumen und Kränze. Ein Tenor sang mit wunderschöner Stimme Kirchenlieder, die sie eher an ihren Dad als an Kelly erinnerten. Der Geistliche sprach in aufrichtigem Ton von dem jungen Mann, der in der Blüte seiner Jugend aus dem Leben gerissen worden war, den kennenzulernen ihm leider nicht vergönnt gewesen sei und so weiter, doch Austin war es, der den größten Eindruck hinterließ.
Besser gesagt, er stahl dem Geistlichen die Schau, dachte sie später etwas zynisch. Damals war es ihr nicht bewußt geworden, dafür war sie viel zu überwältigt von seiner anrührenden Rede. Er stand neben der Kanzel und schilderte die Tapferkeit und Stärke seines Freundes und Partners, lobte Kellys Pioniergeist, stellte ihn als leuchtendes Beispiel für die jungen Männer seines Landes hin. Charlotte hörte Schluchzen in den Reihen hinter sich, denn Austin meinte jedes Wort ernst. Bisher hatte sie in ihrem eigenen Unglück gar nicht bemerkt, daß auch er litt. Kelly war sein bester Freund gewesen, der einzige Mensch, der sich mit ihm ins unbekannte Outback gewagt und nicht nur der Knochenarbeit, sondern auch den offensichtlich lauernden Gefahren gestellt hatte.
Die Demütigung folgte einige Tage später. Austin erklärte nüchtern, er habe ihren Brief an Kelly gelesen, in dem sie ihn um Geld bat.
»Ich kann dich nicht einfach hierlassen«, sagte er, ihre kläglichen Einwände beiseite wischend. »Kelly würde es mir nie verzeihen. Immerhin besitzt du einen Anteil an Springfield. Du mußt mitkommen.«
»Ist das nicht gefährlich?« fragte sie verzagt und hoffte gleichzeitig, daß er keinen Rückzieher machen würde. Doch angesichts des Todes von Kelly – bisher hatte sie nur erfahren, daß er vom Speer eines Schwarzen getötet worden war – schien diese Frage nicht unangemessen.
»Nein, ich werde schon auf dich aufpassen. Innerhalb der Grenzen der Hauptfarm bist du sicher. Doch du wirst die einzige weiße Frau dort draußen sein. Stört dich das?«
»Ich denke nicht, aber wo soll ich wohnen?«
»Ich baue ein Cottage. Ich kann sowieso nicht länger in den Arbeiterquartieren leben. Du kannst dort mit mir einziehen.«
Charlotte errötete. »Ich weiß nicht recht, Austin.«
Er stand auf, ging zur Tür des winzigen Wohnzimmers und blickte mit unverhohlener Verachtung auf die schäbige Straße mit den Arbeiterhäuschen hinaus. »Hier kannst du jedenfalls nicht bleiben. Das ist ganz ausgeschlossen. Kelly wollte nie, daß du auf Dauer hier lebst, er freute sich so darauf, dir Springfield zu zeigen.«
Sie schienen in eine Sackgasse geraten zu sein. Doch wie immer fand Austin einen Ausweg. »Schau mal, Charlotte, wir kommen doch gut miteinander aus. Und wie schon gesagt, ein Teil von Springfield gehört ohnehin dir. Ich kann verstehen, daß du es unziemlich findest, mit mir dort zu leben. Man sollte die Konventionen achten. Warum also heiraten wir nicht?«
Was war das eben gewesen? Heiraten? Vielleicht hatte sie ihn mißverstanden oder, schlimmer noch, ihre Tagträume von diesem Mann hatten dazu geführt, daß sie ihn nun schon das entscheidende Wort aussprechen hörte. Peinlich berührt eilte sie in die Küche, öffnete und schloß in Panik die Schubladen des Schrankes. Wie konnte sie antworten, wenn die Frage vielleicht nur Einbildung gewesen war?
Doch er kam ihr nach. »Was sagst du also?«
»Wozu?« fragte sie und konnte ihm dabei nicht ins Gesicht sehen.
»Zu unserer Heirat. Das heißt, falls du mich als annehmbar betrachtest. Ich weiß, ich bin nur ein Mann aus dem Busch, aber die Brodericks sind aus dem richtigen Holz geschnitzt …« Er lachte. »Von einigen Ganoven in früheren Generationen einmal abgesehen. Charlotte, ich werde dich nie im Stich lassen, das verspreche ich dir.«
Sie bekam eine Gänsehaut. Noch immer warnte sie eine innere Stimme, es könne nicht wirklich sein. Er zeige nur Mitleid mit ihr. Morgen wäre es vergessen, wie seine anderen impulsiven Gesten. Um ihr Gesicht zu wahren, entschied Charlotte sich dafür, ihm einen Korb zu geben; doch dann wollten die richtigen Worte einfach nicht kommen.
Statt dessen fragte sie: »Kommt das nicht ein bißchen plötzlich?«
»Ganz und gar nicht.« Sie war überwältigt von seinem Selbstvertrauen. »Ich habe schon seit Tagen daran gedacht. Du bist eine vortreffliche Frau, Charlotte, und es wäre mir eine Ehre, wenn du Mrs. Broderick würdest.«
Obwohl ihr Herz vor Freude hüpfte, wahrte sie noch einen Rest an Zurückhaltung. »Ich brauche Zeit zum Nachdenken.«
Als sie nach einigen Tagen seinen Antrag annahm, umarmte er sie, küßte sie auf die Wange und sagte: »Braves Mädchen. Springfield wird dir gefallen, ganz bestimmt.«
»Nun«, dachte sie auf dem Rückweg zum Teetisch, wo man sie bereits erwartete, »damit hat er ja zweifelsohne recht gehabt.« Springfield war damals unglaublich aufregend gewesen, und ihren Ehemann hatte sie geradezu vergöttert. Was sonst konnte sich ein Mädchen wünschen?
»Du und deine romantischen Vorstellungen«, schalt sie sich.
»Darüber müßtest du eigentlich längst hinaus sein.« Doch da war noch etwas anderes: ihr Anteil an Springfield. Auch den hatte er als selbstverständlich erachtet. Auf den erneuerten Pachtverträgen tauchte Kellys Name nicht mehr auf, und Charlotte hatte sich nie getraut, das Thema anzusprechen. Es wäre ihr so undankbar erschienen … Doch inzwischen konnte sie sich eines leisen Zweifels nicht erwehren, vor allem, wenn sie an ihre drei ehrgeizigen Söhne dachte.
Victor erhob sich, als seine Mutter eintrat, und zog ihren Stuhl zurück, damit sie Platz nehmen konnte. Der Reverend sah hoch, während er sich die heißen Scones dick mit Butter bestrich.
Victor mochte die Missionare nicht, vor allem nicht die Frau mit dem Gesicht einer Dörrpflaume, dem allzu gezierten Getue und der weinerlichen Stimme. Ihr Ehemann war ein dürrer, boshafter Kerl, der Gott in jede noch so triviale Unterhaltung einzuflechten wußte, als müsse er ständig seine Berufung unter Beweis stellen. Folglich betrachtete ihn jedermann im Haus als frömmelnden Langweiler.
»Ich hoffe, die Hitze macht Ihnen nichts aus«, sagte Charlotte zu Mrs. Billings, um überhaupt etwas zu sagen.
Der Reverend kam seiner Frau zuvor. »Gottes Wille, Mrs. Broderick. Wir betrachten diese geringfügigen Plagen als gottgesandt, um uns zu mahnen, daß wir alle nur Diener unseres Herrn sind. In einer solchen Umgebung, inmitten von Luxus, vergißt man rasch, daß diese Segnungen Geschenke Gottes und nicht von Dauer sind.«
»Sie können Springfield wohl kaum als nicht von Dauer bezeichnen«, warf Victor ein, ohne auf das Stirnrunzeln seiner Mutter zu achten.
»Das ganze Leben ist nicht von Dauer, Sir. Ich mußte zu meiner Enttäuschung entdecken, daß es hier keine Kapelle gibt. Ich frage mich, ob man Mr. Broderick dazu bringen könnte, eine zu errichten. Ich wäre gern bereit, wiederzukommen und den Ort zu segnen.«
»Mein Mann hat sich mit dem Gedanken an den Bau einer Kirche bereits befaßt«, erklärte Charlotte. »Allerdings herrschte unter den Geistlichen, die zu Besuch kamen, Uneinigkeit darüber, welcher Glaubensgemeinschaft diese Kirche gewidmet sein sollte. Ich bin katholisch, der Rest der Familie gehört der Kirche von England an …«
»Und unsere Leute hängen den verschiedensten Glaubensrichtungen an«, fügte Victor grinsend hinzu. »Versuchen Sie mal, dreißig Männer unter einen Hut zu bringen. Dürfte schwierig sein.«
»Das läßt sich ohne weiteres lösen. Unsere Kirche des Heiligen Wortes verbreitet nur die Wahrheit der Bibel. Keine andere Glaubensrichtung hält sich so streng an die Heilige Schrift wie die unsere. Ich finde, eine Kapelle des Heiligen Wortes wäre ein wunderbarer Anfang. Später könnte mein Bischof herkommen und sie als richtige Kirche einsegnen.«
»Oh, Gott, noch so einer«, stöhnte Louisa. »Der letzte Geistliche, ich glaube, er war Methodist, wollte hier auch schon eine Kirche für seine Herde errichten.«
»Sie sehen, wir stecken da in einem Dilemma«, sagte Victor.
»Das sehe ich ganz und gar nicht«, erwiderte der Reverend verstimmt.
»War Ihr Spaziergang interessant?« versuchte Charlotte das Thema zu wechseln.
»Sehr interessant«, entgegnete Mrs. Billings. »Wir sind durch den Garten in den Obstgarten und über die Brücke gelaufen. Mr. Broderick zeigte uns den Hügelkamm, an dem er von Wilden angegriffen worden war.«
»Nicht schon wieder«, stöhnte Victor. »›Sie kamen über den Hügelkamm dort drüben‹ … das ist seine Lieblingsgeschichte.«
»Aber sie entspricht doch sicher der Wahrheit.«
»Natürlich. Er könnte ein Buch darüber schreiben.«
»Dann bin ich der Ansicht, daß es unglaublich mutig von Mr. Broderick war, sich in diesem gefährlichen Land niederzulassen. Gott sei Dank wurden die Wilden besiegt. Das hoffe ich zumindest.«
»Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, Mrs. Broderick«, ergriff der Reverend wieder das Wort. »Wir haben hier Eingeborene gesehen, die unbekleidet umherliefen, ein überaus empörender Zustand, und wir hoffen …«
Charlotte setzte erstaunt ihre Teetasse ab. »Doch nicht etwa beim Haus?«
»Nein, in einem abscheulichen Lager am Fluß.«
»Aber das ist doch meilenweit entfernt!« sagte Louisa. »Sind Sie so weit gelaufen?«
»Da wir es als unsere Pflicht betrachteten, diese Leute in Augenschein zu nehmen, sind wir zwei der Hausmädchen gefolgt.«
»Das ist schon in Ordnung«, sagte Charlotte erleichtert.
»Wir sorgen dafür, daß alle Schwarzen, die in die Wohn- oder Arbeitsbereiche kommen, bekleidet sind. Für die Männer, die als Viehhüter für uns arbeiten, liegen Hosen und Hemden bereit, die Hausmädchen erhalten Kleider. Für die übrigen Stammesangehörigen können sie auch etwas aussuchen und mitnehmen, doch die meisten legen keinen Wert darauf. Um die Kinder machen wir uns ohnehin keine Gedanken, sie laufen immer nackt herum …«
»Aber das ist falsch!« erwiderte Mrs. Billings. »Das darf nicht sein. Die Bibel sagt …«
»Die Bibel ist nicht zuständig für unsere Aborigines«, lachte Victor. »Sie werden nicht einmal darin erwähnt.«
»Es steht Ihnen nicht zu, darüber Witze zu machen«, gab der Reverend pikiert zurück. »Meine Frau war jedenfalls schockiert. Die meisten Eingeborenen hatten kaum etwas am Leib. Das können Sie nicht dulden. Sie leben wie die Tiere.«
»Sie leben so, wie sie seit Tausenden von Jahren gelebt haben, Mr. Billings«, erwiderte Charlotte betont ruhig. »Damals hatte man noch nicht einmal von der Bibel gehört. Gott muß ihnen gewogen gewesen sein, denn er schenkte ihnen ein wunderbares Land, das ihnen ganz allein gehörte. Allerdings scheint mir, daß er sie in letzter Zeit ein wenig im Stich gelassen hat.«
Victor lächelte. Er wußte, daß der Reverend und seine Frau nach wie vor nicht überzeugt waren, doch immerhin hatte Charlotte sie fürs erste zum Schweigen gebracht. Aber noch länger hielt er das nicht aus. Er verzichtete auf ein weiteres Stück Obstkuchen, nur um aufstehen und die Gäste der Gesellschaft der Frauen überlassen zu können.
»Narren, die sich in alles einmischen müssen«, murmelte er auf dem Weg zu den Scherschuppen. Er selbst hatte die beiden durch die Schuppen geführt, die für die bevorstehende Ankunft der Scherer geöffnet worden waren. Zusammen mit den Merino-Zuchtwiddern waren sie Victors ganzer Stolz. Sein Vater hatte sie entworfen und sich dabei an den riesigen Wollschuppen eines Freundes aus den Darling Downs orientiert. Die Gebäude waren jeweils einhundert Meter lang und faßten an die 2 000 Schafe. Das Innere hatte die Besucher überrascht. In jedem Schuppen gab es in der Mitte ein Band, auf dem Vliese und Ballen transportiert wurden, und zweiundfünfzig Arbeitsplätze für die Scherer.
»Im vergangenen Jahr schoren hier vierundfünfzig Scherer zweihunderttausend Schafe«, hatte er Billings stolz berichtet.
»Sie haben fünfzehn Wochen gebraucht, eine reife Leistung.«
Billings war wenig beeindruckt. »Und Sie haben deswegen kein schlechtes Gewissen?«
»Schlechtes Gewissen? Wieso sollte ich?«
»Sie müssen viel Land besitzen, um so viele Schafe halten zu können. Finden Sie das gerecht? Der Herr könnte Leute wie Sie für gierig erachten, weil Sie so viel haben, während andere Männer händeringend nach urbarem Land suchen.«
»Der Herr hat nichts damit zu tun. Mein Vater hat sich diese Weiden hart erarbeitet, ihm steht jeder einzelne Morgen davon zu.«
Der Reverend kratzte sich am Kinn und warf Victor einen gönnerhaften Blick zu. »Offensichtlich nehmen Sie sich nicht zu Herzen, was in Amerika geschehen ist. Die Rancher in den weiten Ebenen dort wurden alsbald von Horden vorrückender Siedler überrannt. Man sagt, das gleiche werde auch hier geschehen.«
»Da liegen Sie falsch. Die großen Schaffarmen wird man nicht so leicht zerstören können.«
»Ich halte es für unvermeidlich«, murmelte Billings, und Victor ließ ihm das letzte Wort. Er klärte ihn nicht darüber auf, welche Schritte bereits unternommen worden waren, um eine derartige Katastrophe zu verhindern. Die australischen Großgrundbesitzer, Squatter genannt, stellten einen Machtfaktor dar, eine geschlossene Gesellschaft, die durch gemeinsame Interessen zusammengeschmiedet worden war. Durch Bestallungen und familiäre Bindungen nahmen sie Einfluß auf Rechtsprechung wie Politik und waren für jede Schlacht um ihre ungeheuren Besitzungen gerüstet.
»Uns wird das nicht passieren«, wiederholte Victor bei sich und ließ seinen Blick durch die untadeligen Schuppen schweifen. Sie waren bereit für die Schur. Die Scherer würden in der kommenden Woche eintreffen.
Er lehnte sich an ein Holzgeländer und zündete sich eine Zigarette an. Seine Gedanken kehrten zu Billings zurück. Wie dreist von diesem Mann, ihre Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen, in angenehmer Umgebung mit den Damen zu plaudern und dabei die ganze Zeit seinen Gastgebern ihren Erfolg zu neiden. Vielleicht war er ja ein Spion. Nein, dafür war er viel zu dumm.
Dennoch blieben hartnäckige Bedenken. Offensichtlich plapperte Billings nur Dinge nach, die er in Brisbane oder den Städten im Landesinneren aufgeschnappt hatte. Es war allgemein bekannt, daß Siedler, die sogenannten Selectors, im ganzen Land ausschwärmten. Sie verlangten, sich ein beliebiges Stück Kronland zum Zwecke des Ackerbaus aussuchen und käuflich erwerben zu dürfen, auch wenn es bereits Teil der von Squattern gepachteten Besitzungen war. Von sozialistischen Subjekten aufgestachelt, stimmten ihnen einige Regierungsmitglieder sogar zu. Die neuen Landvergabegesetze waren bereits dem Parlament vorgelegt, bisher aber abgeschmettert worden.
Austin plante für die Zukunft voraus. Er hatte drei Söhne, die alle strategisch geschickt plaziert wurden. Victor wurde zu seiner rechten Hand auf Springfield gemacht. Harry, der mittlere, hatte aufgrund der Verbindungen seines Vaters einen sicheren Abgeordnetensitz im Parlament als Vertreter der Regierungspartei ergattert. Außerdem war er eine passende Ehe mit der Tochter von Oberrichter Walker eingegangen.
Und dann war da noch Rupert. Er war erst zwanzig und jahrelang fortgewesen, auf einem Internat. Nach seiner Rückkehr widersetzte er sich dem Wunsch seines Vaters, Jura zu studieren. Es hatte hitzige Auseinandersetzungen deswegen gegeben, bis Austin eine bessere Idee gekommen war. Angesichts des Landvergabegesetzes, das wie ein Damoklesschwert über ihnen hing, konnte eine zweite Stimme im Parlament gewiß nicht schaden. Ohne Rupe zu fragen, war sein Vater vorgeprescht und hatte ein Abkommen mit einem Politiker getroffen, der in den Ruhestand ging und dessen Sitz Rupe praktisch erben sollte. Der Premier hatte es auch schon abgesegnet, und so verkündete Austin eines Abends beim Essen Rupes leuchtende Zukunft.
Sein Sohn hatte wütend reagiert. »Ich gehe nicht in dieses verdammte Parlament. Hier gibt es genug zu tun. Ich übernehme die Zuchtwidder von Victor. Und wenn ich hier nicht arbeiten darf, verschaffe ich mir eben meine eigene Weide.«
Victor hatte sich aus den Kämpfen herausgehalten. Sie gingen ihn nichts an, er wollte nur mit seiner eigenen Arbeit vorankommen. Zudem hatte er in letzter Zeit Probleme mit Louisa. Allmählich begann sie sich auf Springfield zu langweilen … Er drückte die Zigarette aus und schnippte die Kippe weg. »Da kann man nichts machen. Es ist nun mal unser Zuhause, und wir bleiben hier.«
Manchmal überlegte Austin, ob es nicht ein Fehler gewesen war, die unteren Zimmer mit Zedernholz zu täfeln. Das Ergebnis war dunkler ausgefallen als erwartet. Victor hatte jedoch darauf hingewiesen, daß die Räume groß und hoch genug waren, den dunklen Ton zu vertragen. Die Holztäfelung in seinem eigenen Flügel jedoch hatte ihm von Anfang an gefallen; sie eignete sich vorzüglich für die Räume eines Gentleman. Er besaß sein eigenes Büro und ein langgestrecktes Zimmer, das im Stil eines Herrenclubs eingerichtet war: Es gab bequeme Ledersessel, einen Billard- und einen Kartentisch; über den Kaminsimsen hingen Fotos seiner preisgekrönten Merinos und die Medaillen, die sie gewonnen hatten.
Er trat auf die Veranda, zufrieden, den Frömmlern entkommen zu sein. Er reckte die Arme und machte einige Atemübungen, da er in letzter Zeit ein wenig kurzatmig geworden war. Helle Wolken zogen über den Hügeln jenseits des Tales dahin, doch er wußte aus Erfahrung, daß sie keinen Regen brachten. Nicht ein Tropfen würde auf das ausgedörrte Land fallen. Er schnüffelte … noch keine Anzeichen für Buschbrände.
»Vielleicht bleiben sie uns dieses Jahr erspart«, sagte er.
»Letztes Jahr war es schlimm genug.«
Mit dem üblichen breiten Grinsen brachte Minnie ihm den Tee auf einem Tablett herein. Sie war ein fröhliches Mädchen um die Zwanzig, das seit vielen Jahren als Hausmädchen auf Springfield arbeitete.
»Missus sagt, Sie auch mögen Kuchen, Boß.«
»Ja. Vielen Dank, Minnie. Wie geht es den Schwarzen unten im Lager? Fangen sie auch genügend Fische?«
»Mondzeit«, erwiderte sie nickend. »Fischen jetzt gut.«
»Dachte ich mir. Sag den Jungs, sie sollen dem Boß einen schönen dicken Fisch heraufschicken, ja?«
Sie kicherte. »Ich sag ihnen.« Sie wandte sich zur Tür und hielt dann nervös inne. »Boß … Familien unten ärgerlich wegen Bedeute. Stecken Nase rein, sollen weggehen.«
Austin goß sich Tee ein. »Sag ihnen, sie sollen sie nicht weiter beachten. Der Reverend und seine Missus werden bald weg sein.«
»Aha.«
Als sie gegangen war, mußte er lachen. »Betleute! Das ist wirklich gut.«
Er nahm eine Zeitung von dem frisch angelieferten Poststapel und las sie aufmerksam durch, während er seinen Kuchen aß. Stirnrunzelnd studierte er einen Artikel über das verfluchte Landvergabegesetz, das nach einer Reihe von Abänderungen erneut dem Parlament vorgelegt worden war. Der Verfasser stand offensichtlich auf der Seite derer, die die Agrarindustrie unterminieren wollten. Er war der Ansicht, jedem hergelaufenen Trottel oder Landarbeiter sollte es erlaubt sein, sich ein Stück aus dem Eigentum seines Arbeitgebers herauszuschneiden. Der Leitartikel hingegen bezeichnete die großen Schaffarmen als Rückgrat des Landes, verdammte diese schändliche Bewegung, die den Ruin der Wollindustrie bedeuten würde, und warnte vor den Gefahren für die Wirtschaft des Landes.
»Recht hat er«, schnappte Austin. »Aber warum läßt er dann den anderen Typen diesen sozialistischen Unsinn verzapfen? Ich will, daß der Kerl gefeuert wird. Bernie Willoughby kriegt einen persönlichen Brief von mir, der wird ihm die Augen öffnen. Es bringt nichts, wenn er als Herausgeber eine Meinung vertritt und seine Leute ein paar Seiten weiter eine ganz andere.«
Wütend blätterte er weiter zu den Leserbriefen. Drei Verfasser unterstützten die Reform der Landvergabegesetze und drängten die Siedler, ihre Landansprüche umgehend geltend zu machen, bevor ihnen die gierigen Squatter die besten Gebiete wegschnappten.
Verblüfft versuchte Austin dies zu verdauen. Was sollte das heißen? Weshalb sollten sich Squatter wie er ihr eigenes Land schnappen? Sie waren bereits die rechtmäßigen Besitzer und konnten wasserdichte Pachtverträge vorweisen.
Er eilte in sein Büro und holte die dünnen Seiten des VII. Landvergabegesetzes hervor, die ihm Harry geschickt hatte. Der Wortlaut klang verwirrend, war vollgepfropft mit den üblichen geschraubten Wendungen wie »in dem Sinne, daß« oder »wohingegen«, offensichtlich in der Absicht, jeden geistig gesunden Leser um den Verstand zu bringen. Im Glauben, er kenne den Inhalt bereits, hatte Austin sich nicht die Mühe gemacht, das Gesetz aufmerksam zu studieren. Er hatte gedacht, es ginge darum, daß die Siedler auf Besitzungen wie Springfield auftauchen, ein Stück des Landes beanspruchen und von den Squattern den Verkauf dieser Claims verlangen konnten.
Doch beim Durchgehen des Wortsalats wurde ihm klar, daß der Sachverhalt völlig anders lag. Diese Gesetze bedeuteten, daß die Squatter ihr gesamtes Land von Pacht- in freien Grundbesitz umwandeln mußten, indem sie es der Regierung abkauften. Ansonsten fiele das gepachtete Land an die Regierung zurück und könnte somit an die Siedler weiterverkauft werden.
»Das ist doch Wahnsinn!« rief er aus und klopfte auf den Schreibtisch. »Wie könnte ich dieses ganze Land Morgen für Morgen kaufen? Es heißt, der aktuelle Preis liege bei einem Pfund pro Morgen. Ich müßte mehr als eine Viertelmillion Pfund aufbringen, nur um Land zu kaufen, das mir bereits gehört. Das würde mir den Hals brechen! Ein Haufen verfluchter Narren sind sie, aber ich falle nicht auf sie herein!«
Er stürmte auf die Veranda hinaus und rief einem vorbeigehenden Hilfsarbeiter zu, er solle Victor zu ihm schicken.
»Sofort!« setzte er hinzu. »Auf der Stelle!«
Victor hatte gerade die Ställe betreten, als ihn der Befehl seines Vaters in Gestalt seines Überbringers Joe Mahoney erreichte.
»Liegt er im Sterben?« fragte er Joe. Dieser zwinkerte. »Sah nicht danach aus.«
»Dann kann er noch einen Augenblick warten. Schauen wir erst mal nach der Stute.« Um seiner Frau eine Freude zu machen, hatte Victor sich auf die Tennispartie mit ihr eingelassen, obwohl sie seinen gesamten Zeitplan durcheinanderbrachte. Und als er ein paar Minuten zu spät auf dem Platz eintraf, mußte Louisa ihm auch noch vorwerfen, daß er keine weiße Tenniskleidung trug. Das war ihre neueste Marotte.
»Verdammte Tenniskleidung«, schnaubte er jetzt, als er an den Streit zurückdachte, der darüber zwischen ihnen entbrannt war. Was würde als nächstes kommen?
Die kastanienbraune Stute fohlte. Sie lag in ihrem Stall und sah sie mit ängstlichen, feuchten Augen an.
»Es wird alles gut, Mädchen«, sagte er und trat näher, um sie zu untersuchen. »Bald ist es soweit, Joe. Du bleibst besser bei ihr.«
»Klar, Vic. Ich laß dich rufen, wenn sich was tut.«
»In Ordnung.«
Obwohl er kein Veterinär war, besaß Victor Erfahrung auf diesem Gebiet. Mit achtzehn hatte ihn sein Vater für ein Jahr nach Brisbane geschickt, als Lehrling eines Tierarztes. Die Arbeit hatte ihm Spaß gemacht, doch sein praktisch veranlagter Vater ließ es nicht dabei bewenden. In der Annahme, Victor habe noch genug freie Zeit übrig, und weil ihm jegliche Zeitverschwendung zuwider war, hatte er ihn zudem für einen Buchhaltungskurs angemeldet. Victor war verärgert gewesen angesichts dieser Doppelbelastung, vor allem, da ihm die Buchhaltung alles andere als leicht fiel. Aber Austin war der Boß und ließ nicht mit sich reden. Er würde am Ende des Jahres ein Buchhaltungsdiplom mitbringen oder eben so lange dort bleiben, bis er es vorweisen konnte. Das Jahr war anstrengend gewesen, doch Victor hatte den Kurs auf Anhieb geschafft und durfte zu einem stolzen Vater heimkehren. Heute war er dankbar, daß Austin auf dieser Ausbildung bestanden hatte. Die Kenntnisse hatten sich für seine Arbeit auf Springfield als unschätzbarer Vorteil erwiesen, und er hatte sie stetig erweitert, indem er Bücher über Viehzucht las, die ihm der befreundete Veterinär aus Brisbane schickte.
Nun mußte er nur noch die Unterkünfte der Scherer inspizieren. Zwei schwarze Hausmädchen waren gerade dabei, die Schuppen zu öffnen und die Schlafstellen zu lüften.
»Paar von diese Matratzen nicht mehr gut«, beklagte sich eines der Mädchen bei ihm und deutete auf ein besonders mitgenommen aussehendes Exemplar, aus dem bereits das Roßhaar hervorquoll.
»Holt neue aus dem Lager«, wies er sie an. »Diese Schuppen müssen blitzsauber sein, sonst werden die Scherer ungemütlich. Und wenn sie kommen, haltet ihr Mädchen euch von ihnen fern. Verstanden?«
»Ja, Boß«, flüsterten sie, als könnten die fremden Männer sie hören. Die Zeit der Schafschur, in der so viele Fremde die Farm bevölkerten, war immer aufregend. Problematisch wurde es nur, wenn die Scherer etwas mit den schwarzen Frauen anfingen.
Auf dem Rückweg zum Haus schlug Victor einen langen, von Pfefferbäumen gesäumten Pfad ein. Das Laub raschelte in der leichten Brise, die eine kühlere Nacht versprach. Das würde auch der Stute die Sache leichter machen.
»Der frühen Hitze nach zu urteilen, haben wir einen langen, heißen Sommer vor uns«, sagte er sich.
Der Pfad teilte sich. Links ging es zum Haus, geradeaus gelangte man nach einer halben Meile über offenes Land zum Haupttor. Das Haus und die Nebengebäude waren eingezäunt, doch von wenigen Koppeln abgesehen, wies der riesige Besitz keine Umzäunungen auf, was Victor einiges Kopfzerbrechen bereitete. Es gab zwei Außenposten, auf denen Aufseher lebten, ihre eigenen Bereiche des Springfield-Besitzes leiteten und Victor regelmäßig Bericht erstatteten. Irgendwann einmal mußten die Grenzen jedoch genauer festgelegt werden. Ihn schauderte bei dem Gedanken an die schwindelerregenden Kosten, die das Einzäunen verursachen würde. Doch so, wie es jetzt war, konnte es nicht bleiben. Nicht umsonst beschwerte sich ihr Nachbar Jock Walker andauernd, daß Austins Grenzen ›Beine hätten‹.
Victor grinste. Vermutlich hatte er recht. Austin scheute nicht davor zurück, sich noch ein paar zusätzliche Meilen Weideland unter den Nagel zu reißen, wenn er damit durchkam. Seine Gier nach Land war nach wie vor unersättlich.
Er überquerte einen Rasen, trat über ein Blumenbeet und sprang über das Geländer an der Veranda seines Vaters. Offiziell hieß dieser Teil des Hauses Dads Flügel, doch die Brüder bezeichneten ihn als seine Höhle. Ein wunderbarer Zufluchtsort für Austin und seine Kumpel, aber eine Gefahrenzone für seine Söhne, die nur zu genau wußten, was die Uhr geschlagen hatte, wenn sie in die Höhle des Löwen vorgeladen wurden.
»Was gibt’s?« fragte Victor fröhlich.
»Du hast dir aber ganz schön Zeit gelassen!« brüllte Austin.
»Hast du die Zeitungen gelesen?«
»Wie könnte ich? Sie sind doch gerade erst eingetroffen.«
»Nun, es würde dir nicht schaden, wenn du mal deine Nase hineinstecken würdest, damit es nicht immer an mir hängenbleibt. Du willst mein Verwalter sein und hast anscheinend keine Ahnung, was vorgeht.« Er knallte eine der Zeitungen auf den Kartentisch und deutete mit einem schwieligen Finger auf die Seite, an der er Anstoß nahm. »Lies das! Bei Gott, ich werde ein Wörtchen mit Bernie zu reden haben. So einen Schwachsinn in seinem Blatt abzudrucken! Verstehst du, worauf die hinauswollen? Wir sollen unser eigenes Pachtland kaufen.«
Victor überflog den Artikel kurz. »Das wollte ich dir schon die ganze Zeit über klarmachen.«
»Davon war nie die Rede! Du hast nur gesagt, diese verdammten Siedler stünden Schlange, um ein Stück von meinem Land zu kaufen!«
»Das stimmt ja auch. Sie wollen es von der Regierung erwerben, wenn wir es nicht tun. Doch es gibt keinen Grund zur Panik. Die Landvergabegesetze werden niemals verabschiedet.«
Austins Gesicht war flammend rot, sein weißes Haar sträubte sich. »Von wegen, ich soll nicht in Panik geraten, du verdammter Grünschnabel! Ich möchte nicht wissen, was aus Springfield wird, wenn ich es Leuten wie dir überlasse. Ich will, daß auf der Stelle etwas dagegen unternommen wird!«
Victor seufzte. »Man unternimmt doch schon etwas. Die Siedler können erst Ansprüche anmelden, wenn die Gesetze verabschiedet sind. Harry hat die Sache im Griff. Sie werden die Gesetzesvorlage bis zum Jüngsten Gericht verschleppen mit ihren diversen Änderungsanträgen. Das hat er dir doch letzte Woche geschrieben.«
»Harry ist ein verdammter Leichtfuß, das weißt du doch! Stolziert in Brisbane herum, als sei er ein Gottesgeschenk an die Gesellschaft. Und dazu noch sein verwöhntes Frauenzimmer! Ich muß von Sinnen gewesen sein, als ich glaubte, er könne uns dort nützlich sein. Ich sollte Rupe hinschicken. So etwas wie ihn brauchen sie im Parlament, blutdürstige, sture Kerle, die pausenlos um sich treten.«
Victor nahm eine von Minnie gerollte Zigarette aus der Dose, zündete sie an und rauchte lässig, während sein Vater tobte. Es war immer dasselbe. Rupe und Austin gerieten bei jeder Gelegenheit aneinander, doch seinen Brüdern wurde Rupe wie ein Heiliger vorgehalten, wie ein junger Austin Broderick, was er keineswegs war. Sicher, Harry war als Politiker nicht gerade ein Volltreffer, doch Victor mißbilligte die Haltung seines Vaters. Er selbst war ein hervorragender Verwalter, das wußte er genau, doch von seinem Vater hatte er stets nur Kritik und Häme geerntet. Es war schwer genug, eine Farm dieser Größe mit all ihren Problemen zu leiten. Nicht zuletzt die Bewohner – Familie, Stammesangehörige, Mitarbeiter und aufgeblasene Besucher – galt es im Zaum zu halten. Da brauchte man nicht auch noch einen Vater, der einem bei jeder Gelegenheit in die Quere kam und ausdrückliche Anweisungen ignorierte. Ignorierte? dachte Victor zornig, das ist ein typischer Harry-Ausdruck. Genau das würde Harry sagen, verdammt noch mal! Austin ignoriert nicht nur, er schmeißt die Anweisungen eigenmächtig um. Läßt mich vor den Männern wie ein Idiot dastehen. Verschiebt andauernd die Grenzen, so wie er es mit Jock Walker und allen anderen auch macht.
Es war Charlottes Idee gewesen, Austin solle sich zurückziehen und Victor die Leitung der Farm überlassen. Mit ihrer sanften, schmeichlerischen Art hatte sie dem alten Mann das Gefühl vermittelt, er selbst habe diese Entscheidung getroffen. Vor seinen Freunden hatte er sich mit seinem Ruhestand gebrüstet. Schmiß eine Party, die drei Tage dauerte und auf der er den Rückzug von Austin Gaunt Broderick ins Privatleben verkündete, der die Zügel an die nachfolgende Generation übergab. Jede Zeitung in Queensland, ja sogar der Sydney Morning Herald, hatte pflichtschuldig darüber berichtet. Es war eine tolle Zeit gewesen, die jedoch mit dem Aufbruch des letzten Gastes ihr jähes Ende gefunden hatte. Victor hatte auf Springfield nach wie vor nicht mehr zu sagen als Minnie in der Küche, wo sie seit Jahren unter der Fuchtel der Köchin Hannah stand.
»Hörst du mir überhaupt zu?« knurrte Austin. »Ist dir schon einmal in den Sinn gekommen, daß wenn diese verdammten Landvergabegesetze durchkommen …«
»Das können sie gar nicht«, beharrte Victor.
»Das ist doch alles nur eine Frage von Zahlen, du Idiot! Politiker sind käuflich. Ein paar von denen, die auf unserer Seite sind, könnten krank werden. Oder den Aufruf verpassen. Und was geschieht dann? Schwachköpfe wie Harry sitzen da und gucken dumm aus der Wäsche. Besiegt! Es braucht nur eine einzige Abstimmung!«
Victor schüttelte den Kopf. »Unmöglich. Du vergißt, daß die halbe Opposition auf unserer Gehaltsliste steht. Ganz zu schweigen von den Verbindungen, die wir überall haben – zu Friedensrichtern, Stadträten, hohen Bankbeamten, Polizisten, sogar der Post. Dad, mach um Gottes Willen aus einer Mücke keinen Elefanten. Die leben doch alle von uns.«
Austin schenkte sich aus einer Karaffe einen Whisky ein und fügte Eis hinzu. »Einen Drink?«
»Ja.« Victor goß sich seinen Whisky selbst ein.
»Du hast zwei Dinge übersehen«, sagte Austin ruhig. »Und bei Jesus, selbst wenn du nie auf mich gehört hast, diesmal wirst du es tun. Erstens darfst du niemals die Macht unterschätzen. Jeder Oppositionelle würde seine eigene Großmutter verkaufen, nur um an die Regierung zu gelangen. An die Macht. Opposition! Das ist doch alles Bockmist. Da helfen dir dann auch deine ganzen Verbindungen nichts mehr. Du kannst nicht auf sie zählen.«
Genußvoll nahm er einen Schluck Whisky.
»Gut. Nehmen wir einfach mal an, daß durch Bestechung oder tiefe Überzeugung, Abwesenheit oder Überredung durch sozialistische Elemente eines dieser Landvergabegesetze doch durchkommt. Was dann, Mr. Broderick, Leiter von Springfield?«
Er schleuderte sein halbvolles Glas in den leeren Kamin. »Ich sage dir, was dann geschieht, du verdammter Idiot. Dein schwachköpfiger Bruder wird seine weichen Händchen ringen, und wir verlieren! Worauf haben sie es denn abgesehen? Auf uns, du Clown. Ihnen geht es nicht um das verfluchte Land. Was kann ein Schafzüchter schon mit einem winzigen Fleckchen Land anfangen? Die Kosten sind zu hoch, die Märkte zu weit entfernt. Man braucht riesige Weideflächen, wie wir sie haben …«
»Das stimmt«, sagte Victor, ohne weiter auf das zerbrochene Glas zu achten. Austin warf oft mit Gegenständen um sich und konnte seine Söhne mit so etwas längst nicht mehr beeindrucken.
»Wir sollten jemanden einen Artikel für Bernies Zeitung schreiben lassen, in dem man ihnen die Risiken klarmacht, die ein solcher Schritt für ihre Investitionen mit sich bringt …«
»Du hast es noch immer nicht kapiert, was?« fragte Austin sanft. »Es will einfach nicht in deinen Kopf, daß sie hinter uns Squattern her sind. Der Oligarchie, wie sie uns nennen. Es geht nur darum, die Macht der Squatter zu brechen. Wir haben das verdammte Land für sie erschlossen und darauf gesiedelt, lange bevor sich die Landvermesser der Regierung hierher gewagt haben. Wir haben die Kämpfe ausgefochten, sind die Risiken eingegangen und haben jeden Penny verdient, den wir besitzen. Und jeden Morgen Land, den uns eine Regierung verpachtet hat, die von der Existenz dieses Landes nicht einmal wußte. Wir haben gearbeitet und bezahlt, nicht nur mit Geld für die Pacht an diese verfluchte Regierung, die sich in Brisbane versteckt, sondern auch mit Menschenleben, darunter Kellys …«
Oh Jesus, dachte Victor, nicht schon wieder Kelly. Er ließ sich in einem luxuriösen Sessel nieder. Kelly mochte zwar ihr Onkel gewesen sein, doch die Broderick-Jungen hatten ihn hassen gelernt. Ein weitere Heiliger aus Austins Repertoire.
»Der zweite Punkt ist – falls es dich überhaupt interessiert, denn ich möchte dich nicht von deinem Tennisspiel abhalten …«
»Ich habe heute gespielt, weil Louisa Gesellschaft brauchte«, setzte Victor zu einer Erklärung an und haßte sich selbst für seinen Drang, sich seinem Vater gegenüber zu rechtfertigen. »Schön für dich«, erwiderte sein Vater sarkastisch. »In der Zwischenzeit steht Springfield am Rande des Abgrunds. Nehmen wir mal an, daß eines dieser hinterhältigen Gesetze durchkommt – trotz meines brillanten Sohnes Harry, trotz aller Hundesöhne, die wir in hohe Positionen gehievt haben. Hat dir nie jemand erklärt, daß ein Mensch, der sich einmal kaufen läßt, sich auch ein zweites und ein drittes Mal kaufen läßt? Klingelt es da nicht bei dir?«
Victor stand auf. »Ich kann das nicht mehr hören. Wenn du dir Luft gemacht hast, erkläre ich es dir noch einmal in aller Ruhe.«
Sein Vater grinste. »Nicht nötig, mein Junge. Wirf einfach einen Blick auf die Karte. Diese Karte. Jetzt!«
Er hatte mehrere Landkarten auf dem Billardtisch ausgebreitet, detaillierte Karten, die in richtiger Anordnung einen Überblick über den Gesamtbesitz von A. G. Broderick boten. Die Grenzen wiesen unregelmäßige Ausbuchtungen an den Stellen auf, wo er das beste Weideland gefunden und für sich beansprucht hatte.
»Wie sollen wir all das zurückkaufen?« fragte er.
»Das können wir nicht. Aber es gehört uns ohnehin schon. Wir müssen es gar nicht kaufen.«
»Und wenn es soweit kommt und Siedler auftauchen, die uns Dokumente unter die Nase halten, laut denen dieses Land in freien Grundbesitz umgewandelt wurde? Wir können sie nur davon abhalten, ihre Claims abzustecken, indem wir ihnen zuvorkommen und es selbst kaufen, und das ist bei unserer derzeitigen finanziellen Lage einfach nicht drin.«
Victor schüttelte den Kopf und sagte nichts dazu. Das war doch alles rein hypothetisch. Oder etwa nicht? Allmählich machte Austin ihn nervös.
»Geh und hol Rupe. Wir halten Kriegsrat. Wir müssen unser bestes Land kennzeichnen, bewässertes Land an den Flußufern und Wasserläufen …«
»Wozu? Wir können doch unmöglich alles einzäunen.«
»Das kommt später. Es ist der Plan für den Notfall. Wir kartographieren Parzellen von der Größe, die Interessenten, darunter auch wir, maximal frei erwerben dürfen. Wenn es zum Schlimmsten kommt, sind wir bereit und schlagen als erste zu. Wenigstens die Sahnestücke können wir uns auf diese Weise sichern.«
Victor starrte auf die Karten. »Das ist viel Arbeit. Ohne einen guten Vermesser ist das gar nicht zu schaffen.«
»Dann besorg einen.«
Charlotte trat ein. »Austin, der Reverend möchte mit dir sprechen.«
»Jetzt nicht. Wir haben zu tun. Was will er?«
»Das weiß ich nicht.«
»Dann finde es heraus. Und mach du es mit ihm aus.«
Sie verließ achselzuckend den Raum.
Da sie nicht Besseres zu tun hatte, war Louisa allein mit den Gästen zurückgeblieben.
»Weshalb wollen Sie mit Austin sprechen?« fragte sie Billings. »Mein Ehemann leitet jetzt die Farm. Austin hat sich zur Ruhe gesetzt.«
»Das ist mir durchaus bewußt, meine Dame, aber mein Bischof hat mich gebeten, mit Austin Broderick über Kirchenfragen zu sprechen.«
»Es hat keinen Sinn, mit Austin über den Bau einer Kirche reden zu wollen. Da könnten Sie bei Victor schon eher Glück haben.«
»Es geht nicht um eine Kirche«, warf Mrs. Billings ein, »sondern um die Aborigines. Wir betrachten es als unsere Pflicht, ihnen zu helfen.«
»Oh, das ist aber nett«, antwortete Louisa geistesabwesend.
In diesem Augenblick kehrte Charlotte zurück. »Die Männer sind zur Zeit beschäftigt, Reverend. Vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen?«
»Sie wollen etwas für die Schwarzen tun«, erklärte Louisa.
Charlotte bemerkte, daß der Reverend nicht allzu erpicht darauf schien, die Angelegenheit mit ihr zu besprechen, und nahm wieder am Tisch Platz. Sie sah ihn ermutigend an.
»Was schwebt Ihnen in diesem Zusammenhang vor?«
In die Enge getrieben, zog er einen Brief aus der Westentasche. »Vielleicht könnten Sie ihn Mr. Austin geben«, sagte er von oben herab. »Es stammt von meinem Bischof. Er empfindet es als unsere Christenpflicht, den armen, benachteiligten Kindern dieser Schwarzen, die in solchem Elend hausen müssen, die Hand zu reichen.«
»Sehr löblich«, murmelte Charlotte. »Darf ich ihn lesen?«
Der Reverend zögerte, wollte seine Gastgeberin aber auch nicht vor den Kopf stoßen.
»Selbstverständlich.«
Charlotte studierte den Brief aufmerksam und schaute dann lächelnd auf. »Was für ein wunderbares Programm. Gibt es das schon seit längerem?«
»Oh ja«, erwiderte Mrs. Billings eifrig. »Eingeborene Kinder müssen aus ihrer heidnischen Umgebung errettet und der Zivilisation zugeführt werden.«
»Sie werden als Christen erzogen«, fügte ihr Mann hinzu.
»Man sorgt für sie und bringt ihnen bei, sich in der Welt der Weißen zurechtzufinden. Dieses Werk der Nächstenliebe liegt uns sehr am Herzen.«
»Ja, so erklärt es Ihr Bischof hier auch. Sie haben also schon mehr als zwanzig Kinder untergebracht? Wohin kommen sie?«
»Wir unterhalten eine Missionsschule in Reedy Creek, ungefähr fünf Meilen außerhalb von Brisbane. Sie wird von unseren Laienbrüdern geleitet. Natürlich halten wir die Rassentrennung ein. Die Kinder lernen Englisch, und wenn sie älter sind, bringen wir sie bei Familien unter, wo sie für ihren Unterhalt arbeiten können.«
»Sind sie dort glücklich?«
»In der Tat. Sie haben viel Gesellschaft.«
»Ich habe schon davon gehört«, sagte Louisa. »Eine wunderbare Idee. Die Kirche von England holte ungefähr zwanzig Kinder von der Farm meines Onkels in Neusüdwales. Es geschieht überall. Wird auch Zeit, denn was sollte sonst aus ihnen werden? Sie können nicht länger in Stammesgemeinschaften leben.«
»Genau. Schließlich haben wir die Trunksucht und das verachtungswürdige Verhalten der Schwarzen erlebt, die in die Slums der Städte strömen. Wir müssen sie vor Not und Verzweiflung bewahren. So viele wie möglich …«
»Und Sie wollen einige unserer schwarzen Kinder mitnehmen?«
»Leider können wir gegenwärtig nur drei Kinder nehmen, weil der Platz im Wagen nicht ausreicht. Außerdem ist die Schule klein; doch später können wir noch mehr aufnehmen.«
»Wie alt sollten sie denn sein?«
»Wir haben zur Zeit Platz für sechsjährige Jungen …«
»Sechs?« fragte Charlotte verblüfft. »Ist das nicht ein bißchen zu jung?«
»Das beste Alter. Sie lernen schneller Englisch als die älteren und passen sich dem neuen Leben besser an. Und wir schenken ihnen doch ein neues Leben, die Chance, in einer sich verändernden Welt zu überleben.«
Charlotte nickte. »Das klingt plausibel. Ich bin sicher, daß Austin es gutheißen wird. Unsere eigenen Jungen mußten ja auch fort ins Internat. Da waren sie natürlich schon älter. Vorher wurden sie von Hauslehrern unterrichtet. Dabei fällt mir ein, Louisa, hast du schon einen Lehrer für Teddy ausgewählt? Es wird allmählich Zeit für seinen Unterricht …«
»Ich halte eine Gouvernante für geeigneter, jedenfalls für den Anfang. Victor hat Freunde und Verwandte in Brisbane gebeten, sich nach einer passenden Dame umzusehen.«
»Dann sollten wir einen Raum für die junge Frau herrichten und uns nach einem geeigneten Schulzimmer umsehen. Es wird mir Spaß machen, nach all den Jahren wieder ein Unterrichtszimmer einzurichten. Für Kinder gibt es jetzt so schöne Möbel …«
Reverend Billings bat noch einmal um Gehör. »Ich benötige Mr. Brodericks Zustimmung so bald wie möglich. Wir haben drei gesunde Jungen ausgewählt, die uns geeignet erscheinen – natürlich wissen sie noch nichts von ihrem Glück. Also sollten wir bald aufbrechen.«
»Unbedingt«, sagte Charlotte. »Ich spreche mit ihm.«
Er wird schon zustimmen, wenn er begreift, daß die Abreise der Missionare davon abhängt, fügte sie in Gedanken hinzu.
»Wo war eigentlich Victors Unterrichtszimmer?« fragte Louisa. Die Erziehung der schwarzen Kinder war vergessen.
»In einem Schuppen, damals stand dieses Haus ja noch nicht. Teddy wird ein hübsches Zimmer bekommen, und zwar auf dieser Seite des Hauses, damit Austin sich nicht ständig in den Unterricht einmischt«, sagte Charlotte lachend.
Nach dem Tee zog Tom Billings sich zu einem Nickerchen zurück, während seine Frau Amy sich für einen Spaziergang entschied. Sie wünschte, Tom hätte nicht so voreilig erklärt, die Farm zu verlassen, sobald sie Austins Zustimmung erhalten hätten, die schwarzen Kinder mitzunehmen. Noch nie in ihrem Leben hatten sie oder Tom in einem so luxuriösen Haus gewohnt. Warum also übereilt aufbrechen? Schließlich waren sie wochenlang unterwegs gewesen, eine anstrengende, eintönige Reise im unbequemen Einspänner durch die unerträgliche australische Hitze.
Tom und Amy stammten von der Südinsel Neuseelands mit ihrer üppig grünen Landschaft. Nie zuvor hatten sie in einer so trockenen Hitze leben oder derart ungeheure Strecken zwischen zwei Dörfern zurücklegen müssen. Sie hatten die Mission auf Ersuchen des Bischofs übernommen, der ihnen versicherte, jetzt im Frühjahr werde die Reise sehr angenehm für sie sein.