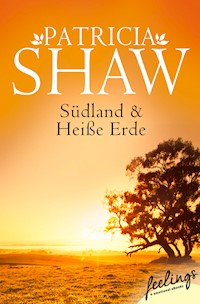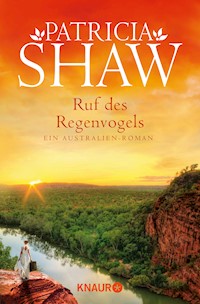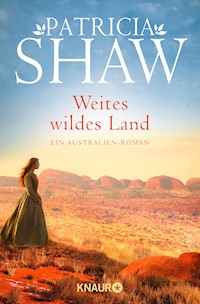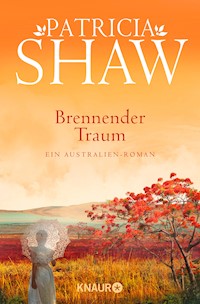6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eine Saga aus dem Tal der Lagunen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Überraschend taucht in Patricia Shaws neuem Roman ein alter Bekannter wieder auf – Jack Drew, der beliebte Held aus ihrem ersten Bestseller Südland. Australien, Mitte des 19. Jahrhunderts. Zehn Jahre sind vergangen, seit Jack Drew, ein ehemaliger Sträfling, in den Weiten des australischen Buschlands bei den Aborigines Zuflucht suchte. Nun ist für ihn die Zeit gekommen, in die Zivilisation zurückzukehren – doch die Welt der Weißen ist ihm fremd geworden. Er findet Arbeit auf der Farm von Major Ferrington und seiner jungen Verlobten und gerät bald in einen dramatischen Konflikt: Ferrington ist entschlossen, mit Jacks Hilfe reich zu werden, und zwingt ihn, die geheimen Goldfelder seiner Freunde, der Aborigines, aufzuspüren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 802
Ähnliche
Patricia Shaw
Im Feuer der Smaragde
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
In Liebe für Debbie, Sterling,Lilly und Jaxson Daniher
1. Kapitel
Im Schutz der Bäume oben auf dem Hügel beobachtete Ilkepala den Überfall auf die Montone-Station. Er war ein großer, kräftig gebauter Mann mittleren Alters mit einem harten, ausdruckslosen Gesicht. Er trug das dicke Haar in Zöpfen, in die Schlangenhaut geflochten war, und sein hervorspringendes Kinn zierte ein dichter Bart. Sein Körper war mit Narben übersät, Erinnerungen an schmerzhafte Initiationsriten, doch anders als seine Begleiter trug er keine Bemalung. Ilkepala benötigte keinen Schmuck, denn er war ein Magier, ein Hüter des Wissens, ein Vertrauter der Geister. Seine Leute respektierten und fürchteten ihn … seine Feinde hingegen kannten ihn nicht. Nur wenige Weiße hatten je von Ilkepala gehört, geschweige denn, ihn zu Gesicht bekommen. Jack Drew, der Mann, den er gerade beobachtete, war einer dieser Auserwählten.
Jack Drew, ein weißer, entlaufener Sträfling, hatte vor etwa zehn Jahren bei den Aborigines Schutz gesucht. Feindliche Clans hatten Ilkepala darauf hingewiesen, dass Jack bei den Familien lebte. Sie verlangten, dass man den Schurken tötete, sich seiner sofort entledigte, doch seine Freunde und seine Geliebte Ngalla hatten um sein Leben gefleht und behauptet, er sei ein guter Mensch, der ihr Mitleid verdiene. Dessen war Ilkepala sich nicht so sicher. Drew sah nicht aus wie ein guter Mensch; seine Augen blickten zu stechend, waren ständig auf der Hut, argwöhnisch. Augen wie die eines Hais. Doch es stimmte, dass er vor seinesgleichen geflohen war und sich fürchtete, zu ihnen zurückzukehren. Einige Männer der Kamilaroi hatten erklärt, dass berittene Polizisten den Burschen nach seiner Flucht tagelang durch den Busch gehetzt hatten und ihn gewiss aufgehängt hätten. Kein Wunder, dass er die Vertreter der Obrigkeit nicht gerade schätzte … Vielleicht wäre es eine gute Idee, ihn eine Weile dazubehalten. Zu beobachten. Wenn er wollte, konnte er den Familien viel über die Welt der Weißen beibringen.
Und dabei blieb es. Ohne es zu ahnen, stand Jack Drew unter dem Schutz von Ilkepala, der jederzeit seinen Tod hätte befehlen können, stattdessen aber fasziniert war von dem ersten Weißen, den er aus der Nähe studieren konnte. Er fand Drew ausgesprochen widersprüchlich … kühn und großmäulig, gelegentlich gemein und selbstsüchtig, aber ein geborener Anführer. Auf seine Art war er ein Kämpfer, wenn auch kein Krieger, ging Auseinandersetzungen aus dem Weg, indem er Zuflucht in banalen Scherzen und Entschuldigungen suchte. Der weiße Mann litt nicht unter einem Gesichtsverlust; dieser Zustand existierte für ihn nicht, er lebte einfach vor sich hin. Und darin lag seine Stärke. Er versuchte, sich anzupassen, war gut zu seiner Frau, bemüht, die Sprache der Schwarzen zu erlernen, und unterrichtete die Aborigines unbewusst in der Lebensart der Weißen.
Ilkepala gebot den Männern, die das Lagerfeuer mit Jack Drew teilten, ihm zuzuhören und daraus zu lernen. Ihm so viele Fragen wie möglich zu stellen, die er offensichtlich gern beantwortete. Von ihm konnten sie etwas über die weißen Männer und ihre Schiffe lernen und die guten Männer, die sie »Sträflinge« nannten und die ihre Sklaven waren. Sie hörten von Pferden, die gute Kameraden waren, und Kühen, die man essen konnte, und auch von Schafen, deren Fell die meiste Wärme spendete. Von ihm konnte man alles Mögliche erfahren, sogar dass weiße Frauen genauso aussahen wie schwarze, wenn man erst die dicken Hüllen entfernt hatte, was die Aborigines ziemlich enttäuschend fanden.
Ilkepala wusste sogar von Jacks Plan, die gelben Steine, auch Gold genannt, zu finden, die die weißen Männer so schätzten. Er fragte ständig nach Gold, erkundigte sich vor allem bei vorbeiziehenden Stammesleuten danach, und obwohl ihm viele von ihnen Gesteinsproben mitbrachten, war erst vor kurzem tatsächlich das Gesuchte darunter gewesen. Ilkepala wartete gespannt, was Jack als Nächstes tun würde. Er hoffte, er werde bleiben, da sein Wissen in diesen schrecklichen Zeiten ungeheuer wichtig für sie war. Und hatte Drew nicht auch gelitten? Seine Frau Ngalla und viele ihrer Angehörigen waren von Weißen ermordet worden, weil sie nicht auf seine Bitten gehört und ihre geheiligten Stätten wieder aufgesucht hatten. Jack hatte sie gewarnt, dass selbst eine friedliche Wanderung durch von Weißen besiedelte Gegenden gefährlich sei, doch sie fanden nichts dabei. Er hatte sie angefleht zu bleiben und hatte erklärt, er könne nicht riskieren, mit ihnen in diesen Bezirk zu gehen, weil man ihn dort verhaften würde. Daher hatte er in den Bergen auf seine Lieben gewartet, die nie zurückkehrten. Danach hatte er sich einer anderen Familie angeschlossen, die nach Norden zog, dem Grauen voraus, und durfte schließlich an einem Korrobori teilnehmen, wo er das Privileg genoss, einen Blick auf die Macht der Magier zu werfen.
»Wer ist das?«, hatte er ängstlich gefragt, als Ilkepala auf einem nahe gelegenen Hügelkamm erschien und dann unvermittelt unter ihnen auftauchte, ein feuerspeiender Gigant mit der Stimme eines großen Geistes, die im Tal widerhallte. Diese Demonstration war nötig gewesen, um die verschiedenen Clans, die sich an diesem Ort versammelt hatten, zu zwingen, sich auf die Gefahr zu konzentrieren und ihre Differenzen beizulegen. Es war an der Zeit, Entscheidungen zu treffen. Wer konnte, sollte sich den Kriegern der Tingum anschließen. Da die Stämme der Tingum und der Kamilaroi nicht gerade die engsten Freunde waren, gab es verdrossenes Gemurmel, doch Ilkepala äußerte dröhnend sein Missfallen, und sie verfielen in erschrecktes Schweigen.
»Dies ist eine Zeit großer Gefahren. Ihr werdet auf mich hören! Wer wagt es, sein Gesicht abzuwenden? Die Krieger gehen ins Land der Tingum, die Familien ziehen tiefer in den Schutz des Buschs und halten sich von den Wegen der Weißen fern!«
Später erteilte er die Anweisung, Jack Drew solle sich ebenfalls den Tingum anschließen, und war verblüfft, dass der weiße Mann sich geweigert hatte, da er angeblich kein Krieger sei. Offensichtlich nicht, hatte Ilkepala geknurrt. Dann begriff er, dass dieser Narr keine Stammesgrenzen kannte; die meiste Zeit hatte er gar nicht gewusst, wo er sich befand.
»Sorgt dafür, dass er ins Lager von Bussamarai zieht«, befahl er, und so geschah es auch.
Als er viele Monde später von seinen Beratungen mit besorgten Stämmen im Norden zurückkehrte, traf er auf Jack Drew, der am Rande eines großen Kriegerlagers lebte, wo er sich unwohl fühlte. Verlassen durfte er das Lager allerdings auch nicht.
»Warum soll er bleiben, wenn ihr ihn nicht gebrauchen könnt?«, wollte Ilkepala vom Häuptling wissen.
»Ich hatte zu tun. Ich kann mich nicht mit abtrünnigen Weißen abgeben.«
»Mit diesem hättest du dich besser abgegeben. Wie viele Männer hast du letzthin verloren? Über vierzig, und viele tragen Wunden von den Gewehren. Dieser Jack Drew weiß, wie die Weißen kämpfen; sieh zu, was er euch beibringen kann.«
»Ich bitte keinen dreckigen Weißen um Hilfe!«
Ilkepala lächelte grimmig. »Du brauchst ihn nicht zu bitten. Hole ihn in den Kreis, wenn ihr eure Überfälle plant. Lass ihn zuhören. Der Mann kann einfach nicht den Mund halten. Ich glaube fest daran, dass er euch bald sagen wird, was ihr zu tun habt, dreist, wie er ist. Vielleicht kann er etwas Interessantes beisteuern.«
Von diesem Tag an wendete sich Häuptling Bussamarais Geschick zum Guten. Es war ihm stets gelungen, die Weißen von seinem Land nahe der Wide Bay fernzuhalten, doch misslangen ihm die Überfälle auf die Siedler, die ihn allmählich einkreisten. Jetzt kam die Wende. Seit Drew die Angriffspläne entwarf und sich weigerte, die traditionellen Strategien einzusetzen, entwickelten sich Bussamarais Männer zur Geißel des Bezirks, vertrieben Weiße aus ihren Häusern und verscheuchten Schafe und Rinder.
Ilkepala erinnerte sich, wie Jack Drew sich zum ersten Mal in die Planung eines Überfalls eingemischt hatte. Er selbst war bei dieser Versammlung zugegen gewesen, ohne dass der Weiße ihn sehen konnte, denn er hatte allen Grund, nervös zu sein. Jack Drew war alles andere als hilfreich; den dritten Abend in Folge hockte er einfach da, den Mund fest geschlossen. Bussamarai war nicht gerade beeindruckt und würde sich auch nicht herablassen, den Burschen nach seiner Meinung zu fragen.
Doch als Ilkepala gerade kapitulieren und Drews Freunde bitten wollte, ihm einen Schubs zu geben, explodierte der Mann und fiel den anderen heftig ins Wort.
»Ihr Narren!«, brüllte er und sprang auf. »Es hat nichts mit Mut zu tun, in ihre Kugeln zu laufen. Eure Schilde sind nutzlos dagegen. Ihr seid alle verrückt!«
Das Gesicht des Häuptlings blitzte vor Zorn. So wenige Worte, so schwere Beleidigungen. Ilkepala fürchtete um Jacks Leben. Rasch ließ er eine dicke Rauchsäule aus dem Lagerfeuer aufsteigen und eine Stimme ertönen, die dem Häuptling befahl, weise zu handeln.
»Ein weiser Mann hört alle Meinungen an und verdaut sie«, fügte die Stimme hinzu.
Nie wieder sollten diese Krieger mit ihren zerbrechlichen Schilden und Speeren in den Kampf ziehen. Von Jack Drew lernten sie, List höher zu schätzen als Tapferkeit; ihre Hauptfeinde, die berittenen Polizisten, aufzuspüren und zu töten; auf ihr Kriegsgeschrei zu verzichten und schweigend anzugreifen; aus der Deckung heraus Herden aufzuscheuchen, Häuser niederzubrennen … o ja, Jack Drew kannte viele Tricks, die er mit großer Freude demonstrierte. Ilkepala kam der Gedanke, dass er die Planung vermutlich mehr genoss als die eigentliche Schlacht.
Der Überfall auf die Montone-Station lag Bussamarai sehr am Herzen. Der Angriff im letzten Sommer hatte in einer Katastrophe geendet. Die erste Reihe seiner Krieger war vom Gewehrfeuer niedergemäht worden, und nach dem Kampf hieben die Weißen mit Schwertern auf die Männer ein, die noch lebend am Boden lagen. Dann warfen sie die Leichen auf einen Haufen und zündeten sie an. Der Häuptling grämte sich noch mehr, als er erkannte, dass die Weißen anscheinend keinerlei Verluste erlitten hatten. Jedenfalls konnte er keines ihrer üblichen Begräbnisse beobachten.
Ilkepala spürte, wie Freude in ihm aufstieg, als die Tingum-Männer durch die Büsche schlichen, die das Wohnhaus und die Nebengebäude der Montone-Station umgaben, sich anpirschten, wie Jack Drew es ihnen geraten hatte. Obwohl Jack Drew und der Häuptling sich angefreundet hatten, würde ein zweiter Fehlschlag dem Ruf des Häuptlings schwer schaden, und es war durchaus möglich, dass man Jack Drew die Schuld geben würde. Ilkepala schauderte. Auch sein eigener Ruf stand auf dem Spiel. Er klopfte auf den Totemstock, den er bei sich trug, um die Geister daran zu erinnern, dass er Glück brauchte.
Doch dann startete Bussamarai den Angriff, und Ilkepala schoss in die Höhe. Er sah, wie der Häuptling aus der Deckung rannte, Speer und Kriegsbeil in Händen, während die Hunde auf der Station anschlugen. Von überall her stürzten seine Männer nach vorn.
Eine weiße Frau kam mit einem Korb aus dem Haus mit den Vögeln und wurde sofort von mehreren Speeren getroffen. Im Fallen kullerten Eier aus ihrem Korb und zerbrachen. Ilkepala seufzte. Die Angreifer waren weitergelaufen, die gefangenen Vögel kreischten und gackerten vor Panik, die guten Eier waren dahin. Er hatte großen Gefallen an den Eiern gefunden, die diese fremdartigen Vögel legten, und erteilte allen, die ihm solche Eier brachten, einen besonderen Segen.
Doch was war das? Jack Drew war unter der ersten Welle der Angreifer, schon tauchten Gewehrläufe an den Fenstern auf. Drew duckte sich zwischen den Gebäuden, gelangte zum Haupthaus, hielt Schritt mit Bussamarai.
»Was macht er da?«, fragte Ilkepala seine eigenen Leute.
»Befehl des Häuptlings«, sagte Moorabi. »Alle Männer müssen kämpfen.«
»Doch nicht er. Er steht nur im Weg.«
»Bussamarai wollte, dass er kämpft, um seine Treue zu beweisen.«
Ilkepala schüttelte den Kopf. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Jack Drew besonders glücklich darüber war, da er Kämpfen stets aus dem Weg gegangen war und sich bisher an keinem Überfall beteiligt hatte. Er besaß weder die Kraft noch die Beweglichkeit der Schwarzen. Durchaus möglich, dass ihn Bussamarai auf die Probe stellen wollte, indem er ihn zur Konfrontation mit seinen eigenen Leuten zwang, sinnierte Ilkepala. Ein interessantes, wenngleich sinnloses Experiment.
Die Weißen leisteten Widerstand, feuerten pausenlos, sorgten für Verluste, doch die Männer der Tingum rannten zu einer Veranda, hämmerten gegen die Tür, stürzten schließlich ins Haus. Die Gewehrschüsse hallten wie Donnerschläge. Jemand hatte die Nebengebäude in Brand gesteckt, rannte mit einer lodernden Fackel zum Haupthaus, wurde aber mit einem Schuss niedergestreckt. Ein anderer Mann sprang vor und hob die Fackel auf. Jetzt konnte niemand mehr den Angriff aufhalten.
Das schienen auch die Verteidiger zu wissen. Ilkepala sah, dass sie das Haus verließen. Es war auch eine Frau unter ihnen. Im Davonlaufen schossen sie weiter, rannten zu einem langgestreckten Gebäude, das ihnen nicht lange Schutz bieten würde. Plötzlich galoppierten aufgescheuchte Pferde von einer Koppel auf das Haus zu, getrieben von der gleichen Panik wie die eingesperrten Vögel.
Jetzt brannte auch das Haupthaus. Einige Minuten lang hatte Ilkepala das Zentrum des Kampfes aus den Augen verloren und sah nun, wie immer mehr Männer auf das Wohnhaus zuströmten. Doch plötzlich entdeckte er hinter dem langgestreckten Gebäude eine Gruppe Weißer, die zu Pferd entkommen wollten, den Weg entlanggaloppierten, gefolgt von den Kriegern, deren Speere im aufgewirbelten Staub zu Boden fielen.
»Da entlang, sucht Jack Drew«, sagte er zu seinen Gefolgsleuten, und sie schossen davon.
Bussamarai hatte gewonnen! Zwar waren die Weißen entkommen, doch die Station war zerstört. Alle Gebäude und der große Heuhaufen standen in Flammen, die Feier konnte beginnen. Man würde diesen Erfolg mit einem großen Festmahl begehen. Später. Viel später. Denn Jack Drew hatte ihnen nahegelegt, rasch zu verschwinden, sobald die Schlacht gewonnen war, denn dies war die beste Schafstation im Bezirk, und man würde ihnen bald Schützen und berittene Polizisten auf den Hals hetzen, die auf Rache aus waren.
Rauch kräuselte sich zum Himmel empor und trieb im Wind davon, was den anderen Weißen in der Gegend als Warnung diente. Sie würden herkommen, und der Zorn über das Werk, das die Schwarzen an diesem Tag vollbracht hatten, würde groß sein. Doch es war notwendig gewesen. Ilkepala machte sich keine falschen Hoffnungen darüber, wer in diesem Teil des Landes letztlich den Krieg gewinnen würde. Die Tage der Tingum waren gezählt, wie es auch bei den Kamilaroi und allen anderen Stämmen und Völkern des Südens der Fall gewesen war, doch er hegte die Hoffnung, dass die kriegerischeren Stämme des Nordens durch eigene Gewalt oder die Gleichgültigkeit der Weißen überleben würden. Gewiss brauchten sie nicht das ganze Land der Schwarzen.
Er ging den Hang hinunter und sah seine beiden Männer, die Jack Drew zu den Bäumen hinübertrugen. Selbst von fern konnte er erkennen, dass seine Brust blutverschmiert war.
»Narr«, murmelte er. »Spielt den Helden. Er hätte zurückfallen und plündern und Schuppen anzünden können, wie viele zaghafte Männer es tun.«
Sie betteten ihn behutsam auf den weichen Farn, der am Boden wuchs, und schüttelten den Kopf, als Ilkepala näher kam. Auf die schlimme Brustverletzung war er vorbereitet, nicht aber auf die Verbrennungen.
»Er lag mit dem Gesicht nach unten im Haus«, sagten die Männer entschuldigend. »Was können wir für ihn tun?«
»Bringt ihn so schnell wie möglich weg. Bevor er aufwacht und den Schmerz spürt und zu schreien anfängt. Bringt ihn in die Höhle hinter den Wasserfällen.«
»Wird er überleben?«
Ilkepala gab keine Antwort. Er konnte sich keinen Irrtum leisten. Vielleicht, vielleicht auch nicht, dachte er.
Er lebte, schwankte aber am Rand des Abgrunds, zwischen den Welten. Sie wuschen Staub und Blut von seinem sonnengebräunten Körper, der eigenartig aussah mit den hellen Flecken unter den Armen, zwischen den Schenkeln und Zehen und im Nacken, den das filzige Haar vor der Sonne schützte. Doch sein Blut sah normal aus, wenngleich er so viel davon verloren hatte, dass sein Gesicht ganz grau wirkte. Ilkepala seufzte. Der Mann war in einem beängstigenden Zustand. Die Kugel hatte die rechte Schulter durchschlagen, und die linke Seite seines Gesichts war schlimm verbrannt, ebenso die linke Schulter und der Arm, die Hüfte und ein Teil des Beins. Wie am Spieß geröstet. Ilkepala fragte sich, ob es nicht gnädiger wäre, den Burschen friedlich sterben zu lassen. Doch immerhin war er ein Medizinmann; und dies hier war eine gute Gelegenheit, verschiedene Salben auszuprobieren. Zunächst musste er jedoch die Schusswunden behandeln.
Er bedeckte sie mit Auflagen aus zerstoßenen Knollengewächsen und Kräutern, beruhigte den Mann, als er stöhnend zu sich kam und sich von den Händen befreien wollte, die ihn festhielten. Ilkepala legte eine schützende Haut aus Honig und verdünntem Pflanzensaft darüber und schickte Moorabi in den Busch, um weiteren Wildhonig zu suchen. Er würde einen gewissen Vorrat benötigen, um alle Verbrennungen dieses hochgewachsenen Mannes zu versorgen. Dann griff er in seinen Beutel, holte ein Säckchen mit zerstoßenen Pilzen heraus und streute etwas von dem Pulver in Jacks Mund. Es war eine starke Medizin; sie würde den Schmerz eine Zeitlang lindern.
Die blauen Augen öffneten sich unvermittelt, Jack spuckte das übel schmeckende Pulver aus und drehte ruckartig den Kopf weg.
»Wer bist du?«, stöhnte er.
»Ich bin Ilkepala.«
»O nein, du hast mir gerade noch gefehlt. Verschwinde und lass mich in Ruhe!«
Ilkepala war überrascht, dass sein Patient englisch sprach, was er in den vergangenen Jahren nur selten getan hatte, doch er begriff, was der Bursche sagen wollte, und hielt ihn noch fester, als er sich hin- und herwarf. Immerhin hatte ihn der Weiße nur bei dem Korrobori gesehen und fürchten gelernt. Und seither dürfte er noch oft von Ilkepala gehört haben.
Natürlich verschlimmerte die Bewegung seine Schmerzen, und Drew wand sich und fing an zu schreien, sodass Ilkepala Jack erneut das Pulver gab und ihm den Mund zuhielt, bis es sich aufgelöst hatte.
»Sei ruhig. Je mehr du dich bewegst, desto mehr wirst du leiden.«
Jack schrie auf vor Wut. Wer tat ihm das an? Wer hatte dieses Inferno in seinem Körper entfacht? Denn genau da war er, in der Hölle. »O Gott, verschone mich. Tu mir das nicht an.«
Eine Hand legte sich über seinen Mund, er biss hinein. Wer wollte ihn ersticken? Könnte er nur aufstehen, dann würde er das Schwein mit bloßen Händen erledigen. Seine Zunge schwoll an. Sie fühlte sich an wie ein Teigklumpen, der seinen ganzen Mund ausfüllte. Jack geriet in Panik; er packte einen Arm, wollte um Hilfe bitten, er war stumm, hilflos, schien zu sterben, erstickte an seiner eigenen Zunge.
»Sei still«, sagte eine Stimme, drückte ihn nach hinten, beruhigte ihn, und die Panik ebbte ab, nahm die große Last mit sich, die er trug. Jack war so erleichtert, dass er vor Dankbarkeit weinte und sich fragte, wer ihn gerettet haben mochte. Ein Freund wohl, aber wer? Er hatte auf diesem Schiff keine Freunde. Er hockte hier unten mit hundert stinkenden Verbrechern, von denen keiner einen Pfifferling wert war, und konnte sich kaum bewegen. Kein Wunder, dass sie sagten, er solle ruhig sein, sonst werde er noch mehr leiden. Das durfte er nicht vergessen. In dieser Hölle kämpfte jeder für sich allein, und Jack hielt sich an diese Regel. Bei Gott, das tat er. Wer klug war, ging Black Jack aus dem Weg.
Jetzt konnte er sie in einer fremden Sprache reden hören. Wer waren sie nur? Vielleicht hatte das Schiff in der Bucht von Sydney geankert, dem seltsamen neuen Land, und dies war die Landessprache. Sie waren gelandet und würden in Gefängnisse gesperrt, aus denen es kein Entkommen gab. Wirklich nicht? Er pfiff vor sich hin. Bei erster Gelegenheit wäre er weg.
»Geht es ihm besser?«, fragte Moorabi. »Sieht so aus.«
»Nein.« Es ging schon seit fünf Tagen so. Das Pulver wirkte, daher zog sich Ilkepala zu den kühlen Quellen über den Wasserfällen zurück. Sie konnten nicht ewig hierbleiben; Moorabi und sein Bruder mussten einen Teil ihres Clans in neue, sichere Gebiete führen, und ihm selbst stand die schwierige Reise ins Grenzgebirge bevor, wo er die Ältesten des mächtigen Kalkadoon-Volkes treffen sollte. Er hatte mit diesen schwierigen, gefährlichen Männern, die nie über das Kriegerdasein hinauswuchsen, ernsthafte Dinge zu besprechen. Die meisten hatten noch nie einen Weißen gesehen und machten sich lustig über die Bedrohung durch die Invasoren, weil sie auf ihre eigene Macht und Magie vertrauten.
Ilkepala würde dafür sorgen müssen, dass sie auf seine Warnung hörten, und – bei diesem Gedanken holte er tief Luft – offiziell darum ersuchen, dass die Kamilaroi und Tingum ihr Land betreten durften, wo sie wenigstens einige Jahre lang sicher sein würden.
Während er grübelte, wie die Kalkadoon auf einen so unerhörten Vorschlag reagieren würden, der nicht einmal Handelsvorteile versprach, da seinen Leuten nicht viel geblieben war, fertigte er kurze Nachrichtenstöcke an, die er Moorabi mitgeben würde. Die Stöcke wurden auf die Größe seines Mittelfingers zurechtgeschnitten, mit einer Markierung versehen und mit weißer Farbe bestrichen. Sie stammten unverkennbar von dem großen Mann, und kaum jemand würde es wagen, sich der Anweisung zu widersetzen, dem Reisenden Hilfe zu leisten.
Als er fertig war, kehrte er in die Höhle zurück, wo Moorabi, ein guter, freundlicher Mann, mit einem Fächer aus Blättern geduldig die hartnäckigen Fliegen von dem Patienten fernhielt.
»Ist er wach?«, fragte Ilkepala. Moorabi nickte.
»Wir müssen bald gehen. Noch zwei Tage. Länger können wir uns nicht aufhalten.«
»Ja.«
Schließlich war die Zeit gekommen. Moorabi wartete auf seine Anweisungen.
»Hole ein Kanu«, sagte Ilkepala bedächtig und schmiedete einen Plan, während er sprach. »Wir können ihn nicht tragen und auch nicht hierlassen. Der Fluss dort unten mündet in den großen Strom. Ich will, dass ihr beide ihn in das Kanu legt und so weit wie möglich von hier wegbringt. Er darf auf keinen Fall mit diesem Überfall in Verbindung gebracht werden, sonst töten sie ihn. Falls er überhaupt überlebt.«
»Verdammt, ich werde überleben«, flüsterte der Engländer, und Ilkepala wollte dies nicht bestreiten, widerspenstig genug war er jedenfalls. Verwundet, verbrannt, kaum fähig zu atmen, geschweige denn, für sich selbst zu sorgen, besaß Jack Drew dennoch die Stirn, seinen Worten einen drohenden Klang zu geben. Als wäre Ilkepala schuld an seinem Dilemma.
Der Magier nahm Moorabi beiseite. »Er braucht Ruhe unterwegs, daher werde ich ihm einen starken Schlaftrunk geben, wenn ihr aufbrecht. Ich möchte, dass ihr still den Fluss hinunter bis in die Nähe der großen Siedlung fahrt und ihn dort ans Flussufer legt, wo man ihn finden kann. Dann ist er in den Händen seiner eigenen Geister. Sie können ihm helfen, falls sie ihn nicht vergessen haben.«
Er reinigte noch einmal die Wunden und bestrich sie mit einer Salbe aus den Stengeln von Mondwinden, die betäubend und schmerzstillend wirkte. Er hatte gehofft, die Maden noch länger in der Wunde lassen zu können, damit sie dort ihre reinigende Arbeit verrichteten, doch blieb keine Zeit mehr dafür. Er musste die Wunden zunähen und das Beste hoffen.
Er suchte in seinem Beutel nach Zwirn und feinen Bambussplittern und begann zu nähen. Zuerst verschloss er die Brustwunde, dann, nachdem Moorabi den Patienten umgedreht hatte, das Loch im Rücken. Danach bedeckte er die Wunden mit Lehm und Rinde, um die Blutung zu stillen und die Stellen vor weiteren Verletzungen zu schützen. Bald darauf war der Lehm hart geworden. Dann kümmerte er sich um die Brandwunden. Sie heilten recht gut, die Honigmischung war fest geworden und ermöglichte es der Haut, zu trocknen und nachzuwachsen.
Der Patient war wieder in sein Murmeln, Streiten, Fluchen versunken, und als Moorabi ihm Wasser in den Mund träufelte, rutschte Jack Drew rastlos hin und her und griff sich an die Brust, doch Ilkepala zog seine Hände energisch weg. »Es wäre vielleicht ratsam, die Hände festzubinden, damit er die Wunden nicht beim Heilen stört«, sagte er zu Moorabi.
Als die frühen Morgennebel über die Mangrovensümpfe zogen, sah er seinen Begleitern nach, die Jack Drew zum Kanu trugen und ihn auf ein Kängurufell legten, das den schmalen Boden des Bootes bedeckte. Sie stellten einen Sonnenschutz aus Rinde auf, hockten sich vor und hinter ihn und tauchten ihre Ruder in den Schlamm. Ilkepala versetzte dem Kanu einen Stoß, und es glitt in die Strömung hinaus.
Sie alle mussten jetzt Zeit gutmachen, nicht zuletzt Jack Drew. Er hatte zehn Jahre seines Lebens als Weißer verloren; falls er überlebte, würde es ihm schwerfallen, wieder in seine Welt hineinzufinden. Doch er musste zu seinen Leuten zurückkehren, da seine schwarzen Familien auf immer verschwunden waren. Sie waren in eine neue, seltsame Welt gezogen.
Er war wieder auf dem Sträflingsschiff, unter Deck, wo das Wasser gegen die Planken klatschte, und hörte, wie O’Meara seine Freunde mahnte, nach jeder noch so kleinen Fluchtmöglichkeit Ausschau zu halten. Sie hatten gehört, dass die Emma Jane in die Bucht von Sydney eingelaufen war und an diesem Morgen dort vor Anker gehen würde. Es war heiß, stank noch mehr als sonst, doch Brosnan lachte. Er gehörte zu O’Mearas Mob. Politische nannte man sie. Aus Irland deportiert, weil sie dort Unruhe gestiftet hatten. Das gefiel Jack. Die Politischen waren die Einzigen, die er im Laufe der Wochen akzeptiert hatte, sie standen eine Stufe über dem übrigen Gesindel.
Ihm gefiel, wie sie redeten, worüber sie redeten, über die Rechte, die man hatte, und alles andere, von dem Jack früher nie etwas gewusst hatte. Er hatte also eigene Rechte. Das wichtigste lautete: »Ich zuerst«, war also weniger kompliziert als die irischen Regeln. Doch dieser Brosnan lachte ständig, selbst in dieser Hölle, und Jack staunte, dass er sogar ihn zum Lachen brachte.
Er spürte einen furchtbaren Schmerz in der Brust und wollte die Hände bewegen, doch sie waren festgebunden. Nein, es waren die verfluchten Ketten, sie alle waren angekettet, und plötzlich war es pechschwarz und still, und Brosnan war nicht mehr da. Er konnte hören, wie O’Meara nach Brosnan fragte, und er sagte es ihm. Er weinte. Gott im Himmel, Jack Drew weinte um niemanden, aber … Brosnan war tot. Erschossen. Natürlich, sie waren auf der Mudie-Farm, arbeiteten für dieses Schwein von Mudie, jetzt waren sie auf der Flucht. Doch der arme Brosnan hatte es nicht geschafft.
Jemand gab Jack Wasser zu trinken, verschüttete etwas davon auf seinem Gesicht. Vielleicht bewegte sich das Schiff überhaupt nicht, er hatte es sich nur eingebildet und hockte seit unzähligen Jahren auf dem Gefängnisschiff, das auf der Themse ankerte.
»Lasst mich raus«, schrie er. »Lasst mich raus!« Doch es tat sich nichts; die Ketten waren schwer, er konnte noch das Wasser klatschen hören, es klatschte von außen ans Schiff. Es klang so kühl, so einladend, er wäre gern darin ertrunken, hätte diesen Schmerz ertränkt. Sterben. Und wenn schon? Er war des Lebens überdrüssig.
Die beiden schwarzen Männer ruderten gleichmäßig weiter, wichen geschickt Farn und Schwemmgut aus und bogen Tage später in den großen Fluss, der sich bis zum Meer wand, tauchten die Ruder tief ins Wasser, um das widerspenstige Gefährt in die Strömung zu drücken.
Für Moorabi war es eine traurige Reise. Er liebte Meerwah, den breiten Fluss, doch seine Leute zogen von ihm weg. Bei jedem Ruderschlag betrachtete er die Orientierungspunkte, die er so gut kannte … die gemächlichen Flussschlingen mit den stillen, bewaldeten Ufern, täuschend in ihrer Ruhe, denn manchmal ergossen sich tosende Sturmfluten über die Böschung. Im Wasser spiegelte sich der Busch in seiner ganzen Schönheit, es gab Nahrung im Überfluss. Er erinnerte sich an ihre liebsten Angelplätze und hielt nach ihnen Ausschau, erkannte die Stellen, an denen er und seine Leute den Fluss überquert hatten, wenn sie nach Süden ins Land der Bundjalung zogen.
Jeden Tag steuerten sie das Kanu ans Ufer, hoben den weißen Mann behutsam ins Wasser, um ihn zu reinigen und kühl zu halten, wie Ilkepala es befohlen hatte. Bisher war er dank der Medizin des großen Mannes fieberfrei geblieben. Dann betteten sie ihn ins dichte Gras, damit er trocknen konnte.
Er wachte murmelnd auf, bewegte sich unbeholfen, wie ein Betrunkener, doch es lockerte die Gliedmaßen und ließ sein Blut gleichmäßiger fließen. Darin lag auch der Grund für die kurzen Pausen. Die Schwarzen hielten ihre Muskeln warm, während sie Nahrung suchten, denn bald mussten sie wieder aufbrechen.
Im Vorbeifahren beobachtete Moorabi den Busch längs der Ufer. Das Land wirkte verlassen; alles war so still, so normal, doch das täuschte. Es lebten noch Stämme hier, die sich weigerten zu gehen, die Fremden und Weißen feindselig begegneten, und die Gegend wurde von berittenen Polizisten kontrolliert, die nach entflohenen Gefangenen und Schwarzen suchten, die einfach erschossen wurden. Ein gefährliches Land. Obwohl Ilkepala ihnen keine diesbezüglichen Anweisungen gegeben hatte, beschlossen sie, die Nacht hindurch zu fahren, da der Mond hell schien und der Fluss nach den schweren Regenfällen rasch dahinfloss. Nach ihrer Schätzung brauchten sie noch einige Tage, um den Rand der weißen Siedlung zu erreichen. Je schneller sie von dort wieder weg waren, desto besser. Sie würden das Kanu zurücklassen und rasch in nördlicher Richtung über Land wandern.
Moorabi verstand nicht, weshalb die weißen Männer ihre Häuser so weit im Landesinneren bauten, in derart einsamen Gegenden, wenn es hier so viel zu essen gab. Da er kein persönliches Eigentum kannte, wusste er auch nicht, dass diese Männer reich waren und riesige Ländereien für sich und ihr Vieh beanspruchten. Doch hatte Ilkepala sie nicht angewiesen, so viel wie möglich zu lernen? Sie glitten durch die Dunkelheit, beinahe lautlos, und das Wasser schien nun, da die Sterne über ihnen standen, die Welt zur Ruhe gekommen war und der weiße Mann wieder im Schlaf vor sich hin murmelte, viel glatter und friedlicher als zuvor.
Eines Nachmittags entdeckten sie hinter einer Flussbiegung ein Haus, das hoch oben auf einem Hügel lag. Moorabis Bruder hob sein Ruder und blickte nach hinten.
»Wo sind wir? Ich dachte, es würde noch einen Tag dauern, bis wir ihnen so nahe kommen.«
»Ich auch.« Moorabi war verwirrt. Wie hatte er sich so irren können? Er schaute sich um. Er wusste genau, wo er war … in dieser Biegung wuchsen zwei Bunya-Bäume, sie standen auch noch an Ort und Stelle, und gegenüber lag unter dem Felsvorsprung ein Sandstrand. Dahinter gab es, wie er wusste, eine uralte Höhle, einen Ort aus der Traumzeit, der sehr heilig war. Ein Heiligtum für das Gute gegen das Böse, wie Ilkepala ihm erklärt hatte. Doch was war das? Ein Weißenhaus stand oben auf der Anhöhe, und ein Teil des Hügels wirkte kahl.
»Sie sind hier«, sagte er niedergeschlagen. »So weit flussaufwärts hätte ich sie nie erwartet.«
»Sollen wir ihn hierlassen?«
»Ja. Das muss der richtige Ort sein.«
Wieder hoben sie den Weißen aus dem Kanu und trugen ihn das steile Ufer hinauf. Moorabi tippte Jack an die Stirn und hoffte, dass seine Worte zu ihm durchdringen würden.
»Wir müssen dich jetzt verlassen, Jack Drew. Du bist gut zu uns gewesen. Das wird unser Volk nicht vergessen.«
2. Kapitel
Kommt mal her«, rief Bart, der die Löcher für die Pfosten grub, den fünf Männern aus seinem Arbeitstrupp zu. »Hier liegt ein toter Nigger am Ufer. Splitternackt. Seht euch das an.«
Sie rannten hinüber, und Albert, der Vorarbeiter, trat näher, wollte die Leiche umdrehen und wich entsetzt zurück. »Allmächtiger, das kann doch nicht wahr sein. Jemand hat das arme Schwein verprügelt und verbrannt. Bestimmt hat ihn einer der Bosse zu fassen gekriegt. Die mögen keine Schwarzen.«
Dann brüllte Bart: »Seht nur! Er ist nicht tot. Er hat gerade gezwinkert.«
»Ach, hör auf«, sagte ein anderer. »Du könntest nicht mal erkennen, ob ein Pferd zwinkert.«
»Ich hab’s gesehen, so wahr ich hier stehe. Los, Albert, hör mal, ob er atmet. Ich glaube, er ist noch bei uns.«
Zögernd kniete Albert sich hin, fühlte den Puls, tastete auf der verletzten Brust nach einem Herzschlag, doch in diesem Moment stöhnte der Mann.
»Scheiße, Bart hat recht«, sagte Albert. »Der arme Kerl lebt noch. Wir bringen ihn besser in die Scheune. Holt den Karren, Jungs.«
»Und dann?«, fragte Bart. »Er sieht gar nicht gut aus, und wir haben keinen Arzt.«
»Die Ärzte behandeln sowieso keine Schwarzen«, gab Albert zurück. »Helft mir, ihn auf den Karren zu legen, wir können ihn nicht hierlassen.«
»Wartet, bis ich die Fesseln losgemacht habe. Sieht aus, als wäre er gefesselt worden und hätte sich irgendwie befreit. Könnte ein Sträfling sein, wir wollen doch keine Schwierigkeiten bekommen, Albert. Sie werden ihn suchen.«
»Was sollen wir denn machen? Ihn hier verfaulen lassen? Na los, hebt ihn hoch. Vorsicht, der arme Kerl.« Albert bückte sich und hob die Schultern an, fuhr zurück, als der Mann vor Schmerzen aufstöhnte. »Haben wir nichts zum Zudecken?«
»Moment, hier ist was.« Bart hielt ein Kängurufell in die Höhe. »Hier ist sein Schurz, ich kapiere bloß nicht, wie der halten soll.«
»Egal, bringt ihn mit. Und jetzt anheben.«
Sie trugen ihn den Weg entlang und legten ihn mit der rechten Seite auf den Karren, um die verbrannten Stellen zu schonen, dann bedeckten sie ihn mit dem Kängurufell.
»Wir können auch gleich Feierabend machen«, sagte Albert. »Es ist ohnehin dunkel, bis wir zurück sind. Packt die Werkzeuge auf den Karren, lasst nichts zurück. Ich will nicht, dass noch mal so etwas wie gestern passiert. Ihr wisst, wir müssen alles abgeben, Äxte, Stemmeisen und so weiter. Wir dürfen nicht mal einen Spaten liegen lassen, selbst wenn er morgen gebraucht wird. Wir müssen die Sachen verdammt noch mal jeden Abend vorzeigen.«
Albert war besorgt, als sie zur Baracke gingen. Sie alle waren Sträflinge aus dem Gefängnis von Brisbane, die auf der Farm von Major Kit Ferrington arbeiteten, der sehr strenge Regeln aufstellte. Sie erhielten einige Shilling im Monat, karges Essen und Unterkunft, wurden allerdings nicht angekettet oder über Nacht eingeschlossen. Sie hätten tagsüber ohnehin jederzeit fliehen können, und Ferrington war nicht bereit, sie rund um die Uhr bewachen zu lassen. Wenn sie flohen, würden sie ohnedies von Schwarzen ermordet oder von berittenen Polizisten gehetzt, dachte Albert bei sich. Die Farm lag tief im Busch am Rande der Stadt. Es hatte wenig Sinn, von hier zu fliehen, da der einzige Weg flussabwärts und damit zurück nach Brisbane führte.
Ferrington unterhielt ein sogenanntes Ehrensystem, um seine Arbeiter bei der Stange zu halten. Es funktionierte ganz einfach. Er beschäftigte ausschließlich Männer, die sich gut geführt und ihre Strafe beinahe verbüßt hatten, was sie angreifbar machte. Ein einziger Verstoß, und man würde sie vor Gericht stellen und vermutlich auspeitschen oder ihre Strafe verlängern.
Dabei ging es wohl eher um Erpressung als um Ehre, dachte Albert, als sie den Buschpfad verließen und querfeldein über das Land zogen, das sie bereits gerodet hatten. Zweifellos versprach dieses Hügelland, man nannte es Emerald Downs, einmal prachtvolles Farmland zu werden … wenn es erst urbar gemacht worden war. Der Boden war gut, es gab ausreichend Wasser und ungeheuer viel Platz. Manche sagten, es gebe Farmen, die noch hundertmal größer seien, doch Albert fand diese zehntausend Morgen schon gigantisch. Ein Monster, das gewiss noch einige Männer fressen würde. Doch momentan dachte er nur an den armen Kerl. Ferrington hatte unglaublich viele Regeln aufgestellt, aber nicht für einen derartigen Fall vorgesorgt. Er hoffte, dass er das Richtige tat … was blieb ihm anderes übrig? Dennoch ahnte er, dass der Boss, der zum Glück unterwegs war, nicht allzu erfreut sein würde. Er verließ die Farm oft, ohne zu sagen, wohin er ritt, und kehrte unerwartet zurück, bereit, auf jeden loszugehen, der ihm in die Quere kam. Daher wechselten die Arbeiter ziemlich häufig, und unter denen, die blieben, herrschte gemeinhin Furcht, weil sie ihre Freiheit unmittelbar bedroht sahen.
Zurzeit waren zwölf Männer auf der Farm – fünf von ihnen rodeten das Land und zäunten es ein, zwei Zimmerleute arbeiteten am Haus, und die übrigen rodeten Parzellen, die anschließend gepflügt wurden, und kümmerten sich um das Milchvieh. Alle arbeiteten schwer und sehnten sich verzweifelt nach Freiheit. Albert wusste, dass er als freier Mann Aufseher geworden wäre und einen angemessenen Lohn erhalten hätte, was bei Sträflingen nicht möglich war. Er war einfach der Vorarbeiter des Trupps, der mit den anderen Farmarbeitern in einem schäbigen Blechschuppen hauste und morgens und abends vor dem Küchenfenster anstand, um von einem zänkischen Chinesen namens Tom Lok sein Essen entgegenzunehmen. Doch letztlich, dachte Albert seufzend, war es gar nicht so übel. Alles war besser als das Gefängnis. Er konzentrierte sich auf die Zukunft; nur noch ein Jahr, dann würde er frei sein. Er beschloss, sich zunächst eine Stelle in einem Büro zu suchen; nur die wenigsten Sträflinge konnten so gut lesen und schreiben wie er …
»Bringt ihn in die Scheune«, sagte Bart. »Das wolltest du doch, Albert, oder?«
Er nickte. Der hinterlistige Bart wollte auf Nummer sicher gehen. »Ja. Ich laufe zu Polly und frage, ob sie mal nach ihm sehen kann. Sie wird wissen, was zu tun ist. Er ist sehr krank.«
Das Haupthaus war bei weitem noch nicht fertig, sondern wurde abschnittsweise gebaut. »Flügel« nannte der Major die einzelnen Trakte. Schon dieser Flügel besaß alles, was ein Haus brauchte, doch Ferrington wollte ein Haus mit allem Drum und Dran. Auf den Plänen waren große Empfangszimmer und ein Gästeflügel zu sehen, sogar ein Spielzimmer war dabei. Albert war beeindruckt. Seine Familie in Liverpool hatte nie in einem richtigen Haus gelebt, es gab nur dunkle Zimmer in den Hinterhäusern der Mietskasernen. Sie besaßen nicht einmal eigene Möbel; jedenfalls nicht, bis Albert sich mit zwölf Jahren ein Bett kaufte. Ein Eisenbett mit Sprungfederrahmen, auf den man eine Matratze legen konnte, sofern man eine hatte. Er musste sich aber meist mit einem Stück von einem alten Teppich zufriedengeben. Doch das Bett war sein ganzer Stolz gewesen; er schleppte es bei jedem Umzug mit, was häufig vorkam. Er hatte es behalten, bis man ihn verhaftete, und fragte sich, was wohl daraus geworden sein mochte.
Schon jetzt war Ferringtons Haus elegant. Ganz aus Holz, mit Schieferdach. Von der vorderen Veranda blickte man auf Hügel und Täler, und quer durch das Haus verlief ein Korridor, durch den der Wind wehte und für Kühlung sorgte. Zu beiden Seiten gingen Zimmer ab, in denen ganze Familien Raum gefunden hätten. Obwohl er es nie zugegeben hätte, liebte Albert dieses Haus. Er hatte es Stück für Stück wachsen sehen, den Zimmerleuten und Putzern bei der Arbeit zugeschaut – unter den Sträflingen im überfüllten Gefängnis waren viele ausgezeichnete Handwerker – und gestaunt, als die Spediteure die herrlichen Möbel anlieferten. Wie gern hätte er so ein Haus besessen.
Es würde ein Traum bleiben, dachte er bei sich, als er zur Küche ging, die im hinteren Teil des Hauses lag. Andererseits wusste man nie, was kommen würde; in diesem wilden Land waren schon seltsamere Dinge geschehen. Erfreulich seltsame Dinge … wie der Mord an Captain Logan, dem Direktor des Gefängnisses von Moreton Bay, den Schwarze bei einer Jagdpartie im Busch getötet hatten. Sagte man jedenfalls. Klügere Leute flüsterten, die Jagdhelfer, lauter Sträflinge, hätten die Tat begangen, um sich für Logans sadistische Grausamkeit zu rächen, doch niemand konnte es beweisen. Wer immer es getan hatte, verdiente einen Orden, darin waren sich die Gefangenen und viele freie Siedler einig. Albert lächelte bei der Erinnerung und blickte zum Himmel empor.
»Dieses Blau«, murmelte er sehnsüchtig, »kein einziges Wölkchen.« Der einzige Schatten war die Sorge um den Schwarzen.
Mrs. Pohlman, genannt Polly, war die Haushälterin und Köchin des Majors und bewohnte ein Zimmer zwischen Küche und Wäscherei.
Anscheinend hatten sich zunächst einige weibliche Sträflinge an der Hausarbeit versucht, wobei der Major großen Wert auf Sauberkeit legte. Schließlich hatte er sich auf die Suche nach einer Frau gemacht, die wirklich gut kochen konnte.
Polly, eine dünne, drahtige Irin Anfang dreißig mit vorzeitig ergrautem Haar und wilden, grünen Augen konnte zwar nicht mit weiblichen Reizen locken, doch sie prahlte damit, die beste Köchin weit und breit zu sein. Was der Major offensichtlich genauso sah.
»Ich habe hier eine Lebensstellung«, hatte sie zu Albert gesagt.
Er war überrascht gewesen. »Aber du hast deine Zeit bald abgesessen. Wie wir alle. Du könntest überallhin gehen.«
»Wohin denn? Die Heimreise kann ich mir nicht leisten, vielleicht will ich das auch gar nicht. Mir würde das Herz brechen, wenn ich all die hungernden Menschen sehen müsste. Und hier habe ich mein eigenes Zimmer. Ich wäre dumm, wenn ich ginge. Hier ist es schön und so ruhig. Und wenig Menschen, die ohnehin alles verderben.«
Während der Jahre in einer überfüllten Fabrik, der grauenhaften Überfahrt auf einem engen Schiff und der Zeit im Gefängnis von Moreton Bay hatte Polly von Raum und Weite geträumt, davon, sich bewegen zu können, ohne fremde Körper zu berühren. Sie war von Sauberkeit besessen in einer Umgebung, in der man sich nicht sauber halten konnte, doch jetzt schrubbte sie sich ständig und ertrug es nicht, nach der Gartenarbeit schmutzige Fingernägel zu haben. Die Küche war blitzblank, ebenso jeder Winkel des Hauses. Polly schwor, sie würde bleiben, selbst wenn man ihr keinen besseren Lohn bezahlen wollte.
Als Albert auftauchte, war sie gerade im Gemüsegarten hinter der Wäscherei und zupfte Blätter von unbekannten Pflanzen. »Was willst du denn hier?«, fragte sie.
»Es geht ganz schnell.«
»In Ordnung. Riech mal.« Sie hielt ihm die Blätter unter die Nase. »Die duften, was? Er bringt mir jedes Mal neue Kräuter mit.«
»Riecht gut. Irgendwie sauber und glücklich.«
»So sollte es sein. Man nennt es Basilikum, schmeckt ausgezeichnet zu Lamm. Was wolltest du denn?«
»Wir haben einen kranken Mann in der Scheune. Ich dachte, du könntest ihn dir mal ansehen.«
»Was hat er denn? Und warum liegt er in der Scheune? Ist es was Ansteckendes?«
»Nein. Er ist verletzt. Überall Brandwunden. Wirklich übel.«
»Gott steh uns bei! Ich glaube, bei Verbrennungen kann ich nicht viel machen. Warte, ich hole meine Tasche und Verbandszeug.«
Als sie den Weg hinuntereilten, erzählte Albert ein wenig mehr. »Wir haben ihn am Fluss gefunden. Beim Anleger. Wir dachten, er sei tot …«
»Guter Gott!« Sie ging schneller.
»Und da wäre noch etwas … der arme Kerl. Er ist wirklich schlimm dran. Keiner hilft ihm. Er ist nämlich schwarz.«
»Er ist was?« Sie blieb unvermittelt stehen und drückte Albert die Medizintasche in die Hand. »Ich weiß nicht, was ich mit einem Schwarzen tun soll. Ich hab noch nie einen angefasst.«
»Sie sind genau wie wir, Polly.«
»Wer sagt das? Ich habe Todesangst vor ihnen. An den gehe ich nicht ran.«
»Komm schon. Sieh ihn dir einfach an. Ich schaue nach und rufe dich. Vermutlich ist er schon tot, und du jammerst, weil du ihn anfassen sollst.«
Auf seine Worte hin ging sie zögernd weiter, bestand aber darauf, ihn nicht zu berühren. »Ich sage dir, was zu tun ist, falls ich es weiß. Aber ich fasse ihn nicht an, nie im Leben.«
Doch dann kam Bart angelaufen, stolperte aufgeregt den steilen Pfad entlang. »Er ist kein Nigger! Er ist weiß, ehrlich. Oder ein Mischling«, fügte er grinsend hinzu.
Albert stieß ihn beiseite. »Mischling? Wovon redest du? Natürlich ist er ein Nigger.«
Neugierig folgte Polly ihnen in die Scheune.
Albert konnte nicht viel sehen, weil die Schatten schon länger wurden, und zündete eine Öllampe an.
Der Kerl war eindeutig schwarz! Die Haut sah aus wie altes Leder. Zugegeben, sein Gesicht hatte nicht viel von einem Schwarzen, die Züge waren ausgeprägt, und er hatte eine Hakennase, doch wer kannte sich schon mit Schwarzen aus?
Bart tanzte eifrig um den am Boden liegenden Mann herum und zog das Kängurufell weg. »Seht euch seine Achselhöhlen an. Sie sind weiß. Und hier zwischen den Beinen, am Hintern …«
Bart vergaß, dass er es mit einem Schwerverletzten zu tun hatte, und griff nach einem verbrannten Bein.
Jack, fast bewusstlos, tauchte gerade erst aus dem Drogenschlaf auf, in den Moorabi ihn versetzt hatte, doch der feste Griff ließ ihn vor Schmerz aufschreien, und er schlug wild mit den Fäusten um sich.
»Hau ab, du Schwein!«, schrie er. Und wurde ohnmächtig.
Als Polly die englische Stimme vernahm, eilte sie herbei, wandte sich aber rasch ab, als sie den nackten Körper sah, der auch ihr wie der eines Schwarzen vorkam.
»Ich weiß nicht recht«, meinte sie. »Was wird der Boss dazu sagen? Er mag doch keine Fremden.«
Es dauerte eine Weile, bis die Männer sie überzeugt hatten, da sie Barts Vorschlag, sich den Patienten genauer anzusehen, ablehnte. Als jedoch jemand ein Augenlid öffnete und ihr die blassblaue Iris zeigte, gab sie schließlich nach, wobei ihre Neugier größer war als ihr Mitleid. »Er hat mehr als nur Verbrennungen«, sagte sie vorwurfsvoll. »Sieht aus, als hätte man auf ihn geschossen. Was geht hier eigentlich vor?«
Niemand antwortete. Die meisten zuckten die Achseln, wandten sich ab, nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte.
»Wenn ihr das Werkzeug abgegeben habt, lauft ihr zum Küchenhaus«, wies Albert sie an. »Und kein Wort, solange der Chinese dabei ist. Wir sollten es geheim halten.«
»Die anderen Jungs finden es sowieso heraus. Sie müssen hier rein; du kannst sie nicht aussperren.«
Das stimmte. Die Scheune war riesig, sie diente als Lager für Tierfutter, Vorräte und Farmgeräte.
»Sagt ihnen, sie sollen auch den Mund halten. Und ihn nicht stören, bis …«
»Bis was?«
»Bis er sich so weit erholt hat, dass er weiterziehen kann«, sagte Albert zweifelnd. Polly knurrte verärgert.
»Keine Ahnung, wann das sein soll«, sagte sie grimmig. »Die Brandwunden sind schlimm, sie ziehen sich über die ganze linke Seite, bis ins Gesicht. Auch das Haar ist verbrannt. Ich hole meine Schere und schneide es zurecht. Jemand hat einen harten Belag auf die Brandwunden geschmiert, der eine Art Kruste bildet. Jetzt bröckelt er an den Rändern ab. Wird schon seinen Sinn haben, ich lasse ihn drauf. Riecht nach Honig.«
»Wer würde einen Sterbenden mit Honig beschmieren?«, fragte Albert besorgt.
»Wer sagt denn, dass er stirbt? Er scheint immer wieder wegzudämmern. Vielleicht haben ihn die Schmerzen erschöpft.«
Pollys große, plumpe Hände waren überraschend sanft. Sie untersuchte die Wunden in Brust und Rücken, wusch den Schlamm ab, der daran festgetrocknet war, und trat überrascht zurück, als sie sah, dass sie genäht worden waren.
»Holt mal die Lampe heran! Gott im Himmel, seht euch das an. Ich würde sagen, ein Buschdoktor hat ihm geholfen. Die Wunde ist genäht. Und der Rücken? Die Kugel ist sauber durchgegangen, hier sind weitere Stiche.«
Albert warf einen flüchtigen Blick auf die Wunden und trat beiseite. Er roch das Desinfektionsmittel, das Polly verwendete, und hörte den Mann stöhnen. Er kam wohl wieder zu sich. Doch was nun? Eine Schusswunde konnte nur eins bedeuten. Er war auf der Flucht, wer immer er auch sein mochte, und das machte das Ganze noch schlimmer. Sie alle konnten wegen Fluchthilfe angezeigt werden. Im Geiste rang er die Hände, während er einen weiteren Eimer Wasser zu Polly schleppte und ihr dann einen kleinen Becher brachte, aus dem sie dem Verletzten zu trinken geben konnte. Er musste ihr helfen, die Brust zu verbinden, und entschuldigte sich für die Nacktheit des Patienten.
»Ja, Albert, du solltest ihm etwas zum Anziehen besorgen. Egal was kommt, er muss wenigstens Hose und Hemd tragen. Mit dem Fell kann er nicht rumlaufen.«
»Soll ich jetzt gehen?«
»Ja. Und zwar schnell. Ich will nicht hier drinnen erwischt werden.«
Sobald Albert gegangen war, beugte sie sich über den Fremden und flüsterte: »Hören Sie, Mister. Sind Sie geflohen? Wenn ja, können Sie nicht hierbleiben. Der Boss liefert Sie aus. Er ist ein hoher Offizier.«
Jack öffnete die Augen. Wer war diese Frau? Er stöhnte wieder. Jesus, schon das Atmen tat weh. Was war passiert? Er erinnerte sich noch an das Sträflingsschiff. Nein, er war auf der Gefängnisfarm von Mudie.
»Sie haben Brosnan erschossen«, sagte er, seine Zunge lag dick und schwer in seinem Mund.
»Wo? Wo ist das gewesen?«
»Bei Mudie.«
»Mudie? Major Mudie?« Alle Sträflinge in New South Wales kannten Mudies Gefängnisfarm. Ein brutales Arbeitslager, in dem hauptsächlich Kettensträflinge einsaßen.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Das tut nichts zur Sache. Sie liegen einfach still und ruhen sich aus. Albert soll Ihnen eine Pritsche besorgen.«
»Was ist mir passiert?«
»Sie wurden angeschossen. Und haben schlimme Verbrennungen. Ich gebe Ihnen Laudanum, damit Sie schlafen können.«
Jack strengte sich an, wollte sich erinnern. »Sie haben nicht auf mich geschossen«, wollte er sagen. Brosnan wurde erschossen, doch sie hörte nicht zu. Er wollte sie überzeugen, doch seine Stimme schwand. Es war, als wäre er in einen tiefen Teich gefallen; er kämpfte sich nach oben und versank wieder, tauchte auf, glitt so oft vom Wachsein in die Bewusstlosigkeit, dass sich Traum, Erinnerung und Wirklichkeit vermischten. Er schien in einer Folterkammer zu stecken, sein Verstand war Schlamm, Treibsand, zerfloss in dem Schmerz, den man ihm fortwährend zufügte. Alle Gedanken waren trügerisch. Doch Jack Drew war schlau, und irgendwo in seinem Gehirn gab es eine Ecke, die wusste, wann er zuhören musste …
Vielleicht war es ein Warnsignal, das ihm half, als alles andere versagte. Es war kürzlich so gewesen, als die Stimme ihm sagte, er solle ruhig sein.
Und heute erlebte er es wieder: sein drittes Ohr hatte eine Warnung vernommen. Er wusste, er war in Gefahr, und hielt die Information fest, als er wieder unterging.
Sie trugen ihn irgendwohin. Sie gab ihm etwas Warmes, Breiiges, das seinem Magen guttat. Dann fiel die Tür in seinem Gehirn wieder zu, wobei er noch einen seltsam vertrauten Geruch wahrnahm.
»Er ist abgehauen«, sagte sie zu Albert. »Er sagt, er komme von Mudies Gefängnisfarm.«
Albert lachte. »Von wegen. Da gibt es gar keine Sträflinge mehr. Wurde schon vor Jahren geschlossen. Der alte Mudie ist nach England zurückgegangen.«
»Das hat er aber gesagt. Muss wohl gelogen haben. Ist aber geheimnisvoll, wenn du mich fragst.«
»Wieso geheimnisvoll? Er ist auf der Flucht. Wurde angeschossen. Aber was sollen wir mit ihm machen?«
»Er muss sehen, wie er zurechtkommt. Wir können ihn nicht anzeigen, krank, wie er ist. Ich wette, die Polizei kann jeden Tag kommen und hier nach ihm suchen.«
»Ja. Vermutlich war er bei einem Arbeitstrupp im Busch. Und sie haben ihn angeschossen, als er durch den Fluss fliehen wollte.« Albert runzelte die Stirn, denn etwas stimmte nicht an seiner Geschichte.
»Klar«, sagte Polly sarkastisch. »Und unterwegs hat er seine Wunden verbunden und genäht und Lehm –«
»Schon gut, Mrs. Neunmalklug. Ich habe nur laut gedacht. Die Schwarzen müssen ihm geholfen haben. Er wurde angeschossen. Sie haben ihn eine Weile versorgt … die Brandwunden sind nicht frisch … und hergebracht.«
Sie nickte. »Aber wenn die Polizei kommt, werde ich meinen Kopf nicht für ihn hinhalten. Wenn sie mich fragen, zeige ich ihnen, wo er ist, so leid es mir tut. Ich kann ihnen aus dem Weg gehen, aber du stehst mitten in der Schusslinie. Du wirst nicht davonkommen, immerhin hast du ihn versteckt.«
»Das weiß ich«, entgegnete er wütend. »Das weiß ich doch.«
In der Morgendämmerung rannte Polly zum Schuppen, hoffte fast, der Fremde wäre wie durch ein Wunder aufgestanden und verschwunden, aber nein, er saß auf der Kante der niedrigen Pritsche, den Kopf gesenkt, als koste es zu viel Kraft, ihn hochzuhalten.
»Ich habe Porridge für Sie«, sagte Polly, worauf er sie verständnislos anblinzelte.
»Porridge?«, wiederholte er. »Porridge?« Doch er aß ihn rasch auf, als sie ihn fütterte.
»Sie sehen schon besser aus«, sagte sie. »Wie fühlen Sie sich?«
»Wacklig. Mein Kopf dreht sich, die Brust tut höllisch weh. Was ist passiert?«
»Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Sie wurden angeschossen. Und haben Verbrennungen erlitten.«
»Jesus!« Er schüttelte verwundert den Kopf.
»Wie heißen Sie?«
»Jack Drew«, antwortete er geistesabwesend. »Haben Sie noch was zu essen?«
»Ich kann Ihnen Brot und Wurst besorgen. Ich wusste nicht, ob Sie essen wollten, da Sie so krank waren.«
»Ich habe Hunger«, sagte er schlicht. »Von dem Porridge-Zeug könnte ich noch was vertragen.«
»Recht haben Sie«, meinte Polly, »ich hole noch etwas.«
Jack sah ihr nach und rappelte sich mühsam auf. Sie hatten ihm eine Hose angezogen, die erste seit Jahren. Der raue Stoff scheuerte im Schritt und rieb schmerzhaft über die Brandwunden an seinen Beinen, doch er biss die Zähne zusammen und ging los, wobei er sich an der Wand abstützte. Er wusste, er konnte nicht hierbleiben, also musste er seinen Körper wieder in Form bringen; es ging nur darum, den Schmerz zu besiegen. Die Schusswunden würden ihn offenbar nicht umbringen, ebenso wenig die Brandverletzungen, auch wenn sie sich anfühlten, als wären glühende Kohlen in seiner Haut vergraben. Ihm blieb also keine Ausrede. Er hatte erlebt, wie die Schwarzen furchtbare Verletzungen mit zusammengebissenen Zähnen und Konzentration bezwangen, nun war er an der Reihe. Und er konnte es, ganz sicher.
Er wünschte, er hätte der Irin nicht seinen Namen verraten. Doch das wunderbar süße Essen der Weißen hatte ihn dazu verführt, sodass er ihm einfach herausgerutscht war. Immerhin war er ein entflohener Sträfling, doch wer sollte sich noch an ihn erinnern? Vermutlich hielt man ihn längst für tot.
An diesem Abend eilte Albert zu ihm herüber. »Wie geht’s, Kumpel?«
»Ich fühle mich wund und elend. Wo bin ich hier?«
Seine Stimme klang eigenartig. Er sprach englisch wie die anderen, wie ein waschechter Cockney, aber ganz langsam, als hätte er Probleme, die Worte hervorzubringen, als kaute er auf ihnen herum. Vermutlich lag es an den Schmerzen.
»Auf der Emerald Downs Farm, außerhalb von Brisbane. Polly sagt, du heißt Jack Drew?«
»Ja. Brisbane? Wo liegt das?«
Albert starrte ihn an. »Na ja, es ist doch der Hafen. Er ist um die Gefängnissiedlung in der Moreton Bay gewachsen. Dreißig Meilen von hier.« Er sah, wie Drews Augen schmal wurden. Er runzelte die Stirn.
»Ist das deine Farm?«
»Himmel, nein! Wir arbeiten nur hier für den Rest unserer Zeit. Dank der Gefängnisbosse. Darf ich fragen, ob du auf der Flucht bist, Kumpel?«
»Nein.«
»Gott sei Dank. Die Berittenen hätten dich bald erwischt. Wir tun ja unser Bestes, der Boss ist unterwegs, aber er mag nun mal keine Fremden …«
Drew setzte sich mühsam auf. »Sobald es geht, bin ich weg. Ich will euch keine Schwierigkeiten machen.«
»Du brauchst aber noch Ruhe, Kumpel … bist noch nicht reisefähig. Woher kommst du?«
Doch Drew ließ sich auf die Matratze sinken und schloss müde die Augen. »Von weit her«, sagte er. »Von verdammt weit her.«
Vier Tage lang schenkte ihm der Schlaf Trost und Sicherheit. Nachts schleppte er sich hinaus, um seine Kraft zu testen und die Farm zu erforschen, wobei ihn zwei misstrauische Hunde begleiteten. Die halb verhungerten Tiere wussten nicht so recht, was sie von ihm halten sollten, doch die Reste von seinem Teller sorgten dafür, dass er in Ruhe durch ihr Revier hinken durfte.
Polly brachte ihm Essen, versorgte seine Wunden und wunderte sich, dass sie so rasch heilten. Dabei beantwortete sie seine Fragen. »Wer hat wohl mehr Fragen, Mr. Drew? Ich weiß nämlich nicht, woher Sie kommen, und Sie nicht, wo Sie sind.«
Sie schnitt sein dickes, verfilztes Haar und rasierte ihm behutsam den versengten, zotteligen Bart ab. »Schließlich können Sie nicht mit halbem Bart und halber Haartracht herumlaufen«, tat sie seine Einwände ab.
Vermutlich hatte sie recht, doch Jack war so lange nicht mehr glatt rasiert gewesen, dass er ganz vergessen hatte, wie er aussah.
»Na bitte«, meinte Polly. »Sie sehen gar nicht so übel aus. Und ich hatte Sie für den Wilden Mann von Borneo gehalten. Aber jetzt sagen Sie mir mal eins, Mr. Drew. Wie wurden Sie angeschossen? Wer tut so etwas?«
Jack hatte sich eine Geschichte zurechtgelegt. Er war ein freier Mann. Er war in die Kolonie gekommen, um das Land zu erforschen, und hatte viele Jahre bei den Schwarzen gelebt.
Er probierte die Geschichte an Polly aus. Sie war verblüfft.
»Was Sie nicht sagen! Konnten Sie denn nicht weglaufen?«
»Brauchte ich nicht. Ich habe gern bei ihnen gelebt.«
»Gütiger Gott! Was haben Sie denn erforscht, bevor Sie ein Eingeborener wurden?«
Hm. Rasch überlegen. »Ich habe nach Gold gesucht.«
»Nach Gold?«
»Ja.« Dann dämmerte es ihm, er ergriff ihren Arm. »Wo ist mein Gold?«
»Welches Gold? Sie hatten nichts bei sich. Gar nichts, Mr. Drew. Keinen Fetzen Stoff am Leib. Albert musste Ihnen Hemd und Hose anziehen, Sie trugen nur ein Kängurufell …«
Doch Jack hörte nicht mehr zu. Plötzlich wusste er es. Und explodierte vor Zorn.
Er erinnerte sich an den Überfall auf die Montone-Station. Den Kampf … er hatte mitmachen müssen, sich wie ein Irrer den Weg ins Haus erkämpft, in ein Schlafzimmer, wo eine Frau … ihr Gesicht war vertraut … sie kauerte angsterfüllt an der Wand. Sie hielt ihn für einen Wilden.
»Bleib da«, hatte er gezischt und die Tür zugeschlagen, hatte seine schwarzen Kameraden weggeführt, doch dann war er dem Boss der Station begegnet, der ein Gewehr bei sich trug … von da an war alles schwarz. Nein. Der Brand. Das Haus stand in Flammen, und er lag da, wie ein Idiot …
Der Schweiß lief ihm übers Gesicht, als er sich mühsam erinnerte, und Polly wischte ihn mit einem feuchten Lappen ab, jammerte, nun habe er doch Fieber bekommen.
»Ganz ruhig«, sagte sie. »Sie sind ja völlig außer sich.«
»Das Feuer«, sagte er. »Ich habe mich verbrannt.«
»Ja, das stimmt. Die Verbrennungen heilen erstaunlich gut, aber es werden Narben bleiben. Sogar im Gesicht, vor allem auf Wange und Stirn. Aber es geht. Was ist denn mit dem Gold? Und wo war das Feuer?«
Irgendwo hier war Ilkepala. Er hatte immer Angst gehabt vor diesem hässlichen Kerl mit seinem Zauberbann. Jack hatte gesehen, wie der alte Bursche furchteinflößende Kunststücke vollführte. Er konnte sich in einen Riesen verwandeln, scheinbar an zwei Orten gleichzeitig sein … doch das alles war jetzt egal. Wo war sein Gold? Er hatte es in einem Ledergürtel versteckt, den er selbst gefertigt hatte. Er war dick und stark und wog schwer mit dem Gold darin, doch Jack hatte ihn nie abgelegt.
»Ein Buschfeuer«, log er.
Die Schwarzen mussten gesehen haben, wie er angeschossen wurde, und hatten ihn aus dem Haus getragen. Wie wild tastete er an seinen Hüften. Vergeblich. Der Gürtel war irgendwo abgefallen, kaputt oder verbrannt. Eine Schnalle hatte er nie auftreiben können. Die Schwarzen wären jedenfalls nicht auf die Idee gekommen, seinen Gürtel zu nehmen. Vermutlich lag er noch in dem niedergebrannten Haus! Verdammt, er würde ihn nie wiedersehen. Die Eigentümer würden die Trümmer durchsuchen und ihn finden. Geschmolzen oder nicht, sie würden sein Gold dort finden.
»Es dürfte wohl weg sein«, meinte er niedergeschlagen.
»Ihr Gold? Wieso?«
»Die Schweine, die mich ausgeraubt haben«, log er erneut. »Was für ein Pech man doch haben kann. Zehn Jahre lang habe ich nach Gold gesucht. Und hielt es endlich in Händen …« Er fand Gefallen an der Geschichte. »Ich wollte gerade in die Zivilisation zurückkehren, als mich zwei Kerle aus dem Hinterhalt überfielen. Sie raubten mich aus, und ich dachte, ich würde im Buschfeuer sterben. Hätten mich meine schwarzen Freunde nicht gefunden, wäre ich jetzt tot.« Das jedenfalls war richtig. Jemand hatte ihn zusammengeflickt, vermutlich eine ihrer Frauen.
»So etwas Trauriges habe ich noch nie gehört«, bemitleidete ihn Polly. »Würden Sie die Kerle wiedererkennen?«
»Mag sein«, antwortete er müde. »Aber was nützt das schon?« Die Unterhaltung erschöpfte ihn. Alles erschöpfte ihn. Wohin sollte er gehen? Und wo war er überhaupt?
»Ich kapiere das immer noch nicht, Missus«, sagte er und stützte sich auf die gesunde rechte Seite. »Können Sie mir noch etwas über Brisbane erzählen? Wo genau liegt das?«
»Ungefähr dreißig Meilen von hier.«
»Ja. Aber wie weit ist es von Sydney?«
Sie sah ihn fassungslos an. »Von Sydney! Mein Gott, Sie sind vielleicht herumgekommen, Mr. Drew. Das ist weit weg. Fünf- bis sechshundert Meilen südlich, sagt man. Wir Regierungsleute wurden mit dem Schiff nach Moreton Bay gebracht.«
Jack verbarg ein Grinsen, war überrascht, dass er in dieser Lage noch Belustigung empfinden konnte, doch der Begriff »Regierungsleute« gefiel ihm. Selbst die Sträflinge gaben sich inzwischen vornehm. Vielleicht behandelte man sie heute besser … Zugegeben, es wäre ein Wunder, aber diese hier schienen es ganz gut zu haben. Kein Boss in Sicht, keine Ketten.
»Ich könnte also nicht zu Fuß nach Sydney laufen?«
»Wohl kaum. Jedenfalls nicht in Ihrem Zustand.«
Jack wusste insgeheim, dass sie seiner Geschichte misstraute. Wie war er so weit in den Norden gelangt, ohne Brisbane zu kennen?
»Ich bin durchs Landesinnere gewandert«, sagte er. »Bin im Laufe der Jahre einfach weitergezogen, immer auf der Suche nach Gold. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich überall gewesen bin.«