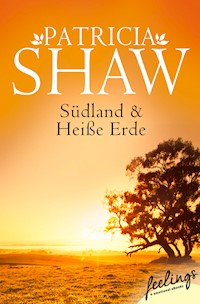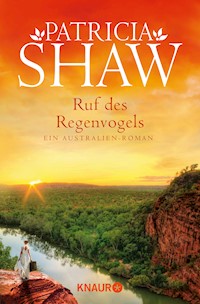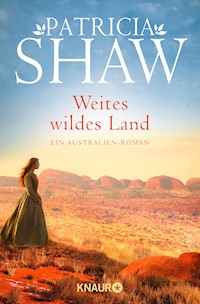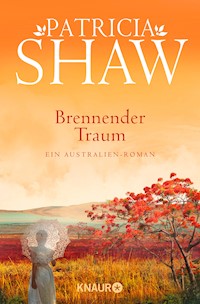6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Tasmanien im 19. Jahrhundert. Die Insel vor der Südküste Australiens ist für Sträflinge aus Europa der Inbegriff des Schreckens. Nicht selten werden sie wegen geringer Vergehen in Strafl ager verbannt, die nur die wenigsten überleben … Mehr Glück haben Sean und Angus, die als Zwangsarbeiter auf der Farm von Barnaby Warboy landen. Dort finden sie halbwegs menschliche Bedingungen vor – sie sollen dem reichen Plantagenbesitzer einen englischen Garten anlegen – und schöpfen Hoffnung, eines Tages wieder freie Männer zu sein. Doch dann wird Warboys Enkelin schwanger und weigert sich, den Namen des Vaters preiszugeben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 783
Ähnliche
Patricia Shaw
Insel der glühenden Sonne
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für
John und Wendy Daniher
Peter und Jean Scott
Elizabeth und Jamie Legge
und Peter Poynton BA LLB
In Liebe
Prolog
Oktober 1832
Ein Leichter, der letzte Vorräte für das Transportschiff Veritas an Bord hatte, legte von Gravesend ab und pflügte durch die raue See. Die Mannschaft versuchte, das alte Handelsschiff, das aus der Ostindienflotte ausgemustert worden war, noch vor den Beibooten zu erreichen, die in dieselbe Richtung fuhren. Sie beförderten Gefangene von der Hulk Earl of Mar, die in die Strafkolonie auf der entlegenen Insel Van Diemen’s Land deportiert werden sollten – als Gäste der Regierung, wie man sie scherzhaft nannte.
In ihrer großen Zeit war die Veritas ein stolzes Schiff gewesen, ein Veteran der ertragreichen Bengalen-China-Route, mittlerweile aber gezwungen, menschliche Fracht rund um den Globus zu transportieren.
Die Veritas schaukelte heftig, als wehrte sie sich gegen die Demütigung, und die Männer auf dem Leichter schauderten. Sie hatten die Holzverschläge unter Deck gesehen, die erst kürzlich eingerichtet worden waren und zweihundert ihrer Landsleute beherbergen sollten, und die Stahlringe, die man als Halterungen für die Ketten der Sträflinge in das billige Holz getrieben hatte.
Sie waren erleichtert, als sie das Rennen gewonnen hatten, und löschten rasch ihre Fracht, damit sie Augen und Ohren vor dem Elend der Männer in den Beibooten verschließen konnten. Neugierige Matrosen blickten voller Abscheu auf die Sträflinge in den Beibooten hinunter. Sie verurteilten sie nicht, kannten aber auch kein Mitleid.
Der Kapitän der Veritas bezeichnete die Hälfte seiner Mannschaft als Abschaum, hatte es jedoch schwer, anständige Seeleute für diese Fahrt zu finden. Sobald der frische Proviant verstaut und das Vieh gefüttert war, wies er den Bootsmann an, das Deck zu räumen und die Gefangenen an Bord zu holen.
1. Kapitel
Februar 1832
Der Richter runzelte die Stirn, sah sich im überfüllten Saal um und blätterte in dem schweren Protokollbuch, das vor ihm lag.
Carlendon war ein kleines geschäftiges Dorf am Stadtrand von London, in dem sich die Leute meist nicht für Strafprozesse interessierten. Heute jedoch wollten alle das Urteil über Lester Harris hören, da nicht nur eine, sondern gleich drei bedeutende Familien der Gegend in den Fall verwickelt waren. Und wie es das Schicksal wollte, war Harris durch Heirat mit den Mudlows, der Familie des Richters, verwandt.
Der Angeklagte war ein gut gebauter, gut genährter Bursche mit glatter Haut und ebenmäßigen Zügen, der viel Erfolg bei den Frauen hatte. Lester Harris wurde oft als attraktiv bezeichnet, doch Richter Jonathan Mudlow meinte, gewisse Makel in seinem Gesicht zu entdecken. Er hatte Lesters Augen immer bösartig gefunden – blasse, berechnende Augen, die unter schweren Lidern hervorblickten. Daher wunderte es ihn sehr, dass seine Cousine Josetta, eine reizende junge Frau und gewöhnlich nicht gerade töricht, eine Heirat mit Lester auch nur in Betracht gezogen hatte. Er hatte mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten, worauf seine Tante Ophelia ihn einen eifersüchtigen Griesgram schalt, da ihre Tochter immerhin den begehrtesten Junggesellen der gesamten Grafschaft ehelichen sollte.
Und so hatten Josetta und Lester geheiratet. Sie wurden Besitzer von Glencallan, einer schönen Farm, die Lesters Großvater ihm hinterlassen hatte, und bald auch stolze Eltern einer prächtigen Tochter namens Louise May.
Jonathan war bei der Taufe zugegen gewesen. Josetta wirkte geschwächt, was nach den Strapazen der Geburt nur verständlich war, doch man tuschelte, Lester misshandle sie.
Entsetzt fragte Jonathan seine Tante danach, die die Frage einfach abtat. »Unsinn! Wo hörst du nur solche Geschichten? Sicher, Lester ist temperamentvoll, doch würde er nie Hand an Josie legen. Niemals! Und sie hat jetzt sogar eine Dienstmagd. Wie viele Frauen können das schon von sich behaupten? In unserer Familie jedenfalls keine.«
Jonathan studierte die Akte, hüstelte, klopfte auf den Tisch und wandte sich an den Gefangenen. »Man hat Sie des besonders brutalen und grundlosen tätlichen Angriffs auf einen Herrn in Tateinheit mit Körperverletzung für schuldig befunden. Das Opfer ist heute taub und kann den rechten Arm nicht mehr gebrauchen.«
Bei sich dachte er: Und wir wissen überdies, dass ein Zeuge behauptet, es habe bereits mehrere Angriffe gegeben, die nie vor Gericht verhandelt wurden.
Er sah, wie Lester höhnisch grinste und die Augenbrauen hochzog. Selbst jetzt schien die Familie Harris noch zu glauben, sie stünde über dem Gesetz und könne diese Angelegenheit mit Geld aus der Welt schaffen. Sie hatten ihm unverblümt erklärt, dass sie von ihm erwarteten, seinen Cousin mit einer Geldbuße davonkommen zu lassen. Was Jonathan in seiner Urteilsfindung nur bestärkt hatte. Immerhin war das Opfer Matthew Powell-Londy, Besitzer einer Sägemühle, und die Verletzungen, die er davongetragen hatte, würden ihn bei der Ausübung seiner Geschäfte stark behindern. Zudem arbeitete sein Bruder als Juraprofessor in Cambridge und hatte dem Vater, James Powell-Londy, einem ebenso mächtigen wie verbitterten Mann, geraten, die Todesstrafe zu fordern. Beide saßen nun im Saal und funkelten den Richter an.
Andererseits musste Jonathan an Josie denken. Sie hatte vor seiner Tür um Gnade gefleht, worauf er versucht hatte, sie wegzuschicken: »Ich kann dir nicht länger zuhören. Das Verbrechen wurde vor Gericht verhandelt, es ist vorbei.«
»Aber er hat es nicht mit Absicht getan«, beharrte sie. »Es war nur ein Temperamentsausbruch. Er wurde nämlich sehr wohl provoziert. Das Holz, das er bestellt hatte, wurde zu teuer berechnet, und wir können uns ohnehin wenig leisten, wo wir gerade die neuen Ställe bauen.«
Jonathan hatte den Kopf geschüttelt. »Komm, Josie, erzähl keine Märchen, eure Farm läuft gut.«
»O Gott, sieh mich nicht so an. Lester bedauert seine Tat wirklich …«
»Ach ja? Ist mir gar nicht aufgefallen.«
»Doch. Du musst ihn freilassen. Er wird es nie wieder tun!«
»Josie, du verstehst mich immer noch nicht. Es gibt zweihundert verschiedene Vergehen, für die man die Todesstrafe verhängen kann, und es sind weit harmlosere darunter.«
»Was?« Sie war entsetzt zurückgewichen. »Das kannst du doch nicht wirklich wollen! Die Todesstrafe, bist du von Sinnen? Unsere Tochter ist erst zwölf, du würdest doch nicht …« Sie konnte nicht weitersprechen und stürzte in die Nacht hinaus; ihr Klagen verhallte in der dunklen Straße.
Als Nächstes hämmerte der alte Harris an seine Tür, doch Jonathan öffnete nicht. Er hielt eine Gefängnisstrafe in Newgate für die angemessene Lösung. Zehn Jahre Haft statt des Galgens.
Die vergangene Nacht hatte an seinen Nerven gezehrt. Er träumte von Tumulten im Dorf, von Plünderung und Brandschatzung und sah sich selbst im hellen Sonnenschein unter dem Galgen stehen, während Kinder zu seinen Füßen spielten und die bunt geschmückte Schlinge vor seinen Augen baumelte.
Jonathan war noch erschöpft von den schlimmen Träumen und der bedrückenden Erkenntnis, dass ihm jede Entscheidung Zorn und Entrüstung einbringen würde.
Dann wurde ihm klar, dass Newgate eigentlich viel zu nah war.
Er malte sich die Zukunft aus und sah Mitglieder des Harris-Clans und ihre Freunde, die nach Besuchen in dem üblen Zuchthaus wieder und wieder ihre Wut an Lesters Richter ausließen. Jonathan wollte nicht am Pranger enden, so Leid es ihm auch tat, dass ausgerechnet er Josettas Mann verurteilen musste.
Er griff nach seinem Hammer und rief den Saal zur Ordnung, bevor er das Urteil verkündete: »Lester Harris, hiermit verurteile ich Sie für dieses Verbrechen zu zehn Jahren Haft, die Sie in der Strafkolonie Van Diemen’s Land verbüßen werden. Sie werden umgehend ins Newgate-Gefängnis gebracht und so bald wie möglich in die Kolonie verbracht.«
Harris wurde davongezerrt, während er wüste Beschimpfungen ausstieß, doch seine Stimme erstarb in dem Geschrei, das durch den Saal hallte. Jonathan hatte noch weitere Fälle zu verhandeln, vertagte sich aber und suchte Zuflucht im Büro des Urkundsbeamten, bis sich die Menge zerstreut hatte. Dann war es vorbei, er verspürte Erleichterung. Bis auf Josetta und ihre Tochter würden die Menschen Lester Harris bald vergessen.
Und wenn sie halbwegs vernünftig war, würde sie sich scheiden lassen.
An diesem Abend kam Josettas Schwiegervater Marvin Harris zu Besuch. Er tobte vor Zorn über das Urteil.
»Josie, ich bin ein praktisch veranlagter Mann, also reden wir offen darüber. Ich weiß, Glencallan gehört meinem Sohn, er hat es von seinem Großvater geerbt, aber du kannst die Farm nicht ohne Lester führen. Er wird nicht zurückkommen, daher müssen wir gemeinsam versuchen, sie zu halten.«
Sie saß am Küchentisch, betäubt vom Weinen, und konnte an nichts anderes denken als an die brutale Strafe, die ihr eigener Cousin über Lester verhängt hatte. Entsetzt hatte sie zugesehen, wie man ihren Mann wegschleppte. Sie konnte das ganze Ausmaß der Strafe noch gar nicht erfassen … ihr Mann, ihr Geliebter, würde zehn Jahre von ihr getrennt sein. Das war nicht möglich. Es war, als würde man sagen, es werde zehn Jahre lang Nacht bleiben oder der Mond nie wieder am Himmel erscheinen. Sie ließ Marvin weiterreden. Sie hatte nie viel Wert auf Lesters Familie gelegt und konnte nur an die Qualen denken, die er jahrelang in einem finsteren Gefängnis würde erdulden müssen.
Als Marvin schließlich überzeugt war, dass Josetta seine Pläne verstanden hatte, begleitete er sie nach London, wo sie Lester im Gefängnis besuchen wollte.
Newgate war der entsetzlichste und schmutzigste Ort, den Josetta je erlebt hatte, und obwohl sie es nicht aussprach, war sie froh, dass ihr Mann nicht mehr lange dort gefangen sein würde. Zum ersten Mal wurde ihr klar, dass Jonathans Urteil auch Vorteile bergen könnte.
Auf Marvins Rat hin verbarg sie ihr Gesicht unter der Kapuze, als sie durch die stinkenden, steinernen Flure gingen.
»Sieh nicht hin, Josie, das ist nichts für dich. Die üblen Kerle sollen dir nicht ins Gesicht grinsen.«
Er bezahlte einen Wärter, der Lester in eine leere Zelle führte, wo sie sich ungestört unterhalten konnten. Sein Anblick schockierte sie.
»Wird Zeit, dass ihr kommt«, brüllte Lester. »Ihr wollt mich hier wohl verfaulen lassen, was? Habt ihr was zu essen dabei?«
Josetta war einer Ohnmacht nahe, und Marvin schnappte sich ihren Korb. »Hier, mein Sohn, jede Menge, Wurst, ein Schinken, Brot, Pasteten von deiner Mutter …«
Er verstummte, als Lester darüber herfiel und sich das Essen gierig in den Mund stopfte.
»Habt ihr mir Geld mitgebracht?«, fragte er kauend. »Hier braucht man Geld, wenn man Essen, saubere Kleidung oder frisches Wasser haben will. Sie haben mir alles weggenommen, was ich bei mir hatte, kein einziger Fetzen am Leib, der mir gehört. So kann ich nicht leben.« Er packte seinen Vater am Revers. »Ihr müsst mich hier rausholen. Tut was! Zahlt, was immer sie verlangen. Verkauft notfalls die Farm.«
Etwas anderes kam für Lester nicht in Betracht. Er fieberte seiner Freilassung entgegen und verlangte, sein Vater solle sich umgehend darum kümmern. Mit Josetta sprach er kaum und drängte sie nur, Marvin ebenfalls anzutreiben.
Schließlich brach er in Tränen aus. »Ich flehe euch an, holt mich hier raus, bevor es zu spät ist. Es heißt, das Transportschiff kann jeden Tag aufbrechen.«
Marvin mietete zwei Zimmer in einem nahe gelegenen Gasthaus, bemühte sich bei den Behörden vergeblich um Gnade für seinen Sohn, suchte täglich das Gefängnis mit einem Korb voller Nahrungsmittel und Wein auf. Er und Josetta saßen gleichmütig da, während Lester sie mit Beschimpfungen überhäufte. Als dieser endlich begriff, dass es kein Zurück gab, brachte Marvin die Farm zur Sprache.
»Es fällt mir schwer, dir das zu sagen, mein Sohn, aber wir müssen auch an uns denken. Du wirst eines Tages wiederkommen, aber bis dahin …«
Lester saß mit hängendem Kopf auf der Bank und bewegte sich nur, um sich ein Stück Brot und den Apfel zu nehmen, den Josetta für ihn geschält hatte. Er schien nicht zuzuhören, doch Marvin drängte weiter.
»Ich habe mir Folgendes überlegt. Da Josetta Glencallan nicht ohne dich führen kann, könnten wir sie mit meiner Farm zusammenlegen und einen einzigen großen Besitz daraus machen. So wäre das Land für dich sicher. Wenn du es so lässt, wie es ist, könnte Josetta womöglich einen anderen Mann ins Haus holen, ihn sogar heiraten!«
»Nein! Wie kannst du so etwas sagen, Pa Harris! Ich liebe Lester, ich würde niemals …« Sie brach in Tränen aus.
Lester beachtete sie gar nicht. »Eine einzige große Farm?«, knurrte er. »Eine einzige große Farm?«
»Ja. Ich habe die Papiere dabei.« Marvin griff in seine Westentasche. »Wenn du mir Glencallan überschreibst, musst du dir nie mehr Sorgen darum machen.«
Lester schoss von der Bank hoch und rammte die Faust gegen die Mauer.
»Hältst du mich für so dämlich? Meinst du, ich wüsste nicht, was du vorhast? Du hast mir Glencallan nie gegönnt, hast Großvater verflucht, weil er mir die Farm hinterlassen hat, hast ihn noch am Grab verflucht. Und jetzt willst du sie ganz für dich! Und mein Bruder reibt sich schon die Hände! Aber so weit wird es nicht kommen. Raus!«
Er stürzte sich auf seinen Vater und stieß ihn aus der Zelle.
Josetta versuchte, ihn zu beschwichtigen, während der schlampig gekleidete Wärter gelangweilt zu ihnen herübersah.
»Gib ihr die Papiere«, knurrte Lester, griff danach und hielt sie Josetta hin. »Ich muss mit dir reden. Allein.« Er nahm sie beiseite.
»Lester, du weißt, ich würde dich nie …«
»Setz dich und hör zu. Ich habe mich umgehört, um etwas über dieses Van Diemen’s Land herauszufinden. Auf diese Idee seid ihr vermutlich gar nicht gekommen.«
»Wir hatten nicht genug Zeit«, wimmerte sie, »wir waren so besorgt um dich.«
»Überlass die Sorgen von jetzt an mir, denn ich habe einen Auftrag für dich. Verkaufe die Farm mit allem, was dazugehört. Dann buchst du eine Überfahrt für dich und die Kleine nach Van Diemen’s Land.«
Sie schlug die Hände vor den Mund. »Wie meinst du das? Ich kann doch nicht im Gefängnis leben.«
»Das zeigt, wie wenig Ahnung du hast. Du bist genauso dumm wie mein Vater. Ich habe mich erkundigt. Menschen werden sich ansiedeln, sie wandern dorthin aus statt nach Amerika. Auf der Insel gibt es schon eine Stadt namens Hobart, und viele machen ein Vermögen, weil die Sträflinge kostenlos für sie arbeiten. Stell dir das vor! Eine Farm, auf der man niemanden zu bezahlen braucht!«
»Aber ich kann nicht einfach in die Wildnis reisen. Ich wüsste gar nicht, wie ich es anfangen soll.«
»Dann lernst du es besser schnell, denn du wirst nach Van Diemen’s Land auswandern, mit meiner Tochter und meinem Geld, und dort eine Farm kaufen. Falls nicht, schwöre ich, dass ich dich nach meiner Rückkehr töte.«
Sie versuchte, ihn zu beruhigen. »Lester, Liebster, du bist außer dir. Hör mir bitte einmal zu. Ich tue alles, was du von mir verlangst. Ich kann es nicht ertragen, ohne dich zu sein. Wenn du mir langsam und geduldig erklärst, was ich machen soll, werde ich alles Menschenmögliche tun, um bald bei dir in Van Diemen’s Land zu sein.«
Überrascht sah Marvin, wie Lester Josetta in die Arme schloss, und dachte traurig, wie töricht sein Sohn doch war, die Farm einer Frau anzuvertrauen.
Doch als Josetta Glencallan an einen Fremden verkaufte, der ihn selbst überboten hatte, war Marvin außer sich vor Zorn.
Dublin, April 1832
Patrick O’Neill versprach seiner Frau, er werde um ihren Sohn kämpfen, solange noch ein Funke Leben in ihm sei. Er verbot ihr, zu verzweifeln. Und in der Tat schien er zunächst Erfolg zu haben. »Der erste Anklagepunkt war wenig mehr als ein öffentliches Ärgernis durch Trunkenheit.«
»Eine aufrührerische Versammlung«, korrigierte ihn der Rechtsanwalt. »Tätlicher Angriff, Sachbeschädigung.«
»Ist doch das Gleiche. Und der Anklagepunkt, Mitglied der Young Ireland Association zu sein, trifft ebenfalls nicht zu. Unser Matt war nie politisch. Er war in diesem Haus nur zu Besuch.«
»Das sagen alle.«
O’Neill schlug mit der Hand auf die Tischplatte. »Sie sind nicht hier, um sich auf deren Seite zu stellen! Ich bezahle Sie, damit Matt nach Hause kommt. Wir übernehmen die Geldstrafe, so hoch sie auch sein mag, aber Sie müssen Ihren Einfluss geltend machen. Sitzen Sie nicht einfach herum, tun Sie was!«
»Mr. O’Neill, was den ersten Anklagepunkt betrifft, ist es mir gelungen, die Strafe von zehn auf fünf Jahre herunterzuhandeln. Allerdings scheint Ihnen nicht bewusst zu sein, dass der zweite Punkt sehr viel schwerer wiegt.«
»Sie haben mir nicht zu erklären, was mir bewusst ist und was nicht!«, tobte O’Neill. »Ich weiß, was die vorhaben, aber sie werden nicht alle über einen Kamm scheren und zu lebenslänglicher Haft verurteilen! Mein Sohn ist keiner von denen, er hat noch nie eine Waffe in der Hand gehalten!«
»Aber er hat sich ihnen angeschlossen, Mr. O’Neill. Seine Unterschrift im Mitgliedsbuch ist eindeutig. Und in dem Haus wurde ein Überfall geplant.«
»Herrgott, das wurde doch nie bewiesen. Es gab keine Zeugenaussagen.«
Der Anwalt seufzte. »Ich habe mein Möglichstes getan. Es ist besser, nach Van Diemen’s Land deportiert zu werden, als viele Jahre hier im Gefängnis zu verbringen.«
»Da irren Sie sich. Sie können ihn nicht einfach von seiner Familie wegreißen. Sie müssen die Deportation verhindern! Legen Sie Berufung ein, bevor es zu spät ist.«
»Das habe ich bereits gemacht, sie wurde abgelehnt. Mehr kann ich leider nicht tun.«
»Und was ist mit meinem Neffen Sean Shanahan?«
»Sein Urteil stand von Beginn an fest, Mr. O’Neill, das habe ich Ihnen gesagt. Angriff und Raubüberfall! Darauf steht lebenslänglich!«
»Aber es war nur ein Dummejungenstreich!«
»Das sieht der Richter leider anders.«
Obwohl es ein warmer Tag war, schien Patrick der Raum plötzlich eiskalt. Ein Schauer überlief ihn. »Haben Sie gelesen, dass ein englisches Sträflingsschiff vor der französischen Küste gesunken ist? Einhundertsechzehn Verurteilte sind ertrunken.«
»Ja«, bestätigte der Anwalt traurig, »aber es waren lauter Frauen. Und einige Kinder.«
»Gott steh Ihnen bei, Mann! Glauben Sie etwa, dass Männer eine bessere Chance gehabt hätten? Angekettet, mit weniger Platz für sich als jede Ratte?«
»Das behaupte ich ja gar nicht. Bedauerlicherweise kann ich Ihnen zurzeit einfach nicht behilflich sein.«
»Dann zeigen Sie mir wenigstens, wie man eine Petition an die Regierung aufsetzt.«
»Zu welchem Thema?«
»Zum Verbot der Deportation unserer Bürger in unbekannte Gegenden der Welt. Könnten wir darüber sprechen?«
»Für Matt ist es zu spät.«
»Meinen Sie, ich wüsste das nicht? Sie sollten mich nicht unterschätzen, Mann. Zeigen Sie mir nur, wie man diese Petition schreibt. Wenn ich meinem Sohn schon nicht helfen kann, möchte ich doch etwas für die Söhne und Töchter anderer Männer tun. Ich werde nicht mit leeren Händen zu meiner Frau zurückkehren.«
»Na schön. Ich lasse meinen Sekretär die offiziellen Petitionsformulare holen. Wenn sie ausgefüllt sind, sorge ich dafür, dass ein Parlamentsmitglied sie in Ihrem Namen einreicht.«
Danach ging Patrick die Sackville Street entlang zu seinem Hotel, wo er das Päckchen mit warmen Kleidern abholte, die seine Frau für Matt eingepackt hatte. Schweren Herzens begab er sich zum Gefängnis.
Am Tor wollte er gerade seinen Erlaubnisschein vorzeigen, als ein Mädchen auf ihn zustürzte und ihn am Arm festhielt.
»Warten Sie, Mr. O’Neill! Darf ich mit, die wollen mich allein nicht reinlassen. Ich muss unbedingt zu Sean.«
Er runzelte die Stirn. »Ach, du bist es, Glenna Hamilton. Du gehörst hier nicht hin. Das ist kein Ort für eine junge Dame.«
»Bitte, Sean wird auch weggeschickt. Er und Matt können jeden Tag an Bord gebracht werden. Sie werden mich doch nicht daran hindern, ihn ein letztes Mal zu sehen.«
Patrick blickte in ihr reizendes Gesicht und erinnerte sich, dass auch Matt sich einmal für Glenna interessiert hatte. Zuletzt war sie jedoch mit seinem Cousin Sean Shanahan gegangen. Und nun waren beide verbannt.
Er war tief erschüttert über das Schicksal der jungen Burschen, doch die Sorge des Mädchens rührte ihn, und es konnte nicht schaden, wenigstens Sean ein wenig aufzumuntern.
»Na gut. Zieh dir das Tuch übers Gesicht und halt den Mund. Ich sehe zu, ob ich ihn finde.«
Man führte sie über einen Hof und durch einen Torbogen zum Besuchereingang, wo sie mit einem älteren Paar und einer dicht aneinander gedrängten Familie warteten, bis man die Tür aufschloss. Sie mussten sich vor einer Bank aufstellen und ihre persönlichen Besitztümer aushändigen.
Die Wärter, drei Männer und eine Frau, beobachteten sie dabei. Nachdem sie ihre Tasche und die Kleeblattbrosche abgegeben hatte, musste sich Glenna von dem hässlichen Weib abtasten und durchsuchen lassen.
Sie sah Mr. O’Neill, der aus der Männerschlange wütend die Frau beobachtete, die mit eisenharten Händen Glennas Körper abklopfte, doch sie schüttelte nur den Kopf, um ihn zu beschwichtigen. Dann durchsuchte man auch ihn. Sie wurden durch einen langen Korridor geführt, bis man ihnen befahl, stehen zu bleiben, als wären sie Soldaten. Die Wärter ließen sie die ganze Zeit nicht aus den Augen.
Glenna war ganz kribbelig vor Aufregung, weil sie Sean gleich sehen würde, und fand den Ausflug ins Gefängnis beinahe abenteuerlich. Bisher unterschied es sich mit dem Steinboden und den grün gestrichenen Wänden kaum von anderen Regierungsgebäuden.
Ein Wärter holte zuerst das alte Paar ab und dann Mr. O’Neill, worauf Glenna vortrat, um mitzugehen. Man schickte sie zurück hinter die schwarze Wartelinie, die sie erst jetzt bemerkte.
»Sie gehört zu mir«, sagte O’Neill, doch man teilte ihm mit, sein Sohn befinde sich auf dem Hof, zu dem Frauen keinen Zutritt hätten.
»Wo kann sie Sean Shanahan sehen?«, fragte Patrick. »Sie hat eine Erlaubnis.«
»Er ist auch draußen. Wir schicken ihn in die Zelle. Du hast nur zehn Minuten, Mädchen, hättest früher kommen sollen. Die kriegen gleich ihren Tee.«
Mr. O’Neill zuckte ungeduldig mit den Schultern und ging los, gefolgt von dem Wärter. Glenna sah ihnen nach. Als sie um eine Ecke verschwanden, wandte sie sich an den Wärter, der ein Schreibbrett bei sich trug und für die Besucher zuständig zu sein schien.
»Was ist denn nun mit mir, Sir?«, fragte sie freundlich, doch er verzog das Gesicht und sagte etwas nach hinten zu seinem Kollegen, das gewiss obszön war und mit Lachen und anzüglichen Blicken quittiert wurde.
Glenna wandte sich errötend ab, und eine Frau sagte laut: »Kümmern Sie sich nicht um die, Kleines. Für so was sind Sie zu gut.«
Dann rief man ihren Namen auf, und Glenna rannte beinahe den Korridor entlang zu einer schweren Tür, die geöffnet und hinter ihr wieder abgeschlossen wurde. Ihr lief die Zeit davon. Man führte sie in ein kahles Zimmer, das keinerlei Möbel enthielt und dessen schmales Fenster vergittert war.
»Ist das seine Zelle?«, fragte sie ungläubig, doch die Tür schlug schon zu. Da sie nicht abgeschlossen war, schlich Glenna hin und wollte sie gerade ein wenig öffnen, um Luft hereinzulassen, doch in diesem Moment stieß man Sean wie einen Sack Kartoffeln herein.
Er trug Fußeisen, hatte die Hände auf den Rücken gefesselt und fiel beinahe hin, doch Glenna fing ihn auf, und sein Mund presste sich auf ihren, suchend, forschend. Sie geriet außer sich.
»Du bist immer noch so schön, was immer sie dir auch antun mögen.« Dann fiel ihr ein, dass er oft gesagt hatte, Schönheit sei nichts für Männer.
»Mein Gott, ich liebe dich so«, sagte Sean und versuchte, sie mit gefesselten Armen an sich zu drücken. »Ich wäre gestorben, wenn du dich nicht von mir verabschiedet hättest.«
»Es ist kein Abschied«, rief sie, als er zur Wand hinüberschlurfte und sich dagegen lehnte. »Du kommst wieder, das spüre ich. Und ich werde nie aufhören, dich zu lieben, Sean, niemals.«
Sie klammerte sich an ihn, sie küssten sich stürmisch, als hörten sie die Uhr ticken. Glenna knöpfte die Bluse auf, bot ihm ihre nackten Brüste dar, tastete nach seinem Geschlecht, wollte ihm einen kurzen Genuss bereiten. Noch nie war sie so kühn gewesen, hatte sich nie so freizügig gezeigt, und er stöhnte auf, beteuerte wieder und wieder seine Liebe, sein Bedauern, dass es so weit gekommen war. Dann flog die Tür auf, und der grinsende Wärter stand auf der Schwelle. Sean trat vor Glenna, damit sie die Knöpfe ihrer Bluse schließen konnte, und wunderte sich, dass es sie überhaupt nicht zu kümmern schien, ob der Wärter sie beobachtet hatte.
Sean küsste sie lange und zärtlich, bevor man ihn abführte. Wie betäubt verließ Glenna die Zelle, holte ihre Besitztümer ab und wartete auf Mr. O’Neill, der bald nachkam.
»Sie fahren morgen«, sagte er mit heiserer Stimme. »Beide.«
Glenna schlug den Mantelkragen hoch, um ihre Tränen zu verbergen.
Themse, Oktober 1832
Eine der heruntergekommenen Hulks, die auf der Themse schaukelten, trug noch den stolzen Namen Earl of Mar, hatte aber ihre glorreiche Zeit als Kriegsschiff lange hinter sich. Heute beherbergte sie den Überschuss der Londoner Gefängnisse. Die Männer wohnten an Bord und wurden täglich an Land geschickt, um in einer als Bosney Flats bekannten Niederung Sümpfe trockenzulegen. Hier sollte Land aufgeschüttet werden, damit Schiffe mit größerem Tiefgang die Kais besser erreichen konnten.
Niemand außer den unglücklichen Gefangenen schien zu merken, dass es an diesem Morgen schneite und das schlammige Wasser mit einer Eisschicht bedeckt war. Die Aufseher waren bis zur Nasenspitze vermummt und trieben die Männer zur Eile an.
Angus McLeod, der früher in Glasgow gelebt hatte, watete ins knietiefe Wasser und zerrte dabei ein Floß hinter sich her, auf dem das gerodete Schilf abtransportiert wurde. Er lauschte den Flüchen seiner frierenden Kameraden. Welche Ironie, dachte er. Sechs Monate zuvor hatte man ihn zur Deportation nach Van Diemen’s Land verurteilt, weil er gegen die unerträglichen Arbeitsbedingungen der Arbeiter protestiert hatte, und heute schufteten er und die anderen Sträflinge unter weitaus schlimmeren Bedingungen als die Armen in den Glasgower Slums.
Er beklagte sich bei George Smith bitterlich über die Behandlung. George lachte nur wie über einen Witz, doch Angus fand nichts Witziges an den Grausamkeiten, die sie erduldeten, den langen Arbeitszeiten und kargen Rationen, bei denen man nur verhungern konnte. Er behauptete, Gefangene besäßen Rechte, sie dürften sogar Beschwerde einlegen.
»Hör auf zu grübeln«, meinte George. »Kannst nichts dran machen. Wenn du nicht drüber nachdenkst, ist es halb so schlimm. Machst es dir nur selber schwer, Angus.«
George war ein freundlicher Bauer aus Südengland, der sich angeblich einen preisgekrönten Ziegenbock »ausgeliehen« hatte, um seine Zuchtziege zu decken. So war er mit dreihundert anderen Männern auf diesem stinkenden Wrack von einem Schiff gelandet, auf dem immer wieder Kämpfe ausbrachen.
Erst vor zwei Nächten hatte ein Schläger namens Lester Harris, der sich selbst zum Boss eines Arbeitstrupps ernannt hatte, einen Mann wegen einer Meinungsverschiedenheit bewusstlos geschlagen. Dann hatte er sich noch die Decke des Mannes schnappen wollen, doch George war dazwischengegangen.
»Wer will mich davon abhalten?«, hatte Harris gebrüllt, doch als George unvermittelt ein Messer zog, hatte sich der Streit schnell gelegt, und der Verletzte konnte seine Decke behalten.
»Auf Waffenbesitz stehen furchtbare Strafen«, fühlte Angus sich bemüßigt zu erklären. »Harris wird dich melden.«
»Wird er nicht«, grinste George. »Dazu fehlt es ihm an Mumm.«
Als Angus sich noch in Newgate befand, war es ihm gelungen, seiner Cousine Ursula einen Brief an seine Eltern mitzugeben. Sie sollte sie nach London holen, damit er sich wenigstens von ihnen verabschieden konnte. Sie hatten ihn im Glasgower Gefängnis nicht besucht, obwohl Ursula sie hatte überreden wollen, doch ihre Bestürzung und Verwirrung waren wohl zu groß gewesen. »Es ging alles so schnell«, hatte sie beim Besuch erklärt. »Und sie kennen sich nicht mit den Vorschriften aus.«
»Aye, verstehe, es muss ein Schock gewesen sein, als sie mich verhafteten, aber wenn jemand mitkommt … und sie herbringt …«
»Ich werde es versuchen. Aber du weißt auch, dass sie mich für ein gefallenes Mädchen halten, weil ich im Grand Hotel arbeite und wohne. Selbst meine Mutter sieht mich mittlerweile schief an.«
»Sie waren immer besonders auf Anstand bedacht. Meine Mutter ist streng gläubig, aber wenn sie mich auf Jahre aus dem Land verbannen, ohne dass ich ihr Lebewohl sagen könnte, würde es mir das Herz brechen. Natürlich darfst du es nicht so ausdrücken, aber sie werden womöglich sterben, bevor ich heimkehre, das wäre die schlimmste Strafe überhaupt.«
Er stand vor dem vergitterten Fenster und trat gegen die Wand. »Begreifen diese verfluchten Richter denn nicht, dass solche Strafen unerhört und unverantwortlich, dass sie dem Vergehen in keiner Weise angemessen sind?«
Ursula hatte respektvoll genickt. Das Mädchen wusste gar nicht, worüber er sprach; die Armen waren so niedergedrückt, dass sie selten aufblickten, geschweige denn die Faust erhoben, um sich zu wehren. Und seine Mutter war genauso, wenn nicht noch schlimmer. Sich über Hungerlöhne zu beklagen, kam in ihren Augen einer Verletzung der eigenen Würde gleich.
»Sollen uns die Leute denn für bettelarm halten?«, hatte sie eines Abends getobt, als er von einer Protestveranstaltung heimkehrte.
»Wir sind bettelarm.«
»Dann hättest du mal sehen sollen, wie wir aufgewachsen sind. Ein Topf Haferschleim zum Abendessen, wenn wir Glück hatten. Geld für Feuerholz gab es nicht. Und die Winter waren damals kälter …«
Sie wehrte sich gegen Veränderungen, trug ihr Leben lang Schwarz, einen Rock für den Winter, einen für den Sommer. Und dankte dem Herrn, der sie behütete.
Dann versuchte er es bei seinem Vater. »Die großen Herren bestehlen uns. Mästen sich durch unserer Hände Arbeit. Verstehst du das denn nicht?«
Doch Jim McLeod hielt nichts von solchem Gerede. »Vielen geht es noch schlechter als uns.«
»Sicher, denen müssen wir auch helfen.«
»Ich finde, du solltest deine Arbeit tun und dich um deine Angelegenheiten kümmern.«
Ursula stand in der Zellentür und rief ihn in die Gegenwart zurück. »Sorge dich nicht, Angus, ich sage deiner Mutter, dass nicht viel Zeit bleibt.«
Doch seine Eltern waren zu spät gekommen und hatten ihn in London nicht mehr finden können. Nur wohlhabende Leute wie Familie Harris konnten dafür bezahlen, unter Bewachung von der Kutschenstation an der Kreuzung von Bosney abgeholt und zu ihren Angehörigen geführt zu werden.
Harris war dort einmal mit seiner Frau zusammengetroffen.
»Wir hatten Geschäfte zu besprechen«, knurrte er, als ihn seine Mitgefangenen mit den üblichen obszönen Bemerkungen empfingen, und schwieg danach.
Nach drei Monaten in der Hulk, in denen Angus nichts von seinen Eltern gehört hatte, näherten sich mehrere Beiboote der Earl of Mar.
»Auf geht’s, ihr Süßen!«, flötete der Aufseher, als die Namen verlesen wurden. Über hundert Männer drängten sich auf dem welligen, unebenen Deck. »Die Veritas wartet schon darauf, euch ans Ende der Welt zu bringen, wo braune Mädchen mit Baströckchen singend in der Sonne sitzen und auf geile Engländer hoffen.«
»Was ist mit den Schotten?«, brüllte einer. »Wir sind die bessere Wahl.«
»Meinst du, das mit den Mädchen stimmt?«, wollte Freddy Hines von Angus wissen. Er war ein drahtiges Kerlchen, der an Land mit ihm gearbeitet hatte.
»Höchstens eiserne Jungfrauen«, meinte Angus.
»Auf dem Schiff könnten auch Frauen sein«, erwiderte Freddy hoffnungsvoll. »Es heißt, die schicken auch weibliche Gefangene dorthin.«
Plötzlich erhob sich Geschrei unter den Gefangenen. Einige warfen sich aufs Deck, weinten um ihre Familien, brüllten in Panik, sie könnten nicht schwimmen, und widersetzten sich den Aufsehern. Andere weigerten sich, die Beiboote zu besteigen. Manche versuchten, in den Fluss zu springen, und ein Mann brüllte mit Schaum vor dem Mund, man wolle sie im fernen Ozean ertränken, womit er allen gründlich Angst einjagte.
Bis dahin hatte Angus sich nicht vor der Reise gefürchtet, doch selbst er hatte ein ungutes Gefühl, als er neben einem Ruderer ins Beiboot springen sollte. Allerdings war die Angst nichts im Vergleich zu dem Schmerz, seine geliebten Eltern ohne ihren Segen verlassen zu müssen. Sein Herz war so schwer, dass er gegen die Tränen ankämpfte. Als die Seeleute sich mit ihren Rudern gegen den Wind stemmten und das Gewicht ihrer menschlichen Fracht verfluchten, wandte Angus sich an den nächsten Ruderer.
»Aye, natürlich sind wir schwer. Ich würde euch gern die Last erleichtern. Werft mich ruhig über Bord«, sagte er bitter.
Sobald sie an Bord taumelten und wie gestrandete Fische auf dem schlüpfrigen Deck der Veritas zappelten, griffen kräftige Hände nach ihnen und rissen ihnen die Kleider vom Leib, worauf trotz der Kälte eine Flut von Salzwasser aus Schläuchen auf sie niederprasselte.
»Schrubbt euch, aber gründlich«, brüllte ein Offizier, als man ihnen Seifenstücke zuwarf. »Wir wollen euren Dreck und eure Läuse nicht auf der Veritas haben.«
Er sprang beiseite, als die Schläuche über das Deck fegten. Manche Gefangenen klammerten sich an die Reling, um sich dort zu reinigen, sie wollten dem Gewirr aus nackten Körpern entkommen.
Man warf ihnen dünne Tücher zum Abtrocknen hin, und sie standen zitternd auf der trockenen Deckseite, während die nächsten Gefangenen die gewaltsame Reinigung erfuhren. Danach erhielten sie neue Kleidung – Hemd, Hose, Weste und Segeltuchschuhe. Als sie angekleidet waren, mussten sie sich in Reih und Glied aufstellen, und die Schiffsbarbiere machten mit Rasiermesser und Schere die Runde.
Freddy Hines sah sich verwundert um. »Hey, Shanahan. Wie soll ich euch jetzt noch unterscheiden? Mit Glatze seht ihr alle gleich aus.«
George Smith grinste. »Na ja, bei dir hat er noch ein paar Büschel stehen lassen.«
Sean Shanahan rückte von ihnen ab und sah sich suchend um. Freddy, der den Zorn des Iren spürte, schwieg lieber.
Danach mussten sie sich nacheinander bei einem Offizier melden, der ihre Namen auf einer Passagierliste abhakte. Es fielen bissige Bemerkungen über ihren Status als »Passagiere«, und der Offizier brüllte, die Matrosen sollten gefälligst die Beinfesseln holen. Hinter dem improvisierten Pult des Offiziers stand ein weißbärtiger Priester, der die Männer sanft ansprach und ihnen versicherte, er werde für sie beten. Für jene, die es interessierte, hielt er eine kurze Predigt über Glaube und Hoffnung, doch die meisten drängten sich an ihm vorbei, um ihre neuen Quartiere aufzusuchen.
Angus hörte den Priester sagen, dass er an Bord die Messe für sie lesen und für eine sichere Überfahrt beten werde. In Portsmouth werde er das Schiff verlassen, wolle aber gern letzte Nachrichten für ihre Liebsten mitnehmen. Angus und ein paar andere nahmen das Angebot sofort an, darunter auch ein hoch gewachsener, vornehm wirkender Mann namens Willem Rothery.
Der Priester, sein Name war Pastor Cookson, notierte ihre Namen und versprach, sie aufzusuchen, bevor er von Bord ginge.
Angus stieg zwei Treppen hinunter und war erleichtert, dass es sich immerhin um ein sauberes, seetüchtig wirkendes Schiff handelte. Alles war besser als die Hulk, auf der sie bisher gehaust hatten.
Erst als Aufseher die Matrosen ablösten und ihre Gefangenen in die engen Räume zwischen den hölzernen Plattformen drängten, die ihnen in den nächsten Monaten als Bett dienen sollten, wurde ihm klar, was ihnen bevorstand.
Auf den flachen Pritschen, die bestenfalls für einen klein gewachsenen Mann reichten, lag dünnes Bettzeug.
»So sollen wir schlafen? Angekettet, hier unten?« Es wurde unruhig, binnen Minuten herrschte Chaos unter Deck. Einige griffen die Aufseher an, andere drängten zum Ausgang, doch die Revolte war bald niedergeschlagen. Offenbar waren die Offiziere auf derartige Reaktionen vorbereitet, denn man holte wieder die Schläuche herbei, und die Hälfte der »Passagiere« blieb in durchnässter Kleidung in dem überfüllten Verlies zurück. Schon jetzt schaukelte das Schiff so stark, dass sich manche erbrachen und um Gnade flehten.
Sean Shanahan griff nach den Vorübergehenden und fragte sie nach einem Burschen namens Matt O’Neill, doch sie stießen ihn beiseite, wollten sich um jeden Preis eine Pritsche nahe am Ausgang sichern. Schließlich gab er es auf. Matt war nicht auf der Hulk gewesen, doch Sean hatte gehofft, er werde mit einem anderen Kontingent Gefangener auftauchen. Nun war es zu spät. Er zog sich in sich selbst zurück, saß reglos da, als man die Ketten durch die Ringe an seinen Knöcheln führte, um jeweils zehn Männer zu einer Gruppe zusammenzuschließen. Wie Ochsengespanne, dachte er verbittert, nur dürfen wir nirgendwohin gehen.
Am späten Nachmittag wurde es plötzlich still, als die Männer die erste Bewegung des Rumpfes spürten, der Wind die großen Segel blähte und die Veritas sich mit den Wellen hob und senkte. Sie hatten die Reise angetreten, und trotz ihrer bedrückenden Lage empfanden manche der jüngeren Männer eine gewisse Abenteuerlust, während andere sich ihrem Elend hingaben.
Nach einer schlaflosen Nacht gesellte sich Sean am nächsten Morgen zu der Gruppe, die zum Pastor an Deck gehen durfte. Nicht dass ihn der Priester selbst interessiert hätte, er wollte nur die kostbare halbe Stunde an der frischen Luft genießen. Er hatte sich gründlich auf die Reise vorbereitet. Seine Gefängniserfahrung riet ihm, den Mund zu halten, die Regeln zu befolgen und sich von Cliquen fern zu halten. Er war der Ansicht, er könne das System nur besiegen, indem er Streit vermied und abwartete, bis die Aufseher sorglos wurden. Auf dieser Reise war zwar nicht damit zu rechnen, doch seine gute Führung würde ihm gewisse Privilegien einbringen, die wiederum irgendwann die Tür in die Freiheit öffnen konnten.
Nur daran dachte Sean Shanahan und verzehrte sich förmlich in seinen Fluchtgedanken.
Pastor Cookson betrübte das Los der Gefangenen so sehr, dass er sich ungeheure Mühe gab, ihnen Trost und Hoffnung zu spenden. Er tat sein Bestes, um ihnen ein wenig Würde zu schenken, und bat den Kapitän um eine ruhige Ecke in der Achterhütte. Als die angeketteten Männer, die sich erst an die Schiffsbewegungen gewöhnen mussten, vor seinen Tisch stolperten, wurden sie dennoch wieder von bewaffneten Aufsehern begleitet.
Der Pastor seufzte. So viel zur Privatsphäre! Mehrere Männer behaupteten, sie seien unschuldig, und flehten ihn an, mit dem Kapitän über ihre Fälle zu sprechen, damit sie in Portsmouth von Bord gehen könnten. Die Wärter, die sie schamlos belauschten, unterbrachen derartige Gespräche sofort und zerrten die Gefangenen weg. Wer noch in der Warteschlange stand, überlegte sich gut, ob er das Gleiche versuchen wollte. Die meisten benötigten jedoch die Versicherung, dass der Herr sie nicht verlassen habe, und baten Cookson, er möge sie in seine Gebete einschließen.
Einige fragten auch, ob er, wie angeboten, ihre Abschiedsgrüße überbringen könne. Angus McLeod wies ihn nachdrücklich auf die richtige Adresse hin, denn seine Eltern hätten ihn nicht mehr im Gefängnis besuchen können. Der Priester sollte ihnen ausrichten, dass Angus sie sehr liebe, was er gewiss in schöneren Worten ausdrücken könne als er selbst.
Willem Rothery, der zu einer großen Gruppe gebildeter Männer gehörte und dessen Gegenwart den Pastor sehr überraschte, erzählte seine Geschichte und bat um Hilfe.
»Ich war ein Spieler, dem die Schulden über den Kopf gewachsen sind. Ich hatte eine verantwortungsvolle Position bei einer Londoner Bank und unterschlug insgesamt zweihundert Pfund, um, wie ich hoffte, mit Wetten aus meiner misslichen Lage herauszukommen. Die alte Geschichte«, seufzte er. »Ich dachte, ich könnte alles zurückzahlen, ohne dass es jemand merkt.
Natürlich kamen sie mir auf die Schliche. Ich wurde verhaftet und angeklagt. Da meine Vorgesetzten nicht wollten, dass die Sache herauskam, sollte ich das Geld umgehend zurückzahlen, was mir nicht möglich war. Sie verlangten, ich solle meinen Vater, Colonel James Rothery, der ihnen als wohlhabender Mann bekannt war, um das Geld bitten. Aber das brachte ich nicht über mich. Ich schämte mich zu sehr.
Also landete ich im Newgate-Gefängnis. Man hielt den Fall so geheim, dass meine Eltern, die in Cornwall wohnen, bis heute nichts von meiner Schande wissen. Ich wollte ihnen schreiben, aber es ging einfach nicht. Doch sie werden es bald herausfinden, werden sich wundern, was aus mir geworden ist … Herr Pastor, würden Sie Ihnen bitte schreiben? Sagen Sie, wie Leid es mir tut, dass ich sie enttäuscht habe und ich sie aus tiefstem Herzen um Verzeihung bitte.«
Ein Aufseher schritt ein. »Die Zeit ist um. Sie müssen wieder runter.«
»Aber da warten noch Männer.«
»Befehl des Kapitäns. Die müssen morgen wiederkommen.«
»Nur noch einen Augenblick.« Während die Wartenden weggetrieben wurden, notierte sich Cookson die Adresse von Rotherys Eltern und versprach, in seinem Namen an sie zu schreiben.
»Ich werde für Sie beten, Mr. Rothery«, sagte er. »Aber Sie dürfen sich nicht der Verzweiflung ergeben. Ihre Familie wird Sie gewiss verstehen. Und den Brief bringe ich gleich, wenn ich in Portsmouth an Land gehe, zur Post.«
Er hielt sein Wort. Sobald er eine Unterkunft in Portsmouth gefunden hatte, machte Pastor Cookson sich daran, die Bitten der Gefangenen zu erfüllen. Er begann mit Colonel und Mrs. J. Rothery, Loddor Estate, Truro, Cornwall.
Später an diesem Tag erfuhr er, dass dreißig weitere Gefangene im Zollamt warteten, um ebenfalls an Bord der Veritas gebracht zu werden, und eilte hin, um ihnen geistlichen Beistand zu leisten.
Anscheinend hatte sich der Kapitän des letzten Schiffes geweigert, die Männer mitzunehmen, da er ein Überladen fürchtete.
Cookson konnte mit einigen von ihnen sprechen und ihnen versichern, dass die Veritas seetüchtig sei. Wieder bot er an, Nachrichten zu überbringen, und ein gewisser Matt O’Neill erkundigte sich nach Sean Shanahan, der womöglich an Bord des Schiffes sei.
»Ein großer Kerl mit dunklen Locken und kurzem Bart«, erklärte O’Neill. »Er ist mein Cousin, ich würde gern mit ihm zusammen in den Südpazifik segeln.«
»Es gibt keine dunklen oder blonden Haare mehr, Mr. O’Neill, man hat alle kahl rasiert. Ich erinnere mich jedoch an einen Mr. Shanahan, der mit dem gleichen Akzent sprach wie Sie; er erkundigte sich nach den Lebensbedingungen in Van Diemen’s Land, wozu ich ihm jedoch nichts Näheres sagen konnte.«
O’Neill wirkte erfreut. »Danke, Herr Pastor, möge der Herr Sie auf ewig segnen.«
Pastor Cookson wandte sich an einen Jungen von etwa zwölf Jahren, der die Arme um den Körper geschlungen hatte. Sein Gesicht war weiß vor Angst.
»Es hat keinen Sinn«, meinte ein Wärter. »Er hat nicht gesprochen, seit er von dem Transportschiff hörte.«
»Muss er wirklich mit?«
Der Wärter sah ihn verblüfft an. »Natürlich. Wir haben schon Jüngere weggeschickt. Ist aber nicht so übel. Da draußen gibt es eine Schule. Ehrlich«, bekräftigte er, »da sind sie besser dran als hier, können was lernen, einen Beruf und so weiter.«
Ein anderer Wärter beugte sich mit höhnischem Grinsen vor. »Falls sie die Reise überleben.«
Tieftraurig kehrte der Pastor vom Hafen zurück und wünschte, er wäre dreißig Jahre jünger, denn diese Mission wäre eine Offenbarung für ihn gewesen. Zuerst hatte ihn die Vorstellung, den schlimmsten Sündern des Königreichs zu begegnen, ein wenig nervös gemacht. Männern, die angeblich so verdorben und boshaft waren, dass man sie ans andere Ende des Globus schickte, möglichst weit entfernt von Großbritannien. Die ganze Nacht hatte er um Mut gebetet, bevor er die Höhle des Löwen betrat.
Mut?, fragte er sich nun. Was für ein Dummkopf war er gewesen, der Propaganda Glauben zu schenken, denn mehr als das waren die Worte seines Bischofs von den »schlimmsten Sündern des Königreichs« nicht gewesen.
Nun wusste er, wie grausam und falsch dieses Gerede war. Wenn diese Männer die schlimmsten im Königreich sind, dachte er bei sich, ist die Gesellschaft in einem ausgesprochen guten Zustand.
Er wünschte, er hätte mit den Verbannten reisen und in der Strafkolonie eine Gemeinde gründen können. Doch er schüttelte den Kopf. Es war tragisch, wenn man seine wahre Berufung zu spät erkannte.
Monate vergingen, und Pastor Cookson, der nach Hause zurückgekehrt war, erhielt die unterschiedlichsten Reaktionen auf seine Nachrichten. Hatte der Gefangene Geld für seine Familie hinterlassen? Welche Entschädigung stand einer Witwe zu, deren Mann auf See ertrank? Wann konnte man den Gefangenen besuchen? Viele schienen zu glauben, Van Diemen’s Land läge in der Nähe der Isle of Wight oder gleich jenseits des Kanals in Frankreich. Andere sorgten sich, ihre Liebsten könnten von Wilden ermordet werden … eine Frau äußerte sogar die Hoffnung, ihr Mann möge dort ein übles Ende finden. Doch die meisten wollten oder konnten nicht antworten.
Ein Brief verblüffte ihn jedoch. Er stammte von einem öffentlichen Schreiber und war im Namen von Angus McLeods Eltern abgefasst.
Mr. und Mrs. Gus McLeod wollen nichts mehr von ihrem Sohn Angus hören, der dem Familiennamen Schande eingebracht hat, als man ihn wegen Teilnahme an einer aufrührerischen Versammlung und Sachbeschädigung verhaftete. Es sind arme Menschen, stolz auf ihre Kirche und Gottes allmächtige Vorsehung. Sie weisen den Sohn von sich, der seine Pflicht, für die Eltern und die alte Großmutter zu sorgen, vernachlässigt hat, indem er leichtfertig an öffentlichen Ausschreitungen teilnahm.
Der Brief klang kalt und herzlos und enthielt keine eindeutigen Anweisungen, wie mit ihm zu verfahren sei. Pastor Cookson entschloss sich daher, den Sohn nicht über die Haltung seiner Eltern zu informieren. Es würde ohnehin Monate dauern, bis ihn der Brief erreichte, und er hoffte, dass diese kaltherzigen Menschen ihre Meinung bis dahin ändern würden.
Ein wenig nervös zog der Pastor den nächsten Brief aus dem Stapel und erkannte den Namen Rothery, als er das Siegel erbrach. Doch seine Angst war unbegründet. Der Colonel hatte sich bereits um seinen Sohn gesorgt, der sowohl die Stelle bei der Bank als auch die Wohnung in der Oxford Street gekündigt hatte, ohne seine Familie davon in Kenntnis zu setzen. Er war erleichtert, wenn auch sehr niedergeschlagen, als er erfuhr, was seinem Sohn widerfahren war.
Seine Antwort war ein Musterbeispiel des Mitgefühls, von dem die McLeods durchaus hätten lernen können, doch dann schalt Cookson sich, weil er arme Menschen, die ohnehin in ständiger Angst und Sorge lebten, verurteilte.
Colonel Rothery dankte dem Pastor für seine Freundlichkeit und versicherte, Willem genieße auch in der Verbannung die volle Unterstützung seiner Familie.
Die Hilfe für die Deportierten nahm zunehmend Raum in Pastor Cooksons Leben ein. Er besuchte Männer und Frauen in Gefängnissen und auf Transportschiffen und sprach ihren Familien Trost zu. Die Angst vor dem Unbekannten, dem Ende der Welt, beherrschte diese Menschen, und er machte es sich zur Aufgabe, alles über Van Diemen’s Land zu erfahren – über die Regierung, das Klima, die Eingeborenen und die Zustände in der Strafkolonie. Die meisten Informationen bezog er aus Bibliotheken und von Behörden, doch der engagierte Pastor suchte auch das Gespräch mit Seeleuten, die Hobart und die Umgebung aus eigener Erfahrung kannten.
So gelang es ihm, die Gefangenen durch seine Berichte zu beruhigen. Er erklärte ihnen, Hobart sei eine zivilisierte Stadt, in der viele Sträflinge auf Baustellen und Farmen arbeiteten. Mehr noch, sie würden im Gefängnis sogar Unterricht erhalten.
»Nur die wirklich Schlimmen werden in Gefängnisse gesperrt, die sich nicht von den englischen unterscheiden. Die Leute haben die Wahl.«
Er verschwieg jedoch, dass Offiziere wie Mannschaften seine Schilderungen zwar bestätigten, aber mit einem Schauder von den anderen Seiten der Strafkolonie berichteten … der Misshandlung hilfloser Gefangener, den Auspeitschungen, Tretmühlen und Erniedrigungen der weiblichen Sträflinge.
»Wer tut denn so etwas?«, fragte der Pastor verwundert. »Wer sind die Peiniger? Woher holt man sie?«
»Das sind Ihre Mitmenschen«, meinte ein Offizier. »Von unseren britischen Inseln. Die Disziplin auf unseren Schiffen ist gewiss mehr als streng, und Auspeitschungen werden gelegentlich als unumgänglich betrachtet. An diesem Ort hingegen sind sie an der Tagesordnung; sechzig Hiebe und mehr gelten als normal. Aber, Herr Pastor, es gibt auch eine noch teuflischere Strafe …«
»Und welche?«, fragte er atemlos.
»Isolationshaft. Einen Monat, sechs Monate, das macht alle fertig. Sie ist die am meisten gefürchtete Strafe von allen.«
Der Pastor würde nicht von diesen Maßnahmen sprechen, sondern weiterhin die Notwendigkeit betonen, sich um eine Arbeit außerhalb der Gefängnismauern zu bemühen.
»Man sagte mir, manche Leute, die sich durch gute Führung auszeichnen, würden das Gefängnis kaum von innen sehen.«
»Das ist durchaus möglich«, stimmte ihm der Offizier zu, »sofern sie den Gemeinheiten der Aufseher entgehen können.«
Von der Kanzel herunter wetterte der Pastor gegen die Deportationen. Er behauptete, sie stellten nicht nur eine doppelte Strafe dar, sondern verstießen auch gegen das Gesetz. Er drängte die Regierung, Geld für die Wiedereingliederung Gefangener bereitzustellen, und rief Freiwillige auf, dorthin auszuwandern, damit die Menschen in Würde nach Van Diemen’s Land reisen konnten. So würde man die ungeheuren Personalkosten für Aufseher und ganze Regimenter einsparen, die sich häufig zur Misshandlung und Peinigung ihrer Gefangenen hinreißen ließen.
Cooksons Ruf als Kämpfer für die Abschaffung der Massendeportationen erregte die Aufmerksamkeit seines Bischofs, der ihn streng ermahnte und verlangte, er solle seine öffentlichen Äußerungen auf religiöse Fragen beschränken. Als der widerspenstige Priester nach einem Jahr immer noch in dieser Weise predigte, wurde der Bischof zum Erzbischof zitiert, der ihm erklärte, Cookson liege völlig falsch. Die Gefangenen würden in den Kolonien dringend gebraucht, und zwar nicht nur in Van Diemen’s Land, sondern auch in Neusüdwales und anderen Gegenden, wo der Bedarf an billigen Arbeitskräften groß sei. Wie sonst sollten die Kolonien gedeihen? Man sehe sich nur Amerika an! Wäre das Land ohne seine Sklaven ebenso schnell reich geworden? Sicher, die Sklaverei in den britischen Kolonien hatte man abgeschafft und das mit Recht, aber Männer aus den Gefängnissen zu holen und sie beispielsweise auf dem Land arbeiten zu lassen, sei ein wahrhaft menschenfreundliches Unternehmen.
»Diese simple Logik kann ein harmloser alter Herr wie Cookson jedoch nicht begreifen. Hoch stehende Persönlichkeiten sind beunruhigt wegen seiner dilettantischen Einmischung in Wirtschaftsfragen. Dieser Bursche weiß einfach nicht, wovon er redet.« Der Erzbischof gähnte. »Das Beste ist, Sie schicken ihn in Pension. Dann sind alle zufrieden.«
Der Bischof zog sich zurück. Pastor Cookson würde auch im Ruhestand weiter agitieren. Das Gespräch mit Seiner Exzellenz hatte ihm ein gewisses Magengrimmen verursacht. Es hatte mit dem zu tun, was der Erzbischof über billige Arbeitskräfte gesagt hatte, aber er fühlte sich so erschüttert, dass ihm der genaue Wortlaut nicht mehr einfiel. Gewiss würde Seine Exzellenz kein System befürworten, das Sklaven durch billige Gefangene ersetzte, oder?
Kopfschüttelnd verließ er den erzbischöflichen Palast. »Ich muss ihn missverstanden haben«, murmelte er vor sich hin. Doch sein Unbehagen wollte nicht weichen.
Die Pensionierung erschwerte Pastor Cooksons Mission. Ihm blieben jämmerliche dreißig Shilling pro Jahr, und er würde so bald wie möglich das Pfarrhaus verlassen müssen.
Sein Sohn war außer sich. »Du musst dich entschuldigen und deine Brandreden endlich einstellen.«
»Ich spreche ja nicht immer von Deportation und der Behandlung der Gefangenen«, protestierte der Pastor. »Nur wenn ich etwas Neues erfahre, wie von dem Schiffskapitän, der mir letztens …«
»Hör auf damit. Du musst dem Bischof dein Wort geben, dass du die Angelegenheit nicht mehr erwähnst. Dann wird er dich wieder in Amt und Würden setzen.«
»Man hat mir aber auch verboten, die Gefangenen auf den Hulks und in Portsmouth zu besuchen.«
»Weil sie nicht zu deiner Gemeinde gehören, Papa.«
»Und auch zu keiner anderen, Leo. Und genau darum benötigen sie dringend meinen geistlichen Beistand.«
»Schön, aber du hast deinen Teil getan. Jetzt sind jüngere Männer an der Reihe.«
»Das geht nicht. Wenn du ihr tiefes Elend erblickt hättest, würdest du mich verstehen, aber du wendest ja den Blick ab, genau wie meine Vorgesetzten. Und deshalb werde ich bald hier ausziehen.«
»Jetzt schon?«
»O ja, der Marschbefehl kam bereits vor Wochen. Ich muss mir eine andere Bleibe suchen.«
»Eine Bleibe? Natürlich ziehst du zu mir, auch wenn es mit den Kindern eng wird.«
»Danke, Leo, aber Oxford ist zu weit weg. Ich suche mir etwas in Portsmouth, da ich mir die Reisen dorthin bald nicht mehr leisten kann. Dann werde ich eine Deportiertenmission gründen.«
»Womit?«, fragte Leo. »Du hast nicht einmal genügend Geld für dich selbst, und ich weigere mich, dich dabei zu unterstützen. Es ist einfach unmöglich, Papa. Da du hier ausziehen musst, werde ich dir beim Packen helfen, und dann nehme ich dich gleich mit. Deine übrigen Sachen können wir uns nach Oxford nachschicken lassen.«
Sein Vater sah ihn liebevoll an. »Das ist gut gemeint, mein Junge, aber es wäre mir wirklich lieber, wenn du sie nach Portsmouth kommen ließest.«
»Dann bist du ja noch weiter von uns entfernt.«
»Ich weiß, aber es ist meine Aufgabe.«
Zufällig erfuhr Patrick O’Neills Anwalt von der Deportiertenmission in Portsmouth und benachrichtigte seinen Mandanten umgehend, da er hoffte, O’Neill werde ihn nicht mehr wegen seines aussichtslosen Falls behelligen.
O’Neill war ein entschlossener Mann und machte sich binnen Tagen auf den Weg, um die Mitglieder der Mission kennen zu lernen und mehr über ihre Tätigkeit zu erfahren.
Auch ein anderer Mann war unterwegs nach Portsmouth.
Colonel Rothery war seit dem ersten Briefwechsel mit dem Pastor in Verbindung geblieben und wollte der Mission beitreten, sowie er von deren Gründung gehört hatte.
Zu O’Neills Enttäuschung waren es billige Räume in der Nähe des Hafens, und das einzige Mitglied war Pastor Cookson, der Gründer, der nicht viel über die juristische Seite der Deportationen wusste. Andererseits erkannte Patrick, dass die Arbeit des alten Mannes wichtig war und beglückwünschte ihn zu seinen menschenfreundlichen Bemühungen.
Noch während er dort war, traf auch Colonel Rothery ein.
Erstaunt sah er sich nur zwei Männern gegenüber, doch O’Neill fand die Situation ganz amüsant und forderte ihn auf, sich als drittes Mitglied zu ihnen zu gesellen.
»Sie dürfen auch sofort in den Vorstand, Colonel«, meinte er grinsend. »Da wir beide einen Sohn dort drüben haben, steht uns das wohl zu.«
Zwei Tage später lief ein Sträflingstransport ein, und nachdem er dem Kapitän einen Korb mit frischem Obst als Spende des Colonels überreicht hatte, erhielt der Pastor die Erlaubnis, mit seinen beiden »Assistenten« an Bord zu gehen.
Später bedauerte der Pastor, den Männern die Gefangenenquartiere gezeigt zu haben. Er selbst hatte sich mittlerweile an die Bedingungen gewöhnt und konzentrierte sich auf die einzelnen Menschen, denen er in der kurzen Zeit, die ihm blieb, helfen wollte, doch die Väter der Deportierten waren erschüttert. Nun sahen sie selbst, welches Elend und welche Erniedrigung ihre Söhne erfahren haben mussten.
O’Neill und der Colonel richteten ihre Wut gegen den Kapitän, der sie umgehend an Land bringen ließ.
Sie kehrten in ein Pub ein, wo sie mit einigen Whiskys ihre Nerven beruhigten und sich mit dem Wissen trösteten, dass ihre Söhne Hobart sicher erreicht hatten. Beide hatten Briefe von dort geschrieben. Doch die Erfahrung bewog die beiden Väter, dem Pastor die dringend benötigte finanzielle Unterstützung zu liefern, und Cookson konnte wenige Tage später Räume in der Nähe der East India Company beziehen. Auch wurde eine Stiftung zugunsten von R. J. Cookson, Priester, gegründet.
Beim Abschied versprachen sie einander, in Verbindung zu bleiben, und der Pastor schenkte ihnen kleine Schiffsglocken, auf denen der Name der Deportiertenmission Portsmouth eingraviert war.
Das Leben geht weiter, dachte er, als er zu seinem neuen Heim zurückkehrte; es geht immer voran. Die Gesichter der Verbannten verblassen mit der Zeit. Die meisten werden ihre Familien nie wieder sehen, denn die Gerichte kümmern sich nicht darum, wie die Gefangenen nach sieben, zehn oder fünfzehn Jahren in Van Diemen’s Land in die Heimat zurückkommen.
Er brachte es nicht übers Herz, die Familien, die ihn aus allen Winkeln der britischen Inseln anschrieben, auf diese Gesetzeslücke aufmerksam zu machen.
Er konnte ihnen nur Trost spenden und für sie beten.
Es schneite stark, als er seine Haustür erreichte. Zum Glück hatte er das Kaminfeuer angelassen.
In dieser Nacht tobte ein Sturm über Portsmouth, und ein weiteres Sträflingsschiff kämpfte sich auf den Atlantik hinaus. Er dachte an Angus McLeod und Willem Rothery, den jungen Matt O’Neill und seinen Cousin Sean Shanahan … und ihn überkam eine Vorahnung. Er versuchte, sie abzuschütteln, indem er laut aus der Bibel las, doch als die Kerze flackernd erlosch, brach er in Tränen aus.
»Möge der Herr sie segnen und beschützen«, rief er in die Dunkelheit hinaus.
2. Kapitel
1837
Auf der belebten Straße schlurften vierzig Männer in fadenscheinigen Hemden und Hosen, die auf Halbmast hingen, dem Lager entgegen, die Schultern von Müdigkeit gebeugt, die staubigen Füße mit klirrenden Ketten beschwert. Ein brauner Hund schoss aus dem Schatten einer Veranda auf sie zu, knurrte, überlegte es sich anders und verkroch sich wieder. Ein Reiter in Tweedjacke und Zylinder hatte sein Pferd gezügelt, um ihnen auszuweichen, und zwei Mädchen aus der so genannten Frauenfabrik wackelten kess mit dem Hintern. Nur sie schienen die Sträflinge, die in dieser Gegend zum alltäglichen Anblick geworden waren, überhaupt zu beachten.
»Was würdest du für eine von denen geben?«, murmelte Freddy Hines.
»Bloß nicht, die Große ist Bobbee Rich«, knurrte der Mann hinter ihm. Angus McLeod senkte den Kopf und blickte verstohlen nach hinten zu der Frau, die als wahrer Albtraum galt. Die Stahlspitze einer Peitsche zischte über seinen Rücken, als der berittene Aufseher »Maul halten!« brüllte.
Angus zuckte nicht einmal. Sein Hass auf diesen Ort und diese Menschen war so groß, dass er im Geist ständig kampfbereit war und den Aufstand plante. Fünf Jahre war er nun in Hobart, hatte die entsetzlichen Sommer und grausamen Winter ertragen, in denen die vernichtenden Stürme aus der Antarktis über die Insel tobten. Noch immer fasste er es nicht, dass man ihn von einem Gefängnis in Glasgow in ein anderes Gefängnis in der südlichen Hemisphäre transportiert hatte, ohne dass seine Familie davon erfuhr und er die Möglichkeit erhielt, Berufung einzulegen. Man hatte ihn mit Tausenden anderer Menschen verbannt, unter denen sich alle Spielarten vom ungehorsamen Dienstboten bis hin zum schlimmsten Verbrecher fanden. Sein eigenes Vergehen konnte man als schlichte Dummheit bezeichnen, über die er in den letzten Jahren gründlich nachgedacht hatte. Er war erst neunzehn gewesen und hatte geglaubt, es mit den großen Herren aufnehmen zu können.
»Schlag dir das aus dem Kopf«, hatte Pa gebrüllt, als er sich der Workers’ Party anschloss, wozu ihn Joe Kirkham überredet hatte. Je länger Angus Joe zuhörte, wenn dieser vor den Toren der Gießerei seine Reden schwang, desto begründeter erschienen ihm die politischen Forderungen – dass sie bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen erreichen konnten, wenn sie nur zusammenhielten und es den großen Herren da oben heimzahlten. Für Angus McLeod ergab das durchaus einen Sinn. Und schien gar nicht einmal so schwer zu sein.
Ein törichter Gedanke, sinnierte er noch, als der Trupp vor dem Wachhaus stehen blieb und zwei ehemalige Sträflinge, die jetzt als Aufseher arbeiteten, die Männer durchsuchten. Sie saßen in einem Gefängnis, das sie mit eigenen Händen erbaut hatten, dachte er verbittert, als sich das Tor hinter ihm schloss und die Ketten abgenommen wurden. Er rieb sich die schwieligen Hände und sah sich um. Angus hatte zunächst mit den Trupps gearbeitet, die das Land jenseits der düsteren Mauern der Frauenfabrik rodeten. Dann errichteten sie Zellenblocks und ein Verwaltungsgebäude, die von einem hohen Palisadenzaun umgeben waren. Das Gelände war als Lager bekannt, um es von dem dunklen Ziegelgefängnis in der Nähe des Hafens zu unterscheiden. Obgleich ihre neuen Quartiere besser als das mörderisch überfüllte Gefängnis waren, blieb ihr Leben entbehrungsreich. Mittlerweile gehörte Angus zu einem anderen Arbeitstrupp, der weiter im Landesinneren eingesetzt wurde, so weit vom Lager entfernt, dass er und seine Kameraden hofften, anders eingestuft zu werden und sich somit die langen Märsche zur Arbeit und zurück zu ersparen. Sie waren Gefangene zweiter Klasse, was bedeutete, dass sie in Ketten arbeiten mussten, sich innerhalb des Lagers jedoch frei bewegen durften. Männer der dritten Klasse waren niemals frei; sie waren mit anderen Gefangenen zusammengekettet oder trugen Ketten und Eisenkugeln an den Füßen. Männer der ersten Klasse, die sich gut geführt hatten, trieb man zwar in Trupps zusammen, doch sie durften unter Aufsicht in Hütten wohnen. Die Elite waren die Männer mit Ausgangserlaubnis, die sich frei bewegen durften und eine Art Bewährungsstatus besaßen.
Angus erinnerte sich, dass er sich nach zwei Jahren in der North Glasgow Workers’ Party einen ausgezeichneten Ruf erworben und auf seine Rechte gepocht hatte, den Bossen auf Augenhöhe gegenübergetreten war, einen gescheiterten Streik angeführt und die Fenster der Gießerei eingeworfen hatte. Zwei wilde, aufregende Jahre, in denen er wirklich geglaubt hatte, das Los der armen Arbeiterfamilien zu verbessern … zwei Jahre, die ihm drei Monate auf einem üblen Transportschiff und die Verbannung an diesen gottverlassenen Ort eingetragen hatten.
Von wegen Verbannung, dachte er. Wartet ab, ihr Schweine, zuerst muss ich die Ausgangserlaubnis bekommen, dann kann ich an Flucht denken.
Doch das war nicht so einfach. Die Richter waren befugt, die Kerkerhaft jederzeit aufzuheben, wenn sich der Gefangene reuig zeigte und gut führte. Leider war Angus nicht fähig, Reue vorzutäuschen, wie es Feiglinge oder Schlauköpfe getan hätten. Er sagte offen, was er dachte, und beschwerte sich ständig wegen der Misshandlung von Gefangenen und der Einschränkung ihrer Rechte.
Angus McLeod hätte die Bewunderung seiner Mitgefangenen durchaus verdient, weil er den Mut fand, sich aufzulehnen und die nachfolgende Bestrafung klaglos zu ertragen, doch sie hielten sich lieber von ihm fern, um nicht ebenfalls als Unruhestifter zu gelten. Die Wärter, für die die Gefangenen meist nicht bedeutender waren als die Schafherden, die mit den Schiffen kamen und durch die Stadt getrieben wurden, betrachteten ihn als Großmaul und Störenfried, dem man das richtige Verhalten notfalls mit Gewalt einbläuen musste.