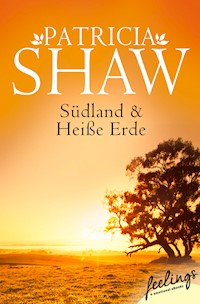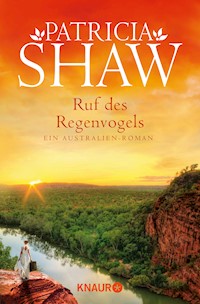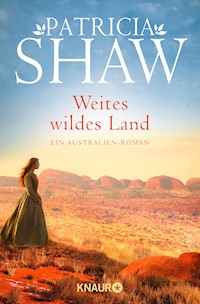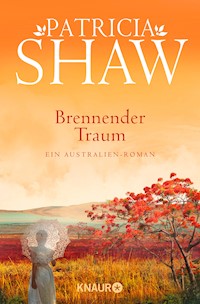4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Hamilton-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Australien um das Jahr 1900: Aufständische Aborigines und Siedler liefern sich im Outback einen Kampf auf Leben und Tod. Auch die Familien der Großgrundbesitzer Hamilton und Oatley, deren Kinder Lucy und Myles heiraten wollen, werden in den Konflikt hineingezogen. Als Myles Mutter stirbt und sein Vater William Oatley in Selbstmitleid versinkt, reist der junge Mann für eine Weile nach Europa. Als er nach Hause zurückkehrt, findet er seinen Vater erneut verheiratet vor - mit der schönen Harriet Cunningham. Myles, der noch immer mit Lucy verlobt ist, missbilligt die Ehe und versucht sie zu zerstören. Aber dann verliebt er sich selbst in Harriet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 810
Ähnliche
Patricia Shaw
Tal der Träume
Roman
Deutsch von Susanne Goga-Klinkenberg
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für Ron und Rose Jones und für Peter Poynton, B. A. LLB– in Erinnerung an die lange Reise.
Erstes Buch
Oktober 1900
1. Kapitel
Auf einer Landkarte des Nordterritoriums wäre die Viehstation von Black Wattle nicht mehr als ein Stecknadelkopf gewesen. Desgleichen ihre weitaus größere Nachbarin, Victoria River Downs, obwohl sie an die achtzehntausend Quadratmeilen maß mit ihren ockerfarbenen Ebenen, uralten Kratern und längst vergessenen Senken in der glühenden Landschaft, wo einst ein stolzer Fluss in das verschwundene Binnenmeer geflossen war. Vor Urzeiten waren hier Dinosaurier umhergestapft und geschwommen, hatten Riesenschlangen ihre Beute belauert und ungeheure Vögel ihre Bahnen am Himmel gezogen. Das »Territorium«, das seinerseits nur einen Teil des »oberen Endes« von Australien darstellte, rühmte sich einer Größe von einer halben Million Quadratmeilen. Stecknadelkopf oder nicht, Victoria River Downs, besser bekannt unter dem Namen Big Run, und ihre Nachbarstationen waren von schwindelerregenden Ausmaßen und vermittelten ihren Bewohnern ganz neue Vorstellungen von Grundstücksgrößen und Entfernungen.
Für Zack Hamilton, der als junger Mann die familieneigene Viehstation Black Wattle geerbt hatte, war sein Riesenbesitz nichts Besonderes. Für ihn war es selbstverständlich, dass er Raum benötigte, um seine Herden in dieser Halbwüste zu erhalten, in der sich nur Geistereukalyptus und hohe, rote Termitenhügel über das trockene, stachlige Gras erhoben. Zack störte es nicht, dass er drei Tage gebraucht hatte, um wegen einer Besprechung zu Charlie Plumb, dem Verwalter von Big Run, zu reiten: Ihr Treffen war wichtig, denn es ging um Pläne für die Zusammenarbeit im Kampf gegen das Hochwasser, das die Regenzeit mit sich brachte. Sorge bereitete ihm nur, dass Charlie ihn ausgerechnet jetzt um Hilfe bat.
»Wir sind knapp an Leuten, Zack. Sechs von unseren Viehtreibern sind letzte Woche in Richtung Goldfelder abgehauen. Ich habe tausend Stück Vieh verkauft und muss sie zu dem Käufer treiben, bevor die Regenzeit beginnt. Seine Leute holen die Tiere in Pine Creek ab.«
»Hast ein bisschen lange gewartet, was?«
»Wem sagst du das! Ich musste eine Treibermannschaft aus Katherine kommen lassen. Ich habe Paddy Milligan und seine Truppe angeworben. Nur eine kleine Mannschaft. Kennst du sie?«
»Nein.«
»Sie sind in Ordnung, aber sie kennen sich hier nicht gut aus. Ich brauche dich, damit du sie bis Campbell’s Gorge bringst. Wenn sie drüben sind, kommen sie allein zurecht. Es ist nur ein Umweg von ein paar Tagen, Zack.«
»Über mein Ziel hinaus«, grollte Zack. »Und siebzig Meilen weiter östlich. Und meine Frau sitzt gestiefelt und gespornt zu Hause und will nach Darwin. Von Lucy ganz zu schweigen. Ich schwöre dir, sie hat schon vor einem Monat gepackt, ihr Freund kommt doch nach Hause. Ich bin ohnehin schon eine ganze Woche zu spät dran.«
»Ah, die Damen! Sie werden es schon verstehen. Ist noch jede Menge Zeit. Wie geht es Sibell überhaupt? Ich habe gehört, sie fühlt sich nicht wohl.«
»Bestens«, antwortete Zack. Er hatte keine Zeit, den Gesundheitszustand seiner Frau oder, besser gesagt, ihre geistige Verfassung zu diskutieren.
»Das freut mich zu hören. Hilfst du mir nun oder nicht, Zack?«
Zack nickte mürrisch. Sie hatten beide gewusst, dass er es nicht ablehnen würde. Nicht ablehnen konnte. Das ungeschriebene Gesetz des Outbacks, dieses wilden, abgeschiedenen Landes, lautete Überleben. Man half, wann und wo auch immer Hilfe nötig war, denn das Überleben hing von der Zusammenarbeit ab.
»Ist Milligan bereit zum Aufbruch?«
»Ja, sie treiben die Herde gerade hinaus.«
Ein paar Tage?, dachte Zack stöhnend. Und das mit einer langsamen Viehherde. Es würde wohl mindestens vier oder fünf Tage dauern.
Lucy Hamilton trat ans Ende der hohen Veranda und warf einen besorgten Blick auf den langen Weg, der vom Wohnhaus wegführte und irgendwo zwischen den Bäumen verschwand. Nichts rührte sich. Man konnte beinahe auf die Idee kommen, die staubige Landschaft sei völlig leer, dieses Haus, das auf einem flachen Hügel kauerte, überrage ein Reich ohne Untertanen und Vieh. Vor allem jetzt um die Mittagszeit, wenn die Luft glühte und über der Station ein muffiger Geruch hing, ein uralter, heißer Geruch, als sei das Land selbst müde, ausgebrannt, erschöpft. Und alles war so still. Totenstill.
Obwohl sie wusste, dass irgendwo dort draußen Viehtreiber arbeiteten, die Aborigines, die auf dem Besitz lebten, ihren Geschäften nachgingen, einheimische Tiere Schutz vor der Mittagshitze suchten, zerrte die Stille dennoch an ihren Nerven.
Und wo war ihr Vater? Er hätte schon gestern zurückkommen sollen. Die Trockenzeit war beinahe vorüber. Es war, als könne die unerträgliche Hitze jeden Tag explodieren, doch das war natürlich nicht der Fall, die Regenzeit, die Wohltat der Nässe, stand bevor.
Lucy schauderte. Sie hasste diese Jahreszeit, das Warten auf den Donner, das Warten auf den Monsunregen, der die Bäche in reißende Flüsse verwandelte, die Flüsse in überflutete Ebenen. Und der sie von der Außenwelt abschnitt, wenn sie nicht rechtzeitig aufbrachen.
Wo also steckte Zack?, fragte sie sich wütend. Er hatte versprochen, sie würden allerspätestens heute nach Darwin aufbrechen, und noch immer war keine Spur von ihm zu sehen. Das Warten war unerträglich. Jeder wusste, dass dieses Klima qualvoll war, dass es alle verrückt machte, die sich nach einer Ruhepause von der langen Trockenzeit sehnten, die nach dem Geruch, dem Geräusch, der willkommenen Flut des ersten Regens lechzten. Die dicken Tropfen, die den Staub aufwirbelten, die Tiere, die sich die Lefzen leckten, die Menschen, die mit ausgebreiteten Armen hinausliefen und endlich lächelten. Aber es bedeutete keinen Trost, dass jeder um die Verrücktheit dieser Zeit wusste. Das Wissen allein brachte keine Erlösung. Die Menschen neigten zum Jähzorn. Männer brachen Schlägereien vom Zaun. Die Leute wurden schnippisch. Schmollten. Fehler passierten. Tore blieben offen. Essen verbrannte. Eine Niederlage beim Kartenspiel, ein zerbrochener Teller, jede Kleinigkeit konnte einen Streit auslösen. Sogar das Vieh war störrisch.
Lucy hatte sich schon oft gefragt, ob das Vieh drohende Gefahren erahnte. Es musste weit weg von den ausgetrockneten Flussbetten und ruhigen Wasserlöchern in die Sicherheit der höher gelegenen Gebiete getrieben werden, bevor die Regenmassen fielen, doch die Aufgabe war schwierig. Zu viele Tiere wurden störrisch, wehrten sich gegen die Eindringlinge, gegen die Peitschen und Flüche der Reiter. Tausende Stück Vieh wurden zusammengetrieben und umgelenkt, und Lucy wünschte, sie könnte dabei sein, helfen. Alles war besser, als im Haus zu sitzen, doch ihr Vater hatte ihr verboten, um diese Jahreszeit am Viehtrieb teilzunehmen.
»Zu gefährlich«, hatte er gesagt. »Das ist nichts für Mädchen.«
Ihre Mutter war der gleichen Meinung. Allerdings missbilligte Sibell Hamilton es ohnehin, dass Lucy ritt und mit den Männern arbeitete, da es angeblich nicht damenhaft war. Sie vergaß, dass sie früher einmal selbst mit dem Vieh gearbeitet hatte, wenn Hilfe nötig war. Zacks Schwägerin Maudie, die Besitzerin von Corella Downs, fühlte sich auch jetzt noch auf dem Pferderücken wohler als im Haus, dabei war sie schon fünfzig. Ein zähes altes Mädchen, dachte Lucy grinsend, im Busch geboren und stolz darauf, zu den »Pionieren des Territoriums« zu gehören.
Lucys Mutter und Tante waren wie Feuer und Wasser. Die in England geborene Sibell missbilligte Maudie Hamiltons raue Manieren, und sie schienen niemals einer Meinung zu sein, obwohl Zack die Ansicht vertrat, dass sich hinter all den Sticheleien echte Freundschaft verbarg. Jetzt, am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, lebten noch immer nur wenige weiße Frauen im Outback, was in Sibells Augen umso mehr dafür sprach, sich hier zu behaupten und zu beweisen, dass ihr isoliertes Leben keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen sei. Sibell empfand übertriebenen Stolz auf ihre hausfraulichen Fähigkeiten. Das Wohnhaus von Black Wattle war kein Herrensitz, sondern ein weiträumiges Holzgebäude mit hohen Decken, breiten Veranden und einem rot gestrichenen Eisendach, das meilenweit zu sehen war, doch es wirkte gemütlich und war gut ausgestattet. Mit Hilfe ihres chinesischen Kochs und der schwarzen Hausmädchen bewirtete Sibell ihre wenigen Besucher gern im großen Stil. Lucy war das recht, doch sie konnte nicht akzeptieren, dass es ausgerechnet ihre Aufgabe sein sollte, durchs Haus zu schweben und die Pflichten und gesellschaftlichen Fähigkeiten zu erlernen, die einer jungen Dame zukamen. Sie hasste das Nähen, konnte weder malen noch Klavier spielen und las lieber romantische Romane als die »besseren« Bücher, die ihre Mutter in die Regale stellte. Aber sie liebte die Station, das Leben hier draußen gefiel ihr.
Lucy war hochgewachsen, mit langem, blondem Haar, ebenmäßigen Zügen und einem schlanken, athletischen Körper. Die Leute nannten sie gutaussehend, obgleich Lucy selbst ihre Zweifel daran hatte. Sie war nicht hübsch wie die Heldinnen in den Groschenromanen, hatte keine Locken und so weiter. Zack behauptete immer, sie sei schön, aber das war kein Wunder: Ihr Vater vergötterte sie, er war stolz auf sie, weil sie gut reiten konnte, ob nun im Damen- oder Herrensattel, und bei den alljährlichen Rennen und Sportfesten Pokale gewonnen hatte …
Aber wo blieb er jetzt, ihr geliebter Vater? Hatte er sie vergessen?
Jedes Jahr um diese Zeit zogen sie nach Darwin und verbrachten den Sommer in ihrem Strandhaus. Zwar konnte man den Wolkenbrüchen und der allgegenwärtigen Feuchtigkeit nicht entrinnen, doch in der angenehmen Atmosphäre der Vorweihnachtszeit und bei den jährlichen Treffen mit den alten Freunden von den anderen Stationen im Outback war alles leichter zu ertragen. Es war eine wunderbare Zeit für alle: eine wohlverdiente Ruhepause für hart arbeitende Männer, die sich mit ihren Freunden entspannen und so tun konnten, als sei es eine schwere Bürde, die Frauen zu all den Partys und Bällen zu begleiten, die schon im Voraus verabredet worden waren. Und für die Frauen war es eine Gelegenheit, endlich einmal wieder den Trubel und Spaß weiblicher Gesellschaft zu genießen, und was die jüngere Generation betraf … Lucy lächelte ein wenig selbstgefällig.
Die Sommermonate in Darwin waren als Zeit der »Brautwerbung« bekannt. Romantik und Liebe lagen in der Luft. »Und Lust«, fügte Tante Maudie stets in ihrer unverblümten Art hinzu. Es war einfach aufregend, und Lucy wollte um keinen Preis den Sommer in Darwin verpassen, da ein gewisser Herr endlich nach Hause kam, der beinahe zwei Jahre in London verbracht hatte. Ein überaus wichtiger junger Herr, der ihr während seiner Abwesenheit allmonatlich geschrieben hatte, ohne auch nur einen Brief auszulassen. Lucy Hamilton brauchte sich auf dem Heiratsmarkt nicht in die Gruppe der verfügbaren Mädchen einzureihen, denn die Liebe ihres Lebens kam nach Hause. Sie und Myles Oatley waren Freunde von Kindesbeinen an, und er hatte sie vor seiner Abreise gebeten, auf ihn zu warten.
In ihrem ersten Brief hatte sie ihm geschrieben, er brauche nicht erst darum zu bitten, sie werde auf ihn warten, ihre Liebe würde durch die Trennung nur noch süßer.
Ihre Eltern waren glücklich über die Verbindung, denn sie mochten Myles, den einzigen Sohn alter Freunde. Maudie jedoch hatte, typisch für sie, einen anderen Rat zu vergeben.
»Du solltest nicht herumsitzen und auf ihn warten. Beackere lieber das Feld. Mach dir eine schöne Zeit, hock nicht zu Hause wie eine alte Jungfer. Guter Gott, du bist gerade mal zwanzig. Solltest schon mehr als einen Freund gehabt haben. Und hör auf meine Worte, Lucy: Setz nicht alles auf eine Karte. Bestimmt kommt er völlig verändert aus London zurück und prahlt mit seinen schicken Freunden. Er wird kein Bushie mehr sein, er wird nicht mehr sein wie wir, wart’s ab.«
»Das ist doch lächerlich«, hatte Sibell eingewendet. »Seine Eltern sind in den Flitterwochen auf Weltreise gegangen, und als sie nach Hause kamen, haben sie sich augenblicklich auf der Oatley-Station niedergelassen, als wären sie nur eben um die Ecke gewesen. Sie haben nie so getan, als seien sie etwas Besseres.«
»Ja, aber sie waren auch zusammen unterwegs. Wenn er so scharf auf Lucy ist, könnte er sie doch heiraten und mitnehmen, oder?«
Lucy störten die unkonventionellen Vorschläge nicht. Sie fand sie eher amüsant.
»Sag mal, Maudie, warum hast du nicht wieder geheiratet?«, fragte sie, um von der Kritik an Myles abzulenken. »Du warst noch jung und Wesley ein Baby, als Onkel Cliff getötet wurde.«
»Jetzt werde nicht frech, Mädchen. Ich habe mich umgeschaut, das kannst du mir glauben. Aber jeder Bewerber, der mir über den Weg lief, hatte nur Augen für meine Station. Sie waren hinter Corella Downs her, nicht hinter mir, und ich konnte den Gedanken, dass jemand meine Station an sich reißt und den Boss spielt, nicht ertragen. Ich bin sie schnell losgeworden. Du solltest auch die Augen offen halten, Mädchen. Bist eine gute Partie. Black Wattle wird eines Tages dir gehören. Dann bist du eine Menge Geld wert.«
»Falls es dazu kommt«, lachte Lucy. »Und im Übrigen gilt das auch für Wesley. Dein Sohn ist älter als ich und noch immer ledig. Auf wen hat er es denn abgesehen?«
Ihre Diskussionen endeten immer auf diese Weise. Maudie ließ kein gutes Haar an Wesleys Freundinnen. Lucy bedauerte das Mädchen, das es mit einer Schwiegermutter wie Maudie aufnehmen musste.
Sie ging über die Veranda zum Schlafzimmer ihrer Eltern, als ihre Mutter rief.
»Ist Zack schon zu Hause?«
Lucy trat durch die schlaff herabhängenden Spitzenvorhänge. »Noch nicht.«
Sie starrte ins Zimmer. Überall standen offene Kisten und Schrankkoffer.
»Was tust du da?«
»Ich packe.«
»Aber du hast doch schon gepackt. Dieses Zeug brauchst du in Darwin gar nicht. Und die Schrankkoffer passen ohnehin nicht in den Wagen!«
»Ich weiß. Ich lasse sie nachschicken.«
»Nachschicken? Das alles?« Sie spähte in einen weiteren Schrankkoffer. »Der hier ist voll. Wir bleiben nur ein paar Monate, keine zehn Jahre.«
Sibell kippte eine Schublade mit Unterwäsche aufs Bett und setzte sich daneben. Sie schaute zu ihrer Tochter hoch. »Ich habe versucht, genügend Mut zu fassen, um es dir zu sagen, Lucy. Ich gehe fort.«
»Fort? Wohin?«
»Ich werde nach Perth ziehen.«
»Wann?«
»Nach Weihnachten.«
Lucy ging durchs Zimmer und öffnete den großen Kleiderschrank. Zu ihrem Erstaunen war er leer.
»Das verstehe ich nicht. Was hast du vor? Urlaub machen?«
»Nein, ich gehe für immer«, erwiderte ihre Mutter ruhig.
»Unsinn. Daddy würde Black Wattle nie verlassen. Was geht hier wirklich vor?«
»Dein Vater geht nicht fort, sondern ich. Ich kann nicht mehr hier leben. Ich habe beschlossen, in Perth zu wohnen.«
»Wieso? Hattest du Streit mit Daddy? Mir ist aufgefallen, dass ihr beide in letzter Zeit ziemlich gereizt wart. Aber wegen eines Streits wirst du doch nicht aufgeben und weggehen. So schlimm kann es doch wohl nicht sein?«
»Wir hatten keinen Streit, nicht wirklich. Er weiß, dass ich gehe, und regt sich schrecklich auf.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Lucy schnippisch. »Was ist los mit dir? Bist du verrückt geworden?«
»Nein«, antwortete Sibell geduldig. »Mir ist diese Entscheidung sehr schwergefallen, aber ich kann das Leben hier draußen nicht mehr ertragen. Ich bin es leid.«
»Was denn? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.«
Ihre Mutter seufzte. »Ach, Lucy, ich habe einfach alles satt … die Einsamkeit, den Staub, die Gewalt, die endlosen Schwierigkeiten …«
»Es war die Mäuseplage, nicht wahr? Stimmt, seitdem warst du irgendwie nervös. Aber das ist vorbei, es kommt so bald nicht wieder vor …«
Sibell schauderte. »Erinnere mich bitte nicht daran. Diese verdammten Biester, mir wird schlecht, wenn ich nur daran denke. Im Haus, im Bett, überall. Aber sie waren nicht der wahre Grund, sie haben nur das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich möchte normal leben, in einem normalen Klima, die Straße entlanggehen, Geschäfte besuchen, wenn mir danach ist, all das. Ich bin fast fünfzig. Wenn ich diesen Schritt jetzt nicht wage, tue ich es nie.«
»Und was wird aus uns? Aus Daddy und mir? Willst du uns einfach so verlassen?«
»Ich werde in Perth sein. Du kannst mich besuchen.«
»Aber das hier ist dein Zuhause. Das kannst du nicht machen. Und Daddy sieht einfach zu?«
»Nicht direkt, das muss ich zugeben. Er nimmt es sehr schwer. Ich hatte gehofft, du könntest mit ihm reden. Ihm erklären, wie ich mich fühle.«
»Es ihm erklären? Dass ihn seine Frau verlässt? Das werde ich nicht tun! Ich kann einfach nicht glauben, dass du so selbstsüchtig bist. Räum die Sachen wieder ein! Ich will nichts mehr davon hören.«
Lucy schlug die Tür hinter sich zu, und Sibell schüttelte traurig den Kopf. Sie liebte die beiden, Mann und Tochter, aber sie waren keine Kinder mehr. Sie mussten verstehen, dass Menschen sich ändern können, Veränderung brauchen. Sie selbst sehnte sich verzweifelt danach. Aber das wollte sie nicht zugeben. Sie hatte versucht, Zack zu erklären, dass ihr Leben an einem toten Punkt angelangt war, dass sie eine neue Perspektive benötigte, doch er war ihr nur mit Verachtung begegnet.
»Neue Ufer, was? Jemand Bestimmten im Auge?«
»Das meinst du nicht ernst, Zack. Diese Bemerkung ist deiner nicht würdig. Ich werde dich immer lieben, aber …«
»Und das zeigst du mir, indem du mich verlässt.«
Er tat ihr leid. Er konnte ihre Gründe einfach nicht begreifen. Die ganze Idee schien über seinen Horizont zu gehen.
»Ist es das Haus? Wir könnten es renovieren, ausbauen, wenn du möchtest. Was immer du willst.«
»Nein, das Haus ist sehr bequem. Verstehst du denn nicht, dass ich eine Veränderung brauche?«
»Dann mach verdammt noch mal Urlaub, wenn du von mir weg willst. Wird dir die Flausen schon austreiben.«
Warum war es so schwer, es zu erklären? Vielleicht, weil sie es selbst nicht genau in Worte fassen konnte. Manchmal, wenn sie in weniger guter Stimmung war, dachte Sibell, sie suche vielleicht nach etwas, das es gar nicht gab, doch sie wollte es unbedingt herausfinden. Vielleicht sehnte sie sich auch nach ihrer Jugend, nach dem jungen Mädchen, das in einem stillen englischen Dorf aufgewachsen war.
Sie seufzte. Jenes Leben war zu einem abrupten Ende gekommen, als ihre Eltern die fatale Entscheidung trafen, nach Australien auszuwandern. Sie war erst neunzehn gewesen, als sie beim Schiffbruch ihre geliebten Eltern verlor, und war an einer verlassenen Küste nördlich von Perth gestrandet, mit einem fremden Mann als einziger Gesellschaft. Dann die vermeintliche Rettung durch eine Horde Aborigines, deren Anführer ein bösartiger Mensch war, der sich mehr für ein Lösegeld als für ihr Wohlergehen interessierte. Nur mit Hilfe eines jungen Aborigine-Farmhelfers namens Jimmy Moon war ihnen die Flucht aus dem schmutzigen Lager geglückt.
Jimmy Moon, dachte sie traurig. Er war ihr Freund gewesen. Auch er kam einige Jahre darauf in den Norden, nachdem er in Schwierigkeiten geraten war. Es tat noch immer weh, an ihn zu denken.
Sibell selbst war in Perth gelandet und hatte bei schrecklichen Leuten gelebt, bis sie Zacks Mutter, eine wunderbare Frau, kennenlernte. Mrs. Hamilton war in die Stadt gekommen, um einen Spezialisten aufzusuchen, weil sich ihr Augenlicht zusehends verschlechterte. Da sie jemanden für die Buchhaltung benötigte, der ihr bei der Verwaltung ihrer großen Viehstation Black Wattle half, bot sie Sibell die Stelle an.
Sibell ertappte sich bei einem Lächeln. »Ich hatte ja keine Ahnung, worauf ich mich da einließ!«, erinnerte sie sich. »Was für ein Schock. Wir brauchten beinahe eine Woche für den Weg von Darwin. Zu Pferd! Damals gab es noch keine Eisenbahn. Es war noch schlimmer als der Schiffbruch. Ich dachte, ich sei ans Ende der Welt gelangt. Aber Mrs. Hamilton hatte wohl noch einen anderen Grund, mich auf ihre Station einzuladen. Ein Jahr später heiratete ich ihren Sohn.«
Sie hatte es nie bereut. Manchmal hatte sie zu kämpfen gehabt, gegen die Elemente, die Entfernungen, um den Erhalt und die Ernährung der großen Viehherden. Und dann der furchtbare Verlust ihres kleines Sohnes. So viele Dinge, die sie überstanden hatte, und ihr war die Station ans Herz gewachsen. Doch nun war es Zeit zu gehen. Als sie zum Mittagessen kam, war Lucy noch immer wütend.
»Bist du wieder bei Sinnen?«
»Können wir ohne diese Grobheiten darüber sprechen?«
»Na schön. Sag mir eins. Was hast du vorhin gemeint, als du von Gewalt sprachst? Ich weiß, mein Onkel wurde von Schwarzen getötet, bevor ich zur Welt kam, aber diese Art von Problemen gibt es heute kaum noch. Es gibt zwar Unfälle mit den Männern und Pferden, aber das kann überall passieren. Wie kommst du darauf, hier auf Black Wattle gäbe es Gewalt?«
»Es tut mir leid. Ich habe das falsche Wort gebraucht. Vergiss es.«
Lucy, die hier geboren war, würde nicht verstehen, dass Sibell auch die weiten Entfernungen schwer zu schaffen machten. Ebenso das Wetter. Die Hitze, die Stürme. Die knochentrockenen Flussbetten. Die Einsamkeit. Der nächste Nachbar war drei Tage weit entfernt, wenn man ritt. Mit dem Wagen dauerte die Reise noch länger.
»Es ist eher das, was hier fehlt«, sagte sie. »Vororte. Ich möchte gern in einem Vorort leben.«
»Unsinn. Du würdest dich nach einer Woche zu Tode langweilen.«
»Das glaube ich nicht. Ich fühle mich hier so verloren. Ich weiß auch nicht, warum, aber mein Dasein hier deprimiert mich.«
»Du bist hier zu Hause! Was in aller Welt deprimiert dich? Mutter, ich glaube wirklich, du langweilst dich bloß. Wenn wir erst in Darwin sind, fühlst du dich besser. Nach den Sommermonaten in der Stadt freust du dich immer auf zu Hause.«
»Mag sein«, antwortete Sibell, um das Thema zu beenden. »Wir werden sehen.«
Die Tränen brannten ihr in den Augen, und sie drehte sich schnell zur Seite, um sie zu verbergen, aber es war zu spät. Lucy war blitzschnell bei ihr.
»Herrgott, Mutter, was ist? Geht es dir nicht gut? Ist es das?«
Sibell wünschte so sehr, sie könnte einfach sagen: »Ja, ich bin krank. Gib mir die Medizin. Morgen früh geht es mir wieder besser.« Das hätte sie den Anfällen von Kummer vorgezogen, die sie immer wieder überfielen, aber sie war nicht krank. Körperlich war sie kerngesund.
»Es geht mir ganz gut«, sagte sie. »Wirklich. Ich bin nur ein bisschen müde. Wahrscheinlich bin ich in letzter Zeit einfach erschöpft.« Sie tupfte sich die Augen und zwang ein Lächeln herauf.
»Ja, du solltest dich ein wenig hinlegen. Ich will nicht, dass du unglücklich bist, Mutter. Vielleicht ist es auch nur das entsetzliche Wetter, die Hitze ist heute fast unerträglich. Rekordtemperaturen, würde ich sagen. Ein Nickerchen wird dir guttun.«
Sibell nickte. »Ja, das werde ich tun. Danke, Lucy.«
Endlich allein in ihrem Schlafzimmer, hinter verschlossenen Türen, brach sie in Tränen aus. Wie konnte sie irgendjemandem ihr Problem erklären, wenn sie doch selbst nicht wusste, was mit ihr nicht stimmte? Sie schämte sich dafür, dass sie, Sibell Hamilton, die eine liebevolle Familie, ein gutes Zuhause und so vieles besaß, für das sie dankbar sein sollte, so undankbar sein konnte, auch nur davon zu sprechen, dass sie fortwollte. Aber sie wollte fort, sie war fest entschlossen. Diese Anfälle von Kummer verfolgten sie inzwischen seit etwa zwei Jahren und wurden allmählich schlimmer. Wenn die Schwermut sie überkam, war sie keine angenehme Gesellschaft, hatte an nichts Freude und wurde schwierig im Umgang mit jedem, der ihr begegnete.
Zack hatte in seiner freundlichen Art versucht, mit ihr darüber zu sprechen, hatte sie gebeten, weniger ungeduldig zu sein, vor allem mit den Arbeitskräften auf der Station. Er wünschte sich so sehr, dass sie ihre gute Laune wiederfand, dass sie über kleinere Schwierigkeiten wieder lachen könnte, nicht alles so schwer nahm. Aber diese Gespräche endeten jedes Mal damit, dass sie vor ihrem ratlosen, aufgebrachten Mann in Tränen ausbrach. Einige Male hatte er versucht herauszufinden, was sie so unglücklich machte, hatte sie gefragt, was er tun oder sagen könnte, um ihr eine Freude zu machen, aber allmählich reagierte auch er gereizt auf das, was er ihre Launen nannte.
Sibell wusste, es lag nicht am Wetter. Sie hatte Jahre der Dürre überlebt, ohne so zusammenzubrechen, und sie wusste jetzt schon, die Ferien in Darwin würden keine Lösung bringen. Im letzten Jahr hatte sie gehofft, der Seewind würde ihre Verzweiflung einfach davonwehen, aber es war nicht geschehen, und da begriff sie, dass ihr vor der Rückkehr auf die Station graute. Mittlerweile hatte sie ein Jahr lang Zeit gehabt, über den Grund für ihre furchtbare Schwäche nachzudenken, die ihr so peinlich war: Sie war doch wirklich immer eine starke Frau gewesen. Aber sie fand keine Antwort. Es gab keinen Grund für ihre Schwermut, keinen einzigen, und deshalb gab es nur eine Erklärung: Sie war dabei, den Verstand zu verlieren.
Aber sie dachte nicht im Traum daran, das irgendjemandem gegenüber zuzugeben. Niemals würde sie ihnen sagen, dass sie verrückt wurde. Sie würde der Sache ein Ende bereiten, ein Mittel finden, um gesund zu werden, und deshalb musste sie nach Perth. Sibell war sicher, dort würde sie sich besser fühlen, glücklicher, entspannter in der städtischen Umgebung, und inzwischen freute sie sich auf den Umzug, obwohl Zack und nun auch Lucy so sehr dagegen waren.
Sie goss Wasser aus dem Krug auf dem Waschtisch in die Schüssel und benetzte Gesicht und Hals, um vorübergehend ein wenig Kühlung zu finden; dann legte sie sich mit einem feuchten Tuch über den Augen aufs Bett und hoffte, wie immer, auf das Wunder: dass sie von diesem Bett als glückliche, vernünftige Frau aufstehen würde und alles in ihrer Welt wieder am richtigen Platz stünde.
Lucy kehrte auf die Veranda zurück und lief die Stufen hinunter zu den Stallungen. Der Gedanke an die verrückte Idee ihrer Mutter, die Station zu verlassen, beunruhigte sie noch immer. Unterwegs traf sie Casey, den Vorarbeiter.
»Ah, Lucy. Ich wollte zu dir. Dein Vater wurde aufgehalten.«
»Was ist passiert?«
»Nichts Besonderes. Er musste helfen, Vieh von Big Run bis Campbell’s Gorge zu treiben.«
»O nein! Woher weißt du das?«
»Er hat ein paar von unseren Schwarzen auf dem Viehweg getroffen und sie mit der Nachricht zurückgeschickt. Damit wir uns keine Sorgen machen.«
Lucy war außer sich. »Sorgen? Ich könnte ihn erwürgen. Was zum Teufel denkt er sich dabei? Sollen wir hier eingeschlossen werden?«
Casey grinste. »Es ist noch viel Zeit. Der Regen ist noch weit.«
»Ach, wirklich?« Lucy wandte sich um und deutete auf eine graue Wolke in der Ferne. »Und was ist das, bitte schön? Etwa Rauch?«
»Nein, aber das ist nur der Anfang. Dauert noch eine Weile, bevor das Wetter umschlägt, und dann ist es noch lange hin, bis die Flüsse anschwellen. Du wirst bald unterwegs sein.« Er ging weiter und drehte sich noch einmal um. »Ich habe gehört, der junge Myles Oatley wird zurückerwartet. Dreht sich das ganze Theater um ihn?«
»Natürlich nicht.« Sie stapfte davon. Verdammt. Verdammt. Verdammt! Es würde Tage dauern, bevor sie aufbrechen konnten, je nachdem, wie weit sich die Treiber der Schlucht bereits genähert hatten, und hier gab es nicht mehr viel zu tun. Außer vielleicht, mit ihrer Mutter zu reden und sie auf diese Weise hoffentlich zur Vernunft zu bringen.
2. Kapitel
Die Wände der Schlucht wuchsen so steil aus der Erde, dass das menschliche Auge sie nicht mit einem Blick erfassen konnte; mächtige, rot gestreifte Zwillingstürme, die sich emporreckten, bis das schmale, blaue Band über dem Spalt nicht mehr Himmel war, sondern ein Dach, das eine machtvolle Hand über die Schlucht gestülpt hatte.
In der Tiefe beugten sich hohe Palmen, zwergengleich vor den ungeheuren Ausmaßen dieser Schlucht, über eine Reihe von Wasserlöchern im zwei Meilen langen Sandboden der Höhle und verliehen der schroffen Umgebung Anmut und einen Hauch von Exotik.
Yorkey starrte die Bäume an, fragte sich, wie sie hier überleben konnten, wo es Hitze und Wasser im Übermaß, aber nur wenig Nahrung gab. In der Regenzeit mussten sie sich mit Gewalt in der Erde festklammern. Viele der Bäume waren noch jung, mager, reckten sich zum Licht, sobald sie Halt gefunden hatten, erschufen Jahr um Jahr eine kleine Oase. Ein Wunder. Doch die Schlucht selbst war schon ein Ehrfurcht gebietendes Wunder. Dieser Ort strahlte Stärke und Macht aus. Er wirkte kühn und standhaft. Yorkey hatte das Gefühl, er müsste jubeln, nur weil er hier war. Weil er diesen Ort überhaupt gefunden hatte.
Seine Mutter hatte ihm die berühmte Legende aus der Traumzeit erzählt, in der sich die Geister über zwei Stämme ärgerten, die um Land stritten, und daher die Erde spalteten, um den Streit zu schlichten. Dabei hatten sie jedoch ein Liebespaar getrennt, und der junge Mann hatte sich aus lauter Verzweiflung in die Schlucht gestürzt. Er hatte den Waray angehört, dem Volk von Yorkeys Mutter, und deshalb beanspruchten sie die Schlucht als ihr Eigentum. So war Yorkey die Geschichte im Gedächtnis geblieben. Sie hatte ihm selten solche Dinge erzählt, nur wenn ihr danach war, und erklärt, die Schlucht trage verschiedene Namen in den Sprachen der Völker, da sie so bedeutend sei. Mittlerweile hatte Yorkey fast alle diese Namen vergessen, wenn er sie überhaupt je verstanden hatte. Immerhin war er in der Welt der Weißen aufgewachsen …
Sehnsüchtig betrachtete er nun die hohen Wände mit den Felsvorsprüngen und wünschte sich, er hätte besser zugehört. Es wäre interessant, die Geschichte genau zu kennen. Wer waren diese Geister? Vermutlich hatten überhaupt nur Geister, keine Menschen, die Schlacht ausgetragen, da sie in die Tiefen der Zeit zurückreichte. Yorkey glaubte an die allmächtigen Geister der Aborigines, die sich nicht vom Gott der weißen Menschen unterschieden, der ebenfalls mit Blitzen zuschlagen konnte, bezweifelte aber, dass sie in den Kämpfen der Menschen Stellung beziehen würden.
Seine Mutter hatte ihm erzählt, diese Schlucht sei heute unter dem Namen Campbell’s Gorge bekannt, nach dem weißen Mann, der sie entdeckt hatte. Manchmal wurde sie auch das »Tal der Träume« genannt. Unter diesen Namen kannte Yorkey die Schlucht. Seine Mutter hatte das alles freilich als Beleidigung aufgefasst. Entdeckt! Als habe sie niemand zuvor gesehen. Als hätten nicht Tausende von Generationen ihres Volkes jeden Zoll darin erforscht.
Yorkey grinste. Sie hatte nicht unrecht, doch er konnte nichts daran ändern. Ihre Erzählung war wichtig, und sie hatte nicht übertrieben. Die Schlucht war ein ungeheurer Anblick. Atemberaubend. So verschwommen ihre Erinnerung auch gewesen sein mochte, sie entsprach der Wirklichkeit. Yorkey liebte diesen Ort und wünschte sich, er könne es ihr sagen und damit ein Lächeln auf ihr verhärmtes Gesicht zaubern.
Er seufzte, führte sein Pferd an ein Wasserloch und watete selbst hinein. Die Kälte des Wassers an diesem warmen Tag traf ihn wie ein Schock.
Doch er war im Auftrag der Weißen hier, zum Trödeln blieb keine Zeit.
Yorkey war Viehtreiber in Paddy Milligans Mannschaft, und sie mussten eine Viehherde durch die Schlucht treiben. Eine große Herde, die zwei Tagesritte hinter ihm lag. Paddy war ein erfahrener Treiber, einer der besten, und er hielt sich an eine Regel, wenn er durch fremdes Land wie das Nordterritorium zog, das weiter westlich lag, als er je zuvor gewesen war …
»Du holst dir Einheimische, die sich auskennen, dann reitest du vor und prüfst es nach, als hätte dir ein Ire den Weg erklärt. Ein Yard könnte ebenso gut eine Meile sein, eine feuchte Stelle ein Sumpf.«
Paddy war stolz, dass er seine Schutzbefohlenen stets sicher ans Ziel brachte.
Yorkey fiel es schwer, sich in Campbell’s Gorge auf die Arbeit zu konzentrieren. Dieser Ort war einfach unglaublich. Obgleich er nie eine Kathedrale gesehen hatte, stellte er sie sich ungefähr wie diese Schlucht vor, nur kleiner. Aber voller Geister.
Während er in glucksenden, nassen Stiefeln über flache Felsen und Steinblöcke stieg, spürte er bei diesem Gedanken ein Kribbeln im Rücken.
Unheimlich. Eine verlorene Welt. Felskängurus hüpften über die schroffen Hänge, vollkommen lautlos. Ein Adler segelte anmutig in seinen sicheren Horst auf einem Felsvorsprung. Eine große Eidechse glitt auf die sonnige Seite eines Felsens und blieb still sitzen, still wie das Wasser in den Teichen.
»Hallo!«, rief Yorkey plötzlich und lauschte dem Echo, das von den steinernen Wänden widerhallte, doch als sein Ruf verklang, meinte er, eine Antwort zu vernehmen, eine verzerrte, fremde Stimme. Er schaute hoch, legte die Hand über die Augen, suchte Simse, Vorsprünge und massive Säulen aus Stein ab, bemerkte die verblichenen Schichten, an denen man das Alter der Schlucht ablesen konnte, sah aber nichts. Niemand.
Er versuchte es noch einmal mit dem Buschruf. »Coo-ee!« Dieser oft verwendete Ruf hallte mit Sicherheit weit und wurde mit einem dröhnenden Echo belohnt. Seine scharfen Ohren vernahmen ein fernes, doch deutliches »Ho«, das sich mit seinem Echo zu vermischen schien.
Der Laut stammte nicht von einem Tier. Es war eine Stimme. Dort war jemand. Aber wo in diesem ungeheuren Schallkessel?
»Wo bist du?«, brüllte er, und auch dieses Echo dröhnte um ihn herum, doch diesmal hörte er nur sich selbst. Er versuchte es wieder und wieder, gab aber schließlich auf. Irgendein Idiot, der sich wichtig nahm. Zum Teufel mit ihm!
Die Einheimischen hatten recht. Eine Abkürzung durch die Schlucht ersparte ihnen eine ganze Woche. Sie konnten die Herde mühelos über den flachen Grund treiben, wenn sie es langsam angehen ließen und nicht alle Tiere auf einmal in Gang setzten. Das Vieh würde sich wie im Himmel fühlen, Schatten, flache Wasserlöcher. Vermutlich würde die riesige Herde die Schlucht trocken trinken, dachte er.
Doch Yorkey ließ sich von den schroffen Wänden der Schlucht nicht täuschen. Er hatte sein Leben lang im Norden dieses Landes gelebt, lange genug, um sich der Gefahren der Regenzeit bewusst zu sein.
»Von wegen weites, trockenes Land«, sagte er zu seinem Pferd, als er sich in den Sattel schwang. »Eine Falle für Anfänger, sonst nichts. Aber im Moment ist sie noch sicher.«
Misstrauisch betrachtete er die steilen Felsmauern. Selbst die gewaltige Kraft, die dieses Plateau gespalten hatte, änderte nichts an den Fluten des Monsuns, die Steine legten Zeugnis davon ab. Über die Wände der Schlucht zogen sich senkrechte grünliche Linien, Rippen, die wie Spalten im Fels wirkten. Yorkey wusste aber, dass es sich in Wirklichkeit um Wasserrinnen handelte. Jetzt waren sie knochentrocken; in der Regenzeit jedoch würden ungeheure Wasserfälle von diesen Wänden stürzen.
Er drehte sich um und untersuchte die Verfärbungen der Felsen, die sich auf seiner Höhe befanden. Bei Regen würden sich tobende Fluten durch diese Schlucht wälzen.
Irgendwo dort oben sammelte sich das Wasser, und die gestreiften Rinnen sandten aus großer Höhe donnernde Sturzbäche hinab, die die Schlucht nicht mehr fassen konnte. Das Wasser würde meterhoch stehen, bevor es in die Ebenen ablief und den Viehzüchtern des Bezirks den ersehnten Segen brachte. Die Schlucht hingegen würde monatelang unpassierbar bleiben.
»Na gut«, sagte Yorkey, während er seinem Pferd die Sporen gab. »Wir sollten uns wohl beeilen.«
Er verabschiedete sich nur ungern von diesem wundersamen Ort, irgendwann würde er zurückkehren und hier eine Weile sein Lager aufschlagen. Die Schlucht faszinierte ihn, genau wie seine arme Mutter, dachte er, aber in einer anderen Weise. Sie hatte ihre Sitten, ihre Erinnerungen, seltsame Dinge, die mit ihrem Volk zu tun hatten. Er selbst empfand es anders. Das Gefühl würde ihn wieder herlocken, dessen war er sicher, konnte es aber noch nicht in Worte fassen. Vielleicht war es eine Art Bewunderung. Yorkey hatte bisher nicht viel Bewundernswertes kennengelernt. Er war nur ein »Abo«-Treiber, irgendein Kerl, der auf den Viehrouten unterwegs war, und damit hatte er noch Glück gehabt. Viele andere »Abos« hatten es weitaus schlechter getroffen. Wie auch immer, er bewunderte diese Schlucht, welchen Namen man ihr auch geben mochte.
»Bist du sicher, dass wir durchkommen?«, wollte Paddy wissen.
»Ja, kein Problem.«
»Keine Sümpfe?«
»Nein, der Boden ist aus Sand. An manchen Stellen etwas schmal, aber wir schaffen es, Paddy. Nach und nach.«
»Bist ein braver Kerl, Yorkey. Geh zum Küchenwagen. Wahrscheinlich hast du seit Tagen nichts Richtiges gegessen.« Er lachte. »Außer, du hast Buschfutter verschlungen.«
Das war ein privater Scherz zwischen ihnen. Obwohl er ein Aborigine war, hatte Yorkey nicht den blassesten Schimmer vom Überleben im Busch und hielt auch nichts vom Essen der Schwarzen, das er mehr als einmal probiert hatte.
Die seltsame Stimme hatte er Paddy gegenüber nicht erwähnt. Auf dem Ritt zurück hatte er darüber nachgegrübelt und war zu der Ansicht gelangt, dass er sie sich vielleicht nur eingebildet hatte. Niemand war dort gewesen. Die Schlucht war so leer wie ein Pub ohne Schnaps. An diesem eigenartigen Ort konnte man sich alles Mögliche einbilden.
Zack wischte sich mit einem Tuch den Schweiß vom Gesicht und blinzelte unter der Krempe seines ramponierten Hutes zu dem wogenden Meer aus Vieh, das vor ihm herzog. Dank Milligans Erfahrung und der Bereitwilligkeit, mit der er Anweisungen befolgte, bewegten sich die Tiere in stetem Tempo. Der Karte nach zu urteilen, schien die Entfernung zur Schlucht um die hundertfünfzig Meilen zu betragen, doch das Terrain war trügerisch. Sie liefen Gefahr, kostbare Zeit zu verlieren, wenn sie das Vieh in Wasserrinnen trieben, die in Sackgassen endeten, oder über rauen, felsigen Boden, der sich unter hohem Straußgras verbarg. Zack, dem seine eigenen häuslichen Sorgen zu schaffen machten, bemühte sich, keine Minute zu verlieren. Er hatte Milligan angewiesen, kurz vor der Schlucht die Herde in drei Gruppen zu teilen, um eine Stampede zu vermeiden, wenn die Tiere das Wasser witterten. Der tiefe Canyon verfügte gewiss über eine Reihe von Wasserlöchern, selbst nach einer außergewöhnlich starken Trockenzeit. Die Schlucht war prachtvoll und als Abkürzung durch eine Kette von Sandsteinhügeln von großer Bedeutung, aber auch gefährlich. Oft bekam das Vieh aus heiterem Himmel Angst dort drinnen, vielleicht, weil es sich vor dem Echo der eigenen Hufe fürchtete, und musste sorgsam in Schach gehalten werden.
Dann gab es die Gefahr von Erdrutschen von den steilen Hängen. Sie konnten Chaos verursachen, waren zu dieser Jahreszeit aber selten. Oft büßten die Wände der Schlucht durch das Gewicht des Auffangbeckens in der Regenzeit ihre Festigkeit ein, so dass Erdrutsche auch nach dem Rückgang des Wassers zu befürchten waren. Zack war immer vorsichtig und pflegte die Schlucht für mindestens einen Monat nach Ende der Regenzeit zu meiden, bis wieder absolute Trockenheit herrschte.
Er ritt am Ende der ersten Herde, sah zu, wie sich das Vieh zerstreute, durch das Gebüsch am Rande der alten Route brach, sich mit seinem ungeheuren Gewicht einen Weg bahnte, als plötzlich ein Bulle weiter vorn ausbrach und andere Tiere mit sich zog. Die Abtrünnigen drängten hartnäckig nach links, wurden schneller, strebten in den Busch. Zack wendete sein Pferd und folgte ihnen, doch ein schwarzer Viehtreiber war schneller.
Mit knallender Peitsche trieb er sein kleines Treiberpferd durch die Büsche, an der Herde vorbei genau auf den flüchtenden Bullen zu. Das Pferd schien um den Anführer herumzutanzen, was den schweren Bullen ebenso wie die Peitsche störte, und allmählich bog er wieder in Richtung der Herde, gefolgt von seinen Mitläufern. Inzwischen hatte Zack sie eingeholt und trieb die Tiere mit seiner langen Viehpeitsche in die Menge, ohne auf das wütende Brüllen und Muhen zu achten.
Der Zwischenfall hatte allgemeine Unruhe gestiftet, und weiter vorn konnte Zack durch die Staubwolken Milligan erkennen, der an den Flanken entlang galoppierte, um ein erneutes Ausbrechen zu verhindern.
»Danke, Kumpel.«
Zack sah sich um und erblickte den schwarzen Treiber. Er lachte.
»Du hast das schon richtig gemacht. Hättest mich nicht gebraucht, Junge. Nettes kleines Tier, das du da hast.«
»Ja, ist eine echte Schönheit.«
»Du arbeitest auf Big Run?«
»Nein, ich bin Treiber. Bin jetzt seit zwei Jahren bei Paddy. Wir arbeiten meistens von Katherine aus, aber er bekam den Auftrag, die Herde hinzubringen. Hat sich gefreut wie sonst was, dass er sich mit den Bossen in Victoria River gut steht. Gibt sicher viel Arbeit da.«
Zack war fasziniert. Der junge Bursche war ein waschechter Aborigine, kein Zweifel, hatte die gleichen breiten Gesichtszüge und den hochgewachsenen, drahtigen Körper wie die meisten Schwarzen dieser Gegend, sprach aber nicht das übliche Pidgin-Englisch, das die meisten von ihnen benutzten.
»Wie heißt du?«
»Yorkey.«
»Woher kommst du?«
»Von überall her.«
»Ich meine, von welchem Stamm?«
»Was geht dich das an?«
Zack war verblüfft. Als Besitzer von Black Wattle war er an derartige Zurückweisungen nicht gewöhnt, schon gar nicht von Seiten eines Schwarzen.
»Nichts. Ich wollte mich nur unterhalten.«
»Na denn«, sagte Yorkey schulterzuckend. Er trieb sein Pferd an, um ausbrechende Tiere wieder in die Herde zu lenken.
Zack schaute ihm nach. »Da hol mich doch! So ein frecher Kerl.«
Yorkey schämte sich. Warum hatte er bloß so etwas Dummes gesagt? Wollte sich ein bisschen wichtigmachen, das war alles. Dem Neuen zeigen, wo es langging. Wieso hatte er nicht wie üblich »weiß nicht« geantwortet? Das gefiel den Weißen, sie konnten die Stämme ohnehin nicht auseinanderhalten. Yorkey hatte seinen Vater nie kennengelernt, er war vor seiner Geburt gestorben, war aber ein wunderbarer Mann, ein großer Mann gewesen. Vom Volk der Whadjuck. Doch wenn man den Weißen am Lagerfeuer davon erzählen wollte, erntete man nur Hohn und Spott …
»Ho! Ho! Wo juckt es, Yorkey? Am Rücken? Am Hintern? Oder sonst wo?«
Und das war noch harmlos. Wenn man sich dann ärgerte, galt man als humorloser Spielverderber. Er hatte jedoch fasziniert ähnliche Gespräche der Weißen mit angehört und festgestellt, dass viele von ihnen mit Schiffen aus anderen Ländern gekommen waren. Zuerst hatte er geglaubt, sie gehörten verschiedenen Stämmen an, doch sie sahen alle gleich aus und sprachen dieselbe Sprache. Irgendwie rätselhaft, doch Yorkey verlor das Interesse und fragte nicht nach.
Mit brennenden Ohren trabte er durch den Busch, um die Flanke der Herde an einer anderen Stelle zu schützen, mindestens eine halbe Meile von dem Burschen entfernt, der so höflich mit ihm gesprochen hatte. Doch er hatte auch gesagt, er wolle sich nur unterhalten. Meinte er damit, dass es ihn eigentlich gar nicht interessierte?
Andererseits wusste Yorkey, dass er nur nach Ausflüchten suchte.
Er ließ das Pferd dahintraben und dachte an seine Mutter …
»Dein Vater war ein Whadjuck-Mann, nicht der Weiße, den wir jetzt hier haben. Und auch nicht der davor. Der Erste hat mich schnell rausgeworfen, als er erfuhr, dass ich ein Baby bekomme und dass es nicht seins war. Hat mich schlimm verprügelt. War ihm zu nichts mehr nütze.«
Anscheinend hatte sie irgendwo in dieser Gegend auf einer Station als Hausmädchen gearbeitet. Zur Zeit der Wanderung durfte sie wohl die Schlucht mit ihren Angehörigen besuchen. Als sich herausstellte, dass sie schwanger war und keinen Mann vorweisen konnte, hatte sie sich so geschämt, dass sie mit einem Viehtreiber davongelaufen war.
»Dein Daddy ist gestorben. Ich habe mich nicht getraut, seinen Namen zu nennen, nicht mal seinen Weißen-Namen. Wozu auch? Er war fort.«
»Wie lautete sein Weißen-Name?«
Sie hatte gelächelt, war ehrlich stolz gewesen. »Er hatte nicht bloß einen Namen wie wir, er hatte zwei wie die Weißen. Er hieß Jimmy Moon.«
Yorkey hatte oft daran gedacht. Eigentlich sollte auch er nach dem Gesetz der Weißen den Namen seines Vaters tragen und sich Yorkey Moon nennen. Doch sie hatte niemandem davon erzählt, man würde daher glauben, er habe sich seinen Namen nur ausgedacht.
Sie hieß Netta. Den zweiten weißen Mann hatte sie als ihren Ehemann bezeichnet, doch eine Heirat hatte nie stattgefunden. Sie war sein »schwarzer Junge«, so nannte man schwarze Eingeborenenfrauen, die ihr Haar kurz trugen, sich wie Jungen kleideten, ihr Bett mit dem Mann teilten und für ihn mit dem Vieh arbeiteten, kochten und putzten. Als »Ehemann« war Alfie Dangett gar nicht mal so schlecht gewesen, vermutete Yorkey. Sie durfte immerhin ihr Kind mitbringen, das Kind, das er nach seiner Heimatstadt York benannt hatte, doch Yorkey und Netta hatten ihn immer »Boss« genannt. So lief das eben. Als Yorkey zwölf gewesen war, war Netta beim Sturz von einem Pferd gestorben.
Nie würde Yorkey die Nacht vergessen, als die Männer ihre Leiche ins Lager brachten, in eine Pferdedecke gehüllt. Er war entsetzt gewesen, auch ungläubig, hatte mit offenem Mund dagestanden, bis ihn die Erkenntnis traf und er zu schreien begann. Doch als er den Boss Alfie erblickte, der neben ihr kniete und weinte wie ein Kind, war er vor Schreck verstummt. Wer hätte geglaubt, dass ein Kerl wie Alfie einer Abo-Frau nachweinen würde? Er hatte sie nicht geschont, doch sie musste ihm tatsächlich etwas bedeutet haben. Ob sie davon gewusst hatte? Und wenn schon, die einzige Liebe ihres Lebens, Jimmy Moon, war längst dahingegangen.
»Dein Vater war ein Wanderer. Ein weiser Mann. Er kam von Süden her, aus Perth. Konnte Sprachen. Manche behaupteten, er sei ein Zauberer. Er durchquerte die großen Wüsten, wo sich nicht einmal die Weißen hinwagen. Ein großer Mann und sehr schön. Du siehst aus wie er.« Komisch, wenn Frauen solche sentimentalen Sachen sagten.
Doch sie hatte nie erwähnt, wie Jimmy umgekommen war. Wohl ein Unfall, er war noch so jung gewesen. Und da er so angesehen war, hatten ihn seine weißen Freunde begraben wollen, doch die Ältesten ihres Volkes, der Waray, duldeten es nicht. Sie hatten ihn mitgenommen und nach den angemessenen Trauerriten bestattet.
Eine schlimme Sache war das gewesen.
Nachdem sie gestorben war, behielt ihn der Boss bei sich, ließ ihn im Küchenwagen mitfahren, Aushilfsarbeiten im Lager übernehmen, er kümmerte sich um die Pferde, flickte Leinwand … es gab viel zu tun, bis er alt genug war, um Viehhüter zu werden. In der Zwischenzeit nahm der Boss einen anderen »schwarzen Jungen« zu sich, doch sie war jähzornig und konnte kaum Englisch, suchte ständig Streit und brachte alles durcheinander. Schließlich trennte er sich von ihr. Dann begegnete er einer Weißen, die Alfie nur heiraten wollte, wenn er die Viehtreiberei an den Nagel hängte. Die Mannschaft zerbrach.
Damals befanden sie sich in Queensland. Yorkey heuerte bei anderen Treibern an und kehrte schließlich ins Territorium zurück, weil seine Mum große Stücke darauf gehalten hatte. Und so übel war das Leben als Viehtreiber auch nicht.
Er griff nach seiner Wasserflasche und nahm einen Schluck. Er freute sich schon, sie mit dem sauberen Wasser aus der Schlucht zu füllen.
Die Arbeit als Treiber bot einem viel Zeit zum Nachdenken. Er befand sich hier im Gebiet der Waray, der Heimat seiner Mutter, doch es war ihm erst aufgefallen, als er den Namen der Schlucht hörte. Sie hatte ihm von ihrer Zeit hier erzählt, den ersten sechzehn Jahren ihres Lebens, der einzigen Zeit, die ihr etwas zu bedeuten schien, als sei der Rest ihres Lebens nichts wert gewesen. Doch er konnte sich kaum noch an ihre Geschichten erinnern. Kinder hören nie richtig zu. Später jedoch zermarterte er sich das Hirn, um sich die Zeit zu vertreiben, suchte nach winzigen Bruchstücken des Wissens, die irgendwo in seinem Kopf steckten, verschwommen und undeutlich. Es wäre schön, eine Heimat zu haben, einen Ort, an den man gehörte. Es war geradezu Mitleid erregend, wenn er sich als Whadjuck bezeichnete. Niemand hatte je davon gehört. Doch die Waray gab es wirklich. Vermutlich hatte er sogar Verwandte in der Gegend.
Yorkey schüttelte die seltsame Stimmung ab. Und wenn schon? Wen interessierte es, wenn der arme, kleine Yorkey ganz allein auf der Welt war? Pech gehabt! Yorkey war stolz auf seine Härte. Er ließ sich nichts gefallen. Er war geschickt, konnte die meisten seiner Kumpel übertrumpfen. Bei einem Zeltkampf hatte er sogar zwei Pfund gegen einen Raufbold aus dem Süden gewonnen. Ihn k.o. geschlagen. Und die Menge hatte getobt! Danach hatten sich alle betrunken. Der Boss der Show hatte ihn sogar aufgefordert, sich der Truppe anzuschließen, doch Yorkey war nicht dumm. Was also hatte diese trübselige Stimmung hervorgerufen? Vermutlich die verdammte Schlucht. Hatte ihn bestimmt verhext wie einen armen, alten Abo, der nicht von der Vergangenheit lassen kann.
Er legte die Finger an die Lippen und stieß einen schrillen Pfiff aus, um Paddy zu warnen. Der Weg hatte sich zu einem ausgetrockneten Flussbett erweitert. Sie waren nur noch eine Meile von der Schlucht entfernt. Es war Zeit, die Herde in die Länge zu strecken und das Tempo zu drosseln. Da kam ihm ein Gedanke. Der andere Viehhüter, der Fremde, hatte ihn gefragt, ob er von der Big Run käme. Was bedeutete, dass er selbst nicht von dort stammen konnte. Wer also war dieser Eindringling? Wo hatte Paddy ihn aufgelesen?
3. Kapitel
Fünf Männer zogen quer durchs Land. Sie bewegten sich schnell, ihre nackten Füße tappten leise über die harte, trockene Erde, die Körper waren staubbedeckt, die Gesichter kalt und grimmig. Sie waren seit der Morgendämmerung unterwegs, machten keine Umwege, drängten stetig voran über die ockerfarbenen Ebenen, aus denen sich vereinzelt bleiche Büschel Stachelkopfgras und verkümmerte Bäume erhoben. Am Horizont erschien die hohe Spirale eines Wirbelsturms, umfing sie mit einem verkleinerten Tornado aus pfeifendem Staub und Geröll, peitschte die nackte Haut, blendete sie fast, doch er zog schnell vorüber, und sie tauchten unversehrt wieder auf, dankbar für die klare Luft.
Sie rutschten die zerfurchte Böschung eines ausgetrockneten Flussbetts hinunter, die Füße tasteten nach Anzeichen von Feuchtigkeit und fanden sie, Hände gruben sich drängend eine Armlänge tief in die Erde, Wasser sprudelte, sie tranken. Dann zogen sie weiter, Meile um Meile im gleichen Tempo, die langen Jagdspeere störten nicht den Rhythmus ihrer Schritte. Sie schienen nicht auf die quälende Sonne zu achten, die sie den ganzen Tag verfolgt hatte, schließlich das Interesse verlor und in der Ferne verblasste. Reden kostete Kraft. Mimimiadie war der Anführer, sie mussten mit ihm Schritt halten an diesem fünften Tag ihrer verzweifelten Flucht.
Die Männer gehörten zu der berühmten oder, wie die Weißen sagen würden, berüchtigten Horde vom Daly River, die in Wirklichkeit aus mehreren Stämmen bestand, denen das Gebiet am Fluss seit Urzeiten gehörte. Doch in den letzten Jahren hatte ein Krieg zwischen den weißen Siedlern, Viehtreibern und Goldsuchern des Territoriums und dem Eingeborenenvolk getobt, das seine Heimat nicht kampflos aufgeben wollte. Dass die neue Regierung, die Tausende von Meilen weiter südlich in Adelaide saß, auf eine humane Behandlung der Schwarzen drängte, wussten die meisten Aborigines nicht, und nur die wenigsten Weißen teilten diese Haltung. Es war ein verborgener, ein Guerillakrieg, der nur selten in den Zeitungen des Südens auftauchte, und wenn es doch geschah, versprachen Geschichten von mörderischen Überfällen durch schwarze Dämonen eine höhere Auflage und kitzelten die Sensationsgier der Bürger in den Vororten. Sie bekamen nicht genug von den blutigen Neuigkeiten und den Heldentaten der Pioniere des Nordens, die den schwarzen Horden standhaft entgegentraten.
Es interessierte niemanden, wenn die Berater der Königin im fernen London ihrem Entsetzen darüber Ausdruck verliehen, dass in dieser Kolonie ein Guerillakrieg tobte, und auf Einhaltung der Gesetze pochten. Mord war noch immer ein Verbrechen, daran sollten die Gerichte beide Seiten erinnern. Aber wie?
Der Vertreter der Regierung im Territorium hatte seinen Sitz in Darwin und war als »Der Resident« bekannt. Zurzeit hatte Lawrence Mollard, ein ehemaliger Staatssekretär für öffentliche Arbeiten, dieses Amt inne. Nach außen hin unterstützte er die Bitten der Parlamentarier in Adelaide, unternahm aber nichts gegen die Gewalttaten, die nach wie vor in seinem Zuständigkeitsbereich geschahen. Mollard fand es einfacher, derartige Berichte als übertrieben abzutun.
Und so ging der Krieg im Outback weiter.
Weiße Männer entführten schwarze Frauen, Schwarze schlachteten das Vieh der Weißen ab. Krieger wurden gejagt und erschossen, Wohnhäuser gingen in Flammen auf, ganze Familien wurden von Trupps weißer Männer umzingelt, die Erwachsenen erschossen, die »Brut« zu Tode geprügelt, um Munition zu sparen. Verletzte Weiße wurden in ihren Lagern ermordet. Die Vergeltung folgte auf dem Fuß. Suchtrupps erschossen blindlings Schwarze, wo immer sie sie fanden, während eine hoffnungslos unterbesetzte Polizei zur gleichen Zeit verzweifelt versuchte, Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten, und einige der wahren Täter, weiß wie schwarz, verhaftete.
Die schnellen Wanderer, von denen hier die Rede ist, gehörten nicht unbedingt zum selben Clan, hatten aber ihre Familien versammelt, um zu überleben, und kümmerten sich nicht um feine Unterschiede zwischen den einzelnen Stämmen. Sie hatten einen Ältesten befragt, der die Verschmelzung unter den gegebenen Umständen befürwortete, allerdings hinzufügte, dass sich jeder an seine Traditionen halten solle.
Jeder Mann trug die Last seiner Trauer mit sich. Numinga, der älteste der Gruppe, empfand seine Trauer wie einen Speer, der nie die Erde berührt hatte. An dem Tag, als er seinen Vater in Ketten gesehen hatte, dem man aus Spaß noch zu essen gab, bevor man ihn erschoss, hatte der Speer die schmerzhafte Reise durch sein Herz angetreten und war ins Blaue geflogen, auf der Suche nach Frieden, nach einem Ort, wo die alten Zeiten wieder aufblühen würden. Obwohl Numinga verfolgt wurde, hatte er den Krieg satt und sehnte sich nach Frieden mit den Weißen.
Mimimiadie war ein erfahrener Vollblutkrieger, ein erbarmungsloser Kämpfer. Seine Frau war mit einer kleinen Gruppe auf die Jagd gegangen, doch als sie ins Lager zurückkehrten, entdeckten sie ihren zerschlagenen Körper in einem nahen Gebüsch. Er hatte sich gerächt, bevor die Frau begraben war, bevor noch die angemessene Trauerzeit begonnen hatte. Numinga wusste, Mimimiadie war ebenso gefährlich wie seine Gefährten Matong und Gopiny, doch was hätte er tun sollen? Nachdem sie zwei Goldsucher, die am Tod seiner Frau offensichtlich keine Schuld traf, aufgespürt und im Schlaf getötet hatten, hatte Mimimiadie erklärt, er führe den Krieg schlicht und einfach nach den Regeln des weißen Mannes. Auch seine Frau sei schuldlos gewesen.
Der junge Bursche Djarama, der ungefähr fünfzehn sein musste, war bei dem blutigen Überfall vor Schreck erstarrt. Er war aus einer Missionsstation geflohen, wo ihm die weißen Gottesmänner, erstaunlich genug, erklärt hatten, dass die Morde an Schwarzen falsch seien. Ein Verbrechen. Ein Verstoß gegen die Gesetze der Weißen. Diese Narren! In der Missionsstation wäre Djarama sicher gewesen, aber nein, ausgerechnet diese Erzählungen hatten ihn dazu getrieben, sich einen Speer zu schnitzen und gegen die Weißen in den Krieg zu ziehen, und er hatte sich dieser Horde angeschlossen.
Die Missionare vom Daly River hatten ihn als Kleinkind zu sich genommen, so dass er keinen Kontakt zu seinen Angehörigen mehr hatte. Er war überglücklich gewesen, dass ihn die schwarzen Männer und die nette Frau bei sich aufgenommen hatten. Doch sie war mittlerweile tot, und seit er ihren verstümmelten Körper gesehen hatte, war die Trauer ein ständiger Gast in seinen Augen. Er stand noch unter Schock, als Mimimiadie und seine beiden Gefährten mit den Goldsuchern kurzen Prozess machten. Und als er die Schreie hörte, krümmte er sich angeekelt zusammen.
Sie alle hatten Narben davongetragen, tiefe Narben, dachte Numinga im Gehen. Sie waren unwiderruflich gezeichnet. Die Stammeskriege der alten Zeit waren festen Regeln gefolgt, die von den Urvätern festgelegt worden waren, aus ihrem Verständnis der Traumzeit heraus. Landbesitz wurde selten in Frage gestellt, weil jeder Fels, jede Wasserstelle, jeder Hügel und jede Ebene eine eigene Geschichte besaß, einen Ort in der Überlieferung der Stämme. Störungen, Überfälle, Beleidigungen führten zu Schlachten, doch nie zu einer Zerstörung ganzer Stämme und Traditionen. Jetzt war ein neues Denken gefragt, auf das niemand vorbereitet war. Selbst die größten Zauberer und Ältesten, die man früher als Richter angerufen hatte, um Blutvergießen zu vermeiden, wussten keine Antwort, keine Lösung.
Während sie in die Abenddämmerung marschierten, brauchte Numinga die drei anderen nicht anzusehen, er kannte ihre Gefühle auch so. Sie waren im Durchschnitt zwanzig Jahre jünger als er, lebten aber in der Vergangenheit. Sie trugen die Bürde des Todes, das konnte er an den angespannten Muskeln ihres Rückens sehen, am Schwung ihrer Hüften, der Art, wie sie auftraten, am Gleichschritt, mit dem sie gingen. Er seufzte. Sie hatten zu viel gesehen, waren zu tief verletzt worden. Sie würden niemals nachgeben und als »zahme« Schwarze um Asyl bitten wie so viele andere vor ihnen. Wie Numinga selbst. Gegen Verpflegung für die Weißen arbeiten. Sie waren Krieger, doch man würde sich an den Lagerfeuern der Zukunft keine Geschichten über sie erzählen, sie würden in dem Wirbelwind untergehen, der ihre Rasse verschlang.
Numinga trauerte an ihrer Stelle, konnte ihnen aber keinen Rat geben: Er wusste keinen Ausweg. Er selbst hatte die Lebensweise der Weißen vor Jahren ausprobiert, die Freundschaft eines Weißen angenommen, eines Viehzüchters. Er war fasziniert gewesen von all dem Neuen, von den Pferden, die ihm ans Herz gewachsen waren. Es hatte weh getan, als Mimimiadie auch die Pferde der Goldsucher mit dem Speer tötete. Er hatte dazwischengehen wollen, doch man hatte ihn ausgelacht und beiseitegestoßen.
»Diese Tiere gehören nicht hierher. Sie haben keinen Platz in unserer Traumzeit«, hatte Mimimiadie gerufen. Und dies von einem Mann, der sich einige Wochen lang eines gestohlenen Pferdes gerühmt hatte, bis die Polizei es ihm wegnahm.
Numinga hatte auf der Station gearbeitet, fasziniert von dem Gedanken, dass die weißen Menschen derart luxuriöse Schutzhütten benötigten. Er hatte gelernt, wie man ein Pferd ritt, Vieh zusammentrieb, und beherrschte bald auch ihre Sprache. Er hatte sie gelehrt, Nahrung und Wasser in Gegenden zu finden, die sie als leere Wildnis betrachteten, und sich über ihre Unwissenheit amüsiert. Als sein Boss eine neue schwarze Frau mitbrachte, hatte er sich geschämt und schämte sich noch. Der Boss hatte keine Ehefrau und daher beschlossen, dass diese, die er von einem in der Nähe lebenden Stamm entführt hatte, ihm reichen würde. Er band sie an einen Baum, um sie zu zähmen, als sei es die natürlichste Sache der Welt. Er hatte sie drei Tage dort gelassen, und Numinga hatte nicht gewagt, seine Missbilligung zu zeigen, brachte ihr aber etwas zu essen.
Sie war ein schönes Mädchen mit weicher Haut und zarten Zügen. Aber temperamentvoll. Sie hatte ihn angespuckt, seine Hilfe zurückgewiesen, geschrien und getreten, wenn der Boss sich lächelnd näherte. Als er sie schließlich freiließ, griff sie ihn mit Tritten und Bissen an. Daraufhin hatte er sie geprügelt. Zu sehr. Am Ende wies er seine Männer an, sie gehen zu lassen, was sie auch taten, nachdem sie den Verband von ihrem Kopf entfernt hatten. Denn sie war zu nichts mehr nütze. Mit ihrem zerschlagenen Hirn war sie zu einer Verrückten geworden, die auf Nimmerwiedersehen in den Busch taumelte.
Die Scham. Die Schande, dachte Numinga trauervoll, selbst wenn es schon so lange zurücklag. Er hatte versucht, sich damit zu trösten, dass schwarze Männer mit ihren Frauen ebenso hart ins Gericht gingen, wenn diese gegen die Gesetze verstoßen hatten. Doch was hatte dieses Mädchen getan? Er versuchte, nicht mehr daran zu denken.
Kurz darauf war ein Trupp weißer Männer auf die Station gekommen, und der Boss hatte sie freudig willkommen geheißen. Doch diese Männer, die der berittenen Polizei angehörten, hatten sechs schwarze Gefangene dabei, die Ketten um den Hals trugen, genau wie sein Vater. Numinga war entsetzt gewesen. Er hatte geglaubt, die Zeiten seien vorbei. Man ließ sie über Nacht am Pferdetrog, doch ohne Wasser, so dass er sich in der Dunkelheit hinausstahl und jedem Mann einen Krug Wasser brachte. Er war froh über ihre Dankbarkeit.
Doch später in der Nacht waren die betrunkenen weißen Männer, darunter auch sein Boss, aus dem Haus gewankt, hatten die Gefangenen freigelassen und dann auf die Flüchtenden geschossen und gejubelt, wenn einer getroffen zu Boden stürzte.
Am nächsten Morgen zogen die Besucher fröhlich weiter, nachdem sich der Boss ohne ein Zeichen der Reue von ihnen verabschiedet hatte.
Numinga hätte sein Gewehr benutzen können. Er wusste, wie man damit schoss, hatte verletztes Vieh getötet, um die Dingos fernzuhalten. Die vier weißen Viehhüter besaßen Waffen und Munition; ihre Gewehre hingen an einem Brett neben der Küchentür. Er hätte sich ohne weiteres eine Pistole, ein Gewehr oder eine Schrotflinte besorgen können, doch das war nicht richtig. Er nahm sich Zeit, einen Speer zu schnitzen, einen Kriegsspeer mit fein geschliffener Steinspitze, so wie es die Tradition vorschrieb, keinen der langen Nägel, wie man sie in letzter Zeit von den Weißen gestohlen hatte. Es war ein schöner Speer, der beste, den er je gemacht hatte, und seiner Mission durchaus angemessen.
Eines Tages ritt Numinga mit seinem Boss weit in den Busch. Plötzlich rammte er ihm den Speer in den rechten Arm, damit er die Schusswaffe beim Sturz nicht erreichen konnte.
»Du hättest die Schwarzen nicht niederschießen sollen, einfach so«, sagte er, um die Hinrichtung anzukündigen. Und den Rest besorgte sein neuer Speer.