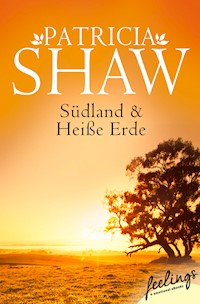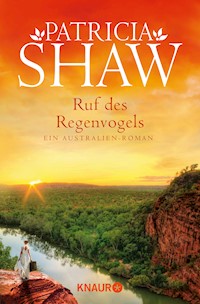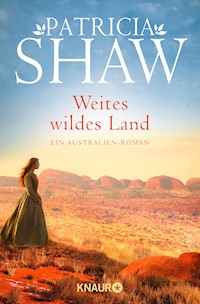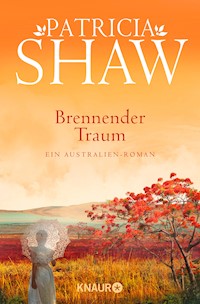6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Für den Schafzüchter Clem ist es Liebe auf den ersten Blick, doch die verwöhnte Thora ist unerreichbar für ihn. Als sie jedoch unehelich schwanger wird, ist die Ehe mit Clem ihre Rettung. Um das Herz seiner Frau zu gewinnen, geht dieser auf Goldsuche – und eine dramatische Geschichte um Liebe, Gier und Leidenschaft beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 860
Ähnliche
Patricia Shaw
Leuchtendes Land
Aus dem kanadischen Englisch von Susanne Goga-Klinkenberg
Knaur e-books
Cromwell, bei deinem Heil,
wirf Ehrsucht von Dir!
Die Sünde hat die Engel
Selbst betört.
SHAKESPEARE, Heinrich VIII.
1.Kapitel
Jeder an Bord wünschte, die lange Reise möge enden; das heißt jeder außer Clem Price, der das herrliche Abenteuer genoss. Der Junge liebte das Schiff – von der gemütlichen kleinen Kabine in dessen Bauch bis zum schwankenden Deck hoch über ihm, auf dem er sich ebenso behende bewegen konnte wie die Seeleute. Jeder Tag brachte neue, aufregende Erlebnisse. Bei gutem Wetter war dort oben eine Menge los. Einige Passagiere spielten Ringwerfen oder Decktennis, andere vollführten Turnübungen, schlenderten umher oder setzten sich in Liegestühle, um zu lesen oder miteinander zu plaudern, während die Mannschaft unter dem wachsamen Auge des Kapitäns ihre Arbeit verrichtete. Bei schlechtem Wetter blieben die Passagiere unter Deck, quetschten sich zu den Mahlzeiten an die langen Messetische oder vertrödelten die Zeit in ihren Kojen. Clem hingegen war immer in Bewegung. Er zog mit den Stewards durch das Schiff oder schlüpfte in die Kombüse, um mit dem Koch zu plaudern, der stets einen Apfelschnitz oder ein Stück Brot mit Bratenfett für den Jungen bereithielt.
Und dann war da der Ozean selbst, der Clem grenzenlose Freude bereitete. Er klammerte sich an die Reling, ließ seine Blicke über die endlosen Wogen schweifen und genoss die Launen des Meeres. Er war dabei, als zum ersten Mal Delphine gesichtet wurden, und würde niemals den ungeheuren Wal vergessen, der wie eine riesige Dampflok in der Nähe des Schiffes aus der Tiefe hervorgebrochen war. Clems Vater hatte seinen Sohn festgehalten, weil er gedacht hatte, er fürchte sich. Der Junge aber hatte ihn weggestoßen, da er nicht eine Sekunde dieses ehrfurchtgebietenden Schauspiels hatte versäumen wollen.
Wenn er nachts in seiner Koje lag, lauschte Clem gespannt auf die Geräusche des Schiffes. Zu Hause auf der Farm waren die Nächte still und reglos, doch hier begann die Dunkelheit zu leben. Er konnte das Tosen und Gurgeln der See hören, das Knarren der Planken, das Klirren der Stahlringe am Mast, die Rufe der Wachen, das schaurige Heulen des Windes, der bei Tag so viel fröhlicher klang. Clem machte es Spaß, diese vielen neuen Geräusche den Dingen, die sie erzeugten, zuzuordnen und in sein Repertoire aufzunehmen, als gelte es, die Instrumente eines Orchesters voneinander zu unterscheiden.
Diese Töne wurden von den weniger angenehmen Geräuschen seiner Mitpassagiere überlagert: den lauten Stimmen und dem Gelächter beim gemeinsamen Singen, manchmal aber auch von wütenden Schreien oder dem Gemurmel ernsthafter Gespräche. All das vermittelte dem Jungen Geborgenheit und sagte ihm, der schöne Clipper mit den drei hohen Masten werde ihn so sicher wie eine Vogelschwinge über die Meere tragen. Eines Nachts verstummten die Stimmen. Verstört von der plötzlichen Stille spitzte Clem die Ohren. Einen Moment lang dachte er, die Welt sei stehengeblieben, doch das Schiff pflügte weiter durchs Meer, hob und senkte sich, und die Stimme des Ozeans klang lauter denn je.
Er setzte sich in seiner Koje auf und spähte in die Dunkelheit. Seine Eltern und seine Schwester Alice waren noch nicht im Bett. Alice war schon neun und durfte, da sie drei Jahre älter war, länger aufbleiben als er, doch selbst sie hätte um diese Zeit schlafen müssen. Langsam glitt Clem aus seinem Bett und öffnete die Kabinentür, um einen Blick in den schmalen Gang zu werfen. Er entdeckte zwei Frauen, die sich leise unterhielten und dann in ihren Kabinen verschwanden. Wenigstens war er nicht allein an Bord.
Obwohl ihn das nicht ganz beruhigte, kehrte er in seine Koje zurück und ließ sich vom tröstenden Flüstern des Ozeans in den Schlaf wiegen, anstatt der unterschwelligen Angst nachzugeben, die sich in ihm regte.
Am Morgen weckte ihn sein Vater Noah mit einem Becher dünnem Tee und ließ sich schwer auf die Koje fallen, um mit ihm zu reden.
So etwas geschah nur selten, und Clem spürte ein gewisses Unbehagen. »Wo ist Mutter?«
»Du weißt, dass deine Mutter krank war«, sagte Noah seufzend. Clem nickte und nahm einen Schluck Tee.
»So krank, dass sie die letzte Woche im Krankenrevier verbracht hat«, fuhr sein Vater fort.
Clem hörte Alice schniefen, als weine sie, und er spähte zu ihrer Koje hoch. »Was ist mit Alice los?«
»Sie ist aufgeregt, Lass sie in Ruhe. Ich will mit dir sprechen. Hier, trink deinen Tee aus.« Noah hielt ihm den klobigen Becher hin, und Clem trank den Rest. »So ist es gut. Nun, Clem, es fällt mir furchtbar schwer, aber ich muss dir sagen, dass deine liebe Mutter in den Himmel gegangen ist. Gott hat ihr Leiden gesehen und sie in seiner Güte zu sich gerufen, damit sie in Frieden ruhen kann.«
Clem starrte ihn an. Er glaubte kein Wort und war wütend, weil sein Vater ihm solch eine Lüge erzählte.
Über ihm war Alice in lautes Schluchzen ausgebrochen. Clem wünschte, sie würde damit aufhören. Sie mochte ein großes Mädchen sein, aber manchmal heulte sie wie ein Kleinkind. Sein Vater redete, erklärte, entschuldigte sich noch immer, und Clem wagte nicht, ihm zu widersprechen.
Noah war ein Riese mit einer lauten Stimme, den man besser nicht verärgerte. Daher schwieg der Junge und nickte teilnahmslos, so dass er aussah wie Alices Puppe mit dem losen Kopf. Schließlich suchte Noah Zuflucht im Gebet und kniete mit seinen beiden Kindern an der Seite über die Koje gebeugt nieder.
Frauen näherten sich der Tür, flüsterten, besprachen sich mit Noah, drängten sich in die Kabine, tätschelten Clems Kopf und nannten ihn einen tapferen Jungen. Sie sagten auch, Alice sei ein tapferes Mädchen – was nicht stimmte, da sie die ganze Zeit heulte –, und Clem traute keiner von ihnen über den Weg.
Als er endlich den erstickenden Umarmungen, Streicheleien und schönen Reden entwischen konnte, rannte er geradewegs in Richtung Deck und prallte mit dem Kapitän zusammen. Etwas Besseres hätte ihm an diesem Morgen gar nicht passieren können. Der Kapitän nahm ihn mit ins Ruderhaus, zu dem der Zutritt den Passagieren eigentlich verboten war, und ließ ihn das Schiff steuern. Er redete jedenfalls nicht die ganze Zeit von Himmel und Tod, weil er Wichtigeres zu tun hatte, und Clem wusste dies zu schätzen. Er stand auf einem Hocker und steuerte das Schiff behutsam durch die steilen Wellen, um zu beweisen, wie ernsthaft und pflichtbewusst er war. Der Kapitän stand neben ihm und rauchte mit geduldigem Respekt seine Pfeife.
Am nächsten Tag erschien Alice in einem glänzenden schwarzen Kleid. Clem starrte sie an. Das Kleid war hässlich, hatte einen schiefen Kragen, der wie ein Lappen herunterhing, und einen unordentlichen Saum, der auf einer Seite über den Boden schleifte.
»Woher hast du das komische Kleid?«, fragte er.
»Einige der Frauen an Bord haben es für mich gemacht.«
»Zieh es aus, du siehst aus wie eine alte Zwergenfrau.« Zu seinem Erstaunen brach Alice in Tränen aus.
»Du siehst nicht aus wie eine alte Zwergenfrau, ehrlich nicht«, lenkte er ein, doch sie ließ sich nicht trösten.
»Du hast recht. Das Kleid ist scheußlich, aber ich muss es tragen, weil wir in Trauer sind. Von jetzt an werde ich immer hässlich sein.«
Er zupfte an dem Kleid. »Du bist nicht hässlich, Alice. Ich habe die Frauen sagen hören, du wärst ein hübsches Mädchen.«
»Tatsächlich?«, Sie schaute ihn freudig überrascht an.
»Ja, ganz ehrlich.« Das hatten sie auch gesagt, dann aber hinzugefügt: »Bis auf …« Clem war jedoch klar, dass er dies besser nicht wiederholen sollte, wenn er seine dumme Bemerkung von vorhin wiedergutmachen wollte.
Clem wünschte, seine Mutter wäre nicht in den Himmel gegangen. Bei ihr hätte Alice dieses Kleid nicht tragen müssen. Doch sie war tatsächlich dorthin gegangen. Zunächst hatte er im Krankenrevier nachgeschaut und anschließend das ganze Schiff nach ihr abgesucht. Überall hatte er nachgesehen. Da er klein war, konnte er ungestört in den Kabinen und tief im Schiffsinneren herumspionieren. Er hoffte, dass es ihr im Himmel gutginge, vermisste sie jedoch sehr, da er ihr Liebling gewesen war.
Jedenfalls war es schade, dass sie Alice nicht mitgenommen hatte. Er und Pa kamen schon zurecht, aber Alice litt sehr. Sie weinte viel, möglicherweise, weil die Familie aus dem Gleichgewicht geraten war und nun aus zwei Männern – ihn mitgerechnet – und nur einem Mädchen bestand. Niemand konnte Alice die Haare flechten, Kleider für sie anfertigen oder mit ihr zusammen nähen. Die ganzen Frauensachen musste sie nun allein erledigen. Arme Alice.
»Keine Sorge, Alice«, sagte er beherzt, »ich werde mich um dich kümmern. Wenn ich groß bin, passe ich immer auf dich auf.«
»Welche Frau hat gesagt, ich sei hübsch?«
»Mrs. Cathcart, und die anderen haben ihr zugestimmt. Es ist wahr, ehrlich.«
Trotz seiner mutigen Worte war er es, der sich an Alice klammerte, als das Schiff in Fremantle vor Anker ging. Dies war der erste australische Hafen, der angelaufen wurde, und Clem stand inmitten des verwirrenden Lärms am Kai, ein kleiner Junge, eingeschüchtert vom Krach und von den Menschenmassen.
Er und Alice warteten eine Ewigkeit und starrten auf die Lagerschuppen, während sich ihr Vater davon überzeugte, dass ihr gesamtes Gepäck an Land geschafft worden war. Zu ihrem Erstaunen mussten sie sich danach in eine Schlange einreihen, um an Bord eines Bootes zu gelangen.
»Wohin fahren wir, Papa?«, fragte Alice nervös. »Ich dachte, wir seien da.«
»Sind wir auch, Mädchen. Von hier aus fahren wir stromaufwärts in die Stadt Perth. Das hier ist nur der Hafen.«
Alice war müde und döste an Noah gelehnt vor sich hin, während das Boot den Fluss hinauffuhr. Clem hingegen rannte hin und her und betrachtete die grünen Wälder zu beiden Seiten des breiten, ruhigen Stromes. Stunden später kamen sie um eine Biegung, und vor ihnen lag Perth.
Noah weckte Alice. »Sieh nur, wir sind da. Die Reise ist vorbei.«
Die Mitreisenden brachten ein dreifaches Hurra auf die Ankunft aus, und alle sahen aufgeregt zu den verstreut liegenden weißen Häusern zwischen den staubgrünen Bäumen hinüber.
»Sieht nicht gerade wie eine Stadt aus«, klagte eine Frau, doch Noah lachte.
»Das ist ja das Schöne daran. Ein unberührtes Land und Platz für alle. Eine Stadt muss nicht nur aus Rauch und Lärm bestehen.«
Nachdem sie von Bord gegangen waren, hatten Noah und Alice viel zu tun. Von irgendwoher tauchte ein Wagen auf. Jemand sagte Clem, er solle schon einmal hineinklettern und warten, doch sie ließen ihn dort so lange in seinem Matrosenanzug sitzen, dass ihm irgendwann der Verdacht kam, sie hätten ihn vergessen. Voller Panik kämpfte er sich auf der Suche nach seiner Familie durch ein Gewirr aus Gepäckstücken und Reifröcken.
Alice rannte mit ihrem komischen schwankenden Schritt hinter ihm her. Einer ihrer Füße war krumm gewachsen. Noah sagte immer, der Fuß sei vollkommen in Ordnung, er schaue nur lieber den anderen Fuß an, als nach vorn zu blicken, doch Alice schämte sich dafür. Sie versteckte ihn deshalb stets unter zu langen Kleidern, doch die guten Frauen auf dem Schiff hatten beim Nähen des Trauerkleides keine Rücksicht darauf genommen, so dass Alices seltsame schwarze Stiefel für jedermann sichtbar waren.
Ihr Bruder seufzte. Sie trug nun auch noch einen schwarzen Schal und eine schwarze Mütze zu dem unförmigen Kleid, so dass sie wie eine kleine alte Frau wirkte. Dazu schwieg er jedoch lieber.
»Na los, Clem«, keuchte sie und riss an seinem Arm, »du solltest doch auf dem Wagen bleiben.«
»Ihr wart so lange weg! Wo seid ihr gewesen?«
»Wir mussten viele Papiere ausfüllen, dann gab es noch einen Streit wegen dem Pferd und dem Wagen. Ein Mann behauptete, sie würden ihm gehören, doch Pa hat sich nicht darauf eingelassen, weil er den Wagen schon lange im Voraus bestellt hatte. Ohne den Wagen hätten wir schön in der Patsche gesessen mit unserem ganzen Zeug.«
»Wo sind unsere Sachen überhaupt?«
»Sie kommen mit dem nächsten Schiff. Wir gehen jetzt zurück zum Wagen, und du setzt dich rein. Ich hole dir einen Himbeersaft vom Kiosk an der Mole.«
Clem setzte sich nicht hin, sondern blieb auf dem hohen Wagen stehen und sah zu, wie die Leute ihre Siebensachen zusammensuchten und nach Umarmungen, Küssen und tränenreichem Abschied in Richtung Stadt loszogen. Aus irgendeinem Grund erinnerte ihn das an seine Mutter, und er hoffte, dass sie wusste, wo sich ihre Familie befand.
Noah hingegen schien genau zu wissen, wo sie sich befanden. Zügig hatte er den Wagen so hoch beladen, wie es ging. Die restlichen Möbel, die nicht mehr daraufpassten, wurden erst einmal in einem Lager untergestellt. Wenig später machten sie sich auf den Weg. Sie fuhren langsam durch die sandigen Straßen bis an den Stadtrand von Perth. Dort hielt Noah vor einem Straßenlokal und kaufte drei Schalen dampfende, kräftige Suppe.
»Wir müssen ein Dankgebet sprechen«, erklärte er seinen Kindern.
Gehorsam falteten Alice und Clem die Hände und senkten die Köpfe, während er betete.
»Herr, wir danken Dir für die erste Mahlzeit in diesem Land. Es war ein gutes Mahl, und wir danken Dir, dass du uns sicher an dieses Ufer geführt hast. Wir bitten Dich, unsere liebe verstorbene Frau und Mutter Lottie Price so sehr in deinem Herzen zu tragen, wie wir es immer tun werden. Segne meine kleine Familie in ihrem neuen Leben. Amen.«
Er setzte den Hut auf und schenkte seinen Kindern ein breites Grinsen. »Kommt jetzt. Wir fahren zu unserem neuen Heim. Der Hof ist zehnmal größer als das größte Gut in unserer alten Heimat, und es gibt dort schon ein fertiges Haus. Schade, dass wir England verlassen mussten, aber in der neuen Welt können wir reich werden.«
Clem hörte die Aufregung in Noahs Stimme, als er ihn und seine Schwester auf den Wagen hob, die Zügel ergriff und das neue Pferd antrieb. Er grinste ebenfalls und freute sich, dass sein Vater so gut gelaunt war.
Doch sie hatten den Hof noch nicht gesehen.
Noah richtete sich nach der Landkarte, die man ihm zugeschickt hatte, und erkundigte sich unterwegs mehrmals nach dem Weg. Schließlich stieß er am Ende eines Buschpfades, der kaum den Namen Straße verdiente, auf sein Land. Da war es – ein Schild, festgenagelt an einem Pfosten, verkündete: »Winslow Farm«.
Inzwischen hatte Noahs Stimmung sich verdüstert, doch Clem glaubte, das läge an der langen Fahrt und dem Einbruch der Dunkelheit.
»Wo ist das Haus?«, wollte er wissen.
»Nicht mehr weit«, antwortete Noah. Sie folgten einem holprigen Pfad und orientierten sich dabei an Pfeilen, die an Baumstämme genagelt worden waren, bis sie auf eine Ansammlung baufälliger Schuppen stießen.
»Wo ist das Haus?«, fragte Alice. Statt zu antworten, drückte ihr Noah die Zügel in die Hand. »Wartet hier. Ich sehe mich mal um.«
Als er zurückkam, sah er aus, als würde er gleich explodieren, und die Kinder zuckten zusammen. »Das ist es. Steigt aus.«
»Sieht aber nicht so toll aus«, bemerkte Clem, doch Alice hieß ihn zu schweigen. »Sei still. Meinst du etwa, Pa wüsste das nicht?«
Entsetzt folgten sie Noah zum nächstgelegenen Schuppen. Im Licht der Laterne erkannten sie, dass dies tatsächlich ihr neues Heim war. Es bestand aus einem einzigen großen Raum mit vier Fenstern ohne Scheiben. Stattdessen hatte jemand grobes Sackleinen über die Fensteröffnungen gespannt. Über ihren Köpfen befand sich nacktes Wellblech, unter ihren Füßen festgestampfte Erde. Das Mobiliar umfasste schmutzige Wandbetten, einen kahlen Tisch mit Stühlen, der beim offenen Kamin am anderen Ende des Raumes stand, und zu ihrer Überraschung einen neuen Küchenschrank aus Kiefernholz.
Clem schnüffelte. Hier stank es, und er spürte unter seinen Füßen den knirschenden Kot irgendwelcher Tiere, vermutlich von Ratten oder Mäusen. Er schaute zu Noah hinüber, der mit verschränkten Armen ihr armseliges Heim betrachtete und vor Wut kochte.
Plötzlich wurde er aktiv. »Es hat keinen Sinn, hier nur herumzustehen und zu glotzen«, sagte er. »Wir müssen die Nacht hier verbringen und werden zunächst einmal Feuer anzünden und dann gründlich sauber machen.«
Während sie kehrten und Staub wischten, Eimer mit Wasser vom Brunnen herbeischleppten, um den Dreck abzuwaschen, die muffigen Matratzen hinauswarfen und das Nötigste aus dem Wagen hereinbrachten, machte Clem sich Gedanken. Er hatte Hunger.
»In diesem Haus gibt es nichts zu essen. Was machen wir jetzt?«
Alice quälte sich ein Lächeln ab. »Keine Sorge. Pa hat eine Kiste Proviant bei einem Händler an der Mole gekauft. Den Rest besorgt er morgen. Hier muss es irgendwo einen Laden geben.«
An diesem Abend sprachen sie weder vor noch nach dem Mahl aus Brot und Speck ein Dankgebet, weil ihr Vater nicht in der Stimmung war, irgendjemandem zu danken.
Clem schlief unruhig. Ihn plagten Sorgen, und er wusste, dass sein Vater ebenfalls kein Auge zutat – deutlich konnte er hören, wie Noah sich auf seinem quietschenden hölzernen Wandbett hin- und herwarf. Am Morgen weckten ihn kreischende Vögel. Die anderen waren schon auf. Clem roch Toast, und das munterte ihn ein wenig auf.
»Was gibt es zum Frühstück?«, fragte er seine Schwester, die sich am Kamin zu schaffen machte.
»Gebratene Eier«, erwiderte sie knapp, und Clem schoss plötzlich im Bett hoch.
»Mit wem redet Pa? Wer ist da draußen?«
»Psst. Mit sich selbst.«
»Wieso?«
»Er ist böse.«
Clem fand das eigenartig und hielt es für klug, sich nicht vom Fleck zu rühren, bis man ihn rufen würde. Noahs Zorn konnte furchtbare Ausmaße annehmen.
Als sein Vater hereinkam, bebte er noch immer vor Zorn. Er aß rasch sein Frühstück, kippte den Tee hinterher und erhob sich.
»Ich muss in die Stadt. Ihr seid hier sicher, aber lauft nicht in der Gegend herum. Ich komme so schnell wie möglich zurück.«
Er nahm seinen Stadthut und stürmte zur Tür hinaus. Dann drehte er sich noch einmal um und schaute sie an. Sein zerfurchtes Gesicht wirkte ungewohnt weich. »Seid brav.«
Er hatte es wirklich eilig. Wenige Minuten später galoppierte er bereits über die buckeligen Felder davon.
Die Kinder ließen in einer großen Pfanne Speck aus und gaben Eier und das übrig gebliebene Brot hinein.
»Jetzt bin ich die Köchin«, sagte Alice feierlich. »Ich hätte Pa eine Liste mitgeben sollen, damit er weiß, was wir brauchen.«
»Das schafft er schon«, sagte Clem. »Aber warum musste er bis in die Stadt reiten, um Vorräte zu kaufen? Gibt es denn keine Geschäfte in der Nähe?«
»Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste es welche geben. Wenn er eins in der Nähe findet, kommt er schneller zurück.«
Sie erforschten die leere Scheune und die kleineren Schuppen. Der heruntergekommene Hof beeindruckte sie nicht weiter, da es noch kein Vieh gab. Zudem war es ein heißer Tag, und so verkrochen sie sich schließlich niedergeschlagen in der Hütte.
Noah brachte einen Mann mit nach Hause. Und hielt ihn mit dem Gewehr in Schach!
Die Kinder schauten verblüfft zu, als er dem Mann befahl, vom Pferd zu steigen und mit ihm über die Felder zu gehen. Sie rannten hinter den beiden her, während Noah den Mann mehr als eine Meile weit vor sich her trieb, zuerst in die eine, dann in die andere Richtung. Entsetzen packte sie, als der Mann stolperte und hinfiel und Noah überhaupt keine Rücksicht auf die feinen Stadtkleider des Fremden nahm. Schließlich stieß er das Gesicht des Mannes mit dem Stiefel in den Dreck.
»Probier mal, du Bastard! Probier das Land, das du mir verkauft hast! Schmeckt salzig, was? Und wieso? Weil es fast nur aus Sand besteht. Und wieso? Weil es zu nah am Meer liegt. Ich wette, dieses Land war mal von Wasser bedeckt, und du hast es gewusst.«
Der Mann lief rot an und spuckte. »Lassen Sie mich los, Price! Ich hetze Ihnen die Polizei auf den Hals!«
»Oh, nein. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Ich werde nicht jahrelang warten, bis mir ein Hai wie Sie mein Geld zurückgibt. Ich kenne diese Tricks. Notfalls erschieße ich Sie hier und jetzt.«
»Pa! Nein!«, schrie Alice.
»Dieser Gentleman hier«, wandte Noah sich an seine Kinder, »heißt Mr. Clive Garten. Er hat dieses Land, die ganzen fünfzehnhundert Morgen, umsonst bekommen, weil er als Beamter für die Regierung arbeitet. Dann wurde ihm klar, das es schlechter Boden ist, unbrauchbar für die Landwirtschaft, und was hat er wohl gemacht?«
Der Fremde, der noch immer am Boden lag, versuchte wie ein Krebs seitwärts davonzukriechen. Als Noah den Hahn spannte und das Gewehr auf ihn richtete, hielt er inne.
»Hier konnte er es nicht verkaufen, weil die Leute Bescheid wissen. Also hat er es in einer Londoner Zeitung als bestes Ackerland angepriesen. In der Nähe von Perth gelegen und mit einem Cottage als Draufgabe.«
Noah warf einen Blick über die Schulter. »Nun ist diese Hütte da weder ein Cottage noch ein Bauernhaus, aber damit könnte ich leben. Ich könnte uns ein anständiges Haus bauen. Am Boden kann ich aber nichts ändern.«
Er stieß sein Opfer mit dem Gewehr an. »Ich kann weder Wasser in Wein noch Sand in gutes Ackerland verwandeln. Siehst du, Alice. Man hat uns Anfänger schlicht und einfach reingelegt. Wir werden hier draußen verhungern. Und das alles nur wegen ihm.«
»Erschieß ihn, Pa!«, rief Clem, und selbst Alice wurde unschlüssig.
»Es gibt noch einen anderen Ausweg.« Noahs Stimme klang nun ruhiger. »Nur wenn ich mein Geld auf Heller und Pfennig zurückbekomme, werden Sie, Mr. Clive Garten, diesen Tag lebend überstehen.«
»Damit kommen Sie nicht durch.«
»Oh, doch. Ich hatte Zeit, darüber nachzudenken. Entweder geben Sie mir einen Schuldschein, oder Sie sterben hier draußen. Falls Sie Ihr Versprechen nicht halten, komme ich in die Stadt und erschieße Sie mitten auf der Hauptstraße. Das schwöre ich feierlich – und ich stehe zu meinem Wort.«
In der Hütte unterzeichnete Garten den Schuldschein, und Noah forderte ihn auf, seine goldene Uhr als Sicherheit dazulassen.
Sobald Noah sein Geld erhalten und die Uhr zurückgegeben hatte, beluden sie den Wagen und zogen weiter. Diesmal würde Noah sein Land selbst auswählen.
Sie legten einen langen, langen Weg zurück. Tagaus, tagein ging es endlos geradeaus durch das weite Land hinter der Küste und dann in Richtung Westen. Denn Noah wollte möglichst viel Grund und Boden erwerben und auch den Preis dafür bestimmen – und Landmangel herrschte in diesen gewaltigen Ebenen keiner.
Sie erreichten ein kleines Dorf namens York und zogen von dort aus noch weiter nach Westen, bis Noah fand, was er gesucht hatte.
Er erwarb Grund und Boden, baute ein Haus aus Stein, kaufte Schafe und nannte den Besitz »Lancoorie«. Er bezeichnete ihn immer als seinen Hof, doch die Kinder bestanden später darauf, das es eine Schaffarm sei. Ihr Vater interessierte sich nicht weiter für den Namen, sondern kaufte immer mehr Land, weil diese wilde Weite schier endlos schien.
2.Kapitel
Es war die Zeit der Schafschur. Noah war es gelungen, genügend Geld zusammenzukratzen, um drei Scherer anzustellen. Mit ihrer Hilfe konnten er und Clem die Arbeit vollenden, solange das Wetter noch schön war. Nachdem im Jahr zuvor siebzig frisch geschorene Schafe nach einem plötzlichen Kälteeinbruch gestorben waren, hatten sie nur noch etwa fünfhundert zu scheren. Sie gingen ihre Arbeit zügig an, und auch Alice half mit, indem sie die Tiere in das Laufgatter trieb und immer wieder hereinkam, um die Vliese aufzusammeln und zu stapeln.
Clem liebte die Schafschur und war selbst ein guter Scherer. Er mochte den Geruch von Schweiß und Staub, den Lärm und das Knipsen der Scheren, die gebeugten Rücken der Männer, ihre Gespräche, ihre Flüche und ihr respektloses Lachen. All das schien in der Luft zu tanzen, zusammen mit dem flirrenden Sonnenlicht, das durch das hohe Fenster fiel. Es war ein guter Arbeitstag, an dem alles glattlief. Als einer der Männer vom Außenklo kam, bemerkte er, das ein fremdes Pferd am Geländer angebunden war.
»Hast du Besuch, Noah?«
»Ja. Vikar Petchley. Kerle wie er sind verdammte Kletten.«
»Will er dich etwa bekehren?«
»Von wegen!«
Clem sah, wie sich die Männer zuzwinkerten. Er grinste, weil er das Gefühl hatte, er gehöre dazu, auch wenn er nicht so recht wusste, wozu. Die Scherer hielten gerne ein Schwätzchen und waren stets zu Scherzen bereit. »Du solltest dir seine Predigten anhören, Noah. Es könnte dir nicht schaden.«
»Ich habe keine Zeit für Predigten.«
»Er könnte dir seine letzte vortragen, wenn er schon hier ist. Eine Predigt umsonst, und ein Teller geht auch nicht rum.«
»Umsonst ist gar nichts. Ich schätze, er spekuliert auf eine Mahlzeit.«
»Das ist nicht nett von dir, Noah. Der arme Kerl verbreitet schließlich das Wort Gottes.«
Noah ließ seinen Schafbock los, schubste ihn zur Tür hinaus und streckte sich. »Na ja, bei mir verbreitet er es jedenfalls nicht.« Er stieß ein tiefes, kehliges Lachen aus. »Soll er es bei Dora verbreiten. Sie kann es brauchen. Was ist er überhaupt? Zu welcher verdammten Kirche gehört er?«
»Man sagt, er sei Methodist.«
»Nie gehört.« Noah zog eine selbstgedrehte Zigarette hinter dem Ohr hervor und ging nach draußen, um eine Pause zu machen.
Die Männer grinsten wieder, und Clem spürte ein nervöses Ziehen im Magen.
»Dieser Vikar verbreitet sich wirklich ganz schön«, meinte einer augenzwinkernd.
»Fällt ihm schwer, ihn in der Hose zu behalten, sagt man.«
»Nett zu den Frauen, was?«, Ein lüsternes Grinsen.
»Furchtbar nett. Ein schmales Hemdchen, aber er muss was an sich haben. Gibt viele, die seine Art, sich zu verbreiten, mögen.«
»Im Moment verbreitet er sich bestimmt bei Dora.«
Noah stand in der Tür. Er füllte den Rahmen völlig aus und nahm den anderen das Licht. Er sagte nichts. Das war auch nicht nötig. Sie spürten, wie sein Zorn in den Schuppen strömte. Dann wandte er sich um und rannte davon.
Clem ließ sein Tier los. »Ihr verdammten Idioten! Seht nur, was ihr angerichtet habt!«, Er schoss hinter seinem Vater her.
»Hör nicht auf sie, Pa. Du weißt doch, wie sie sind. Von dem, was sie sagen, stimmt nicht einmal die Hälfte, und die andere kannst du auch nicht glauben.«
Es war eine Farce. Wie das alberne Theaterstück, das sie in York gesehen hatten. Damals hatten sie es sich noch leisten können, ins Dorf zu fahren.
Während er über die Weide rannte, brüllte Noah: »Was geht da vor? Mein Gott, du bist minderwertiger als jeder Dingo! Wenn du meine Frau anfasst, verarbeite ich dich zu Hackfleisch!«
»Halt den Mund, Pa!«, rief Clem und rannte neben ihm her. Er schenkte dem Gerede keinen Glauben. »Um Himmels willen, er ist ein Vikar! Er würde nichts Unrechtes tun. Er ist ein Mann der Kirche! Hör doch zu!«
Doch als sie die Hintertreppe hinaufstürmten, entwischte der Vikar gerade mit flatternden Hemdschößen aus der Vordertür. Und Doras Bluse war verrutscht, so dass man eine ihrer üppigen Brüste erspähen konnte, als sie sich ins Schlafzimmer flüchtete.
»Oh nein, das tust du nicht«, schrie Noah. »Was hast du da?«
Sie umklammerte ein Stück Stoff, doch er riss es ihr aus der Hand. Clem blieb der Mund offen stehen, als sein Vater den Fund in die Höhe hielt. Ihre Unterhose! Sie hatten wirklich nichts Gutes im Schilde geführt, die beiden! Noah war erzürnt, weil der Vikar seine Frau angefasst hatte. Er versetzte Dora einen heftigen Schlag, so dass sie quer durchs Zimmer flog, riss sie wieder in die Höhe, entblößte ihren dicken Hintern und drückte ihr die Unterhose ins Gesicht. »Du verdammte Hure! Wo gehört die wohl hin? Jedenfalls nicht auf den verfluchten Boden, wenn wir einen Vikar im Hause haben, oder? Du Hure! Bei Gott, um dich kümmere ich mich später, wenn ich wieder nach Hause komme.«
Clem ließ sich dieses Schauspiel nicht entgehen. Seit Jahren hatte er darauf gewartet, dass der alte Mann erkannte, was für ein Früchtchen Dora war. Und dann auch noch mit einem Vikar! Er wünschte sich, Alice hätte gesehen, wie Dora schließlich die verdiente Strafe erhielt. Er lachte, als Noah die Verfolgung des Vikars aufnahm. Der Mann würde diesen Distrikt nie wieder betreten, wenn Noah mit ihm fertig war!
»Pech gehabt, was?«, sagte er zu der weinenden Dora und machte sich dann auf die Suche nach Alice, um ihr die gute Neuigkeit zu überbringen.
Die Scherer fanden seine Leiche. »Er hat sich das Genick gebrochen«, erfuhr Clem von einem der Männer. Dann scharrte der Mann mit den Füßen und wandte traurig die Augen ab. »Er hat nicht gelitten, Clem. Ist auf den Boden geschlagen. Bums! Und aus! Wenn einer so schnell reitet … und querfeldein. Das Pferd ist gestolpert. Hat sich eine Fessel gebrochen. Mussten es erschießen. Tut uns wirklich Leid, Kumpel. Ehrlich. Komm mit mir zurück, die Jungs bringen deinen Pa heim.«
»Nein, ich bringe ihn selbst zurück.«
»Schätze, wir reiten besser zum Haus. Wir müssen der Missus und Alice die Nachricht überbringen. Die kleine Alice sollte es am besten von dir erfahren.«
»Die Missus kann meinetwegen zur Hölle fahren, und einen Weg, es Alice schonend beizubringen, gibt es nicht. Sie wird auf jeden Fall einen Schock erleiden. Er ist mein Pa, also muss ich bei ihm bleiben.«
Später wünschte er sich, er wäre nicht so eigensinnig gewesen. Er kämpfte gegen eine Ohnmacht, als er beobachtete, wie die Männer den schlaffen Körper seines Vaters, Noah Wolverton Price, wie einen großen, unhandlichen Sack über den Rücken eines Pferdes legten. Das verschreckte Tier wehrte sich gegen die Last. Als sie die Leiche festschnallen wollten, scheute und bockte es und schnappte wütend nach ihnen. Nach dem zweiten Versuch fluchten sie leise, um die Gefühle des trauernden Sohnes an ihrer Seite nicht zu verletzen. Die Unwürdigkeit der Szene war ihnen peinlich bewusst. Schließlich gelang es ihnen mit Clems Hilfe, die Leiche seines Vaters sicher zu befestigen und mit der Satteldecke zu verhüllen. Vor ihnen lag ein Neunzehn-Meilen-Ritt.
Noah hatte anscheinend gewusst, dass sein altes Pferd es nicht mit dem edlen Tier des Vikars aufnehmen konnte, und daher die Straße verlassen, um Petchley auf der westlichen Route nach York den Weg abzuschneiden. »Offensichtlich hat er den Bastard nicht erwischt«, dachte Clem grimmig. »Aber ich werde ihn eines Tages finden. Nicht wegen Dora, sondern weil mein Vater die Jagd mit seinem Leben bezahlt hat.«
Während er der kleinen Prozession hinterherritt, blickte er auf das weite, flache Land hinaus. »Flach wie ein Brett«, hatte Noah immer wieder kopfschüttelnd bemerkt. »Flach bis zum Horizont, wohin man auch sieht. Verdammt langweilig, aber ausgezeichnetes Weideland.«
Clem hatte nie weiter darüber nachgedacht, da er nichts anderes kannte. Als Bewohner des Outbacks nahm er die Unermesslichkeit des Landes als selbstverständlich hin. Nur das Wasser bereitete zuweilen Probleme. Nun jedoch sah er zum gewölbten blassblau Himmel empor und fragte sich, was er mit diesem Boden und vor allem mit dem noch unberührten Buschland anfangen sollte. Er fand die Gegend öde. Manchmal konnte er zehn Meilen in Gedanken versunken dahinreiten. Schaute er wieder hoch, hätte er schwören können, dass sich nichts verändert hatte.
Andere Bauern hatten riesige Weizenfelder angelegt. Auch Noah hatte daran gedacht, Getreide anzubauen, und sich mit Clem darüber beraten, dann aber gesagt, er sei Schafzüchter. Seine Familie habe seit Generationen Schafe gezüchtet, und dabei könne es auch bleiben.
»Du rodest das Land, aber die verdammten Bäume kommen immer wieder«, hatte er zu Clem gesagt. »Wenn du versuchst, sie abzubrennen, wachsen sie noch besser als zuvor.«
»Nicht, wenn man gründlich rodet. Du musst alle Wurzeln entfernen.«
»Und das kostet Geld. Wir würden eine Armee von Männern brauchen, um Lancoorie zu roden.«
»Man könnte sich Morgen für Morgen vornehmen.«
»Mal sehen, wann wir ein bisschen Geld übrig haben.«
Doch es war nie Geld übrig, weil Dora und das Haus die geringen Einnahmen verschlangen.
Alice kam ihnen mit flatternden Haaren und wehenden Röcken entgegengelaufen. Dann blieb sie so plötzlich stehen, dass sie fast über ihre eigenen Füße fiel. »Habt ihr Pa gefunden?«
Clem sprang vom Pferd und half ihr hoch. »Komm mit, Liebes, Pa hat einen Unfall gehabt.« Doch sie riss sich los und rannte zu dem anderen Pferd hinüber. Mit offenem Mund starrte sie auf Noahs Kopf, der in einem grotesken Winkel an der Flanke des Tieres herunterbaumelte. Das weiße, von Schweiß und Schmutz verklebte Haar sah aus wie ein zweiter Bart am falschen Ende des Kopfes. Seine Augen waren weit aufgerissen.
»Er ist tot!«, schrie sie, als Clem nach ihr griff. »Was hat dieser schreckliche Mann mit ihm gemacht?«
»Nichts. Pa hat ihn wohl gar nicht erwischt. Wir beide trinken jetzt eine Tasse Tee. Sie bringen Pa in den Schuppen.«
»Das werden sie nicht tun. Tragt ihn ins Haus.«
»Wäre das richtig?«, fragte Clem unsicher.
Sie nickte und musste sich auf ihn stützen, während sie an den drei großen Eichen vorüberstolperten, die Noah aus englischem Samen gezogen hatte. Er hatte ursprünglich eine ganze Reihe von Bäumen zum Schutz vor den heißen, trockenen Winden, die im Sommer über die Ebene hinwegfegten, pflanzen wollen, doch lediglich drei der Bäume hatten überlebt. Und dies auch nur dank Alices ständiger Pflege.
»Wir kommen morgen wieder«, sagten die Scherer zu Alice. Nachdem sie ihre traurige Pflicht erfüllt hatten, hielten sie ihre Hüte umklammert. Dora lag ausgestreckt auf der Couch und bejammerte lauthals den Verlust ihres Gatten.
»Nein«, unterbrach Clem ihre Vorstellung. »Wir gehen in den Schuppen zurück. Wir müssen fertig werden.«
»Du grausamer Junge!«, kreischte Dora. »Hast du keine Achtung vor dem Toten? Lass sie gehen!«
»Ab in den Schuppen«, sagte Clem. Die Scherer nickten, denn als praktisch veranlagte Männer wussten sie, dass er recht hatte.
Bald kamen andere Frauen ins Haus, um den Leichnam herzurichten und während der Vorbereitungen für das Begräbnis lange, geheimnisvolle Unterhaltungen mit Alice – von Frau zu Frau – zu führen. Dora hingegen setzte sich in ihrem besten schwarzen Taftkleid mit den goldenen Streifen stocksteif auf die Veranda und schniefte in ein großes Taschentuch. Die Männer hatten nichts Besonderes zu tun und gingen überall zur Hand. Sie molken die Kühe, flickten Zäune, reparierten das Rad am Pferdewagen und das Dach des Vorratsschuppens und schoren die streunenden Tiere, die noch eingefangen werden konnten. Sie packten die Wollballen zusammen und deckten sie ab, bis die Fuhrleute kamen und sie nach York brachten. Mit ihren Frauen und Kindern hatten sie in der Nähe ein kleines Zeltlager aufgeschlagen. Sie wollten die kleine Familie in dem langgestreckten, steinernen Farmhaus nicht stören, doch Clem spürte ihre Kraft, so als wären sie ganz dicht bei ihm und Alice. Das erstaunte ihn. Obwohl er mit Noah zusammen oft ähnliche Hilfe geleistet hatte, überraschte es ihn, dass diese Leute sich mit den Prices abgaben, die verglichen mit den anderen Farmern und den Stadtbewohnern doch einen recht ärmlichen Eindruck machten. Sie standen kaum über den Kleinfarmern, die sich abrackerten, um auf ihren handtuchgroßen Grundstücken, die noch dazu trocken wie Pergament waren, zu überleben.
In Clem wuchs ein neuer Stolz, als man ihn bat, einen Ort für den Familienfriedhof auszuwählen. Bei der Beerdigung traten mehrere Männer vor und sprachen in warmen Worten von Noah Price. »Ein ehrlicher Mann, aufrecht und treu«, sagten sie. »Ein fleißiger Mann, der uns noch lange als Pionier dieses Distrikts in Erinnerung bleiben wird. Er wurde uns zu früh genommen.« Alle nickten. »Ein großer Verlust.«
Die Frauen wahrten Dora gegenüber höfliche Distanz und bezeichneten sie als Noahs Haushälterin, wofür ihnen Clem ewig dankbar sein würde. Als sie ihre Körbe packten, erinnerten sie Clem und Alice daran, dass sie bei ihnen jederzeit willkommen seien.
»Ihr jungen Leute dürft euch jetzt nicht verkriechen«, meinte Mrs. Gorden Swift. »Ihr könnt gerne zu den Tanzabenden in den Gemeindesaal kommen.«
Alice errötete, da sie an ihren Fuß denken musste, und Clem half ihr rasch aus der Verlegenheit. »Ich kann nicht tanzen.«
Mrs. Swift lachte. »Nun, Clem Price, das kann keiner, bevor er es nicht versucht hat. In York gibt es viele hübsche Mädchen. Sie werden Schlange stehen, um einen feinen Burschen wie dich das Tanzen zu lehren. Wie alt bist du jetzt? Achtzehn?«
»Ja, Ma’am.«
»Dann erwarten wir dich. Ihr jungen Leute solltet am gesellschaftlichen Leben teilhaben.«
Clem sagte zu. Dabei ging ihm durch den Kopf, dass er unbedingt ein neues Paar Stiefel brauchte, wenn er sich überhaupt bei einem Gesellschaftsabend zeigen wollte.
»Was machen wir mit ihr?«, fragte Alice, als die letzten Trauergäste davongeritten waren.
»Sie loswerden.«
»Sie weigert sich zu gehen.«
»Tatsächlich?«, Clem marschierte in die Küche, wo sich Dora an den Resten eines gespendeten Obstkuchens gütlich tat. »Morgen verschwindest du. Pack deine Sachen. Ich will dich hier nicht mehr sehen!«
»Das ist mein Haus, ich bleibe! Mein Bruder wird kommen und hier mit mir wohnen. Einer muss sich ja um den Hof kümmern.«
»Falls du bis Sonnenaufgang fertig bist, bringe ich dich im Pferdewagen nach York. Falls nicht, werfe ich deinen Kram in die Einfahrt, und du kannst zu Fuß gehen.«
Dora erlitt einen ihrer Anfälle und stieß wüste Beschimpfungen gegen Clem und Alice aus, die ihr keinerlei Beachtung schenkten. Als sie sich kratzend und beißend auf Clem stürzen wollte, schlug er ihr hart ins Gesicht. »Das ist für Noah. Ein Vorgeschmack auf das, was dich morgen erwartet, wenn du nicht beim ersten Hahnenschrei im Wagen sitzt. Geh jetzt packen.«
»Pass gut auf, was sie mitnimmt«, warnte er Alice. »Sonst hast du keine Pfanne mehr im Haus.«
»Ich passe schon auf. Sie bekommt nichts aus der Küche, aber den Nippes aus dem Wohnzimmer kann sie geschenkt haben. Ich bin froh, das Zeug loszuwerden.«
Nachdem die beiden Frauen an diesem Abend zu Bett gegangen waren, holte Clem Noahs alte Seekiste hervor. Die Unordnung in den Büchern und Papieren überraschte ihn nicht sonderlich. Dora hatte überall herumgestöbert und nach Wertsachen gesucht, doch da sie nicht lesen konnte, hatte keines der Schriftstücke ihr Interesse geweckt. Er fand die Grundstücksurkunden, die säuberlich mit Bändern verschnürt waren, und versank in Erinnerungen, als er auf Alices und seine alten Schulbücher stieß. Natürlich war er nie zur Schule gegangen. Alice hatte ihren jüngeren Bruder unterrichtet, und abends hatte Noah mit seinen Kindern am Küchentisch gesessen und sie Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt. Er hatte ihre »Schulausbildung« sehr ernst genommen. Nur am Wochenende waren sie von den lästigen Aufgaben befreit gewesen. Clem lächelte. Alice war gut in Rechtschreibung, doch im Rechnen hatte er schließlich Vater und Schwester überflügelt.
Als er den großen alten Stuhl am Kamin betrachtete, in dem Noah immer gesessen hatte, wurde ihm die Ungeheuerlichkeit des Ereignisses bewusst. Noah war tot. Ihr Vater. Clem konnte sich ein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen. Bis jetzt hatte er noch keine Zeit gehabt, in Ruhe darüber nachzudenken. Alles war so plötzlich geschehen. Er erinnerte sich noch, wie er gelacht hatte, als Noah die Verfolgung des Vikars aufgenommen hatte. Wie hätte er ahnen sollen, dass er seinen Pa zum letzten Mal lebend sah? Noah. Seinen Pa. Gott, wie würde er ihn vermissen. Clem knallte die Kiste zu, als könne er damit die aufsteigenden Tränen zurückdrängen.
»Verdammt noch mal, Noah«, murmelte er in sich hinein, »als du Dora ins Haus geholt hast, hast du uns das Familienleben gründlich verdorben – und es war uns nur noch so wenig Zeit vergönnt. Doch sie wird uns nicht mehr länger auf der Pelle sitzen.«
Es war nicht leicht, sie loszuwerden. Nachdem sie ihre Sachen im Schuppen eines Freundes neben der Brücke untergestellt hatte, marschierte sie geradewegs aufs Polizeirevier und verlangte die Verhaftung von Clem Price, der sie aus ihrem Haus geworfen habe. Wachtmeister Fearley, dem sichtlich unwohl war, betrat mit Dora im Schlepptau die Bank, um Clem dort abzufangen.
Die Bank war Clems erste Anlaufstelle in der Stadt. Mit Mr. Tanner konnte er vermutlich am besten über die Farm sprechen.
»Tut mir leid, das von deinem Vater zu hören«, sagte Tanner. »Ich habe Noah immer gemocht. Ich konnte leider nicht zur Beerdigung kommen, denn dann hätte ich die Bank für einen Tag schließen müssen.«
»Schon gut, Mr. Tanner. Ich wollte fragen, wie die Dinge stehen … mit uns.« Ihm war nicht ganz klar, was er eigentlich wissen wollte.
»Ja, ich habe dich schon erwartet. Dich oder Alice. Carty hat den Totenschein ausgestellt und wird eine Abschrift für dich herbringen. Hier ist die Bankerklärung. Alice muss einige Papiere unterschreiben …«
»Das mache ich.«
»Du bist noch minderjährig, mein Sohn. Wie alt ist Alice?«
»Zweiundzwanzig.«
»In Ordnung. Ist sie mitgekommen?«
»Nein. Sie muss melken. Wir haben keine Hilfen.« Während Clem sprach, ließ er den Blick über die ordentlichen Zahlenkolonnen auf dem Blatt schweifen und stutzte bei der letzten Zeile. »Was bedeutet das? Da steht ›fünfhundert Pfund, drei Shilling und sieben Pence‹.«
»Richtig. Euer Guthaben.«
»Ich dachte, wir sind pleite.«
»Seien pleite«, berichtigte Tanner. »Oh, nein. Euer Dad bezeichnete diese fünfhundert Pfund als seinen ›Notgroschen‹. Er hat sie für schlechte Jahre zurückgelegt. Des Öfteren hat er das Geld anbrechen müssen und dann immer gedacht, das Ende der Welt sei gekommen. Ich sagte ihm, wir würden ihm Kredit geben, aber dein Dad war ein stolzer Mann. Hat niemanden um etwas gebeten.«
»Nur seine Kinder«, erwiderte Clem zornig.
Tanner strich sich über seinen dunklen Bart und stützte das Kinn in die Hand. »Hat es euch an irgendetwas gefehlt, Clem?«, fragte er leise.
»Wir hatten zu essen, lebten aber ärmlich«, antwortete Clem trotzig. Er schaute sich um, ob auch keiner lauschte. »Sehen Sie mich an! Es ist mir peinlich, in meiner Arbeitskleidung in die Stadt zu kommen, von den alten Stiefeln ganz zu schweigen.«
Tanner zuckte die Achseln. »Den Wert eines Mannes misst man nicht an seiner Kleidung. Das wirst du noch lernen.«
»Wir brauchen Farmarbeiter. Unsere tausend Morgen da draußen werden vergeudet.«
»Das ist mir klar, aber Noah war ein vorsichtiger Mann. Zu viele sind untergegangen, weil sie immer mehr Farmland gekauft haben. Die weiten Ebenen können in der Trockenzeit gefährlich werden.«
»Und was ist mit denen, die nicht untergegangen sind? Den Pedlows, den O’Mearas und den Cadmans? Wie steht es mit ihren großen Weizenfeldern? Sie sind reich geworden, statt unterzugehen.«
»Auch sie haben schwere Zeiten erlebt. Die Farm der Pedlows ist vor Jahren beinahe den Buschbränden zum Opfer gefallen. Eines Tages werde ich dir erzählen, was auf den großen Farmen während der letzten zwanzig Jahre passiert ist.«
»Ganz bestimmt«, drängte Clem. »Eins möchte ich aber wissen. Wie haben sie ihre Probleme gelöst?«
»Mit Darlehen. Hypotheken. Ich darf nicht über einzelne Kunden sprechen, aber viele Farmer haben Schulden. Für Noah waren Schulden immer wie ein rotes Tuch. Verstehst du das?«
»Nicht richtig. Es ist mir noch nicht ganz klar. Ich möchte schwarz auf weiß sehen, was es mit so einem Darlehen auf sich hat. Könnten Sie es mir erklären?«
In diesem Moment stürmte Dora in die Bank und drängte die anderen Kunden mit ihrem Reifrock beiseite. »Da ist er, Wachtmeister! Verhaften Sie ihn!«
Clem blieb ungerührt sitzen und betrachtete ein Bild an der hinteren Wand, das die Hauptstraße von Perth zeigte. Tanner hingegen stand auf und strich sich die Rockschöße glatt.
»Was hat das zu bedeuten?«
»Er hat mich rausgeworfen«, schnappte Dora. »Mich von Haus und Hof vertrieben, dieses verdammte Ekel. Mein Ehemann stirbt, und ich werde behandelt wie ein Niemand.«
Wachtmeister Fearley schaltete sich ein. »Sie möchte eine Klage vorbringen, Mr. Tanner.«
»Ich war bisher der Annahme, Sie seien nicht mit Noah Price verheiratet gewesen«, bemerkte Tanner.
»Doch, war ich.«
»Nein, war sie nicht«, sagte Clem und schaute weiterhin das Bild von Perth an. Er hatte die Stadt nicht mehr betreten, seit sie die erste erbärmliche Farm verlassen hatten. Es kam ihm vor, als seien hundert Jahre vergangen. Er war damals noch ein kleiner Junge gewesen.
»Besitzen Sie eine Heiratsurkunde?«, erkundigte sich Tanner.
»Ja, irgendwo habe ich eine.«
»Hat sie nicht«, warf Clem ein.
»Noah hat mich geliebt!«, schrie Dora. »Ich war seine Frau, mit allen Rechten und Pflichten. Wo ist sein Testament? Das möchte ich gerne wissen. Wartet ab, bis ihr sein Testament seht. Er hätte mich niemals übergangen. Nicht Noah. Seine Kinder haben ihn nie interessiert.« Sie schlug mit ihren dicken Händen, die in schwarze Spitzenhandschuhe gezwängt waren, auf den Schreibtisch.
»Hast du das Testament deines Vaters mitgebracht?«, wollte Tanner von Clem wissen.
»Es gibt kein Testament. Er hat keins gemacht. Wieso auch? Er hat nicht damit gerechnet, während der Schur zu sterben. Oder während der Jagd auf diesen dreckigen Bastard, der sie gebumst hat.«
Tanner erstarrte. »Das reicht, Clem! Solche Wörter möchte ich hier nicht hören. Da es anscheinend kein Testament gibt – und auch nie eine Heirat stattgefunden hat, denn ich hätte davon erfahren –, würde ich vorschlagen, Wachtmeister, dass Sie diese Frau hinausbegleiten.«
»Ihr Männer seid alle gleich!«, Dora wedelte mit ihrem verblichenen Sonnenschirm drohend in Richtung des Bankdirektors. Tränen gruben schmutzige Rinnsale in den Staub, der sich während der langen Stunden auf der Straße in ihrem Gesicht angesammelt hatte. »Ihr denkt, ihr könnt uns Frauen benutzen und danach wegwerfen. Nun, ich sage euch, Noah war anders! Er hätte nie geduldet, dass man mich beleidigt und auf die Straße setzt. Ich will, was mir zusteht.«
Fearley ergriff ihren Arm. »Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses, Dora«, warnte er sie. »Bitte beruhigen Sie sich. Ich möchte Sie nicht verhaften müssen.«
»Nehmen Sie mich doch mit«, entgegnete sie unter Tränen. »Dann habe ich wenigstens ein Dach über dem Kopf.«
Clem empfand kein Mitleid mit ihr. »Du kannst bei deiner Freundin Mrs. Penny wohnen. Als Pa noch lebte, hat es dir nie an Ausreden gemangelt, um in die Stadt fahren zu können. Sie ist ein Schluckspecht wie du. An Gesellschaft wird es dir jedenfalls nicht fehlen.«
»Nun, nun«, warf Tanner nervös ein. Er befürchtete wohl, Clem könne in Anwesenheit der Polizei eine weitere Indiskretion begehen, denn Mrs. Penny pflegte bekanntermaßen ungewöhnlich viele Männerfreundschaften. »Hier führe ich die Geschäfte, Wachtmeister …«
Der Polizist verstand den Hinweis und ging hinaus, wo er auf Dora wartete, die unbedingt das letzte Wort haben musste. »Clem Price, du tust mir etwas Schreckliches an!«, zischte sie. »Ich habe wie eine Mutter für dich und deine Schwester gesorgt. Grins mich nicht so höhnisch an! Du wirst deinem Pa nie das Wasser reichen können.«
Sie drängte sich zwischen drei neugierigen Kunden hindurch, die sich am Eingang eingefunden hatten und entzückt dem pikanten kleinen Schauspiel beiwohnten. Dann fegte sie quer über die sandige Straße und stieß dabei wütend mit dem Sonnenschirm auf den Boden.
»Vielleicht könntest du später noch einmal wiederkommen«, meinte Tanner zu Clem und deutete auf die Menschenschlange, die sich in der Bank mittlerweile gebildet hatte.
»Ja, morgen früh.« Er war froh, dass er die Bank verlassen und alles, was der Tag sonst noch zu bieten hatte, auf sich zukommen lassen konnte.
Auf dem Weg zum Duke of York Hotel verspürte er den Drang, seinen Hut in die Luft zu werfen und an Ort und Stelle einen Freudentanz hinzulegen. Er war nicht nur Dora losgeworden, ihm gehörte auch Lancoorie, und er hatte Geld auf der Bank! Er war reich! Was für ein Geizkragen war Noah doch gewesen. Hatte die ganze Zeit Geld gehabt, während alle geglaubt hatten, er sei pleite. Einschließlich Dora. Gut, dass sie die Wahrheit nicht erfahren hatte, sonst wäre ihr Auftritt noch dramatischer ausgefallen. Sie hatte kein Geld von Clem verlangt, weil sie glaubte, er habe keins.
Clem blieb stehen, um sich die Stiefel zu schnüren – Noahs Stiefel. Er hatte Tanner gegenüber nicht zugeben wollen, dass sein Pa seine Stiefel so oft neu besohlt hatte, dass die Oberseite über die Jahre altersgrau und rissig geworden war. »Eigentlich hätte ich Mr. Tanner um ein paar Pfund aus Noahs Notreserve bitten können. Schließlich muss ich hier übernachten. Falls Noah Geld im Haus aufbewahrt hat, ist es sicher in Doras Tasche gelandet. Alice hat jedenfalls nichts gefunden. Nun stehe ich hier ohne einen Penny in der Tasche.«
Ursprünglich hatte er Dora absetzen, umgehend nach Lancoorie zurückfahren und unterwegs im Wagen seinen Proviant essen wollen. Doch nun konnte er ruhig einen oder zwei Tage in der Stadt bleiben. Alice würde schon zurechtkommen.
Er nahm allen Mut zusammen, betrat die dämmrige Hotelbar und bestellte ein Bier.
»Schreiben Sie es an, Chas«, sagte er zum Wirt. »Ich bleibe eine Weile in der Stadt. Haben Sie ein Zimmer für mich?«
»Natürlich, Clem«, antwortete der Mann freundlich und schob ein Bier über die Theke. »Das geht aufs Haus. Tut mir wirklich leid um deinen Vater, mein Junge. Der alte Noah war ein anständiger Kerl.«
Clem zog alle Aufmerksamkeit auf sich. Freunde wie Fremde erwiesen dem trauernden jungen Mann den nötigen Respekt. Er hatte nie mit den anderen Burschen »durch den Distrikt ziehen« dürfen, wie Noah sich auszudrücken pflegte, und besaß daher keine Freunde in seinem Alter.
Als Les und Andy Postle hereinschwankten, behandelten sie ihn wie ihren ältesten Freund, nicht wie einen Nachbarn, dessen Farm immerhin zweiunddreißig Meilen von ihrer entfernt lag. Zum Glück, denn Noah hatte die beiden als »ein Paar wilder Tiere« bezeichnet und damit auf ihre allgemein bekannte Lüsternheit angespielt – ohne zu berücksichtigen, dass auch er kein Kind von Traurigkeit war.
»Waisen!«, klagte Les nach einigen mitleidvollen Runden. »Mein Gott, Clem, das wird mir jetzt erst klar! Ihr zwei seid ja Waisen. Ihr armen Schweine.« Fasziniert breitete er sich über dieses Thema aus, bis sein Bruder dem rührseligen Gerede ein Ende setzte.
»Halt die Klappe, Les. Wir sollten den alten Clem aufheitern, sonst fühlt er sich noch schlechter. Komm schon, Clem. Trink noch einen.«
Als das Pub zumachte, zogen sie sich mit zwei Flaschen Bier und einer Flasche Whisky in Clems Zimmer zurück. Clem hatte die Getränke unbekümmert auf seinen Namen anschreiben lassen, weil er in seinem alkoholisierten Zustand überaus dankbar war für seine neugewonnenen Freunde.
Wie durch ein Wunder erschien kurz darauf das Schankmädchen mit einer eigenen Flasche Bier. Es hieß Jocelyn. Clem sagte ihr mehrmals, was für einen schönen Namen sie doch habe, und machte auf dem Bett Platz für sie. Ihr Körper war kurvenreich. Sie schien die älteste in dieser Runde zu sein, eine hübsche Frau mit rosigen Wangen und dichtem, glänzendem schwarzem Haar, die verspielt war wie ein junges Kätzchen. Sie tranken aus ihren Flaschen, lachten und neckten sie, und Jocelyn wusste sich schlagfertig zu wehren.
Clem hoffte, er würde das Rennen machen, doch schließlich ging Andy als Erster durchs Ziel. Er wurde immer zudringlicher, flüsterte ihr ins Ohr, zupfte an den Knöpfen ihrer weißen Bluse und schaffte es sogar, einige davon zu öffnen, ohne dass Jocelyn sich beschwerte. Clem schaute eifersüchtig zu und stritt dabei mit Les über die Vor- und Nachteile des Weizenanbaus. Als Jocelyn und Andy nach hinten aufs Bett kippten, miteinander rangen und kicherten, machten sie ihnen ein wenig Platz.
Les kümmerte sich nicht weiter um die Kapriolen der beiden. Clem versuchte ebenfalls so zu tun, als sei es für ihn ein alltäglicher Anblick, wenn ein Mann und eine Frau direkt neben ihm knutschten und schmusten. Im Vergleich zu der überaus wichtigen Unterhaltung mit Les Postle war es auch eine Bagatelle, denn dabei ging es um das Schicksal von Lancoorie. Dennoch beobachtete er aus dem Augenwinkel Jocelyns offene Bluse und Andy Postles Hand, die sich heftig darin bewegte. Es war heiß im Zimmer. Clem stand der Schweiß auf der Stirn, und er rutschte unbehaglich hin und her.
»Du kommst schon noch dran.« Les zwinkerte ihm zu, und Clem zuckte entsetzt zusammen. Er war noch nie mit einer Frau zusammen gewesen und würde zu Eis erstarren, falls er es vor diesen beiden hier versuchen sollte. Wenn er sich zum Narren machte, würden sie die Nachricht überall verbreiten.
»Ich muss mal pinkeln«, sagte er und schoss zur Tür hinaus.
Langsam ging er die Treppe hinunter und wieder hinauf, schlich im Gang umher und suchte nach einer Ausrede, um nicht in sein Zimmer zurückzumüssen. Er wünschte, er wäre nach Hause gefahren, doch ihn erwartete noch seine geschäftliche Besprechung mit Mr. Tanner. Außerdem musste er den Urkundsbeamten des Gerichts aufsuchen. Les hatte ihm einen interessanten Tip gegeben: »Wenn du dir keine Hilfsarbeiter leisten kannst, besorgst du dir Sträflinge. Hier in der Gegend gibt es noch welche, und sie sind nicht schlimmer als die anderen Herumtreiber, die es zu uns verschlägt. Wir hatten mal einen. Bis er dann meine Schwester geschwängert hat.«
»Wen? Elsie?«
»Ja. Pa hat ihn mit der Pferdepeitsche verjagt und Elsie nach Perth verfrachtet.«
Clem war verblüfft. Elsie war ihm immer so langweilig und gesetzt erschienen. Als er vor der Tür stand, dachte er immer noch über Elsie nach, bis ihm schließlich auffiel, dass in seinem Zimmer ein Streit ausgebrochen war. Wenn sie weiterhin solchen Krach schlugen, würde man ihn noch hinauswerfen.
Jocelyn saß mit untergeschlagenen Beinen auf dem Kissen am Kopfende des breiten Bettes. Sie fauchte die beiden Männer an wie eine wütende Katze. »Andy Postle, ich habe nein gesagt, also verschwinde!«
»Du hast es so gewollt«, schnappte Andy zurück. Mit Schwung hob er sie hoch und warf sie wieder aufs Bett, schob ihr die Röcke über den Kopf und ließ sich ungeschickt auf sie fallen.
Clem starrte Les an, der zurückgelehnt auf einem Stuhl saß, die langen Beine gegen den Toilettentisch gestemmt. »Wie wär’s mit einer Wette, Clem? Ich setze fünf zu eins auf Andy.«
Wenigstens war der Lärm verstummt. Man hörte nur noch erstickte Kampfgeräusche vom Bett.
»Sie wird sich schon beruhigen«, meinte Les so lässig, als spräche er von einer Stute, die beschält werden sollte. Clem spürte Abscheu in sich aufsteigen. Er wusste nicht, was er tun sollte, und ging zum Bett hinüber.
»Geht es dir gut?«, fragte er die Frau, die unter ihren Röcken und Andys kräftigem Rücken beinahe erstickte.
»Natürlich nicht«, erklang ihre Stimme. »Schaff diesen Bastard von mir runter.«
Und Clem tat, wie ihm geheißen. Es war eher ein Reflex als eine kalkulierte Handlung. Er kannte die Spielregeln nicht. Also griff er rasch nach Andys Beinen und zog ihn zum Fußende des hohen Bettes hinunter. Dann versetzte er ihm einen heftigen Stoß, so dass Andy polternd zu Boden krachte.
Sein neuer Freund schnellte hoch und umklammerte dabei seine Hosen. »Price, du Wahnsinniger, dafür wirst du mir büßen! Ich hätte mir das Rückgrat brechen können.«
»Versuch’s doch«, erwiderte Clem und ging in Angriffsstellung. Er hatte die Nase voll von Dora, von Noahs Heuchelei, von der Last einer großen Farm, die wie ein Bauernhof in der Vorstadt geführt wurde – einfach von allem!
»Versuch’s doch«, warnte er Andy, der ihm an Größe und Körperkraft unterlegen war, »dann bekommst du die Prügel deines Lebens.«
»Hör ihn dir an«, lachte Les, der ältere der beiden. Ihn schien einfach alles zu amüsieren. »Ich schätze, er könnte es dir zeigen, altes Haus. Aber nicht hier, wenn es geht. Jocelyn ist nicht in der Stimmung, wir sollten besser zu Mrs. Penny gehen, bevor sie den Laden schließt.«
Nachdem sie ihre Bluse zugeknöpft hatte, glitt Jocelyn vom Bett. Sie kochte vor Wut. »Zur Hölle mit dir, Andy Postle!«
Heftig stieß sie Les’ Beine beiseite, um einen Blick in den Frisierspiegel werfen zu können. Sie brachte hastig ihr Haar in Ordnung und war kurz darauf verschwunden.
»Nun, wie sieht’s aus?«, fragte Les und ergriff seinen Hut.
»Kommt ihr beide mit oder wollt ihr euren Streit unten im Hof austragen?«
»Ich kriege dich schon«, drohte Andy und schloß sich damit stillschweigend dem Vorschlag seines Bruders an. Clem fühlte Panik in sich aufsteigen, als er an Mrs. Penny dachte. Das Freudenhaus an sich war schon schlimm, aber wenn er nun Dora dort begegnete? Les würde sich köstlich amüsieren. Ganz zu schweigen von den Folgen, die ein weiterer Zusammenstoß mit Dora haben würde. Zum zweiten Mal an diesem Abend stieg Clem die Treppenstufen vor dem Hotel hinunter und fiel plötzlich der Länge nach zu Boden.
Les hob ihn hoch, ließ ihn aber wieder fallen. »Verdammt, er hat schlappgemacht.«
»Der könnte nicht mal saufen, wenn’s um sein Leben ginge«, meinte Andy fröhlich.
»Wir sollten ihn besser nach oben bringen.«
»Vergiss es. Lass ihn hier. Markiert den großen Mann, wo sein Alter noch warm ist. Und dann diese billige Nutte im Haus. Ich wette, er hat sich schon mit ihr eingelassen.«
»Keine Sorge. Ich habe gehört, dass er sie schon rausgeworfen hat.«
»Na, los!«, Andy stieß Clem mit dem Stiefel an. »Vor einer Minute war er noch nicht so blau. Spielt uns bestimmt was vor. Diese verdammten Prices sind arm wie die Kirchenmäuse. Er könnte sich die paar Kröten für die Huren gar nicht leisten.« Andy trat fester zu, aber Clem biss die Zähne zusammen, als der Schmerz seine Brust durchzuckte, und blieb reglos liegen. Andy hatte recht. Bisher war ihm nicht klar gewesen, dass er gar kein Geld für eine Hure hatte.
Als die Postle-Brüder gegangen waren, rappelte er sich auf und kehrte in sein Zimmer zurück. Er war vollkommen niedergeschlagen. Doch mitten in der Nacht fühlte er Jocelyn zu sich ins Bett schlüpfen. Trotz seiner schmerzenden Rippen glitt er mit sanfter Wollust aus seinen Träumen, bis ihm schließlich klarwurde, dass sie wirklich bei ihm war. Greifbar nah. Und nackt! Sie schien keinerlei Scham zu empfinden. Ihre Absichten waren unmissverständlich. Leidenschaftlich küsste sie jeden Fleck seines Körpers, so wild, dass es ihn in Erstaunen versetzte. Er hatte immer geglaubt, Frauen wollten sanft umschmeichelt werden, doch sie war anders. Diese wunderbare Wendung, die die Ereignisse genommen hatten, löste eine heftige Erregung in ihm aus. Er rollte sich auf sie und legte los, als habe er Angst, sie könne ihre Meinung in letzter Sekunde ändern.
Am Morgen lag er im Halbdunkel auf dem zerwühlten Bett. Die Jalousien waren noch geschlossen. Im Geiste erlebte er jeden Augenblick ihres Zusammenseins noch einmal. Sie war lange bei ihm geblieben, und sie hatten sich wieder und wieder geliebt. Darin lag für ihn eine weitere Offenbarung. Clem fühlte sich stark und war stolz auf sich, denn beim Abschied hatte sie ihm zugeflüstert: »Du hast einen wunderschönen Körper, Clem Price. Ich wusste, du würdest gut sein.«
Er grinste zufrieden. Hatte sie gemerkt, dass er zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen hatte? Hoffentlich nicht. Es war jetzt auch egal. Boshaft fragte er sich, wie es wohl den Postle-Brüdern bei Mrs. Penny ergangen war. Etwas Besseres als er konnten sie einfach nicht erlebt haben, doch damit zu prahlen wäre zwar spaßig, aber kaum klug. Auf den unvermeidlichen Klatsch konnte er gut verzichten.
Als er aus dem Duschraum neben der Wäscherei trat und sich das dunkle Haar trockenrieb, entdeckte er zu seinem Erstaunen Jocelyn, die gerade Wäsche aufhängte. Er wusste nicht, was er zu ihr sagen sollte. Was wäre richtig? Doch sie winkte ihm nur zu, als sei nichts geschehen, und fuhr mit ihrer Arbeit fort. Clem nickte erleichtert, steckte sich das Hemd in die Hose und stapfte barfuß zur Hintertreppe. Hier hatte Andy ihn getreten, doch auch das war ihm jetzt egal. Schließlich hatte er den Kampf gewonnen.
Bevor die Bank öffnete, wurde er im Gerichtsgebäude vorstellig, um sich zu erkundigen, ob man tatsächlich Sträflinge als Farmarbeiter einstellen konnte. Vielleicht hatte Les ja auch bloß dummes Zeug geredet.
Ein Todesfall in der Familie beEinflusst auch das Verhalten der Leute. Der Beamte wusste von Clems Verlust und behandelte ihn freundlich und rücksichtsvoll. Er war ein geschäftiger kleiner Bursche in den mittleren Jahren und arbeitete in einem winzigen Büro. Aus den offenen Regalen quollen Berge von Papier hervor.
»Mal sehen, was wir für dich tun können, Clem. Die Antragsformulare müssten irgendwo hier sein.« Beim Suchen redete er weiter: »Schade um deinen Vater. Wirklich schade. Was ist aus Vikar Petchley geworden? Ich hörte, er sei an jenem Tag draußen auf Lancoorie gewesen.«
»Keine Ahnung«, erwiderte Clem kurz angebunden.
»Habe ihn seither nicht mehr gesehen«, murmelte der Beamte, während Clem reglos und schweigend dastand.
»Da sind sie ja. Diese Formulare müssen in dreifacher Ausfertigung ausgefüllt werden. Alice muss sie unterzeichnen. Sie hat nichts dagegen, mit Sträflingen zu arbeiten?«
»Nein.«
»Na, gut, dann wird es wohl in Ordnung sein. Wir werden schon ein paar brauchbare Burschen für euch finden. Wie viele brauchst du?«
»Weiß nicht. Hm, zwei. Versuchen wir es mal mit zweien.«
»Das halte ich für sehr vernünftig, denn ihr seid allein auf der Farm. Sonst fallen sie noch über euch her.«
Clem war sich nicht sicher, ob er überhaupt Sträflinge einstellen wollte, brauchte aber dringend Hilfe. Auf dem Heimweg würde er bei Ted Cornish vorbeischauen und fragen, wie es bei ihm zurzeit aussah. Nicht, dass er sich einen bezahlten Arbeiter hätte leisten können, aber es schadete nicht, zu wissen, an wen man sich im Notfall wenden konnte.
»Im Augenblick erhalten die Sträflinge Unterkunft und Verpflegung und bekommen zwei Shilling sechs Pence pro Woche«, erklärte ihm der Beamte und legte ihm ein weiteres Formular vor. »Dies sind die Vorschriften zur Beschäftigung von Staatsgefangenen. Ich verstehe nicht, warum sie die Transporte eingestellt haben. Sträflinge bildeten doch stets einen wesentlichen Bestandteil unserer Arbeitskräfte. Ohne sie wären wir niemals zurechtgekommen. Und wir brauchen sie im Grunde immer noch, denn dieses Land ist riesig und wird mehr und mehr erschlossen.«
Schließlich war Clem wieder unterwegs. In einer Pappmappe, die mit einer dünnen roten Kordel verschnürt war, hatte er nun eine verwirrende Sammlung von Formularen dabei.
Dr. Carty trank in der Bank gerade eine Tasse Tee mit Mr. Tanner. »Ach, Clem. Auf dich habe ich gewartet. Alles in Ordnung mit dir?«
»Ja.«
»Und mit Alice?«
»Vielen Dank, Doktor, es geht ihr gut.«
»Ich habe den Totenschein für euch.«
»Wie bitte?«