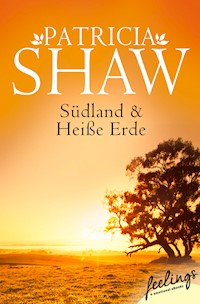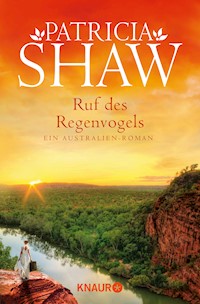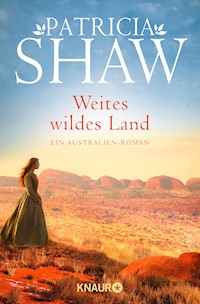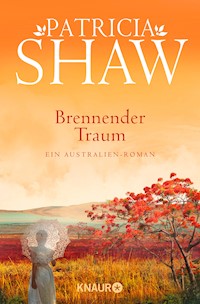9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Zwei Geschichten um den attraktiven Abenteurer Mal Willoughby jetzt in einem Band! »Feuerbucht« Im Jahr 1868 reisen die Schwestern Emilie und Ruth von England nach Australien, um dort ihr Glück zu suchen. Während es Ruth auf eine Farm im Landesinneren verschlägt, ist Emilie gezwungen, eine Stelle im Hafenort Maryborough anzunehmen. Als sie dem Abenteurer Willoughby begegnet, ist dieser sofort hingerissen von der "englischen Dame". Obwohl seine ungenierte Art Emilie zunächst empört, kann sie ihm nicht widerstehen. Doch dann gerät Willoughby in Verdacht, einen Geldtransport überfallen zu haben.. Hat Emilie sich in ihm getäuscht, oder ist er wirklich unschuldig, wie er behauptet? Die junge Frau beschließt, ihrem Herzen zu trauen und Willoughbys Unschuld zu beweisen - koste es, was es wolle... »Wind des Südens« Eine bunt zusammengewürfelte Reisegruppe segelt auf einem Luxusliner von Hongkong nach Australien. Unter ihnen sind auch der Abenteurer Mal Willoughby und seine schöne chinesische Frau. Im Pionierland Australien wollen die beiden ein neues Leben beginnen, doch die Reise nimmt eine dramatische Wendung: Mitglieder der Crew zetteln aus Goldgier eine Meuterei an – und Mals Frau wird dabei getötet ... Eine große Saga voll Dramatik und großer Gefühle von der Bestseller-Autorin Patricia Shaw. »Feuerbucht + Wind des Südens« ist ein eBook von feelings –emotional eBooks*. Mehr von uns ausgewählte romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.de/feelings.ebooks Genieße jede Woche eine neue Liebesgeschichte - wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1614
Ähnliche
Patricia Shaw
Feuerbucht & Wind des Südens
Zwei Romane in einem Band
Knaur e-books
Über dieses Buch
Zwei Geschichten um den attraktiven Abenteurer Mal Willoughby jetzt in einem Band!
»Feuerbucht« Im Jahr 1868 reisen die Schwestern Emilie und Ruth von England nach Australien, um dort ihr Glück zu suchen. Während es Ruth auf eine Farm im Landesinneren verschlägt, ist Emilie gezwungen, eine Stelle im Hafenort Maryborough anzunehmen. Als sie dem Abenteurer Willoughby begegnet, ist dieser sofort hingerissen von der "englischen Dame". Obwohl seine ungenierte Art Emilie zunächst empört, kann sie ihm nicht widerstehen. Doch dann gerät Willoughby in Verdacht, einen Geldtransport überfallen zu haben.. Hat Emilie sich in ihm getäuscht, oder ist er wirklich unschuldig, wie er behauptet? Die junge Frau beschließt, ihrem Herzen zu trauen und Willoughbys Unschuld zu beweisen - koste es, was es wolle...
»Wind des Südens« Eine bunt zusammengewürfelte Reisegruppe segelt auf einem Luxusliner von Hongkong nach Australien. Unter ihnen sind auch der Abenteurer Mal Willoughby und seine schöne chinesische Frau. Im Pionierland Australien wollen die beiden ein neues Leben beginnen, doch die Reise nimmt eine dramatische Wendung: Mitglieder der Crew zetteln aus Goldgier eine Meuterei an – und Mals Frau wird dabei getötet ...
Inhaltsübersicht
Feuerbucht
Die große Australien-Saga
Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg
Für Evangeline und Benjamin Shaw.
In Liebe
The Times, London, 4. Oktober 1867
Die Förderer und Mitglieder der Auswanderungsgesellschaft für die weibliche Mittelklasse haben in dieser Woche sechs weitere Gouvernanten auf die weite Reise in die Kolonien geschickt, wo Positionen in von ihnen gewählten Berufen auf sie warten.
Vier dieser Damen schifften sich auf der Pacific Star ein, die beiden anderen verließen unser Land an Bord der City of Liverpool.
Ein Lob gebührt den Mitgliedern der Auswanderungsgesellschaft für die weibliche Mittelklasse, die sich dem Wohl ihrer weniger glücklichen Schwestern verschrieben haben. Leider bestehen in diesem Land nur wenige Beschäftigungsmöglichkeiten für in wirtschaftliche Not geratene gebildete Damen.
Wie wir erfahren haben, erhielt die Gesellschaft auf ihre letzte Anzeige, mit der sie Gouvernanten für Posten im Ausland suchte, dreihundertsechzig Bewerbungen. Viele dieser Frauen mussten eingestehen, in völliger Armut zu leben.
Sosehr die Gesellschaft auch allen Bewerberinnen helfen möchte, sieht sie sich gezwungen, ihre Bemühungen aufgrund ihres begrenzten Etats auf einen verhältnismäßig kleinen Kreis zu beschränken.
Allerdings hat dies zur Folge, dass die Frauen, die letztlich ausgewählt werden, mit erstklassigen Kenntnissen in englischer Literatur, Latein, Französisch oder Deutsch, Musik, Malerei und Redekunst aufwarten können.
Uns bleibt nur hinzuzufügen, dass von unserem Verlust die Kolonien profitieren, denn welche Familie würde sich nicht wahrhaft glücklich schätzen, eine solche Perle in ihrem Heim zu haben? Wir wünschen den Emigrantinnen eine gute Reise und allen nur erdenklichen Erfolg am anderen Ende der Welt.
1. Kapitel
Der blendend weiße Leuchtturm von Cape Moreton sandte den reisemüden Passagieren und der Mannschaft der City of Liverpool einen warmen Willkommensgruß, als das Schiff an diesem herrlichen, sonnigen Morgen stolz in die Bucht segelte. Sie alle empfanden eine ungeheure Dankbarkeit bei diesem tröstlichen Anblick. Die Gefahren des Ozeans lagen hinter ihnen. Die fünfzehnwöchige Reise war beinahe vorüber.
Man hatte sie vor rauher See in der weiten Bucht gewarnt, doch das Wetter war ihnen gnädig, und das Schiff wurde von einer sanften Dünung geschaukelt, als es den schützenden Windschatten von Stradbroke Island verließ und auf das Festland zusteuerte. Hoch über ihnen schwebten Pelikane am makellos blauen Himmel, und schlanke Delphine schnellten durchs klare Wasser, als wollten sie das Schiff zu einem Wettrennen bis zur Mündung des Brisbane River herausfordern.
Zwei junge Damen in dunklen Hauben und Umhängen standen inmitten der Menschenmenge an der Reling, die zu dem kleinen Decksbereich gehörte, der den Passagieren der zweiten Klasse vorbehalten war.
»Es kann nicht mehr lange dauern«, sagte Emilie zu ihrer Schwester, und die Aufregung war ihrer Stimme deutlich anzumerken.
»Gott sei Dank. Ich kann es gar nicht erwarten, dieses schreckliche Schiff zu verlassen.«
Sie passierten einige Inseln. Emilie warf einen Blick in ihr Notizbuch.
»Eine dieser Inseln heißt St. Helena, dort gibt es auch ein Gefängnis. Wie ungewöhnlich. Und auf der anderen befindet sich eine Leprastation. Was für ein furchtbarer Ort das sein muss, Ruth.«
»Entsetzlich. Aber ich nehme an, die Ärmsten hätten es schlechter treffen können. Die Inseln als solche scheinen recht hübsch zu sein.«
Andere Passagiere eilten geschäftig umher, trugen ihr Kabinengepäck an Deck oder waren mit Familie und Freunden in Abschiedsgespräche über ihre weiteren Reisepläne vertieft. Doch die Tissington-Schwestern blieben auf Distanz. Sie waren unterwegs, um als Gouvernanten in Brisbane oder der näheren Umgebung zu wirken, und hielten es in Anbetracht ihres Berufs für wichtig, so viel wie möglich über dieses neue Land zu lernen. Sie hatten Reisetagebücher geführt und alles gelesen, was sie über Australien auftreiben konnten. Nun bekamen sie Gelegenheit, ihr theoretisches Wissen um eigene Anschauung zu erweitern, und so beobachteten sie den Verlauf des Flusses und die ungewöhnliche Pflanzenwelt, die seine schlammigen Ufer säumte.
Obwohl auf vornehme Zurückhaltung bedacht, konnten sie dennoch nicht umhin, mit geradezu kindlicher Neugierde Ausschau nach den berühmten Kängurus und Koalas zu halten; doch leider steckte keines dieser Beuteltiere die Nase aus dem Grün. Vögel hingegen gab es viele. Jenseits der Ufermangroven erkannte Ruth stattliche Eukalyptusbäume, die über dem Busch emporragten. Rote Blüten flammten auf, die offensichtlich den zahllosen leuchtend bunten Vögeln, die kreischend und zeternd die Ufer bevölkerten, als Nektarquelle dienten.
Emilie war hingerissen. »Sieh dir diese Papageien an! Sind sie nicht herrlich?«
»Ich glaube, das sind Loris. Wie schön, sie hier einmal in Freiheit erleben zu dürfen. Sie geben sicherlich ganz wunderbare Motive für deine Aquarelle ab.«
Sie versanken wieder in Gedanken. Während sie das unbekannte Land betrachtete, kam Ruth unwillkürlich die unglückselige Verkettung von Ereignissen in den Sinn, die sie gezwungen hatten, im Ausland ihr Auskommen zu suchen. Sie erschauderte. Ohne die Unterstützung der Auswanderungsgesellschaft würden sie noch immer in London leben, in schrecklicher Armut, Arbeitslosigkeit und Verzweiflung. Voller Traurigkeit dachte sie an ihre liebe Mutter. Alice Tissington hätte sich im Grab umgedreht, hätte sie um das Elend gewusst, das ihre Töchter seit ihrem Tod heimgesucht hatte. Sie war eine gebildete Frau gewesen, die Tochter eines Philosophen und Mathematikers, und hatte dafür gesorgt, dass Ruth und Emilie neben dem Wissen, das sie in der Dorfschule von Brackham erwarben, eine umfassende Ausbildung in den schönen Künsten erhielten.
Vor drei Jahren – einer halben Ewigkeit, wie es Ruth nun schien – hatte ihr verwitweter Vater wieder geheiratet. Die scheuen Mädchen hießen ihre Stiefmutter willkommen, mussten aber feststellen, dass diese ihre Anwesenheit in dem kleinen Haushalt missbilligte. Nur allzu bald erfuhren sie, dass sie im Dorf über sie tratschte, sie der Faulheit und Aufsässigkeit bezichtigte und sie zwei alte Jungfern nannte, die ihrem lieben Vater nur zur Last fielen. Die dreiundzwanzigjährige Ruth war entsetzt und peinlich berührt. Auf die ihr eigene sanfte Weise erinnerte sie die neue Mrs. Tissington daran, dass ihr Verdienst als Musiklehrerin zum Familieneinkommen beitrug und die erst neunzehnjährige Emilie bereits Privatschüler für Französisch und Kunst annahm.
»Das ist auch so eine Sache«, hatte die Frau erwidert. »Ich dulde nicht, dass mein Heim zu einer Schule verkommt, in der ein ständiges Kommen und Gehen herrscht.«
Ruth wandte sich Hilfe suchend an William Tissington, der jedoch die Ansicht vertrat, seine Frau sei im Recht. »Wie kann sie Gäste in ihrem eigenen Salon empfangen, wenn dort Jugendliche auf dem Klavier herumhämmern? Außerdem bekommt die arme Frau Kopfschmerzen von dem ständigen Geklimper.«
Immer häufiger kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Frauen. Emilie setzte sich gegen das ständige Nörgeln ihrer Stiefmutter heftig zur Wehr, während Ruth sich erfolglos darum bemühte, die Probleme auf damenhafte Weise zu lösen. Naiv wie sie waren, hielten es die beiden Schwestern nicht für möglich, dass eine neue Ehefrau ihnen den Platz streitig machen und ihre sicher gewähnte Position immer mehr untergraben konnte, bis nichts mehr davon übrig war.
Als Emilie verkündete, dass sie Freunde zu einer ihrer musikalischen Abendgesellschaften eingeladen habe, verweigerte Mrs. Tissington ihr rundheraus die Erlaubnis dazu.
»Ich teile dir das eigentlich nur der Höflichkeit halber mit«, antwortete Emilie aufbrausend. »Unsere musikalischen Abendgesellschaften werden im Dorf sehr geschätzt, das war schon immer so. Ruth und ich haben auch ein Recht auf ein gesellschaftliches Leben. Wir brauchen deine Erlaubnis nicht, um ein paar Freunde einzuladen; schließlich ist es auch unser Heim.«
»Das werden wir ja sehen. Ich spreche mit Mr. Tissington darüber.«
»Tu das nur!«
Die Entscheidung ihres Vaters schmerzte noch immer.
»Ich kann diese ständigen Sticheleien nicht länger ertragen. Diese Dame ist meine Frau. Sie sollte ebenso wenig darunter leiden müssen. Sie hat sich solche Mühe mit euch gegeben, doch ihr seid anscheinend nicht in der Lage, dies anzuerkennen. Es wäre besser, wenn ihr euch eine anderweitige Unterkunft suchtet.«
Nachdem sich der erste Schock gelegt hatte, kamen die jungen Damen zu dem Schluss, dass ein solcher Schritt gar nicht so verkehrt sei. Es wäre ganz schön, endlich ein eigenes Zuhause zu haben, unabhängig zu sein und frei von dieser schrecklichen Person. Sie entschieden sich jedoch dagegen, ein Haus im Dorf anzumieten, wo früher oder später bekannt werden würde, dass man sie praktisch aus ihrem Heim vertrieben hatte. Dieser Demütigung wollten sie sich nicht aussetzen. Besser, sie zogen gleich nach London, wo sie einige Leute kannten und eine sehr viel größere Auswahl von Beschäftigungsmöglichkeiten als Privatlehrerinnen oder außer Haus lebende Gouvernanten vorfinden würden.
Tissington gab Ruth zwanzig Pfund für den Anfang und sagte ihr weitere finanzielle Unterstützung zu, die jedoch niemals kam. Er beauftragte einen Spediteur, ihre Schrankkoffer und Möbel nach London zu bringen. Möbel aus ihrem eigenen Heim, so beeilte sich seine Frau hinzuzufügen, von denen sie sich aus reiner Nächstenliebe trenne.
Im Rückblick sah Ruth ein, wie töricht ihre Hoffnung gewesen war, in einer Stadt wie London anzukommen und nur aufgrund persönlicher Referenzen sogleich eine angemessene Stellung zu finden. Potenzielle Arbeitgeber und Vermittler hielten ihnen immer wieder ihre mangelnde Erfahrung vor.
Sie unterdrückte ein Schluchzen. Doch was hätten sie sonst tun sollen? Ihr Vater hatte sie im Stich gelassen, das Geld schmolz dahin, und sie sahen sich gezwungen, Gelegenheitsarbeiten anzunehmen. Sie halfen in Bibliotheken aus, schrieben in Büros Briefe ab, betreuten Kinder in Abwesenheit ihres Kindermädchens oder übten andere unbedeutende Tätigkeiten aus, mit denen sie sich jedoch kaum über Wasser zu halten vermochten. Sie verkauften ihre Bücher und alle Möbelstücke, auf die sie verzichten konnten, zogen in ein schäbiges Zimmer im Souterrain, wo sie abends hungrig im Dunkeln saßen und nicht wagten, eine Kerze zu verschwenden. Alle Bittgesuche an ihren Vater stießen auf taube Ohren.
Dann erfuhr Emilie von der Auswanderungsgesellschaft und nahm Kontakt auf – ein erster Hoffnungsschimmer, der den Mädchen so lange gefehlt hatte. Ein Gesellschaftsmitglied, das ihre Bewerbungen prüfte, hatte ihre verstorbene Mutter gekannt. Die Dame bedauerte, dass die Töchter ihrer Freundin in Not geraten waren, und empfahl sie umgehend für das Auswanderungsprogramm. Schon bald befand man sie für geeignet, Stellungen als Gouvernanten in Queensland anzutreten. Sie würden unter der Schirmherrschaft der Gesellschaft reisen, zudem bot man ihnen ein Darlehen von zweihundert Pfund für Reisekosten und Spesen an. Die beiden Mädchen waren überglücklich. Nicht nur waren sie der Armut entronnen, sie erfuhren nun auch, dass sie als Gouvernanten in den Kolonien ein Jahreseinkommen von mindestens einhundert Pfund erwarten durften. Dann jedoch stellte sich heraus, dass es noch eine letzte Hürde zu nehmen galt. Sie mussten einen Bürgen benennen, der das Darlehen zurückzahlen würde, falls ihnen das nicht innerhalb der vorgeschriebenen drei Jahre gelingen sollte.
»Was sollen wir nur tun?«, hatte Emilie lamentiert. »Wer würde denn schon für eine solche Summe bürgen?«
»Vater.«
»Wie bitte? Auf gar keinen Fall! Ich würde ihn nicht einmal fragen, wenn mein Leben davon abhinge.«
»Wir müssen es versuchen«, hatte Ruth düster geantwortet. »Unser Leben könnte tatsächlich davon abhängen.«
»Er wird dir nicht antworten.«
»Vielleicht doch. Wenn er erfährt, dass wir das Land verlassen und die Gesellschaft uns Anstellungen in den Kolonien vermittelt hat, ist er uns los. Keine Bettelbriefe mehr. Wir werden sicher in der Lage sein, das Darlehen selbst zurückzuzahlen, immerhin haben wir drei Jahre Zeit dazu. Er hat also nichts zu verlieren. Ich glaube, er wird für uns bürgen. Es ist das Mindeste, was er tun kann.«
Schließlich war Emilie einverstanden, ihn zu fragen, doch für den Notfall hielt sie noch einen anderen Plan bereit. »Na schön, Ruth, dann schreib ihm eben. Doch wenn er sich weigert, verfasse ich die Bürgschaft selbst und fälsche seine Unterschrift.«
»Gott im Himmel! Das ist doch nicht dein Ernst!«
»Und ob! Bis er es herausfindet, haben wir das Land längst verlassen.«
Wie sich herausstellte, erklärte William Tissington sich tatsächlich bereit, für sie zu bürgen. Einerseits waren sie erleichtert, andererseits schmerzte dieser letzte Schritt zur endgültigen Trennung.
Emilie stieß ihre Schwester an. »Ich wüsste gern, woran du jetzt denkst.«
Mit einem schwachen Lächeln verscheuchte Ruth den Gedanken an die Vergangenheit. »Ich hoffe, dass unsere Arbeitsplätze nicht zu weit auseinanderliegen. Man sagt, die großen Entfernungen hier draußen seien eine schwere Belastung, und Reisen ist teuer.«
»Kopf hoch. Vielleicht kommen wir sogar bei benachbarten Familien unter. Ich glaube, dort drüben bei den Bauernhäusern beginnen die Vororte.«
Ruth konnte einfach nicht den gleichen Enthusiasmus für dieses Abenteuer aufbringen wie Emilie; sie hatte sich nur darauf eingelassen, weil ihnen keine andere Wahl blieb. Als das Schiff jedoch am Pier von Brisbane anlegte, spürte sie eine Welle der Erleichterung. Die Stadt wirkte freundlich, wenn auch ländlich; die fernen Hügel umgaben die niedrigen weißen Gebäude wie ein Ring.
An Bord der City of Liverpool hatten sie einige Ausgaben gehabt. Mit Mühe und Not ergatterten sie die Hälfte einer Kabine für sich, in der sie nichts als ein Leinwandvorhang von zwei ungehobelten Frauen trennte; doch sie mussten Geld in die Ausstattung investieren, wie zum Beispiel Matratzen für die nackten Schlafpritschen, dazu Rettungswesten, Laternen, einen Toiletteneimer und verschiedene andere Dinge, die man an Bord eines Schiffes benötigte. Dennoch hatten sie Geld gespart, indem sie ihr eigenes Bettzeug und Geschirr, Lampen und Kerzen mitbrachten. An Land würden sie diese Gegenstände nicht mehr benötigen, da ihre Stellungen Kost und Logis mit einschlossen. Emilie verkaufte die Sachen daher an den zweiten Maat, der sie, zweifellos mit einigem Gewinn, an ausreisende Passagiere weiterveräußern würde.
Ruth wartete in der Kabine auf ihre Schwester, damit keines ihrer Besitztümer ihren Mitbewohnerinnen in die Hände fiel, die groß im Leihen und vergesslich im Zurückgeben waren. Sie nutzte die Zeit, den Brief an Jane Lewin zu beenden, die Leiterin der Auswanderungsgesellschaft, der sie für ihre Freundlichkeit dankte und versprach, das Darlehen so bald wie möglich zurückzuzahlen. Sie beschrieb die elende Überfahrt in allen Einzelheiten und machte deutlich, dass man Damen niemals zweiter Klasse reisen lassen sollte. Die Gegenwart der Frauen, die sie monatelang zu erdulden hatten, war unpassend und unerträglich gewesen. Sie beschrieb sie als vulgäre Angehörige der untersten Schichten und ihre Haltung gegenüber den einzigen beiden Damen unter ihnen als schändlich. Sie scheute sich nicht, Miss Lewin diese Informationen zu übermitteln, da diese ausdrücklich um Berichte ihrer Gouvernanten gebeten hatte.
Als Emilie zu ihr herunterkam und murmelte, sie habe nicht mehr als zwei Pfund aus dem zweiten Maat herausquetschen können, errötete Ruth.
»Nun, dann muss es eben reichen. Du kannst schließlich nicht mit ihm feilschen.«
»Ich habe ja gefeilscht. Zuerst wollte er mir nur ein Pfund zahlen. Wir können jetzt gehen, der Steward bringt unsere Koffer nach oben. Wir sind endlich am Ziel, Ruth, ist dir das überhaupt klar? Ich kann es gar nicht erwarten, alles zu erforschen.«
»Und ich kann den Geschmack von frischem Essen nicht mehr erwarten«, gab ihre Schwester trocken zurück.
Anders als erwartet, wurden sie nicht abgeholt. In der drückenden Hitze standen sie verloren am Kai und warteten auf den Stellenvermittler oder wenigstens einen Vertreter der Gesellschaft, doch niemand erschien. Auch an Bord hatte sich niemand nach ihnen erkundigt. Als die nachmittäglichen Schatten länger wurden, blieb ihnen nichts anderes übrig, als den Schiffskapitän um Rat zu fragen. Er empfahl ihnen eine Pension in der Adelaide Street.
»Sie sollten sich für die Nacht dorthin zurückziehen, meine Damen. Dann weiß ich Bescheid, wenn ihre Freunde sich nach ihnen erkundigen. Morgen früh sieht alles schon ganz anders aus.«
Er arrangierte ihre Beförderung zu der Pension mit dem seltsamen Namen Belleview Boarding House, und sie genossen die kurze Fahrt, bis sie feststellen mussten, dass diese sie drei Shilling plus sieben Shilling für die Schrankkoffer gekostet hatte.
»Wir hätten laufen sollen«, flüsterte Ruth.
»Das ging nicht, wir hätten unsere Koffer nie wiedergesehen.«
Ihre Wirtin, eine Mrs. Medlow, teilte ihnen gleich beim Empfang mit, der Preis pro Nacht betrage vier Shilling Sixpence oder eine Guinee pro Woche mit Halbpension. Sie entschieden sich für den Einzelpreis mit der Begründung, ihre Pläne stünden noch nicht genau fest, worauf sie in ein geräumiges Zimmer im Erdgeschoss geführt wurden.
Der Raum mit den einladenden Einzelbetten und der makellosen Ausstattung erschien den Tissington-Schwestern wie der Himmel auf Erden, doch sie hielten ihre Begeisterung im Zaum und ließen nicht erkennen, welchen Luxus dies nach den Entbehrungen der zweiten Klasse für sie bedeutete.
»Abendessen um sechs. Es wird jeden Moment läuten.« Damit verabschiedete sich Mrs. Medlow.
»Du lieber Himmel!«, rief Emilie. »Richtige Betten! Privatsphäre. Sauberkeit ist ein wahres Gottesgeschenk. Endlich kein Gestank mehr.« Sie zog eine weiße Tagesdecke zurück. »Fühl doch nur die Laken, Ruth. Sie sind weich und nicht steif wie ein Brett vom Salzwasser. Und wie sie duften! Hier könnte ich ewig bleiben.«
Ruth lachte. »Ich rieche schon das Essen. Wir müssen uns schnell umziehen, ich falle um vor Hunger.«
Als die Tissington-Schwestern in ihren ordentlichen dunklen Taftkleidern und mit den winzigen Toques auf dem hochgesteckten Haar an ihren Ecktisch geführt wurden, folgten ihnen neugierige Blicke der anderen Gäste. Ein älterer Herr, der allein an einem Nachbartisch saß, begrüßte sie.
»Guten Abend, die Damen. Gerade vom Schiff gekommen, was?« Die beiden waren nicht daran gewöhnt, von einem Wildfremden derart keck angesprochen zu werden. Emilie nickte nur kurz, während Ruth an ihrer Serviette herumfingerte, voller Entsetzen angesichts dieser Verwegenheit.
Das Menü bestand aus einer hervorragenden, gehaltvollen Suppe, Lammbraten mit frischem Gemüse und zum Nachtisch Zitronenpudding. Die Mädchen aßen so vornehm wie möglich und ließen nur zögernd von jedem Gericht einen Anstandshappen auf dem Teller zurück.
Die Serviererin teilte ihnen mit, der Kaffee werde im Salon serviert, doch sie lehnten höflich ab. Beide waren plötzlich sehr müde; die lange, anstrengende Reise forderte ihren Tribut.
»Ich bin ganz froh, dass uns niemand abgeholt hat«, seufzte Emilie und schloss die Zimmertür hinter sich. »Jetzt haben wir wenigstens Zeit, uns zu erholen.«
Bevor sie zu Bett gingen, knieten sie zum Beten nieder und dankten dem Herrn, der sie sicher an Land geführt hatte. Innerhalb weniger Minuten waren beide eingeschlafen, umhüllt vom Frieden und der Bequemlichkeit des bescheidenen Pensionszimmers.
Der Stellenvermittler Julius Penn kam die Ann Street herauf und betrachtete zufrieden die lange Schlange der Frauen, die sich bereits draußen vor seinem Büro angesammelt hatte. Einige Stammkundinnen grüßte er mit Namen.
»Du schon wieder, Dulcie«, sagte er zu einer blonden Frau und schloss die Tür auf. »Was ist denn diesmal schiefgegangen?«
»Sie haben mich nicht bezahlt, das war’s. Zwei volle Wochen hab ich für sie gekocht, und dann erzählen sie mir, sie hätten nichts, ich müsste auf mein Geld warten. Wovon soll ich denn wohl meine Miete bezahlen?«
»Schön, schön, ich streiche sie von der Liste. Wir finden etwas anderes für dich.«
»Ich glaub, die Hälfte aller Bosse sollte von Ihrer Liste gestrichen werden«, gab sie vorlaut zurück, doch er warf nur einen Blick auf die Wanduhr in seinem Büro und schloss die Tür hinter sich. Sie blieb draußen und tauschte Klagen mit den anderen hoffnungsvollen Arbeitsuchenden aus. Noch zehn Minuten, bis das Büro öffnete.
Er hängte Hut und Stock an einen Holzhaken, zog das Jackett aus, hängte es ebenfalls auf und nahm dann in Hemdsärmeln hinter seinem Schreibtisch Platz. Er zündete sich einen Stumpen an und betrachtete mit einem Kopfschütteln die Reihen leerer Stühle vor sich. Dulcie hatte recht: Die Hälfte der Arbeitgeber auf seiner Liste griff zu jedem nur erdenklichen Trick, um die Dienstboten um ihren Lohn zu bringen. Andererseits verstand die Hälfte aller Frauen, die er losschickte, nichts von vernünftiger Arbeit, somit waren sie wieder quitt. Er verschob sie einfach von einem zum nächsten und kassierte bei jeder Vermittlung einen Shilling, vom Arbeitnehmer wie vom Arbeitgeber. Erstaunlich, wie sich diese kleinen Shillinge summierten. Mit seinen fünfzig Jahren fragte sich Julius, weshalb er erst so spät auf diesen Dreh verfallen war. Er hatte ein schweres Leben hinter sich, hatte stets Grund zur Klage gehabt, nichts schien jemals richtig zu laufen, obwohl er jede Menge Jobs angenommen hatte, vom Büroangestellten bis hin zum Handlungsreisenden im Outback. Er hatte hochfliegende Pläne gehabt, mit denen er sein Glück machen wollte, war damit aber stets auf die Nase gefallen. Da war zum Beispiel das von ihm erfundene alkoholfreie Ale. Er wusste noch immer nicht, wo der Fehler gelegen hatte. Die Temperenzler von Parramatta hatten ihn aus der Stadt gejagt, als mehrere ihrer Damen davon sturzbetrunken geworden waren.
Er seufzte und sog an seinem Stumpen. Durch reinen Zufall war er dann auf dieses Geschäft gestoßen. Er war von Sydney nach Brisbane gekommen, um den drückenden Schulden zu entfliehen, und hatte sich auf die Suche nach einer Stellenvermittlung gemacht, wobei er feststellen musste, dass es so etwas in Brisbane gar nicht gab. Innerhalb weniger Tage hatte Julius sein eigenes Büro eröffnet. In der Mitte stand ein Schreibtisch, davor waren die Stühle für die Bewerber aufgereiht, und hinter ihm befand sich ein mitgenommener Paravent, hinter dem hoffnungsvolle Arbeitgeber Platz nehmen konnten. Ihnen bot er eine bessere Sitzgelegenheit in Gestalt einiger durchgesessener Sofas an. Von da an ging die Post ab, wie der Wirt nebenan feststellte, der sich als Gegenleistung für ein gelegentliches Glas Brandy auf Kosten des Hauses das beste Personal aussuchen durfte. Julius schaltete einige Anzeigen im Brisbane Courier, doch danach lief alles wie von selbst. Es ging eben nichts über Mundpropaganda. Alle beklagten sich über seine Honorare, doch er pflegte in seinem seriösesten Tonfall darauf hinzuweisen, dass sie unvermeidlich seien – was immer das auch heißen mochte.
Die Uhr schlug acht, und diese verdammte Dulcie hämmerte gegen die Tür; er rief ihr zu, sie solle hereinkommen, und lehnte sich, die Daumen in den Hosenträgern, auf seinem Stuhl zurück. Eine Lawine von Frauen ergoss sich mit ihr in sein Büro und kämpfte um die besten Plätze.
»Ich zuerst«, schrie Dulcie und ließ sich auf den leeren Stuhl unmittelbar vor seinem Schreibtisch plumpsen, während die anderen kreischten und drängelten wie beim Essenfassen in einer Feldküche. »Mal sehen.« Er blätterte die Seiten seines ordentlichen Arbeitgeberverzeichnisses durch. »Du könntest ins Ship Inn gehen. Die suchen da eine Köchin.«
»Da geh ich nicht hin. Dieser Schweinehund verdrischt einen für jede Kleinigkeit.«
»Ansonsten gibt es im Moment nicht viel. Außer, du wärst bereit, in den Busch zu gehen.«
»Von wegen. Die meisten da draußen sind doch bekloppt.«
»So schlimm ist es in den Städten auf dem Land doch gar nicht. Ich bekomme viele Briefe von Leuten, die dort leben, sie suchen verzweifelt nach Dien…, nach Personal.« Julius musste aufpassen, was er sagte. Im Gespräch mit Arbeitgebern nannte er sie immer Dienstboten, doch nach zehn Monaten im Geschäft würde er den Teufel tun, diesen Begriff in Gegenwart der Frauen zu verwenden. Köchinnen waren Köchinnen und Hausmädchen Hausmädchen, doch sie wollten um keinen Preis als Dienstboten abgestempelt werden. Dieses Wort war für sie ein rotes Tuch.
»Welche Landstädte denn?«
»Toowoomba, Maryborough.«
»Nee, ich bleib lieber in der Stadt.«
»Ich könnte dich als Zimmermädchen unterbringen. Im Hotel Victoria.«
»Ich bin kein verdammtes Zimmermädchen, sondern eine Köchin. Wie oft muss ich dir das noch sagen, Julius?«
»Na schön. Aber im Moment habe ich nichts für dich. Du bleibst am besten an deiner jetzigen Arbeitsstelle.«
»Ohne Lohn, während sie die feinen Pinkel mit Hummer und Austern und Champagner bewirtet wie eine russische Fürstin?« Julius sah ein, dass sie recht hatte. Mrs. Walter Bateman, die Frau des leitenden Zollinspektors, war eine ehrgeizige Frau, die für ihre Partys berühmt, bei Personal und Händlern hingegen als Geizhals berüchtigt war.
»Sag einfach, du würdest ihr den Gerichtsvollzieher auf den Hals hetzen«, murmelte er.
Dulcie starrte ihn an. »Jesus, das ist wirklich ein toller Rat. Sie würde mir in den Hintern treten, dass ich achtkantig rausfliege.«
»Du hast doch nichts zu verlieren«, entgegnete er grinsend und strich sich über den exakt getrimmten grauen Schnurrbart. »Sie ist ganz groß darin, Leute zu entlassen, wenn der Lohn fällig wird. Sie wird Probleme haben, einen Ersatz für dich zu finden. Du könntest ihr eine Warnung zukommen lassen.«
»Ich möchte ihr Gesicht sehen, wenn ich es auf die Tour versuche.«
»Liegt ganz bei dir.«
Dulcie legte sich ihren rosa Häkelschal um die Schultern und stand auf. »Ich versprech nicht, dass ich da bleibe. Mit oder ohne Geld.«
Er nickte. »Wir werden sehen. Die Nächste, bitte.«
Dulcie hatte sich kaum vom Stuhl erhoben, da stürzte schon ein dünnes Mädchen auf ihn zu. »Sie müssen mir helfen, Mister. Bin völlig verzweifelt …«
Die Gouvernanten warfen einen ungläubigen Blick durchs Schaufenster.
»Das kann nicht richtig sein«, sagte Ruth und wich zurück.
»Doch. Das ist die Adresse, die wir von Miss Lewin bekommen haben, und da steht auch der Name.«
»Ich werde nicht hineingehen. Es ist offensichtlich eine Einrichtung für Dienstboten. Wir können uns nicht in solcher Gesellschaft zeigen.«
»Dann bleibst du eben hier! Vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine andere Vermittlung. Ich werde hineingehen mich erkundigen.«
Julius sprach gerade mit einer rundlichen Frau, die eine Stelle als Kindermädchen suchte. Er nickte aufmunternd, während er ihre Referenzen studierte. Mit dieser hier würde er keine Probleme haben. Er sah nicht hoch, als die Tür aufging, doch ein Raunen im Raum erregte seine Aufmerksamkeit. Eine junge, selbstbewusst wirkende Frau näherte sich seinem Schreibtisch; sie war sehr hübsch, trug ein elegantes, dunkelblaues Kleid und dazu einen bändergeschmückten Hut auf dem dichten, dunklen Haar.
Julius stufte sie als potenzielle Arbeitgeberin ein und schoss von seinem Stuhl hoch, um sie hinter den Paravent zu führen.
»Sind Sie Mr. Penn?« Ihre Stimme klang kultiviert und passte zu ihrer reizenden Erscheinung.
»Zu Ihren Diensten, meine Liebe. Nehmen Sie bitte Platz. Es ist sehr warm heute. Dürfte ich Ihnen ein Glas Wasser anbieten?«
»Danke, nein, Mr. Penn. Ich muss mich wohl in der Tür geirrt haben, aber vielleicht können Sie mir ja den Weg weisen. Ich bin Miss Tissington; die Auswanderungsgesellschaft hat meine Schwester und mich zu Ihnen geschickt. Wir sind die Gouvernanten, die Sie angefordert hatten, scheinen aber in der falschen Abteilung Ihrer Agentur gelandet zu sein.«
»Jesus!«, murmelte Julius. Jetzt fiel ihm diese Gesellschaft wieder ein. Sie hatten ihn vor Monaten angeschrieben, vor sechs Monaten, um genau zu sein, und sich erkundigt, ob er Gouvernanten mit den besten Empfehlungen angemessene Positionen vermitteln könne. Er hatte dies bejaht, weil er sich geschmeichelt fühlte, dass sein Ruhm bis nach London gedrungen war. Vermutlich hatte jemand seine Anzeige an die Gesellschaft weitergeleitet. Da er nicht wieder von ihnen hörte, hatte er die Sache völlig vergessen.
»Meine Dame, Sie haben sich keineswegs in der Tür geirrt, und ich habe mich für diese Räumlichkeiten zu entschuldigen. Hier läuft alles in einem kleineren Rahmen ab. Der Hauptsitz befindet sich in Sydney.«
Von Frauen, die zwischen den Bundesstaaten umherreisten, hatte er erfahren, dass es separate Stellenvermittlungen für höher-gestellte Frauen gab, doch er konnte es sich nicht leisten, zwei Büros anzumieten. Die wenigen gebildeten Frauen, die in seiner Agentur landeten, lohnten solche Mühen nicht, selbst wenn es zu seinem Prestige beigetragen hätte.
»Verstehe.« Unbeeindruckt überreichte die junge Dame ihm eine ordentlich zusammengebundene Akte. »Hier sind mein Einführungsschreiben von der Gesellschaft und meine Referenzen im Original. Sie haben uns doch erwartet? Miss Lewin hat Ihnen doch sicherlich geschrieben?«
»Mag sein, Miss Tissington, aber ich habe schon länger nichts mehr von der Gesellschaft gehört. Möglicherweise befindet sich die Mitteilung über Ihre bevorstehende Ankunft noch auf hoher See oder kam auf demselben Schiff an wie Sie. Wann sind Sie eingetroffen?«
»Gestern. Wir waren sehr überrascht, dass man uns nicht abgeholt hat. Wir sind davon ausgegangen, dass man uns umgehend zu unseren Arbeitsplätzen bringen würde.« Ihr Selbstvertrauen geriet ins Wanken. »Erwartet uns denn niemand?«
»Im Augenblick nicht, aber das ist nur ein vorübergehender Zustand. Ich brauche ein wenig Zeit, um mich mit der Angelegenheit zu befassen.«
»Meine Schwester ist draußen. Soll ich sie hereinholen?«
Julius wollte ihr um jeden Preis gefallen, außerdem tat sie ihm leid, doch die wartenden Frauen bedeuteten bares Geld, wenn es ihm gelänge, die Spreu vom Weizen zu trennen. »Wissen Sie was? Machen Sie doch einen Spaziergang und lernen die Stadt ein wenig kennen. Brisbane hat Ihnen sicherlich viel Interessantes zu bieten. Wir treffen uns um zwölf Uhr in dem kleinen Café am Ende der Straße, dort können wir uns in Ruhe unterhalten.« Die Frauen draußen wurden allmählich unruhig.
»Wir können nicht sofort unsere Stellen antreten?«, fragte Ruth entsetzt. »Bist du sicher?«
»Nein, das nicht. Er hat mich irgendwie verwirrt. Erwartet hat er uns jedenfalls nicht.«
»Hat er denn trotzdem freie Stellen anzubieten? Das hat er der Gesellschaft jedenfalls versichert. Du hättest darauf bestehen sollen, dass er dir die nötigen Informationen gibt, damit wir uns darüber beraten können.«
»Warum gehst du nicht selbst rein, wenn du so klug bist? Immerhin habe ich den Kontakt mit der Agentur hergestellt.«
»Was man so Agentur nennt«, erwiderte Ruth. »Ich werde Miss Lewin einiges über die Zustände hier zu berichten haben, so viel ist sicher. Und wie kann er es wagen anzunehmen, dass wir bis heute Mittag in dieser Hitze herumlaufen?«
»Wir könnten uns nach einem Postamt umschauen.«
Der Morgen war heiß und schwül. Beim Spaziergang durch die Hauptstraße bereute Ruth, dass sie ihr kurzes Cape angelegt hatte; doch sie konnte es schlecht ausziehen und mit sich herumtragen. Sie tupfte wiederholt mit der behandschuhten Hand die Schweißperlen unter ihren Augen weg, während sie die Schaufenster betrachtete. Alle waren mit hochwertigen und entsprechend teuren Waren gefüllt, was an diesem abgelegenen Ort überraschte.
»Ist dir aufgefallen, dass die Damen hier viel größere Hüte tragen?«, fragte Emilie. »Meinst du, unsere sind hier unmodern?«
»Nein, es hat wohl eher mit der Sonne zu tun. Wir sollten uns besser auch solche kaufen, sonst riskieren wir einen Sonnenstich.«
Sie fanden das Postamt, schickten Ruths Brief ab und erkundeten das Geschäftsviertel von Brisbane, dessen Straßen ein gleichförmiges Raster bildeten. Wenige Blocks vom Fluss entfernt gerieten sie in ein Wohngebiet mit Reihenhäusern und machten kehrt. Sie bogen in eine bergab führende Straße ein und entdeckten zu ihrer Freude, dass diese zu einem Rathaus und einer Kathedrale führte. Also hatte die Stadt doch einiges zu bieten. Sie stießen auf Spuren kulturellen Lebens: ein Museum, ein Theater, sogar ein Plakat der Philharmonie von Brisbane. Da beide nicht an die hier herrschende Hitze gewöhnt waren, waren sie vollkommen erschöpft, als sie an das eindrucksvolle Parlamentsgebäude gelangten, das, von hohen Bäumen umgeben, am Fluss lag. Und noch über eine Stunde bis zu ihrer Verabredung!
»Wir sollten zur Pension zurückgehen und Mrs. Medlow mitteilen, dass wir wahrscheinlich noch eine weitere Nacht bleiben müssen«, sagte Ruth.
»Noch nicht. Warte ab, bis dieser elende Mr. Penn uns etwas Definitives gesagt hat. Vielleicht benötigen wir das Zimmer ja für eine Woche.«
»Eine Woche? Ganz sicher nicht.«
»Wir wissen es aber nicht. Und der Einzelpreis pro Nacht ist hoch.«
»Nicht so hoch wie der Preis für eine Unterkunft, die wir am Ende gar nicht brauchen.«
Schließlich suchten sie einen nahe gelegenen Park auf und setzten sich dort niedergeschlagen auf eine schattige Bank.
Penn erwartete sie bereits im Café und schwenkte einen Brief, während er sie zu einem Ecktisch führte.
»Was habe ich Ihnen gesagt, meine Damen? Hier ist die Mitteilung von Miss Lewin. Sie hätte Sie Ihnen eigentlich gleich mitgeben können. Sie müssen die zweite Miss Tissington sein, es ist mir eine Freude. Nur selten lernt man an einem Tag gleich zwei so reizende Damen kennen.«
Ruth gab sich kühl. Sie saß steif auf ihrem Stuhl und nahm seinen Gruß mit einem kurzen Nicken zur Kenntnis. Ihre Referenzen steckten zusammengerollt und verschnürt in ihrer Handtasche, doch sie hatte nicht vor, sie hier in aller Öffentlichkeit auszubreiten.
»Nun, möchten Sie Tee? Gut, Tee und herzhafte Scones, die sind hier sehr zu empfehlen.« Er winkte die Kellnerin herbei und bestellte, dann wandte er sich an Emilie.
»Ich muss schon sagen, Miss Emilie … Ich darf Sie doch Miss Emilie nennen, nur, um Sie beide zu unterscheiden? Ihre Referenzen sind ausgezeichnet, wirklich bemerkenswert. Wie ich sehe, unterrichten Sie neben den üblichen Fächern auch Musik – Klavier, wie ich hoffe. In diesem Winkel hier gibt es nämlich keinen anständigen Haushalt ohne Klavier.«
Emilie beugte sich vor, um seinen Redefluss zu unterbrechen. »Klavier. Ja, wir beide geben Klavier- und Gesangsunterricht.«
»Wunderbar. Und Französisch, Redekunst, Tanz und Zeichnen.«
»Nein, Malerei. Meine Schwester gibt Zeichenunterricht.«
»Ja, natürlich. Sehr begabte Damen.«
»Vielen Dank, Mr. Penn«, entgegnete Ruth. »Aber ich wüsste gern, ob Sie irgendwelche Neuigkeiten für uns haben.«
»Noch nicht, doch ich hatte heute Morgen auch ausgesprochen viel zu tun.« Er schwafelte weiter, während die Kellnerin ihren Tee brachte, beschrieb in allen Einzelheiten die Schönheiten Brisbanes und wies sie auf einige der Familien hin, deren Bekanntschaft sie in nächster Zukunft machen würden, bis Ruth ihn erneut unterbrach.
»Aber Sie können uns nichts Definitives sagen?«
»Es ist noch zu früh dazu.«
Während sie ihren Tee tranken, stellte er zahlreiche Fragen. Mit wie vielen Kindern würden sie zurechtkommen? In welchem Alter? Wollten sie lieber in der Stadt oder auf dem Land leben? Wie sahen ihre Gehaltsvorstellungen aus? Emilie antwortete gewissenhaft, bis ihr klar wurde, dass er lediglich Zeit schinden wollte.
»Sie haben diese Informationen doch sicher bereits von der Gesellschaft erhalten, Mr. Penn?«
»Ja, aber es ist immer hilfreicher, es von den Bewerberinnen selbst zu erfahren, aus erster Hand sozusagen. Ich habe nur Ihr Bestes im Sinn, Miss Tissington.«
Müde sah Ruth zu, wie er sich den letzten Scone angelte. »Wir hatten eigentlich gehofft, Sie könnten uns heute Nachmittag einige Vorstellungsgespräche vermitteln. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie zurzeit keine freien Stellen für Gouvernanten anzubieten haben?«
»Ja, aber das ist nur vorübergehend, Miss Tissington. Die Angebote werden sicher bald kommen. Es wird sich herumsprechen, dass Sie in unserer schönen Stadt eingetroffen sind, dafür werde ich schon sorgen. Umgehend. Wo wohnen Sie übrigens?«
Sie gaben ihm ihre Adresse. Er nickte vielsagend. »Eine hervorragende Adresse. Mrs. Medlow ist eine angesehene Frau. Nun muss ich Sie leider verlassen, meine Damen. Die Pflicht ruft. Sie werden von mir hören. Genießen Sie Ihren kleinen Urlaub, bevor Ihre eigentlichen Pflichten beginnen.«
Sie sahen ihm nach, wie er an der Theke zahlte, einen ramponierten Zylinder ergriff und hinauseilte.
»So ein Angeber«, meinte Ruth fassungslos, bemerkte aber, wie verwirrt ihre Schwester wirkte, die offensichtlich zu dem gleichen Schluss gelangt war. »Ich hoffe, er strengt sich jetzt ein bisschen an.«
»Ruth, was sollen wir tun, wenn wir hier keine Arbeit finden? Fängt jetzt alles wieder von vorne an?«
»Natürlich nicht. Du hast doch gesehen, wie er auf deine Referenzen reagiert hat. Ich glaube nicht, dass es hier draußen so viele qualifizierte Damen gibt. Oh, ich muss ihm auch meine Referenzen geben, gleich morgen.«
Als sie das inzwischen überfüllte Café verlassen wollten, ertönte eine Glocke über der Tür, und die Kellnerin eilte hinter ihnen her.
»Meine Damen, Sie haben vergessen zu bezahlen.«
Ruth erstarrte. »Keineswegs. Der Herr hat bezahlt.«
»Mr. Penn? Oh, aber doch nur für sich selbst. Er wollte nicht, dass Sie seine Rechnung mitbegleichen müssen. Ich bekomme vier Shilling von Ihnen.«
Peinlich berührt, suchten sie die Münzen zusammen und eilten hastig davon.
Nach Büroschluss strengte Penn sich an diesem Nachmittag tatsächlich an. Die Tissington-Mädchen waren erstklassige Kundinnen, und er war sicher, dass er sie unterbringen und dafür eine höhere Vermittlungsgebühr berechnen könnte. Zunächst suchte er die Bar im Hotel Victoria auf, wo seine Neuigkeit zwar Interesse an den Damen selber weckte, sich aber keine Beschäftigungsmöglichkeit auftat. Doch es war noch nicht aller Tage Abend. Er ging auch in die Bushmen’s Bar im Hotel Royal, wo die reichen Viehzüchter abstiegen, doch das Ergebnis war das Gleiche. Unbeirrt beschloss er, seine Nachforschungen am nächsten Tag im Rennclub fortzusetzen. Samstags traf man dort nämlich gewöhnlich die wohlhabenden Gesellschaftslöwen an, die in Scharen zu den Rennen kamen. Sie würden die Neuigkeit schon verbreiten.
Emilie kaufte auf dem Heimweg eine Zeitung und freute sich schon auf die Nachrichten aus aller Welt, doch als sie sie aufschlug, fiel ihr Blick auf den Wochentag.
»Du lieber Himmel, heute ist Freitag! Wenn er bis morgen nichts für uns gefunden hat, müssen wir bis Montag auf die Vorstellungsgespräche warten. Wir sollten das Zimmer wohl doch besser für eine Woche nehmen.«
Die Pensionswirtin ließ sich darauf ein, betonte jedoch, damit hätten sie das Zimmer bis zum nächsten Freitag gebucht.
»Nein, bis Donnerstag«, widersprach Emilie entschlossen. »Wir sind gestern angekommen. Hier ist das Geld für den Rest der Woche.« Sie hatte aus der schwierigen Zeit in London gelernt, dass Barzahlung stets den Ausschlag gab, und auch diese Wirtin bildete da keine Ausnahme.
»Das ist höchst ungewöhnlich«, grollte sie, »aber ich muss mich wohl damit abfinden. Sie können übrigens ihr bisheriges Zimmer behalten.«
»Vielen Dank.«
»Erwarten Sie, noch länger zu bleiben?«
»Nein.«
»Haben Sie Freunde hier in Brisbane, Miss Tissington?«
»Selbstverständlich«, log Emilie zum Entsetzen ihrer Schwester.
»Warum hast du das gesagt? Sie kennt doch Mr. Penn und könnte von ihm die Wahrheit erfahren.«
Emilie zuckte die Achseln. »Und wenn schon? Dann soll sie eben nicht so neugierig sein.«
Mrs. Medlow sah den beiden nach, als sie in ihrem Zimmer verschwanden, und murmelte: »Zwei eingebildete Dämchen haben wir uns da eingehandelt.«
Sie betrachtete die säuberlichen Unterschriften in ihrem Gästebuch. Die größere mit den dunklen Haaren war Emilie, die ältere, rundlichere Ruth. Ruth wirkte sympathischer, doch im Grunde waren beide für ihren Geschmack zu überheblich. Gleichwohl brannte sie vor Neugierde. Die Kleider der beiden waren von guter Qualität, weite Röcke über dezenten Reifröcken, ganz nach der neuesten Mode, doch sie trugen keinerlei Schmuck. Einige ihrer Gäste hielten sie für Missionarinnen, doch Mr. Kemp hatte darüber nur gelacht.
»Die doch nicht. Viel zu hochnäsig. Eher Lehrerinnen, würde ich sagen.«
»Da irrst du dich«, sagte seine Frau. Nach ihrer Erfahrung waren Lehrerinnen alt, hässlich und unelegant, ganz anders als diese Mädchen. Allerdings wusste sie jetzt schon, dass sie sich über kurz oder lang von ihren unpraktischen weiten, mit Volants besetzten Krinolinen würden verabschieden müssen. »Ich halte sie für Damen der Gesellschaft, die auf eine der großen Schaffarmen im Westen weiterreisen, dahin, wo all die feinen Leute leben. Wir müssen unbedingt ihre Bekanntschaft machen.«
Am nächsten Morgen war sie allerdings anderer Meinung.
»Diese Mädchen!«, sagte sie aufgebracht zu ihm. »So etwas von unhöflich. Ich habe sie lediglich gefragt, ob sie spazieren gehen wollten, doch sie haben mich einfach nicht beachtet. Sind an mir vorbeigegangen, als wäre ich Luft. Was habe ich ihnen denn bloß getan?«
»Nichts, meine Liebe. Mir scheint, sie hatten den Kopf voll mit anderen Dingen. Wenn man Sorgen hat, wirkt man oft reserviert.«
»Tatsächlich?«
»Ja, in der Tat.«
Ruth und Emilie war noch nicht bewusst geworden, dass sie sich auf gewaltige Veränderungen im Umgang mit den Menschen hier einstellen mussten. Noch kannten sie nicht die Angewohnheit der Kolonialbewohner, Fremde einfach anzusprechen, und die Notwendigkeit, ihre Fragen höflich zu beantworten. Sie missbilligten die neugierige Annäherung dieser Frau, und ihre eigenen Anstandsregeln schrieben vor, sie nicht weiter zu beachten. Sobald sie aus der Tür waren, hatten sie sie auch schon vergessen.
»Hast du deine Referenzen mitgenommen?«, erkundigte sich Emilie. »Ja. Und diesmal werden wir die Angelegenheit in aller Form in seinem Büro besprechen. Schließlich hat er Miss Lewin wissen lassen, dass Anstellungen verfügbar seien.«
»Aber das ist doch schon Monate her.«
»Dennoch könnten einige dieser Posten noch frei sein. Vielleicht haben sie keine passenden Gouvernanten gefunden. Wir müssen den Burschen festnageln.«
An diesem Tag würde es jedoch keine Unterredung geben, denn sie fanden Penns Bürotür verschlossen, die Jalousien heruntergelassen, vor.
»Es ist Samstag«, meinte Emilie. »Offensichtlich hat er am Wochenende gar nicht geöffnet.«
»Das hätte er uns aber auch sagen können! Das zeigt doch nur, was für ein unzuverlässiger Patron er ist. Nun, am Montagmorgen werden wir als Erste hier sein.«
Die Sonne verbarg sich nun hinter einer niedrigen Wolkendecke, was der Hitze jedoch keinen Abbruch tat. Sie lastete wie eine Glocke über der Stadt, die Feuchtigkeit war allgegenwärtig. Ruth spürte, wie Schweiß zwischen ihren Brüsten hinunterlief, und sie fragte sich verärgert, wie Emilie nur so kühl wirken konnte. Das jüngere Mädchen schwitzte einfach weniger, und Ruth beneidete es um diesen Vorteil.
Sie seufzte. »Wir können ebenso gut in unser Zimmer zurückgehen.«
»Nein«, antwortete Emilie entschlossen. Ruth hatte bei jedem Rückschlag so reagiert, sowohl in London als auch auf dem Schiff, und Emilie war es allmählich leid, sich hinter verschlossenen Türen vor der Welt zu verkriechen.
»Was sollen wir denn sonst tun?«
»Wir könnten einen Spaziergang machen.«
»In dieser Hitze? Die Luftfeuchtigkeit nimmt mir den Atem.«
»Ich weiß, aber wir müssen uns ohnehin daran gewöhnen. So ist hier der Sommer eben.«
»Mag sein, aber deshalb müssen wir noch lange keine Risiken eingehen. Außerdem haben wir uns bereits gestern die Stadt angesehen.«
»Wenn du nicht mitkommen willst, dann geh zurück. Ich für mein Teil habe viel Zeit. Ich würde mir gern die Vororte anschauen.«
»Du kannst unmöglich allein in der Gegend umherwandern.«
»Um Himmels willen, früher oder später werden wir ohnehin getrennt irgendwo arbeiten. Ein Spaziergang kann nicht schaden, und ich lerne dabei wenigstens die Stadt kennen.«
Ruth wandte sich beleidigt ab. »Wie du meinst, aber sei vorsichtig. Verlauf dich nicht.«
Nachdem sie sich getrennt hatten, atmete Emilie erleichtert auf. Sie und Ruth verstanden sich gut, und die gemeinsame Notlage hatte ihre gegenseitige Zuneigung noch vertieft, doch Emilie war dieser erzwungenen Nähe schon lange überdrüssig. Sie stritten sich gelegentlich, doch das war nicht das eigentliche Problem; sie spürte, dass ihre Schwester sich mehr und mehr zurückzog und sie gegen ihren Willen mitzog, bis sie beinahe erstickte. Ihre Beziehung ließ sich durchaus mit der drückenden Hitze vergleichen, die sie als ebenso unangenehm empfand wie Ruth; doch anders als ihre Schwester suchte sie sich davon zu befreien, gedachte sie zu überwinden. Aufbrechen zu neuen Ufern. Sie wünschte sich, so weit von Ruth entfernt zu arbeiten, dass sie ihr eigenes Leben führen und unabhängig von ihr sein könnte. Sie ging die Hauptstraße entlang, von der sie inzwischen wusste, dass sie Queen Street hieß, fest entschlossen, zu ergründen, was an ihrem Ende und dahinter lag. Es tat so gut, einmal allein zu sein und überall hingehen zu können, ohne sich erst auf lange Diskussionen einlassen zu müssen.
Charles Lilley war nicht nur Justizminister, sondern auch Parlamentsabgeordneter für Fortitude Valley, einen Wahlbezirk am Fluss, der nur einen Steinwurf von dem verlässlicheren Wahlkreis Brisbane entfernt lag. Als er in die gesetzgebende Versammlung des Staates gewählt worden war, war er zunächst stolz gewesen auf das Vertrauen, das die Leute aus dem Valley ihm entgegenbrachten; doch in der Folgezeit hatte er einen schweren Kampf führen müssen, um im wechselvollen Spiel der öffentlichen Meinung seine Position zu wahren. Er stöhnte, während er mühsam einen goldenen Knopf in seinen gestärkten Kragen zwängte, den der verschwitzte Hals bereits aufzuweichen drohte. Früher war Fortitude Valley ein überaus eleganter Wohnbezirk gewesen, doch inzwischen hatten Ladenbesitzer, die im Geschäftsviertel von Brisbane nicht Fuß fassen konnten, die Hauptstraße für sich erobert. Auch Besitzer von Ställen, Sattlereien und kleinen Fabriken hatten die Vorteile dieses Stadtteils erkannt. Hinter ihnen zwängten sich die Häuschen der Arbeiter, drängten das sanft gewellte offene Weideland immer weiter zurück. Die Anwohner des Flusses blieben dennoch, weil sie ihre herrliche Aussicht, die kühlen Brisen und die prachtvollen Feigenbäume der Moreton Bay liebten, und wandten dem Menschengewimmel des Geschäftszentrums standhaft den Rücken zu. Es wimmelte nur so von Hotels und Spielhallen; geheimnisvolle Chinesen, als reiche Männer von den Goldfeldern zurückkehrend, stellten ihren Besitz nicht protzig zur Schau, sondern investierten ihr Geld lieber in unauffällige Wäschereien und schäbige Läden. Anrüchige Etablissements schoben sich dreist ans Tageslicht, siedelten sich gleich neben Tuchhändlern und Schneidern an. Sogenannte Damen beugten sich ungeniert über hohe Balkonbrüstungen und scherzten mit den welterfahrenen Seeleuten der Handelsschiffe, die ihnen begierige Blicke zuwarfen.
Und über diesen geldgierigen und eigensinnigen Mob herrschte also der hochwohlgeborene Charles Lilley. Er wünschte, er hätte einen Wahlkreis auf der anderen Seite von Brisbane übernommen, wo neue Vororte wie Paddington, Toowong oder Yeronga ein gesetztes, anständiges Bild boten, doch er hatte nun einmal Fortitude Valley gewonnen und war darauf sitzengeblieben. Auf brüllenden Arbeitern, die lieber rauften, als ihr tägliches Brot zu verdienen. Auf vornehmen Anwohnern, die es vorzogen, sich aus seinen Kämpfen gegen die sozialistischen Elemente herauszuhalten, die ihm ständig zusetzten. Zum Glück durften Frauen, Männer ohne Grundbesitz und junge Windhunde nicht wählen, obwohl man bei den öffentlichen Versammlungen, auf denen sie in Scharen auftauchten und alle möglichen Rechte, will heißen Geld, einforderten, einen anderen Eindruck gewinnen konnte. Charles war immer erstaunt über die Frauen, die mit den Männern dort hinkamen und ihn niederbrüllten, als sei dies eine Neuauflage der Französischen Revolution.
»Furchtbare Leute«, sagte er mit einem Blick in den Spiegel. Endlich saß der Kragenknopf.
Verlassen konnte er sich auf seine treuen Flussanwohner und seltsamerweise auch auf die Chinesen. Charles war entsetzt gewesen, als so viele von ihnen in seinen Wahlkreis geströmt waren, doch einige ältere Herren mit langen Zöpfen hatten sich mit ihm verabredet und ihn in Begleitung sich ständig verbeugender Mätressen aufgesucht, um einige Dinge klarzustellen.
Sie wollten keinen Ärger.
Sie waren, ungeachtet aller gegenteiligen Behauptungen, gesetzestreue Bürger.
Sie hatten bescheidene Häuser und Geschäfte erworben und strebten nicht nach Höherem. Er erfuhr, dass sie den Großteil ihres Vermögens an bedürftige Verwandte in China schickten.
Es wäre ihnen eine Ehre, wenn der große Sir sie als Gentlemen und Vertreter ehrenwerter Familien behandeln würde.
Und bei Gott, dachte er vor dem Spiegel, während er seinen Gehrock glattstrich und die Falten seiner schwarzen Krawatte ordnete, sie hatten recht. Wie viele Chinesen sitzen im Gefängnis? Nicht einer. Sieht aus, als würden sie sich selbst um ihre Schurken kümmern. Charles lief ein Schauer über den Rücken. Er zog es vor, nichts Näheres darüber zu erfahren, welche Methoden sie dabei anwandten. Dem äußeren Eindruck nach zu urteilen, waren sie echte Musterbürger, die Geld für seinen Wahlkampf spendeten und sich ansonsten um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten. Sie würde er nicht unter den Rowdys finden, die es sich mit Sicherheit wieder nicht nehmen ließen, bei der Versammlung heute Morgen aufzutauchen.
Sein Sekretär Daniel Bowles erwartete ihn bereits am Tor.
»Was machen Sie denn hier? Ich hatte doch gesagt, Sie sollten schon vorgehen und im Park nach dem Rechten sehen …«
»Da war ich ja auch, Sir. Das Podium steht schon. Macht einen soliden Eindruck.«
»Ich hoffe, es steht im Schatten.«
»Ja. Und ich habe die Flagge an den Baum hinter dem Rednerpult gehängt. Aber, Mr. Lilley, der Bürgermeister hat sich entschieden, nicht zu sprechen.«
»Wieso? Er sollte mich doch vorstellen. Das ist typisch für diesen Trottel, im letzten Augenblick zu kneifen. Erst gestern hat er mir fest versprochen zu kommen.«
Daniel schüttelte den Kopf. »Er war ja auch da, ist aber wieder gegangen. Eine große Menge hat sich versammelt, Mr. Lilley, und die Stimmung ist gar nicht gut. Der Bürgermeister hat mich gebeten, Ihnen zu raten, die Versammlung abzusagen.«
»Absagen? Nachdem eine Anzeige in der Lokalzeitung ausdrücklich darauf hinweist, dass ich um zehn Uhr heute Morgen eine Rede halten werde? Das kann ich nicht tun. So etwas hat es noch nie gegeben.«
Er setzte seinen schwarzen Zylinder auf und ging entschlossen die Straße hinauf.
Daniel eilte hinter seinem Boss her. »Mr. Lilley, nachdem ich diesen Mob gesehen habe, neige ich dazu, dem Bürgermeister zuzustimmen. Wie er schon sagte, Vorsicht ist besser als Nachsicht.«
»Vorsicht, so ein Unsinn! Er ist ein Drückeberger. Mir ist bewusst, dass die Leute guten Grund haben, besorgt zu sein, deshalb muss ich ja auch zu ihnen sprechen. Ich muss ihnen erklären, dass die momentane Arbeitslosigkeit nicht von Dauer sein wird.«
Wütend bog er um eine Ecke. »Es ist nicht unsere Schuld, dass diese verdammte Bank zusammengebrochen und der Regierungskredit damit geplatzt ist. Wir konnten unsere Arbeiter einfach nicht ausbezahlen. Doch wir sind dabei, einen neuen Kredit aufzunehmen, dann wird alles gut.« Er sah auf die goldene Taschenuhr, die er an einer Kette in der Westentasche trug. »Zehn vor zehn. Kommen Sie, Daniel, wir haben es eilig. Sie müssen mich vorstellen.«
»Ich? Ich bin kein Redner, Sir.«
»Jetzt schon.«
Die Menge verharrte in finsterem Schweigen, als Lilley mit seinem Sekretär den Park betrat, fröhlich den Zylinder zog und die mürrischen Zuschauer begrüßte. Zögerlich machten sie ihm Platz. Daniel machte im Augenblick jedoch seine ungewohnte Rolle größere Sorgen als die Feindseligkeit des Publikums.
Als er das Podium betrat, bemerkte er, dass Lilley eindringlich auf Joe Fogarty, einen Hafenarbeiter und Unruhestifter erster Güte, einsprach. Anscheinend nahm das Gespräch keine allzu hoffnungsvolle Wendung, da Fogarty jetzt brüllte und wild mit den Armen gestikulierte. Lilley ließ ihn schließlich mit einem Achselzucken stehen und kam zu seinem Sekretär herüber.
»Na los«, stieß er Daniel an. »Holen Sie tief Luft. Sprechen Sie mit lauter Stimme.«
»Was soll ich denn sagen?«
Daniel trat nervös nach vorn. Er hob die Arme zu einer Geste, die er sich bei den Politikern abgeschaut hatte. Dann warf er einen raschen Blick über die Menge und bemerkte voller Furcht, dass sich die Menschen sogar bis in die Seitenstraßen hineindrängten. Zumeist war es ärmliches Gesindel, schäbig gekleidet, aber nicht nur Arbeiter; auch Angestellte und Lehrer, von denen er einige erkannte, waren darunter, sogar Frauen. Das gab für ihn den Ausschlag bei der Wahl seines Tonfalls.
»Meine Damen und Herren«, schrie er mit schriller Stimme, »vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Heute findet hier eine wichtige Versammlung statt, wie Sie zweifellos alle wissen, und ich …«
»Wer bist denn du?«, brüllte jemand, und Daniels Vorstellung ging in dröhnendem Gelächter unter.
Eine Frau kreischte los: »Geh lieber nach Hause zu deiner Mama!«
Daniel errötete und umklammerte seinen Strohhut. Er sprach weiter, obwohl er inmitten des verächtlichen Gelächters kaum seine eigene Stimme hören konnte. »Es ist mir eine Ehre, Ihnen Mr. Charles Lilley, Mitglied der gesetzgebenden Versammlung für den Bundesstaat Queensland, vorstellen zu dürfen, und …« Endlich trat Lilley vor und rettete ihn.
Jetzt kehrte Ruhe ein. Er nickte Daniel zu, der sich rasch nach hinten verzog.
»Meine Damen und Herren, Ihre Regierung ist sich der derzeitigen Probleme durchaus bewusst …«
»Seit wann denn das?«, rief eine heisere Stimme, und andere stimmten ein, doch Lilley wartete geduldig ab, bis sich der Aufruhr ein wenig gelegt hatte.
»Ich bin gekommen, um mir anzuhören, was Sie zu sagen haben, und gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen zu suchen. Das ist aber nur möglich ohne die Agitatoren in Ihrer Mitte, die jeden vernünftigen Ansatz im Keim ersticken.«
»Dann kommen Sie uns mal mit Ihrer Vernunft«, dröhnte Fogarty. »Die Banken haben den Betrieb wieder aufgenommen. Warum dauert das so lange, bis die entlassenen Arbeiter wieder eingestellt werden?« Er schwenkte dankend die Mütze, als die Menge seine Frage mit stürmischem Beifall bedachte.
»So einfach ist das nicht. Wir beginnen bald mit den öffentlichen Bauarbeiten: neue Straßen, ein neues Hauptpostamt in der Queen Street …«
»Wann?«, rief jemand. Eine Gruppe von Männern mit harten Gesichtern hatte sich nach vorn gedrängt. Daniel gefielen ihre Mienen ganz und gar nicht, und er fragte sich, ob Mr. Lilley sie ebenfalls bemerkt hatte.
»Die Arbeiten befinden sich im Planungsstadium.«
»Die Leute verhungern, während Sie zum Pferderennen gehen«, schrie ein Mann aus dieser Gruppe. Als Lilley ihn darauf hinwies, dass er doch hier sei, konterte der Zwischenrufer: »Erzählen Sie doch keine Lügenmärchen! Sie gehen heute zum Rennen. Sie haben ein Pferd laufen, Lilley!«
Der Fremde kletterte auf das Podium, um sich im Rampenlicht zu sonnen. Damit verärgerte er Fogarty, der wohl vorgehabt hatte, die tobende Menge auf seine Seite zu bringen, indem er Lilley als Scharlatan, Großmaul und reichen Narren brandmarkte, der überhaupt keine Ahnung vom Los der Arbeiter habe.
Lilley brüllte zu Fogarty hinunter: »Wer ist dieser Kerl?«
Fogarty zuckte nur die Achseln. Die Versammlung geriet mehr und mehr außer Kontrolle; Männer drängten sich nach vorn, andere, die Plakate schwenkten, stießen von hinten nach.
Daniel bemerkte einen Reiter, der sein Pferd am Parkeingang angehalten hatte. Ein Zweiter kam hinzu, und beide betrachteten neugierig die Szene, ohne sich jedoch einzumischen. Fogarty murmelte wütend vor sich hin. Vermutlich hatte der Hafenarbeiter, dessen politische Ambitionen kein Geheimnis waren, ursprünglich vorgehabt, diese Gelegenheit dazu zu benutzen, die Aufmerksamkeit der Menge auf sich zu lenken und eine eigene Rede zu halten. Offensichtlich hatte er diesen Plan inzwischen aber aufgegeben, und Daniel wünschte, Lilley würde es ihm gleichtun. Doch sein Boss sprach immer noch, besser gesagt, er schrie wütend ins Publikum hinein.
Plötzlich schien ein Ruck durch die Menge zu gehen, und sie wälzte sich mit dem Ruf »Packt den Mistkerl!« nach vorn.
»Wir sollten ihn aufhängen!«
»Lyncht ihn!«, schrien andere und erstürmten das Podium.
Daniel sprang herunter und landete inmitten des Mobs, der die Tribüne umgab, blieb aber unbehelligt. Fogarty schrie nun auch, doch mit der Absicht, den Ansturm aufzuhalten; er zog die Männer von den Stufen hinunter, suchte sie zurückzuschieben. Lilley bekam dennoch einiges ab, da er inmitten der Menschenmasse gefangen war, die sich mit wildem Geschiebe um ihn drängte.
In diesem Augenblick galoppierte einer der Reiter tollkühn nach vorn, ohne sich um die Leute zu kümmern, die vor ihm und seinem Pferd in Deckung gingen. Er preschte direkt auf das Podium zu. Wenig später eilte ihm der zweite Reiter zu Hilfe. Er war jung, hoch gewachsen, hatte blondes Haar und schwang lachend seine Peitsche, während er sich ins Getümmel stürzte. Er schien sich prächtig zu amüsieren.
»Das ist nicht zum Lachen«, murmelte Daniel, der sich um Lilley sorgte. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er weggelaufen war, doch wie hätte er sich gegen die aufgebrachte Menge zur Wehr setzen sollen?
Der Parlamentsabgeordnete war außer sich vor Wut angesichts dieser Behandlung und schlug zurück, so gut er konnte. Er verteilte wilde Hiebe und bemerkte, wie sein Gehrock zerriss, als er sich mit Gewalt aus dem Griff der vielen Hände zu befreien suchte und mit seinen harten Lederstiefeln gegen ungeschützte Knöchel trat. Er fluchte und befahl seinen Angreifern, von ihm abzulassen, hörte die Rufe der Idioten, die ihn lynchen wollten, fürchtete sich aber weitaus mehr davor, zertrampelt zu werden. In letzter Sekunde wurde er gerettet, bevor ihn die schwitzende Menge, die von allen Seiten auf ihn eindrang, vom Podium zerren konnte.
Er erspähte einen rotbärtigen Reiter, der beinahe auf gleicher Höhe mit dem Mob neben ihm auftauchte, und hielt ihn zunächst für einen weiteren Vertreter dieses Gesindels, das ihn von unten her bedrohte. Doch der Bursche beugte sich vor, und als Lilley gefährlich nah an den Rand der Podiums geriet, spürte er plötzlich einen eisernen Griff am Arm.
»Steig auf, Kumpel!«, schrie der Mann und deutete auf sein Pferd.
Dieser Zwischenfall überraschte die Zuschauer und bot Lilley genügend Zeit, die Lage zu sondieren.
»Ganz sicher nicht!«, rief er zurück. Er hatte nicht vor, sich wie eine hilflose Maid von einem edlen Ritter retten zu lassen. Stattdessen sprang er in den sicheren Spalt zwischen Pferd und Podium hinunter und hielt sich an den Steigbügeln fest, bis er das Gleichgewicht wieder gewonnen hatte.
Das Pferd bewegte sich schon vorwärts und bot ihm Schutz, doch so leicht würde sich die Menge nicht abschütteln lassen. Sie wurden mit Dreckklumpen beworfen.
Dann hörte er das Knallen einer Viehpeitsche. Ein weiterer Reiter tauchte hinter ihm auf. Er sprang ab, drückte Lilley die Zügel in die Hand und verschwand in der Menge, bevor überhaupt jemand begriff, was geschehen war. Diesmal fügte sich Lilley, schwang sich in den Sattel und galoppierte durch die Menge, die den Pferden auswich, aus dem Park hinaus.
Sie ritten in eine ruhige Seitenstraße, wo Lilley sein Tier zügelte und sich an den ersten Reiter wandte.
»Ich habe Ihnen zu danken, Sir. Diese Schurken hätten mir echten Schaden zufügen können.«
»Wieso?«, wollte der Mann wissen.
»Politische Unruhen. Was man so Hungerrevolte nennt.«
»Verstehe. Ich dachte mir schon, dass Sie irgendwas mit Politik zu tun haben.«
»Ich bin Charles Lilley, der Abgeordnete dieses Bezirks. Ich wollte diesen Narren erklären …«
»Das sollten Sie nächstes Mal besser mit bewaffnetem Begleitschutz tun. Bin noch nie einem Politiker begegnet. Sehr erfreut.« Er schüttelte Lilley die Hand. »Wohnen Sie hier in der Gegend? Ich bringe Sie besser nach Hause. Sie versetzen ja die Damen in Angst und Schrecken, wenn Sie sich in diesem Zustand auf der Straße sehen lassen.«
Erst in diesem Moment wurde Lilley sich seines ramponierten Aussehens bewusst. Er hatte seinen Hut verloren, die Kleidung war schmutzig und zerrissen.
»O Gott! Ich habe auch meine Uhr verloren.«
»Dürfte einiges wert gewesen sein, was?«
»Eine Menge. Uhr und Kette sind aus Gold. Allerdings habe ich so daran gehangen, weil sie meinem verstorbenen Vater gehörte.«
»Hat keinen Sinn, danach zu suchen«, erwiderte der Fremde. »Dürfte inzwischen längst einen anderen Liebhaber gefunden haben. Damit kann man eine Menge hungriger Mäuler stopfen.«
»So eine Schande. Na ja, wir sollten weiterreiten. Wie heißt Ihr Freund? Ich möchte ihm ebenfalls danken.«
»Hab ihn nie zuvor gesehen. Noch ein halber Junge. Aber schlau. Schlau genug, sich schnell davonzumachen. War ganz schön flink mit der Viehpeitsche dabei.«
»Geschieht ihnen recht«, knurrte Lilley. »Aber was mache ich jetzt mit seinem Pferd?«
»Keine Sorge. Sie können damit nach Hause reiten, und ich nehme es mit zurück. Werd ihn schon noch finden.« Er warf einen Blick auf das kastanienbraune Tier mit der weißen Blesse. »Noch sehr jung und ebenso waghalsig wie sein Besitzer. Hat nicht vor der Menge zurückgescheut. Meine alte Stute hier war mal ein Viehpferd; die fürchten sich vor keinem Zweibeiner.«
Als sie das Tor zu Lilleys Haus erreichten, kam Daniel aus der entgegengesetzten Richtung angerannt.
Lilley hatte inzwischen seine Fassung wiedergewonnen. Er stieg ab und klopfte seinem Sekretär auf die Schulter. »Wenigstens sind Sie unbeschadet davongekommen. Haben Sie Geld bei sich?«
»Nur ungefähr zehn Shilling.«
»Das muss reichen. Geben Sie es bitte diesem Gentleman. Nur ein kleiner Lohn für seine Mühen.«
Daniel hoffte, dass dieser das Geld zurückweisen würde, da es schwierig war, von einem bedeutenden Mann wie Lilley, der etwas so Nebensächliches gewöhnlich vergaß, geborgtes Geld wiederzu-bekommen. Doch der Fremde erwies sich nicht als Gentleman; er nahm die zehn Shilling an, ergriff das andere Pferd am Zügel, wünschte den beiden Männern einen guten Tag und ritt davon.
James McPherson war mit seinem Tagewerk zufrieden. Er hatte sich zehn Shilling verdient und ein gutes Pferd noch dazu.
Um sich zu orientieren, hielt sich Emilie immer links vom Fluss, den sie nur gelegentlich zwischen ungerodeten Grundstücken erspähen konnte. Es schien keine Spazierwege an seinem Ufer zu geben. Nachdem sie die Stadtmitte hinter sich gelassen hatte, waren die Bürgersteige verschwunden, und so hielt sie sich am äußersten Rand der sandigen Straßen, der Schatten und Sicherheit bot. Die wenigen Reiter und Wagen jagten seltsam rasch an ihr vorbei, ganz im Gegensatz zur üblichen Sonntagsruhe. Sie war erst einige Blocks weit gegangen, als ein junger Mann auf sie zugerannt kam, als werde er verfolgt; doch außer ihm war niemand zu sehen. Als er sie erreichte, blieb er stehen und blickte sich keuchend um, dann sprach er sie an.
»Da lang würd ich nicht gehen, Miss. Im Park tobt der Mob, und die werden sicher bald auch die Straßen unsicher machen.«
»Wie bitte?«
Er grinste. »Nur ein gut gemeinter Vorschlag, Miss. Ein Umweg wäre angebracht.«
Emilie starrte ihn ungläubig an. Er mochte ja recht haben, aber deswegen gleich einen Umweg machen? Welchen Weg sollte sie denn da nehmen? Sie war verwirrt.
»Kommen Sie, ich begleite Sie zurück bis zur nächsten Ecke.«