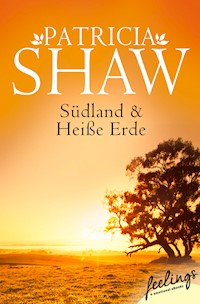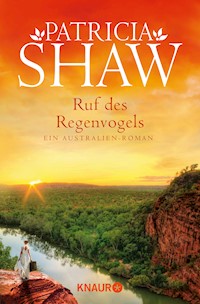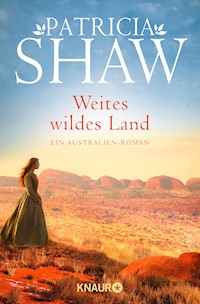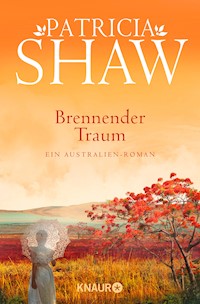6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eine Saga aus dem Tal der Lagunen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Australien 1878: Drei ungleiche Brüder entbrannt im Streit um das Familienerbe. Zwei verfeindete Völker im Kampf um Recht und Eigentum. Ein weites Land, das Blutvergießen am Horizont aufsteigen lässt … Patricia Shaw at her best: ein Australien-Epos voller Gefahren, heimlicher Leidenschaften und falscher Versprechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 936
Ähnliche
Patricia Shaw
Im Tal der Mangobäume
Roman
Aus dem Englischen von Margarete Längsfeld und Heidi Lichtblau
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Prolog
1884
Sie war etwa neunzehn Jahre alt, eine magere, sehnige Frau mit drahtigem, schwarzem Haar, das aus dem kantigen Gesicht zurückgebunden war, und sie hatte einen Säugling auf dem Rücken. Sie trug ein zerlumptes Hemd, eine staubige Latzhose und einen Fransenschal, jedoch keine Stiefel – das übliche bunte Sammelsurium einer Ureinwohnerin, die es in die Welt der Weißen verschlagen hatte.
Ungeachtet ihres eigentümlichen Aufzugs, näherte sie sich den drei Reitern mit einem Selbstvertrauen, das diese erschreckte, auch wenn ihre Stimme freundlich war.
»Du Boss hier, ja?«, wandte sie sich an Paul.
Er blickte zu ihr hinunter, erstaunt über den Gleichmut in ihren dunklen Augen. Ihm war, als wäre ihm plötzlich eine gütige Macht begegnet.
»Was willst du?«, stammelte er.
»Onkel hier finden!« Sie wies in die Richtung des Schwarzenlagers, das unweit der westlichen Grenze der Mango-Hill-Station lag. »Alter Mann, Guringja sein Name.«
»He, Boss! Schauen Sie mal«, rief Sam und griff nach seinem Gewehr, »da drüben!«
»Ach du lieber Himmel!«, stieß Noah, der andere Viehhüter, hervor.
Auf einer erhöhten Felskante, kaum einen Steinwurf von ihnen entfernt, stand ein hünenhafter Aborigine-Krieger in vollem Ornat. Sein Haar war aufgetürmt und mit Kakadufedern geschmückt. Auf sein rabenschwarzes Gesicht, in dessen Nase ein Knochen steckte, waren weiße Striche gemalt und von seinen Kinnbacken standen schwarze Haarbüschel ab. Wie um seinen Knochenbau hervorzuheben, war sein athletischer Körper ebenfalls weiß bemalt, und er trug Schmuck aus weißen Federn um die Knöchel.
»Nur die Ruhe«, murmelte Paul und blickte argwöhnisch auf den langen Speer, den der Schwarze herausfordernd in den Boden gerammt hatte. Er wandte sich an die Frau: »Wer ist das?«
»Das mein Mann«, erklärte sie mit stolz glänzenden Augen. »Hat mich gebracht. Wegen sicher.«
Paul furchte die Stirn. Keiner der Schwarzen auf seinem Besitz gebärdete sich feindselig, und in einem Aufzug wie dieser Bursche marschierten sie schon gar nicht herum. Diese Zeiten waren längst vorbei.
»Geh!«, befahl er. »Ich kann euch hier nicht brauchen. Ihr gehört nicht zu unseren Leuten. Geh zu deinem eigenen Volk zurück und nimm ihn mit.« Er nickte mit dem Kopf in Richtung des Ehemanns.
Die Frau malte mit dem Zeh einen Bogen in den Staub und musterte ihn einige Minuten, als überlege sie, was sie als Nächstes tun solle.
Sam streichelte sein Gewehr. »Boss, wollen Sie, dass ich dem großen Burschen Beine mache?«
Die Frau sah zu Paul. »Mein Mann nun gehen. Mich langen Weg bringen.«
»Gut. Und du begleitest ihn. Hier kannst du nicht bleiben.«
Sie schien ihn nicht gehört zu haben. Sie hievte das Kind ein Stückchen höher und schickte sich an, den Weg zum Gut hochzulaufen.
Paul starrte unsicher zu dem Ehemann, der sie beobachtete, und dann wieder zu der Frau.
»Moment!«, rief er. »Komm zurück! Ich hab’s dir doch gesagt. Du gehörst hier nicht her. Von welchem Volk stammst du?«
»Kalkadoon!«, erwiderte sie hoch erhobenen Hauptes.
»Nie gehört.«
»Doch, haben Sie«, erinnerte ihn Noah. »Das ist der Stamm, von dem Paul gesprochen hat. Sie kommen aus dem Hinterland. Und sorgen für jede Menge Ärger. Glauben Sie, die kommen jetzt hier entlang?«
»Bitte? Eine zweiköpfige Armee? Nun mal halb lang!« Paul rief der Frau hinterher: »Du kommst jetzt zurück! Du und dein Mann, ihr verschwindet! Hörst du?«
Sie wandte sich um und blickte ihn an. Über ihre schmutzigen Wangen liefen Tränen. »Er fort, Boss.«
Ihre Traurigkeit verwirrte Paul. Plötzlich bäumte sich sein Pferd auf und erschreckte die anderen Pferde, so dass diese zurückwichen und zusammenstießen. Während er sein Tier wieder unter Kontrolle zu bringen versuchte, sah er, wie der alte Guringja mit Hilfe eines kräftigen Stocks und seiner beiden Frauen unsicher den Pfad hinunterkam.
»Der große Kerl hat sich verzogen.« Sam zügelte sein Pferd. »Ich sehe mal lieber zu, dass ich ihn wieder einfange.«
»Er fort«, beharrte die Frau. Sie rannte zu Guringja und redete in ihrer eigenen Sprache auf ihn ein.
»Was sagt sie da, Sadie?«, fragte Paul eine von Guringjas Frauen. Sadie zuckte die Achseln. »Kenn diese Sprache nicht.«
Schließlich erklärte Guringja: »Sie Kalkadoon. Heißt Wiradji. Meine Mama Kalkadoon, deshalb sie verwandt mit mir. Große Schwierigkeiten da, von wo sie kommt, darum sie hier mit Baby.«
»Und was ist mit ihrem Mann?«, wollte Paul wissen. »Der hat hier nichts verloren.«
Guringjas Blick wurde ausdruckslos. »Kein Mann, Boss.«
»Jetzt lass den Unsinn. Er lauert irgendwo da drüben. Sie weiß, dass er hier ist.«
»Ah! Das niemand, Boss. Niemand.«
»Sie hat gesagt, er ist ihr Ehemann«, knurrte Sam ihn an. »Ich habe es selbst gehört.«
Paul wandte sich an Sadie. »Du hast ihn doch gesehen, als ihr hierher gelaufen seid, oder? Du musst ihn doch …«
Sie schüttelte den Kopf und stapfte zu der Frau hinüber. »Wo ist dein Mann?«
»Er weggegangen«, erwiderte Wiradji traurig.
»Wohin?«, wollte Paul wissen, aber Guringja packte Sadie am Arm. Er flüsterte ihr etwas zu, und sie erbleichte.
»Mr.Paul«, sagte sie leise. »Besser, wir nehmen sie zum Lager, ja?«
»Erst, wenn ich weiß, wohin ihr Mann verschwunden ist! Ich will nicht, dass er hier herumlungert!«
Sadie seufzte und ging zu Paul hinüber. Sie tätschelte sanft sein Pferd und sprach so leise, dass er sich zu ihr hinunterbeugen musste, um sie zu verstehen.
»Kein Ehemann hier. Er gekämpft in großem Krieg. Wurde getötet. Für sie schwierige Zeit.«
»Bitte? Was für ein Blödsinn! Er war hier! Wir haben ihn gesehen!«
Sadie senkte den Blick und rieb sich den Nacken, offensichtlich darauf erpicht, das Thema fallenzulassen.
Automatisch kratzte Paul sich ebenfalls am Nacken, womöglich aus demselben Grund. Die Haare dort pieksten wie Nadeln, und er erschauerte. Einen Augenblick lang war er völlig ratlos.
Noah rutschte nervös auf seinem Sattel herum. »Versuchen die uns weiszumachen, der schwarze Bursche wäre gar nicht da gewesen?«
»Nein«, entgegnete Paul. »Das ist nur ihr übliches doppelzüngiges Gerede.«
»Wo ist er überhaupt hin?«
»Was weiß ich!«, erwiderte Paul gereizt. »Plötzlich war er weg. Sagt mir Bescheid, wenn er sich noch mal blicken lässt.«
Er nickte in Richtung der kleinen Gruppe von Aborigines. »Na dann! Bringt sie nach oben in euer Lager. Sie sieht aus, als bräuchte sie dringend was in den Magen.«
Die drei Männer ritten davon, und Sam lachte. »Wenn Noah diesen Ehemann je wieder zu Gesicht kriegt, gibt er garantiert Fersengeld!«
»Und was ist mit dir?«, fragte Paul.
Sam zuckte mit den Schultern. »Mit mir? Ich habe niemanden gesehen.«
Kapitel 1
Brisbane, 1878
Von dem Ereignis angelockt, standen an diesem schwülheißen Vormittag Scharen Schaulustiger geduldig vor der St.-Stephen’s-Kathedrale und atmeten die von Frangipaniwolken geschwängerte Luft ein. Für gewöhnlich hätten die butterweißen Blüten einen zarteren Duft verströmt, doch der vormals niedrige Baum neben dem Kirchenportal war zu einem großen und herrlichen Exemplar herangewachsen und wirkte in seiner Fülle von zierlichen Blüten nun fast schon vulgär. Die Bewohner des frisch zur Stadt gekürten Brisbane waren stolz auf den Baum, wie auch auf die hohen Palmen, die prächtigen purpurroten Jacarandas und die mächtigen Moreton-Bay-Feigenbäume, die ihre Straßen beschatteten. Und das, obwohl die Natur in dieser subtropischen Lage fast ein bisschen »zu viel« war, wie vornehme Neuankömmlinge hinter ihren Fächern zu sagen pflegten und sich damit von den früheren Siedlern abzusetzen versuchten, denen die Gegend als die berüchtigte Moreton-Bay-Strafkolonie bekannt gewesen war.
Nun ja. Nicht gerade die respektabelste Gründung. Doch nachdem diese Einrichtung geschlossen und der Ort in »Brisbane« umbenannt worden war, gewann er allmählich an Ansehen.
Die Straßen waren in einer Richtung nach englischen Königen, in der anderen nach englischen Königinnen benannt worden: Elizabeth Street – die mit der Kathedrale aufwarten konnte –, Charlotte Street und so fort. Entlang dem Ufer des breiten Flusses war ein botanischer Garten entstanden, und stolze öffentliche Gebäude, wie das Parlament und das stattliche Museum, sorgten für einen würdigen Anstrich.
Schon immer hatte die Elite der australischen Kolonien aus den reichen Siedlern bestanden, die früh genug hergekommen waren, um noch riesige Gebiete für die Schafzucht an sich reißen zu können. In Brisbane trat jedoch eine weitere mächtige Gruppe in Erscheinung: die Rinderzüchter, die mit ihren Herden nordwärts in die wilde und weitgehend unerforschte Kolonie Queensland vordrangen.
Nach Schätzungen der Seefahrer, die stets auf der Hut vor den Riffen an den Ufern dieser Kolonie waren, belief sich die Länge der Küste auf mehr als dreitausend Meilen. Das Land dahinter war unbekannt, bis der deutsche Forschungsreisende Leichhardt von ausgedehnten Ebenen berichtete, die durch eine Reihe schöner Flüsse üppig bewässert wurden.
»Ein Land des Überflusses, und im Überfluss für alle«, lautete die Parole, und schon drängte man landeinwärts, wo die Entdeckung, dass die Eigentümer dieser fruchtbaren Weiden nicht zu weichen bereit waren und sich mit äußerster Brutalität gegen die Eindringlinge wehrten, ihnen unvermittelt Einhalt gebot.
Doch die ehrgeizigen weißen Siedler wähnten sich im Recht.
»Hier gibt es weder Häuser noch Städte«, erklärten sie. »Niemand wohnt hier, weshalb es uns freisteht, das Land in Besitz zu nehmen.«
Darauf hingewiesen, dass hier Menschen wohnten, Aborigines, versetzten sie: »Von wegen! Das sind nur Nomaden. Es gibt keine Grenzen und weit und breit kein Dorf.«
Besagtes Flussgebiet war der Treffpunkt dreier Völker, der Udangi, Jagaro und Jukame, sowie der jeweiligen Stämme. In ihren Augen waren die Grenzen der Völker völlig eindeutig, und diesbezügliche Gesetze mussten respektiert werden. Kein vernünftiger Mensch betrat ohne Einladung oder Erlaubnis das Territorium eines anderen. So etwas war äußerst gefährlich und konnte schlimme Auswirkungen haben. Diese Gesetze galten auch, als die Weißen plötzlich auftauchten. Es kam zu Racheakten.
Dennoch drangen die Weißen mitsamt ihren erstaunlichen Waffen weiter ein. Sie machten das Land einfach nur »zugänglich«.
Die Aborigines hatten dafür einen anderen Begriff. Sie nannten es Krieg.
Vor gar nicht langer Zeit war der Widerstandsheld der Aborigines, Dundalli, unweit der Kathedrale – vor dem Hauptpostamt, um genau zu sein – gehängt worden. Aus Rache töteten die Schwarzen Captain Logan, den Kommandanten der Strafkolonie. Was in den Augen der Strafgefangenen, die unter seiner harten Knute gelitten und ihn für ein wahres Ungeheuer gehalten hatten, durchaus etwas für sich hatte.
Dann bewegte sich der Krieg mit der Welle der Siedler weiter nach Norden und Westen und geriet in Brisbane weitgehend in Vergessenheit. Milly Forrest jedoch, die sich mit ihrer Tochter Lucy Mae in der Zuschauermenge vor der Kirche befand, rückte er sehr wohl ins Bewusstsein. Sie waren hier, um am Trauergottesdienst für ihre liebe Freundin Dolour Rivadavia teilzunehmen.
Bei der Erinnerung an Dolours ersten Mann, Pace MacNamara, der hoch im Norden von Schwarzen getötet worden war, tupfte Milly, eine gefühlsselige Frau, sich die Augen. Wie lange ihre Freundschaft doch zurückreichte, dachte sie traurig. Pace war mit demselben Schiff in die Kolonie gekommen wie Milly und ihr verstorbener Ehemann Dermott. Damals waren sie alle drei jung gewesen und begierig auf ein neues Leben.
Sie schluchzte verhalten auf. Alle hatten sie Erfolg gehabt. Ausgerechnet in der Viehzucht. Zunächst als Farmverwalter, dann mit eigenem Besitz. Zu Beginn war das Leben im Outback für ein kleines englisches Mädchen wie Milly allerdings äußerst hart gewesen. Schließlich war sie nie über die Vororte Manchesters hinausgekommen, bis ihr geliebter Dermott ihr Herz im Sturm erobert und sie in diese fremde Welt entführt hatte.
Es war Dolour, eine energische Irin, die sie gelehrt hatte, die Ellenbogen zu gebrauchen, erinnerte sich Milly. Und Dolour war es auch, die zur Stelle war, als sie und Dermott in Bedrängnis geraten waren. Gerade mal zwei Jahre zuvor, als alles so gut lief, als sie sich in ihrem entzückenden Haus mit Blick auf den Fluss zur Ruhe gesetzt hatten, war Dermott an Diphtherie erkrankt und hatte innerhalb kurzer Zeit sein Leben ausgehaucht.
Milly seufzte. Noch immer hatte sie diesen Schicksalsschlag nicht verwunden. Und dann war Lucy Maes Ehemann, dieser Halunke Bartling, bei einem Schiffsunglück vor Fraser Island ums Leben gekommen. Wahrlich kein Verlust, wohingegen sie bei der Nachricht, dass Dolour am gefürchteten Krebs erkrankt sei und im Sterben liege, am Boden zerstört gewesen war.
»Sollten wir nicht besser hineingehen?«, fragte Lucy Mae.
»Noch nicht«, zischte Milly. Sie wollte noch weitere Ankömmlinge in Augenschein nehmen. Saß man erst einmal vorn auf der Kirchenbank der Familie, mit dem Rücken zur Gemeinde, bekam man kaum noch etwas mit.
Juan Rivadavia war ein einflussreicher Bürger geworden. Der argentinische Viehzüchter war vor vielen Jahren hergekommen und hatte umgehend Grund und Boden erworben. Milly hatte immer etwas für ihn übrig gehabt – zweifelsohne war er überaus charmant –, dennoch hatte es sie überrascht, als Dolour ihn so bald nach Pace’ Tod geheiratet hatte.
»Wer ist das denn?«, fragte Lucy Mae, als eine Kutsche vor der Kirche hielt und ihr eine junge Frau, die statt eines Hutes einen schwarzen Spitzenschleier trug, entstieg.
»Dolours Stieftochter Rosa«, erwiderte Milly. Ringsum drängten die Leute nach vorn, um einen besseren Blick auf den Liebling der Gesellschaftsseiten, auf denen sie ungeachtet ihrer argentinischen Herkunft oft als »die spanische Schönheit« betitelt wurde, zu haben. »Und das ist ihr Mann, Charlie Palliser. Ein berühmter Chirurg.«
Lucy Mae seufzte. »Was für ein schönes Kleid. So elegant!«
»Importiert!«, bemerkte ihre Mutter und warf einen Blick auf Lucy Maes Garderobe. »Du könntest mal wieder etwas neues Schwarzes gebrauchen. Dieses Kleid ist dir zu weit. Bringt deine Formen gar nicht zur Geltung.«
»Seit Russ’ Tod habe ich abgenommen.«
»Macht nichts, das steht dir. Morgen gehen wir einkaufen.«
Milly beobachtete, wie Rosa Palliser eine Frangipaniblüte pflückte, an ihr schnupperte und sie dann wieder fortwarf, ehe sie mit ihrem Mann die Kirche betrat.
»Typisch!«, schnaubte sie.
»Was denn?«
»Ach, nichts. Du meine Güte, da kommt Juan!«
Milly verfolgte, wie Rivadavia mit gesenktem Kopf und ohne jemanden eines Blickes zu würdigen die Treppe hinaufeilte. Er sah müde und abgespannt aus, fand sie, jedoch genauso charmant und gutaussehend wie immer. Eines, dachte sie lächelnd, musste man Dolour lassen: Sie hatte sich zwei der bestaussehenden Männer ihrer Zeit geangelt. Dabei war sie doch nur ein kleines irisches Sträflingsmädchen gewesen. Das wussten die wenigsten, auch wenn es Dolour nicht gestört hätte. Sie war, weiß Gott, immer ihren eigenen Weg gegangen!
Erneut kam in der Menge Bewegung auf, als die reichverzierte Kutsche des Gouverneurs eintraf. Einer der livrierten Lakaien sprang hinab und stellte einen Schemel vor die Tür, um sodann dem Gouverneur, dem Marquis von Normanby, und seiner Gattin herauszuhelfen.
Jemand klatschte und wurde von der Marquise auf ihrem kurzen Weg zur Kirche mit einem finsteren Blick bedacht. Ihr Gatte, von dessen puterrotem Gesicht unter dem großen, mit Federn geschmückten Hut Schweiß troff, scheuchte sie vorwärts, aber das Interesse hatte sich ohnehin schon auf einen Herrn verlagert, der über die Straße gestürmt kam.
»Habe dir doch gesagt, dass heute alles von Rang und Namen da sein wird.« Milly stupste ihre Tochter an, als sich der Premierminister von Queensland näherte und den glücklichen Leuten in der ersten Reihe die Hände schüttelte. Bei Milly angekommen, blieb er stehen.
»Du meine Güte! Sie sind’s, Mrs.Forrest! Was tun Sie denn hier draußen in der Hitze?«
»Äh, ich warte, Mr.Palmer«, stammelte Milly. »Es ist so schwierig. Die vielen Menschen … Wir wollten soeben … Kennen Sie meine Tochter Lucy Mae?«
»Aber gewiss doch! Mrs.Bartling! Nun kommen Sie, meine Damen. Ich begleite Sie persönlich hinein.«
Genau in diesem Augenblick trafen die MacNamaras, John Pace und Paul, mit ihren Familien und etlichen Freunden ein und waren im Nu von Leuten umringt, die sie bekümmert begrüßen wollten. Schließlich bewegten sie sich langsam in die duftgeschwängerte Düsterkeit der Kirche, einschließlich des Premierministers, Sir Arthur Palmer, mit Lucy Mae am Arm.
Damit war es mit Millys Fassung dahin. Denn nun sah sie den Sarg, bedeckt mit Kränzen und flankiert von Kerzenständern. Das war zu viel für sie. Das war Dolour! Ihre beste Freundin!
Sie brach in Tränen aus, schluchzte hemmungslos und stolperte dabei in die Arme eines in der Nähe stehenden Herrn. Und als sie nun Duke MacNamara erkannte, Dolours jüngsten Sohn, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten war, weinte sie noch mehr.
Der Chor stimmte »Glaube unserer Väter …« an.
»Oh! Verzeih, Duke«, stieß Milly hervor. »Vielleicht gehe ich besser hinaus. Ich sorge hier nur für Unruhe.«
»Nein, Milly, schon gut. Wir stehen einander bei. Würdest du mit mir zusammen den Gang hinuntergehen? Mutter würde das bestimmt gefallen.«
Bei seinen Worten hätte Milly beinahe wieder aufgeschluchzt, doch sie holte tief Luft und fasste sich. Duke bot ihr den Arm.
Als Milly sich umwandte, sah sie, wie noch mehr Leute in die Kirche strömten und sich in den Seitenflügeln verteilten, und dann entdeckte sie im Licht der offenen Tür, ganz flüchtig, die Silhouette einer vertrauten Gestalt.
Als sie erkannte, wer das war, wäre Milly Forrest beinahe gestolpert.
»Gütiger Gott!«, stieß sie hervor und lehnte sich schwer an Duke.
»Ist dir nicht gut?«, fragte er.
»Doch, doch«, erwiderte sie verlegen. Mittlerweile besaß sie das, was man gemeinhin als stattliche Figur bezeichnete. Kein Leichtgewicht. »Danke, Duke.«
Während sie sich setzten, wagte sie es nicht, sich zur Vergewisserung noch einmal umzudrehen. Die Kirche war ohnehin brechend voll. Und im Grunde war es auch unnötig. Sie wusste auch so, wer es war. Was für eine Unverschämtheit! Heselwood! Der verflixte Lord Heselwood!
Die durch ein Buntglasfenster hereinströmende Sonne schien sich die Augen Charlie Pallisers als Ziel ausgesucht zu haben, der mit seiner Frau, seinem Vater und seinem Schwiegervater Juan Rivadavia in der ersten Reihe saß. Sicher versuchte seine Mutter selig, ihn absichtlich zu blenden, dachte er gereizt, denn wie er seinen Kopf auch hielt, er entkam den Strahlen einfach nicht. Wohl die Strafe, dass er sich mit Ausländern eingelassen hatte. Infolge ihrer völlig unbegründeten Angst vor Fremden war sie, als er seinen Eltern mitgeteilt hatte, er wolle die Tochter Juan Rivadavias heiraten, völlig außer sich geraten.
»Diese Ausländerin!«, hatte sie entsetzt geschrien.
Sein Vater Duncan hatte sie mit dem Hinweis, Rosa sei eigentlich nur eine halbe Ausländerin, da ihre Mutter eine englische Adelige sei, etwas besänftigen können. Es brauchte jedoch Zeit und viel gutes Zureden, ehe Dora Palliser Miss Rivadavia empfing, und das auch nur aus sicherer Entfernung zu ihrem Gast auf einem Stuhl am anderen Raumende. Glücklicherweise hatte Rosas Charme Charlie durch diese nervenaufreibende Begegnung geholfen. Das Einzige, was man Dora in dieser Angelegenheit zugutehalten konnte, überlegte Charlie blinzelnd, war, dass sie sich schließlich immerhin bereit erklärt hatte, die auserwählte Braut ihres jüngsten Sohnes zu dulden.
Die Diskussion mit seiner Mutter war allerdings nicht halb so traumatisch gewesen wie die Reaktion seines Vaters, als Charlie ihm eröffnet hatte, er wolle an der Universität in Sydney Medizin studieren. Damals wohnte er noch zu Hause auf ihrer Hauptfarm am Darling River, und zunächst hatte Duncan nicht begriffen. Er war ein rauher Mann vom Land, der das Viehgeschäft von der Pike auf gelernt hatte, indem er – mit einem Pferd und einem Gewehr als einziger Habe – jahrelang als Viehhüter auf einem Besitz im Outback gearbeitet hatte. Aber er liebte das Leben und die täglichen Herausforderungen der Farmarbeit.
»Ich weiß nicht, woher du die Zeit dafür nehmen willst«, hatte er entgegnet. »Du bist jetzt sechzehn. Ich warte darauf, dass du mit der Schule fertig wirst. Ich möchte, dass du dann die Blackbutt-Farm leitest. Dieser Idiot von Verwalter verliert zu viel Vieh im Busch, und deinem Bruder fehlt die Zeit, ihn sich vorzuknöpfen. Du kannst ein paar Viehhüter mit hinausnehmen, ihn vor die Tür setzen und eine Musterung durchführen. Finde heraus, was da läuft. Ich wette, der Schweinehund verkauft sie selbst!«
»Du möchtest, dass ich da draußen bleibe?«
»Ja, natürlich, hörst du schlecht? Ich habe gesagt, ich möchte, dass du sie leitest, und nicht, dass du kurz dort auftauchst, einmal das Vieh durchzählst und wieder verschwindest.«
Mit Schaudern erinnerte sich Charlie an den väterlichen Ausbruch, als er erwidert hatte, dass er sich bereits in Sydney am Medizinkolleg eingeschrieben habe.
Seine Mutter war herbeigerannt gekommen. »Was schreit ihr denn hier so herum?«
»Charlie!«, brüllte sein Vater. »Es ist alles deine Schuld! Du hast ihm die Flausen in den Kopf gesetzt. Hast ihn auf diese feine Schule geschickt. Nun sieh ihn dir an! Will wieder zurück und lernen, wie man Quacksalber wird. Er hat nichts gegen das Geld, das die Farmen abwerfen, ja? Aber er will keinen Finger rühren, um etwas dazu beizutragen!«
Sie versuchte, ihn zu beschwichtigen. »Ich finde, wir sollten uns das durch den Kopf gehen lassen. Schlaf ein paarmal darüber.«
»Das ist überhaupt nicht nötig!«, wütete Duncan. »Ich weiß, was hinter der ganzen Sache steckt, erzählt mir nichts! Er hat was gegen Arbeit. Wieso kann er sich nicht anstrengen wie Langley? Und wie ich? Ich habe mein ganzes Leben hart arbeiten müssen und bin froh darüber, in der Welt weiterzukommen. Er dagegen hält immer nur die Hand auf …«
»Also, Duncan, das stimmt nicht, und das weißt du auch«, erwiderte sie. Aber während er seinen Eltern zuhörte, wurde Duncan klar, dass sein Vater nicht ganz unrecht hatte. Das Leben auf einer Rinderfarm war Knochenarbeit, tagaus, tagein. Ihre Farmen waren so riesig, dass die Männer etliche Nächte in der Woche im Freien übernachten mussten, um das Gebiet abzudecken. Sobald sein Vater ihn für kräftig genug gehalten hatte, um mit einem Hütepferd umzugehen, war Charlie oft mit ihnen unterwegs gewesen, und als Jugendlicher hatte er das sehr genossen. Doch der Reiz des Neuen war durch die Hitze, den Staub, die erstaunlich kalten Nächte im Freien und auch durch den fast ungenießbaren Lagereintopf bald verflogen.
Langley hatte immer auf seinen jüngeren Bruder achtgegeben, und auch diesmal ließ er ihn nicht im Stich. Er erklärte, Charlie habe ein Recht darauf, zu machen, was er wolle. Schließlich war es jedoch seine Mutter, die Duncan besänftigen konnte und sogar vorschlug, dass Charlie, sobald er seine Ausbildung abgeschlossen habe und Arzt sei, zurückkommen und aushelfen könne. Ihre Schlüsse verblüfften Charlie. Sie schien sich einzubilden, sein ärztliches Wissen käme auch Tieren zugute. Er ließ sie in dem Glauben, und zu seiner Belustigung nannte sie ihn von seinem ersten Tag am Medizinkolleg an Dr.Palliser.
»Na, schön.« Duncan zuckte mit den Achseln. »Rosa wird nach Rivadavias Tod eine Reihe von Rinderfarmen besitzen. Und wenn ich mal ins Gras beiße, du auch. Ich schätze, ihr beide werdet alles verkaufen, und unsere ganze Schinderei war für die Katz.«
»Jetzt fang nicht wieder damit an. Du solltest dich freuen. Du wirst Enkelkinder haben, die das Ruder übernehmen. Und überhaupt, Rosa mag seine einzige Tochter sein, aber er hat drei Stiefsöhne, und die sind auch im Viehgeschäft.«
»Und wer soll das sein?«
»Die MacNamaras.«
»Woher?«
»Von Kooramin und von Oberon oben im Norden. Weitere Güter haben sie auch noch, glaube ich.«
»Du meinst doch nicht etwa Pace MacNamaras Söhne?«
»Doch, glaube schon. Juan hat seine Witwe geheiratet.«
»Allmächtiger Gott! Richtig! Nun hör mir mal gut zu, Charlie. Du setzt dich da in ein Hornissennest. Pace hatte Feinde. Er ist seinerzeit ein paar einflussreichen Leuten in die Quere gekommen. Ich hab ihn gekannt. Kein schlechter Kerl, immer auf der Jagd nach Land, aber er hat sein Glück herausgefordert. Ist zu früh zu weit vorgedrungen. Rivadavia hat dir vermutlich davon erzählt.«
An den selbstgefällig hochgezogenen Augenbrauen des Vaters konnte Charlie ablesen, dass er vom Gegenteil ausging.
»Warum sollte er? War doch nicht wichtig, worum auch immer es sich gehandelt hat.«
»Vielleicht nicht«, erwiderte Duncan. »Ich rate dir dennoch, dir das Ganze noch einmal gründlich durch den Kopf gehen zu lassen. Lernt euch zuerst besser kennen. Es eilt ja nicht, oder?«
»Nein, außer dass ich sie liebe und sie mich.«
Duncan stopfte seine Pfeife. »Und du glaubst nicht, dass sie für unsereins die Nase ein bisschen zu hoch tragen könnte?«
Charlie packte die Wut. »Wie meinst du das?«
»Ich kann lesen. Ich sehe sie in den Zeitschriften. Sie sitzt gern auf dem hohen Ross, gib’s zu. Ist ständig irgendwo unterwegs. Zu unseren Zeiten war dein Bild nur in der Zeitung, wenn du entweder gewöhnlich oder kriminell warst.«
»Herrgott noch mal! Und was kommt als Nächstes? Ich gehe. Und komme wieder, wenn du besser gelaunt bist.«
Der Trauergottesdienst, eine Requiemmesse, zog sich endlos hin. Die Kirche glich einem Dampfbad und Charlies steifer Kragen spannte. Rosa an seiner Seite fächelte sich Luft zu, und auf seiner anderen Seite bereute Duncan vermutlich seine liebenswürdige Entscheidung, am Gottesdienst teilzunehmen – es war das zweite Mal, dass er St. Stephen’s mit seiner Gegenwart beehrte.
Die Gemeinde erhob sich, entgegen Charlies Hoffnung jedoch nicht, um zu gehen, sondern um nach weiteren Gebeten ein gemütvolles Kirchenlied anzustimmen.
»Mir ist nicht wohl«, flüsterte Rosa ihm zu. »Ich muss an die frische Luft.«
Er drückte ihr die Hand. »Ich komme mit.«
»Nein, nein, nicht nötig!«
»Bist du sicher, dass du zurechtkommst?«
»Aber ja.«
Sie küsste ihn auf die Wange und schlüpfte zur Seitentür hinaus. Charlie kam in den Sinn, dass sie schwanger sein könnte, und er summte mit frohem Herzen das Lied mit.
Draußen stützte Rosa sich an der kühlen Steinmauer ab, um sich einige Minuten zu fassen, und spürte erleichtert, wie ihr Kopf sich klärte.
Mit einem Seufzer begab sie sich auf einen beschatteten Weg zur Vorderseite der Kirche. Die Messe war nun fast vorüber, bald würden alle herausströmen, und es würden weitere Tränen fließen.
Rosa hatte Dolour gemocht, mehr sogar als ihre eigene Mutter Delia, die mit dem Klima und dem Farmleben hier in Australien nicht zurechtgekommen war. Die englische Adelige hatte Juan verlassen und war mitsamt Rosa in die Heimat zurückgekehrt. Aber ihr hatte man es schon immer schwer recht machen können, sie war entschlossen, unglücklich zu sein. Ihre Briefe an Juan waren eine einzige Litanei an Klagen. Schließlich hatte sie geschrieben, man könne nicht erwarten, dass sie allein eine Zehnjährige aufziehe – obgleich Juan dafür gesorgt hatte, dass sie ein wunderschönes Haus in Kensington beziehen konnte und es ihr an nichts fehlte.
Rosa litt noch immer an Angstanfällen, die von dem Tag herrührten, als sie ihre Mutter zur Haushälterin sagen hörte, sie könne es nicht länger ertragen, dass dieses entsetzliche Kind im Haus herumstreiche.
»Dafür geht es mir einfach nicht gut genug«, hatte Delia erklärt. »Ich bin eine zartbesaitete Person, wie man einfach sehen muss. Lärm jeglicher Art ist mir ein Graus. Ich schicke Rosa zu ihrem Vater. Und Sie, Sie bringen sie hin.«
»Wohin, Madam?«, erkundigte sich die Frau ängstlich.
»Nach Argentinien natürlich!«
»O, nein, Madam, das geht unmöglich!«, kreischte die Frau. »Ich weiß ja nicht einmal, wo das liegt!«
Sie zog sich die Schürze über den Kopf und stürzte aus dem Zimmer. Rosa wünschte, sie könne das auch, denn sie war vor Demütigung tiefrot angelaufen. Sie spähte in das Boudoir der Mutter, das sie immer geliebt hatte: ein Regenbogenzimmer aus bunten Satinkissen verschiedenster Art, die überall herumlagen, auf dem Bett, der Chaiselongue, dem großen, weichen Sessel, hoch aufgehäuft auf dem Fensterplatz und sogar einfach wahllos auf den Boden geworfen.
Delia saß an ihrer Frisierkommode, das lange, braune Haar offen über die Schultern gebürstet.
»Was willst du?«, rief sie.
Rosa machte ein finsteres Gesicht. Das Betreten des Raumes war ihr nicht gestattet, weshalb sie zurückrief: »Ich will nicht nach Argentinien!«
»Natürlich nicht. Bockig wie immer!«
»Wie lange müsste ich dort bleiben?«
Delia winkte mit einer weiß behandschuhten Hand. »Ich weiß es nicht. Das liegt an deinem Vater.«
»Und was, wenn er mich auch nicht möchte?«
»Dann schickt er dich vermutlich zurück.« Delia gähnte. »Himmel noch mal, hör auf, mich so auszufragen. Sag dieser Frau, dass ich jetzt meinen Tee möchte und dazu ein gekochtes Ei.«
»Welcher Frau?« Häufig rächte sich Rosa an ihrer Mutter, indem sie vorgab, ihre vagen Anweisungen nicht zu verstehen.
»Na, der Person, die gerade gegangen ist.«
»Welcher Person?«
»Oh, einfach irgendeiner, Dummchen!«
»Ich sehe nach, ob ich eine finden kann.«
Sie unternahm keinen Versuch, es der Haushälterin auszurichten. Ihrer Mutter fehle nichts, hatte der Arzt gesagt.
»Sie bleibt zu viel im Bett, Rosa. Du solltest sie ermutigen, aufzustehen und spazieren zu gehen. Ansonsten versteifen ihre Gelenke.«
Rosa entschied, dass sich das Problem leicht lösen ließe.
»Wir hungern sie einfach aus«, informierte sie den Koch, der ihr keine Beachtung schenkte. Die Haushälterin ebenso wenig.
Der Plan, Rosa mit dem Schiff nach Argentinien zu schicken, schien vergessen, und so besuchte sie weiterhin das St. Mary’s College gleich gegenüber, bis sie, eine Woche nach ihrem zwölften Geburtstag, bei ihrer Heimkehr ihren Vater im Salon antraf.
Sie kannte diesen Mann mit der sanften Stimme, den dunklen Augen und dem blendenden Lächeln kaum, folglich setzte sie sich mit einem mulmigen Gefühl auf eine Stuhlkante, beantwortete seine höflichen Fragen und wünschte, er würde gehen. Doch da kam ihre Mutter, angetan mit einem raschelnden grauen Spitzenkleid mit einer kurzen Schleppe und einem schönen Hut, der mit grauem Georgette bedeckt war, hereingerauscht. Sie sah fantastisch aus!
»Gehst du aus?«, fragte Rosa ungläubig. Zu den seltenen Gelegenheiten, an denen Delia tatsächlich einmal das Haus verließ, hüllte sie sich ihrer Anfälligkeit wegen in Mäntel und Schals.
»Ja.«
»Noch nicht«, versetzte ihr Mann. »Nimm Platz, Delia.«
»Ich stehe lieber«, erwiderte diese hochmütig.
»Und ich möchte, dass du dich hinsetzt, also sei so gut.«
Schmollend ließ Delia sich auf dem nächsten Stuhl nieder, und zwar kerzengerade, ohne stützende Kissen. Rosa wünschte, der Arzt könnte sie so sehen.
»Du möchtest zu mir kommen und bei mir wohnen, verstehe ich das richtig?«, fragte ihr Vater.
Rosa saß stumm und mit roten Wangen da. Hatte Delia gelogen? Das war ihr durchaus zuzutrauen. Aber wollte ihr Vater sie denn bei sich haben? Allzu begeistert klang er nicht. Ihre Miene verdüsterte sich.
»Ich kann kein Spanisch.«
»In den australischen Kolonien wird Englisch gesprochen.«
»Ich dachte, du würdest in Argentinien leben?«
Er warf Delia einen gereizten Blick zu und schüttelte den Kopf. »Ich komme zwar ursprünglich aus Argentinien und wir haben in diesem Land auch Familie und Besitz. Aber zu Hause bin ich auf der Rosario-Farm, nördlich von Brisbane.«
»Rosario?«, rief Rosa entzückt. »Hast du dein Haus nach mir benannt?«
»Mehr als ein Haus«, schnaubte Delia. »Das Ganze hat die Größe einer Grafschaft. Einer großen, leeren Grafschaft!«
»Ja, das habe ich. Nun gehen deine Mutter und ich zum Tee an den Grosvenor Square, der, so habe ich mir sagen lassen, sehr schön sein soll. Wenn du Lust hättest mitzukommen, könnten wir uns dort weiter unterhalten.«
»Zum Grosvenor?«, rief Rosa. »Sehr gern sogar!«
»Unmöglich, sie hat nichts zum Anziehen«, wandte Delia ein und zog ihre Handschuhe glatt.
»Wie bitte?« Juan klang verärgert, und Rosa wich auf ihrem Stuhl zurück. Aber Delia erhob sich.
»Wie schon gesagt, sie hat nichts anzuziehen, und sie ist zu jung.«
Ihr Vater schien Delia keinen Glauben zu schenken. Er wandte sich an Rosa. »Hast du denn kein hübsches Sommerkleid und einen Hut?«
»Nein.«
»Dann gehen wir eben erst morgen dorthin.«
»Kommt nicht in Frage!«, schrie Delia.
»Wir gehen morgen«, wiederholte er. »Ich bin gleich in der Früh da, Rosa, und dann machen wir ein paar Einkäufe, damit du uns begleiten kannst.«
»Morgen könnte ich einen schlechten Tag haben«, wandte Delia ein.
»Dann bleib zu Hause«, gab er wütend zurück. »Ich kann es nicht glauben, dass meine Tochter keine standesgemäße Garderobe besitzt. Verzeih, Rosa, dass ich es zugelassen habe, dass es dazu kam. Passt es dir morgen um zehn?«
»Ja«, hauchte sie glückselig.
Als Juan am nächsten Morgen Punkt zehn Uhr eintraf, blieb Delia im Bett, doch das kümmerte ihn nicht. Er fuhr mit seiner Tochter zu vornehmen Läden in der Bond Street und kaufte ihr schachtelweise Hüte und Kleider, die allesamt zu einer wartenden Kutsche gebracht wurden.
Rosa schwieg schüchtern, als auch noch Reisegarderobe zu den Einkäufen hinzukam. Offensichtlich stand für Juan bereits fest, dass sie mit ihm zurückkehren würde, aber sie war derart überwältigt von all den Kleidern, dass sie sich nur zu gern dazu bereit erklärte. Nicht, dass sie gefragt worden wäre.
An diesem Nachmittag trug sie ein weißes Empire-Kleid aus Schweizer Baumwolle mit rosa Besatz und eine leichte Damenhaube aus Stroh, die mit den wenigen rosa Rosen unter der Krempe in ihren Augen reichlich schlicht aussah, die die Dame in dem Laden jedoch für perfekt erklärt hatte. Juan hatte ihr zugestimmt.
Delia, die bei der Anlieferung der ganzen Einkäufe in Wut geraten war, meinte, für so etwas sei das Kind noch zu jung. Rosa war sich unsicher, wer recht hatte, doch eigentlich kümmerte sie es auch nicht. Sie war so glücklich, dass sie zum vornehmen Nachmittagstee an den Grosvenor Square ausgeführt würde!
Widersprüchlich wie immer, warf Delia Juan schließlich vor, ihr Rosa wegnehmen zu wollen, indem er sie mit billigem Putz besteche.
»Die Sachen waren nicht billig, Mutter, glaub mir«, flüsterte Rosa.
»Sei still, du törichtes Ding.«
»Es reicht, Delia«, mahnte ihr Mann leise. »Benimm dich. Du gibst dem Kind ein schlechtes Vorbild. Man streitet sich nicht in der Öffentlichkeit.«
»Dann gehe ich zu meinem Anwalt«, entgegnete Delia. »Streite dich doch mit dem herum!«
Rosa sah, wie in seinen Augen erneut Zorn aufglomm, und bemerkte fasziniert, dass dieser nette, höfliche Mann seine Frau nicht leiden konnte. Rosa konnte es ihm nicht verdenken. Ihre Mutter war eine echte Nervensäge. Sie fragte sich, warum er sie überhaupt geheiratet hatte. Ihres guten Aussehens wegen, nahm sie an. Leute, die Delia von ihrer besten Seite kennenlernten, waren stets von ihr bezaubert.
Ohne sich um Delias Androhung bezüglich des Anwalts zu kümmern, bot er Rosa ruhig die silberne Kuchenetagere an.
»Hast du mich gehört?«, hakte Delia nach.
»Ja, meine Liebe. Mach, was du willst.«
Als wäre die Anwaltsgeschichte ein Bluff gewesen, schien Delia nach diesen Worten in sich zusammenzusinken, und sie tat Rosa ein wenig leid.
Die Schrankkoffer waren gepackt. Rosas Anstandsdame und Erzieherin, eine junge Witwe namens Lark Pilgrim, die bereit war, mit ihnen zu reisen, war ins Haus gezogen. Delia, die behauptete, Lark sei die Hure ihres Mannes, der Rosa als Ausrede benutze, um mit dieser Frau zu reisen, blieb auf ihrem Zimmer.
Die Haushälterin war peinlich berührt. Sie erklärte Lark, ihre Herrin könne sie nicht empfangen, weil sie die bevorstehende Abreise der Tochter so belaste.
Rosa wusste nicht, wie sie sich in dieser Situation verhalten sollte. Zum ersten Mal hatte sie das Wort »Hure« ausgesprochen gehört, und der Schock kam einer Ohrfeige gleich. Ob das wahr sein könnte? War Lark die Geliebte ihres Vaters?
Schließlich fragte sie die Haushälterin, die entgegnete: »Ganz gewiss nicht!«
Rosa musste sich für den Abreisetag wappnen. Wie erwartet, war Delia an diesem Morgen hysterisch, rannte in ihrem Morgenmantel herum, weinte und schrie an der Haustür. Obgleich sie derlei Anfälle schon kannte und ihr klar war, dass ihre Mutter zur Teezeit darüber hinweg sein würde, weinte Rosa auch: vor Schuldgefühlen über ihre große Freude, sich mit dem angebeteten Vater zu diesem großen Abenteuer aufmachen zu dürfen.
Was Lark betraf, so ging sie, sobald sie an Bord waren, glücklich und entspannt mit Rosa um. Obwohl bildhübsch, war sie ihrem Arbeitgeber gegenüber jedoch entsetzlich schüchtern, was Rosa, die die beiden nicht aus den Augen ließ, ihre Frage beantwortete.
Lark nahm ihre Mahlzeiten in der Suite ein, die sie zusammen mit Rosa bewohnte, da die einzige andere Möglichkeit die undenkbare zweite Klasse gewesen wäre. Aber sie begleitete Rosa an Deck, nahm an Spielen und anderem Zeitvertreib teil.
Sechs Wochen sind jedoch eine lange Zeit. Binnen einer Woche bemühten sich mehrere Herren um Larks Bekanntschaft, und schon bald tanzten etliche Verehrer nach ihrer Pfeife. Rosa fand das amüsant, bis ihr auffiel, dass auch ihr Vater trotz zur Schau getragener Gleichgültigkeit sich zunehmend für Lark interessierte.
Bis das Schiff in Brisbane anlegte, hatten die beiden eindeutig eine Affäre, ein Ausdruck, den Rosa an Bord gelernt hatte. Und zu ihrem Erstaunen nahm ihr Vater im Victoria Hotel in der Queen Street zwei Zimmer, wobei eines für Lark und ihn bestimmt war!
Nun marschierte sie zur Eingangsseite der Kirche, setzte sich im lichten Schatten eines Gummibaums auf eine Bank und schüttelte in Gedanken an diese Unverfrorenheit den Kopf. Typisch ihr Vater. In so vieler Hinsicht kultiviert, aber gegenüber seiner Tochter streng und altmodisch. Und das hatte über die Jahre zu einigen fürchterlichen Auseinandersetzungen geführt.
Sie sah, wie ein Herr aus der Kirche trat und stehenblieb, um sich seinen Hut wieder aufzusetzen. Er war großgewachsen und sah vornehm aus, makellos gekleidet – sein dunkler Anzug hatte einen Londoner Schnitt –, und doch war sein Gesicht leicht wettergegerbt. Vermutlich einer der Viehzüchterfreunde ihres Vaters.
Als er an ihr vorbeikam, lüpfte er den Hut. »Mrs.Palliser!«, grüßte er. Sie glaubte, er wolle sich mit ihr unterhalten, doch er ging weiter.
Sie beobachtete, wie er – in kerzengerader Haltung, hoch erhobenen Hauptes, fast schon arrogant – die Treppe hinunterging und die Straße überquerte. Doch dann kamen andere Trauergäste aus der Kirche, und darüber vergaß sie ihn. Sie erinnerte sich wieder an Dolour und ihre eigene Mutter.
Rosa war dreizehn und lebte mit ihrem Vater auf der Rosario-Farm, als ihr Juan mitteilte, ihre Mutter sei ums Leben gekommen. Von einem Brauereiwagen überfahren, als sie versuchte, eine belebte Straße in London zu überqueren. Erst nach Monaten trafen sie in London ein und konnten die von Delia so geliebten weißen Rosen an ihr Grab legen. Nur sie beide. Und es war Rosa unwirklich vorgekommen. Ihr schien es, als wäre ihre Mutter einfach auf ihre vage Art in den Himmel entschwebt und hätte den zarten Duft der Rosen zurückgelassen. Delias kleiner Gedenkgottesdienst war um so vieles besser gewesen als diese Massenansammlung bei Dolours Begräbnis, zumal die Tortur am Grab noch bevorstand. Und danach dann der Leichenschmaus, der auf Juans Beharren hin in seinem Haus in Brisbane stattfinden sollte, wo er und Dolour bei ihren seltenen Stadtaufenthalten gewohnt hatten. Dolour hätte den Busch vorgezogen.
Charlie kam an ihre Seite geeilt. »Alles in Ordnung mit dir, Schatz?«
»Ja. Können wir jetzt gehen?«
»O nein. Ich bin einer der Sargträger. Es geht dir doch gut?«
Er eilte davon, und Rosa saß da und harrte aus. Die hässliche schwarze Trauerkutsche mit Glasfenstern wartete ebenfalls. Geduldig. Schicksalhaft.
Ein paar Leute kamen aus der Kirche, und Rosa erhob sich, als ihr Vater an der Spitze der Sargträger die Eingangstreppen hinunterschritt.
Ein paar Lausbuben huschten um sie herum, um einen besseren Blick auf diese seltsame Prozession zu haben, und wurden von dem Leichenbestatter fortgejagt, als der Sarg in der Trauerkutsche untergebracht wurde. Sein Gehilfe streute Blumen darüber, und die Sargträger zogen sich unsicher zurück.
Erneut erschien Charlie an ihrer Seite.
»Gott sei Dank ist es überstanden«, sagte sie. »Gehen wir!«
»Das geht doch nicht. Wir müssen deinem Vater beistehen.«
Sein eigener Vater, groß und kantig wie der Sohn, stand hinter ihm. Achselzuckend sah er Rosa an, als wolle er sagen: »Bedaure. Da kommst du nicht aus.«
Rosa seufzte und gestattete Charlie, sie zu Juan auf den Hauptweg zu bringen, wo Freunde – und Fremde, wie sie bemerkte – den Hinterbliebenen ihr Beileid aussprechen konnten.
Einer nach dem anderen und Paar für Paar kamen sie, einige mit von der Hitze gerötetem Gesicht, einige, die sich Tränen wegtupften und versuchten, das Richtige zu sagen, und alle erzählten sie von Dolour, dieser prächtigen Frau. Die Farmer schüttelten Juan einfach wortlos die Hand und nickten dem Paar an seiner Seite zu.
Während die Schlange der Kondolierenden langsam an ihnen vorbeizog, konnte Rosa die Seelenqualen des Vaters spüren.
»Das ist doch barbarisch«, flüsterte sie ihm zu. »Komm. Wir müssen jetzt gehen.«
»Wir können noch nicht«, erwiderte er mit gepresster Stimme. »Sir Samuel …«
Sie folgte seinem Blick und sah zu ihrem Ärger den Gouverneur und seine Gattin, die in aller Seelenruhe beim Eingang ein angeregtes Gespräch mit dem Priester führten.
»Geh und sag ihnen, dass wir gern bald aufbrechen würden«, bat sie Charlie.
»Das kann ich unmöglich tun.«
»Ich schon!«, ließ sich eine Stimme hinter ihr vernehmen, und sie beobachtete erfreut, wie ihr Stiefbruder Duke MacNamara zum Gouverneur marschierte und ein paar Worte mit ihm wechselte.
»Ah ja«, meinte dieser, schüttelte dem Priester rasch die Hand und eilte mit seiner Frau herbei.
Die Nachzügler in der Schlange machten dem bedeutenden Paar Platz, das sein Beileid bekundete und sich dann entfernte, so dass der Priester Juans Aufmerksamkeit auf sich lenken konnte.
»Danke, Duke«, meinte Rosa. »Ich freue mich, dich wiederzusehen. Noch immer draußen auf Kooramin?«
»Schon, aber bald geht es nordwärts.« Er grinste. »Verflixt, Rosa, mal wieder schön wie der junge Tag! Aber du warst schon immer eine Augenweide. Dabei bist du nun eine alte Ehefrau!«
Sie stupste ihn mit ihrem Fächer. »Ich bin gerade mal zwei Jahre älter als du, vergiss das nicht.«
Sie wurden von Mrs.Forrest unterbrochen, die sich inzwischen zu ihnen gesellt hatte.
»Du musst nun um die vierundzwanzig sein, nicht wahr, Duke?«, meinte sie. »Wann läuten denn die Hochzeitsglocken?«
»Jetzt, da Rosa nicht mehr zu haben ist, vermutlich nie«, sagte er grinsend und drehte sich zu der Frau hinter ihm um. »Kann ich deine Mutter nun deinen tüchtigen Händen überlassen, Lucy Mae? Das war eine ganz schöne Tortur für sie.«
»Natürlich«, nickte Lucy Mae.
Aus den Augenwinkeln sah Rosa, dass John Pace MacNamara zu ihr herübersah, und wandte sich rasch ab.
»Ich gehe jetzt nach Hause«, erklärte sie Charlie.
»Wir müssen zum Friedhof!«
»Ich muss ins Haus zurück und mich um die Verköstigung der Gäste kümmern«, schwindelte sie. »Ich sage Juan, dass du ihn begleitest.«
»Aber du musst doch mitkommen. Du kannst nicht einfach …«
»Das geht schon«, schaltete Mrs.Forrest sich ein. »Es wird nicht unbedingt erwartet, dass Frauen nach dem Gottesdienst noch mit zum Grab gehen.«
Rosa schenkte der lieben alten Dame ein Lächeln und eilte mit dem Wissen davon, dass Milly das vermutlich erfunden hatte. Wenn sie nicht gerade auf der Jagd nach dem neuesten Klatsch war, konnte sie zuweilen wirklich hilfreich sein.
John Pace sah, wie Palliser eine Pferdedroschke für Rosa herbeirief, ihr hineinhalf und anschließend dem Fahrer die Adresse gab. Dann ging er zurück zu Rivadavia, der blass und verwirrt aussah.
Das mindeste, was sie tun könnte, wäre, ihrem Vater zur Seite zu stehen, dachte er wütend, aber das war typisch Rosa, selbstsüchtig wie eh und je. War es etwa zu viel verlangt von der verwöhntesten Frau auf Gottes Erden, Dolour zu ihrer letzten Ruhestätte zu begleiten, auch wenn sie nur ihre Stiefmutter gewesen war? Nur!, dachte er. Dolour hatte Rosa geliebt wie ihr eigenes Kind. Sie hatte solche Freude an ihr gehabt.
»Welch schöne Abwechslung«, hatte sie ihre Söhne geneckt, »nach all den trampelnden Jungen ein liebes, süßes Mädchen im Haus zu haben.«
Als Dolour Rivadavia geheiratet hatte, war er mit ihr und Rosa nach Argentinien gereist, um sie seiner Familie vorzustellen. Er hatte auch den jungen Duke dazu eingeladen, doch der hatte rundweg abgelehnt und es vorgezogen, mit seinen Brüdern auf der Kooramin-Farm zu bleiben. Allen, erinnerte sich John Pace, war bei dem Gedanken noch immer unbehaglich zumute, dass ihre Mutter nur sechs Monate nach dem Tod – der Ermordung – ihres Vaters beschlossen hatte, erneut zu heiraten. Und noch dazu seinen besten Freund!
Jedermann hatte seine Meinung zu den Hintergründen ihrer Entscheidung, aber Dolour hatte sich nie dazu geäußert. Außer natürlich, nahm er an, vor Rivadavia. Manche meinten, es sei des Geldes wegen. Paul, sein Zwillingsbruder, behauptete, sie wolle es Pace heimzahlen, dass er aus purer Landgier ins Tal des Todes geritten sei. Was zu Dolours irischer Logik gepasst hätte. Sie und ihr Vater hatten viel gestritten, bis, wie Pace gern lachend erzählte, »sie mich fragte, was ich aus Liebe zu ihr zu tun bereit sei. Und ich habe ihr die richtige Antwort gegeben.«
Für John Pace selbst war es offensichtlich, dass Dolour Rivadavia liebte, obgleich sie es nie tatsächlich aussprach, und sie ihn vielleicht brauchte, um sie von all den traurigen Erinnerungen abzulenken.
Welchen Beweggrund sie auch hatte, eines stand außer Frage: Rivadavia betete Dolour an. Milly Forrest behauptete, er habe sie schon immer geliebt, von ihrer ersten Begegnung an, als sie mit Pace verheiratet war.
Ein Jahr darauf kamen sie aus Argentinien zurück, wohnten in der im spanischen Stil erbauten Villa mit einem Ballsaal, die er in den Anhöhen mit Blick auf die Stadt hatte bauen lassen, und Dolour freute sich über Rosas Gesellschaft, da Juans Viehhandel ihn oft weit fort führte. Rosa ihrerseits war glücklich, endlich in der Stadt zu wohnen, und noch dazu in einem Haus, das für Geselligkeiten wie geschaffen war.
John Pace erinnerte sich an das Fest zu Rosas achtzehntem Geburtstag, das in dem Ballsaal veranstaltet wurde, ein glänzender Abend und für ihn unvergesslich, weil er Rosas offizieller Begleiter gewesen war. Wie hatte er über Paul triumphiert, der gehofft hatte, sie würde ihn fragen!
Er hatte sie an diesem Abend geküsst und gemerkt, dass er völlig verrückt nach ihr war. Stillschweigend war er davon ausgegangen, dass sie von nun an ein Paar waren. Wie konnte man so schiefliegen?, dachte er zornig.
»Kommst du?«, rief seine Frau ihm zu. Das holte ihn rasch in die Gegenwart zurück, und er fühlte sich nun noch elender als in der Kirche, wo er am Sarg seiner Mutter hatte sitzen müssen.
»Kannst du nicht eine Minute warten?«, fuhr er sie an. »Wir fahren in der zweiten Kutsche zusammen mit Paul und Laura zum Friedhof.«
»Laura kommt nicht mit, wir passen also noch bei Juan und Charlie mit rein.«
Er hatte weder den Wunsch, sich eine Kutsche mit Rivadavia, noch, sich eine mit Rosas Mann zu teilen.
»Eileen«, sagte er fest. »Wir nehmen die zweite Kutsche. Ich bin heute lieber mit der eigenen Familie unterwegs, wenn’s recht ist.«
»Oh, mach doch, was du willst!«, schnaubte sie. Er hatte sie immer damit aufgezogen, dass sie ein gesellschaftlicher Emporkömmling sei, aber an diesem Tag hatte er genug.
»Wo ist Duke?«, fragte er.
»Der wollte auch nicht mit Rivadavia einsteigen! Er ist in Mrs.Forrests schicker Kutsche mitgefahren. Ist sie denn nachher noch mit ins Haus eingeladen?«
»Keine Ahnung«, stöhnte er, der sich vor der Beerdigung seiner Mutter fürchtete und sich fragte, wie er sich ohne Aufhebens vom Leichenschmaus entfernen konnte.
Ihm fiel ein, dass er vom nächsten Tag an tun und lassen konnte, was er wollte, was Rivadavia anging. Er war nicht länger verpflichtet, Dolour zuliebe auf seine Launen einzugehen. Fortan konnte man alles wieder aus dem Blickwinkel der geliebten Eltern betrachten, Pace und Dolour. Und nicht aus dem des Mannes, der bei Pace war, als er von Wilden ermordet wurde.
Laura MacNamara entfernte sich unauffällig von den Trauernden und marschierte so schnell sie konnte die Straße entlang. Aber anstatt an der nächsten Ecke zum Victoria Hotel einzubiegen, in dem sich die meisten der angereisten Trauergäste einquartiert hatten, lief sie bis zur William Street weiter.
Ihr fürsorglicher Gatte hatte erklärt, es sei eigentlich nicht notwendig, dass sie mit auf den Friedhof komme, da sie Dolour ohnehin kaum gekannt habe und ihr die meisten Trauergäste fremd seien. »Und du brauchst mich auch sicher nicht an deiner Seite?«, hatte sie gefragt.
»Schatz, nein. Ich bin im Moment wie betäubt. Ich möchte dir den Rest ersparen.« Dolour selbst hatte Beerdigungen nicht ausstehen können. Sie hatte sie »öffentliches Händedrücken« genannt. Der Gedenkgottesdienst für seinen Vater war wunderschön gewesen. Es gab nur fünf Trauernde: seine drei Söhne, John Pace’ Frau Eileen und Dolour. »Du ruhst dich aus, und wir treffen uns dann später im Haus von Rivadavia. Oder möchtest du, dass ich vorbeikomme und dich abhole?«
Sie lächelte. »Nein. Ich komme zurecht. Keine Bange.«
Laura stammte aus Rockhampton, das mehr als hundert Meilen nördlich von Brisbane lag. Ihr Vater, ein Parlamentsmitglied, war vor einiger Zeit gestorben, nur ein paar Jahre nachdem das offizielle Parlamentsgebäude errichtet worden war. Nun wollte sie sich dieses hochgepriesene Bauwerk ansehen, da sich die Möglichkeit dazu bislang noch nicht ergeben hatte.
Als sie die ruhige, von Bäumen gesäumte Straße entlangeilte, kam ihr ein Polizeiinspektor entgegen. Sie erkannte Marcus Beresford sofort und versuchte so zu tun, als hätte sie ihn nicht bemerkt. Zu spät.
»Ja, sieh an, ist das nicht Miss Maskey?«, begrüßte er sie. »Wie nett, Sie wiederzusehen. Was führt Sie in unsere Stadt?«
Widerstrebend nahm sie Notiz von ihm, ließ ihn ansonsten aber im Unklaren. Inspektor Beresford hatte die Befehlsgewalt über die berüchtigte Einheimischenpolizei Queenslands. Ihr Vater hatte ihn gemocht. Ihr Mann hasste ihn. Aus gutem Grund.
»Ich möchte mir das Parlament ansehen«, sagte sie. »Das kenne ich noch nicht.«
»Ein fantastisches Gebäude! Und vortrefflich eingerichtet. Ich würde mich glücklich schätzen, Sie dort herumführen zu dürfen.«
»Vielen Dank. So viel Zeit habe ich nicht.«
Die gusseisernen Tore befanden sich direkt vor ihr, und dahinter erhoben sich die schönen, fast rosafarbenen Sandsteinmauern des Stolzes und der Freude der Kolonie.
»Sind Sie sicher?«
»Verzeihen Sie«, sagte sie und ging auf die Tore zu, »aber ich muss nun wirklich gehen.«
Er ließ nicht locker und passte sich ihrem Schritt an. »Vielleicht könnte ich Sie einmal nachmittags zu einem Tee ausführen.«
»Nein danke!«
Er öffnete das hohe Tor, und Laura ging rasch hinein und schlug es dann vor seiner Nase zu, so dass er keine Chance hatte, ihr zu folgen.
Ein paar Minuten lang versteckte sie sich in der Eingangshalle, trug sich in das Gästebuch ein und blickte sich um, bis sie sicher sein konnte, dass Beresford sich entfernt hatte. Dann marschierte sie wieder hinaus. Eine Führung durch das Parlament hatte sie nicht im Sinn gehabt; sie hatte es sich samt seiner Umgebung einfach nur einmal ansehen wollen.
Ihr Weg führte sie um das Gebäude herum zur Flussseite, so dass sie sich auch von der Umgebung ein Bild machen konnte. Es lag äußerst malerisch direkt an einer Flussbiegung. Aber Beresford hatte ihr die Laune verdorben. Zu dumm, dass er ihr begegnet war und sie an die Tragödien erinnert hatte, mit denen Paul zu kämpfen hatte.
Laura war Pauls zweite Frau und in Gegenwart seiner Familie noch immer nervös. Seine erste Frau Jeannie und ihr Dienstmädchen waren auf der Oberon-Station von Mitgliedern der Berittenen Einheimischenpolizei aus Beresfords Kompanie umgebracht worden.
Die meisten – darunter Lauras Vater – gaben Beresford nicht die Schuld, und konnten es auch nicht, nahm sie an. Paul hingegen schon. Er behauptete, die Männer der Einheimischenpolizei seien von Haus aus Überläufer, dazu ausgebildet, die eigenen Leute zu töten, im Grunde nur zum Töten ausgebildet, allerdings zugunsten der weißen Siedler. Er machte ihren Vorgesetzten für eine große Anzahl ihrer ruchlosen Taten verantwortlich und stand der bloßen Existenz dieser Truppen ausgesprochen kritisch gegenüber.
Sie seufzte. Gott sei Dank war ihr Mann eben nicht dabei gewesen. Und glücklicherweise trug sie Handschuhe, die ihren Ehering verbargen und dadurch neugierige Fragen von diesem Burschen verhindert hatten.
»Jetzt kann ich genauso gut zurückgehen«, murmelte sie verärgert. »Ich komme ein andermal wieder und sehe es mir dann in aller Ruhe an.«
Sie beschloss, zum Hotel zu gehen, sich auszuruhen und dann mit einer Droschke zu Rivadavias Haus zu fahren. Sie hatte die Adresse, und der Hotelportier konnte dem Droschkenfahrer gewiss den Weg beschreiben.
Das Haus lag in einem großen Garten, bei dessen Planung man darauf bedacht gewesen war, den Blick auf die Stadt und den gewundenen Fluss zu erhalten.
Da Laura Bewegung brauchte, stieg sie bereits am Tor aus der Droschke und marschierte die Zufahrt hinauf. Sie und Paul waren schon ein paar Wochen vor dem Tod seiner Mutter hergekommen, und nun, da Dolour zur letzten Ruhe gebettet worden war, würden sie nach Hause fahren, vielleicht schon tags darauf.
Das weiße Haus mit seinen abgeschiedenen Spazierwegen beiderseits des Eingangs sah so kühl und einladend aus, dass Laura schneller ging. Ein duftender Rosengarten grenzte an die Zufahrt, mit Hunderten von Blüten, die der verstorbenen Dame des Hauses zu huldigen schienen. Alle hatten sie einen rosa Farbton, offensichtlich Dolours Wahl.
Jemand rief ihr jenseits einer niedrigen Hecke etwas zu, und als sie sich umwandte, erkannte Laura Mrs.Palliser.
»Hallo!«, rief sie. »Hier drüben. Sie sind die Neue, Laura, nicht wahr?«
»Ja, so könnte man es nennen.« Laura lächelte. »Und Sie sind Mrs.Palliser?«
»Ach, kein Grund, so förmlich zu sein. Duzen wir uns doch. Ich bin Rosa. Wie geht es dir?«
»Sehr gut, danke. Die anderen sind noch nicht zurück?«
»Nein. Und ich verziehe mich gerade lieber, weil die Haushälterin, Mrs.Payne, die Aufsicht über das Buffet hat und man so, wie sie sich aufführt, denken könnte, es würde königlicher Besuch erwartet statt der Familie und ein paar Freunden.«
Laura nickte. »Was für ein wunderschönes Haus. Wie traurig, dass euer Vater es nun ganz allein bewohnen wird.«
»Der kommt schon klar. Aber ich habe mich gefragt, wie es dir eigentlich geht? Es ist sicher nicht einfach, die Familie kennenzulernen, wo die Tragödie um Pauls erste Frau allen noch frisch im Gedächtnis ist? Ich finde es sehr mutig, dass du hergekommen bist.«
»Ich bin nicht mutig. Und habe es auch nicht von mir aus angeboten. Paul hat darauf bestanden. Er hat gesagt, es würde keine Rolle spielen, wenn ich Freunde und Verwandte von Jeannie träfe; selbst in zehn Jahren würde es nicht leichter werden. Das müssen wir einfach durchstehen.«
Rosa schlenderte zu einem Gartenstuhl im Schatten hinüber und lud Laura ein, sich zu ihr zu gesellen. »Würde es dich stören, eine Weile hier draußen zu bleiben? Sonst ist noch niemand da.«
»Du liebes bisschen, bin ich zu früh?«
»Nein, die anderen kommen sicher gleich. Hast du Dolour gekannt?«
»Leider habe ich sie erst kurz vor ihrem Tod kennengelernt, doch sie meinte, sie sei glücklich über unsere Heirat. Das hat mich sehr erleichtert und mir Zuversicht gegeben.«
Rosa nickte. »Ja, das klingt ganz nach Dolour. Als Vater sie geheiratet hat, habe ich es zunächst kaum fassen können. Aber sie war so nett und verständnisvoll, selbst bei meinen – und auch seinen – gelegentlichen Anfällen, dass ich nicht umhinkonnte, sie ins Herz zu schließen. Leider hat sie meine Ehe mit Charlie nicht gebilligt, auch wenn wir nicht gestritten haben. Sie fand mich noch zu jung.« Sie lachte. »Dann habe ich gehört, wie sie sich mit Juan stritt. Er sagte, zwanzig sei das richtige Alter zum Heiraten, und sie schimpfte darauf: ›Ihr Männer! Ihr erfindet diese Mythen doch bloß, um eure Töchter loszuwerden!‹«
Laura war entsetzt. »O nein! Aber das hat sie bestimmt nicht so gemeint. Sie hätte sicher nicht gewollt, dass jemand das persönlich nimmt!«
»O doch. Soweit ich weiß, könnte sie in der Hinsicht auch durchaus richtig gelegen haben. Doch sie hatte nicht recht damit, dass ich zu jung war. Charlie und ich sind überaus glücklich.«
Laura lächelte. »Das ist ein gutes Gefühl, nicht?«
»Oh, verflixt, da kommen sie.«
Die beiden Frauen erhoben sich und beobachteten, wie vor der ersten Kutsche Reiter in die Zufahrt einbogen.
»Ich gehe mal besser hoch, sonst macht mir Sergeant Payne die Hölle heiß. Komm.«
Laura stürmte mit ihr durch ein Labyrinth an Wegen, über die Auffahrt hinweg und die Treppe zur Tür hinauf, und eilte sodann über den polierten Boden einer Eingangshalle in einen langen Salon, der mit bequemen Ledersesseln und -sofas ausgestattet war.
»Du bleibst hier«, meinte Rosa. »Ich muss Portier spielen. Dolour wollte keine Butler oder dergleichen, und die Mädchen werden nun, da die ersten Gäste eintreffen, alle im Ballsaal sein und das Büffet herrichten.«
»In Ordnung.« Laura grinste, als ihre neue Freundin Rosa davoneilte. Sie sah sich in dem Raum mit seinen interessanten Porträts und farbigen Wandbehängen um und ging dann zu einer Glasvitrine, in der ein mit Juwelen verziertes Kreuz ausgestellt war. »Oh, wie schön!«, hauchte sie, geblendet von dem Überfluss an Rubinen, Smaragden und Perlen. »Sind die echt?«
Sie blickte sich verstohlen um. Hoffentlich hatte niemand diesen törichten Ausruf gehört, denn natürlich waren sie echt. Eine schwarz gekleidete Prozession bewegte sich durch die offene Eingangstür, doch sie drehte sich wieder zurück und starrte weiter gebannt auf das Juwelenkreuz, das sie in seiner Schönheit schier überwältigte.
Der Ballsaal war zu einem mit Teppichen ausgelegten Salon umgestaltet worden, in dem Diwane und Polstersessel um niedrige Tische zu Sitzgruppen aufgestellt waren. Ein paar betagtere Herrschaften hatten sich hier schon niedergelassen und ruhten ihre müden Knochen aus.
Eileen MacNamara war überrascht über diese Verwandlung. Sie hatte die Idee, das Treffen in dem für strahlende Empfänge bekannten Ballsaal stattfinden zu lassen, nicht gutgeheißen und Rosa die Schuld für diesen Fauxpas gegeben.
»Was spielt es denn für eine Rolle?«, hatte John Pace gefragt. »Es handelt sich schließlich nicht um einen echten irischen Leichenschmaus. Es soll lediglich eine Zusammenkunft nach der Beerdigung sein, bei der es eine Kleinigkeit zu essen gibt. Ein Art frühes Abendessen, denke ich.«
»Wer hat dir das gesagt?«
»Die Haushälterin. Gestern, als ich die zusätzlichen Blumen vorbeigebracht habe. Sie sagte, Ansprachen wünsche Herr Rivadavia auch nicht. Aber sehen die Blumen nicht hübsch aus?«
Eileen waren sie bereits aufgefallen. An den offenen Seitentüren zum beschatteten Garten hin standen riesige Vasen mit rosa Rosen. Übertrieben, befand sie.
Dienstmädchen bewegten sich mit trübsinniger Miene stumm im Raum umher und boten Tee und Kuchen an, doch ihr Mann steuerte auf eine Seitentür zu.
»Auf der Terrasse gibt es ein Büffet«, erklärte er begeistert. »Lass uns rausgehen. Ich sterbe vor Hunger.«
Eileen sah, dass sich dort die Jüngeren zusammengefunden hatten. Sie wäre lieber in diesem Raum geblieben, der sich bereits mit bedeutenden Personen füllte, dem örtlichen Parlamentsmitglied Jasper Forsyth etwa oder dem Präsidenten des Viehzüchterbunds von Queensland und seiner Frau. Unter diese Leute hätten sie sich mischen sollen! Doch John Pace war bereits fortgestürmt, und sie folgte ihm notgedrungen.
Rosa hatte ihren Spitzenschleier inzwischen abgelegt und plauderte gerade mit Laura. John Pace begrüßte noch kurz seine Brüder, ehe er sich zum Büffet begab.
»Er hat immer Hunger!«, seufzte Eileen.
»Der alte Nimmersatt«, grinste Duke. »Immerzu dabei, sich den Bauch vollzuschlagen.« Er nickte in Richtung Laura. »Sieht so aus, als spieltest du nur noch die zweite Geige, Paul.«
Sein Bruder lächelte. »Ja, die zwei scheinen sich gut zu verstehen.«
»Keinen Anstand, alle beide«, bemerkte Eileen. »Vor Dolours Begräbnis am Friedhof haben sie sich gedrückt, die gesellschaftliche Seite des Tages scheinen sie dagegen nicht verpassen zu wollen!«
»Ach ja?«, versetzte Duke sarkastisch und marschierte davon.
Paul warf seiner Schwägerin einen finsteren Blick zu. »Eigentlich wollte Laura gar nicht herkommen. Ich habe sie überreden müssen.«
»Wozu bloß? Ich dachte, du hättest mehr Respekt vor Jeannies Familie.« Eileen blickte sich in dem inzwischen bevölkerten Garten um. »Du musst doch gewusst haben, dass Jeannies Eltern da sein würden. Und ihre Schwester. Gott weiß, wie sie sich fühlen müssen, wenn ihnen deine neue Frau derart vorgeführt wird.«
»Jetzt reicht es, Eileen«, herrschte John Pace sie an. »Verzeih, Paul. Sie redet dummes Zeug.«
Sein Zwillingsbruder wandte sich ab. »Ich hatte vergessen, dass sie hier sein würden. Ehrlich.«
»Egal. Lass dich von Eileen nicht ärgern.«
Paul schüttelte den Kopf. »Tut sie nicht.«
Als er sich nun durch die Gästeschar zu Laura schlängelte, dachte er über seine Situation nach.
»Meine Frau und eine weitere Dame wurden auf abscheuliche Weise ermordet«, sagte er sich.
Nach solch einem Schicksalsschlag konnte einem nichts mehr etwas anhaben. Gehässiges Gerede ähnlich dem Eileens war seit seiner Hochzeit mit Laura gang und gäbe gewesen, hatte ihn jedoch kalt gelassen. Es konnte ihm nicht gleichgültiger sein. Und was Laura anging, so war sie ein willensstarkes Mädchen und konnte auf sich selbst aufpassen.
»Wenn ich es mir recht überlege«, murmelte er, »sollte Eileen sich besser vorsehen.«
Rosa merkte, dass die Gespräche um sie herum kurz verstummten, und sah, dass ihr Vater und Duncan Palliser den Raum betreten hatten. Sie entschuldigte sich und eilte ihnen entgegen.
Sie nahm Juans Arm und drückte ihn an sich. »Alles in Ordnung mit dir, Vater?«
»Ja«, nickte er und blickte um sich. »Hier ist alles in Ordnung? Genügend zu essen da?«
»O ja. Und es schmeckt ausgezeichnet. Kann ich dir etwas bringen? Und dir ebenfalls, Schwiegerpapa?«
»Danke, für mich noch nicht, Liebes, aber du könntest Mr.Palliser in mein Arbeitszimmer bringen und ihm einen Portwein anbieten. Ich wollte ihm ein Bild von dem Angusbullen Minotaur zeigen. Deshalb … überlasse ich Sie Rosas fähigen Händen, Sir. Ich brauche nicht lang.«
Rosa beobachtete, wie er seine schwarze Seidenkrawatte zurechtrückte, die Schultern straffte, wie er es oft tat, wenn er seinen berühmten Latinocharme einsetzen würde, und mit ausgestreckten Armen auf das nächste Paar zusteuerte.
»Einen Augenblick, bitte«, sagte sie zu Duncan und winkte ein Serviermädchen herbei.
»Würden Sie bitte ein schönes Tablett mit Essen für zwei Herren herrichten und es in Mr.Rivadavias Arbeitszimmer bringen?«
»Ja, Madam.« Das Mädchen knickste.
»Ich kann euch beide doch keine Reste essen lassen«, erklärte Rosa ihrem Schwiegervater. »Aber jetzt komm mit und schau dir Juans Lieblingsbullen an.« Sie senkte ihre Stimme ein wenig. »Er hält sich ganz wacker, nicht?«