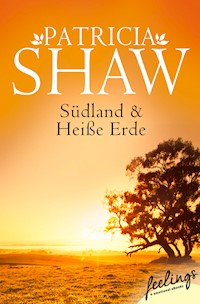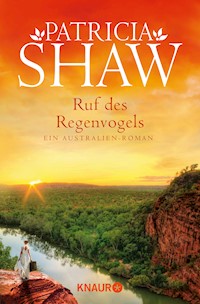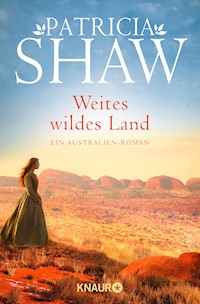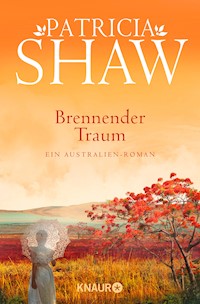6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Mal-Willoughby-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Wie in all ihren großen Love & Landscape-Romanen überzeugt Patricia Shaw, die Meisterin der Australien-Saga, auch in "Wind des Südens" mit der Schilderung atemberaubender Landschaften, einer temporeichen, fesselnden Handlung und großen Gefühlen. "Wind des Südens" ist dabei der Roman Patricia Shaws, der sich zum größten Publikumsliebling entwickelt hat und für den sie daher mit dem Corine-Leserpreis ausgezeichnet wurde. Sie spinnt in diesem historischen Schmöker die Geschichte von Mal Willoughby weiter, den sie in "Feuerbucht" erstmals auftreten ließ. 1873: Mittlerweile hat der attraktive Glücksritter Mal in China sein Glück gefunden und befindet sich mit seiner schönen chinesischen Frau auf dem Weg nach Australien. Inmitten einer bunt zusammengewürfelten Reisegruppe segeln sie auf einem Luxusliner von Hongkong in Richtung des 5. Kontinents, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch die Reise nimmt eine dramatische Wendung, als Mitglieder der Crew aus Goldgier eine Meuterei anzetteln – und Mals Frau dabei getötet wird. Die Suche nach den Schuldigen führt Mal Willoughby durch das chinesische Bergland und schließlich zurück nach Australien, auf die weiten Goldfelder rund um Cairns …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 956
Ähnliche
Patricia Shaw
Wind des Südens
Die große Australien-Saga
Aus dem Englischen von Karin Dufner und Elisabeth Hartmann
Knaur e-books
Über dieses Buch
Eine bunt zusammengewürfelte Reisegruppe segelt auf einem Luxusliner von Hongkong nach Australien. Unter ihnen sind auch der Abenteurer Mal Willoughby und seine schöne chinesische Frau. Im Pionierland Australien wollen die beiden ein neues Leben beginnen, doch die Reise nimmt eine dramatische Wendung: Mitglieder der Crew zetteln aus Goldgier eine Meuterei an – und Mals Frau wird dabei getötet …
Eine große Saga voll Dramatik und großer Gefühle, die den Helden auf seinem Rachefeldzug quer durch den Fünften Kontinent führt.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
1873
Das schmucke Schiff segelte, von Hongkong kommend, schneidig in die lange Durchfahrt zwischen dem Great Barrier Reef und der Küste von Queensland. Der erleichterte Seufzer des Kapitäns hallte in der sanften Brise nach. Wenngleich diese Gewässer mit ihren unzähligen Inseln und kleineren, nicht kartierten Riffen gefährlich sein konnten, so waren sie im Vergleich zur hohen See mit ihren Risiken geradezu wie ein sicherer Hafen. Es war die schlimmste Unwetterperiode, die Kapitän Judd Loveridge auf dieser Route je erlebt hatte, und er dankte dem Herrn dafür, dass ihm ein Hilfsmotor zur Verfügung gestanden hatte.
Nachdem seinem Schiff im Südchinesischen Meer schwer zugesetzt worden war, hatte der Kapitän zwei zusätzliche Tage in Singapur anberaumt, um Reparaturen vornehmen zu lassen und einen Ersatz für den Ersten Offizier Barrett zu finden, der sich beim vergeblichen Versuch, rutschende Fracht zu sichern, ein Bein gebrochen hatte. Loveridge hatte tatsächlich einen neuen Burschen ausfindig gemacht, Jack Tussup, einen Australier, der als Zweiter Offizier auf der SS Meridian gedient hatte. Die SS Meridian war in der Malakkastraße auf Grund gelaufen. Tussup war eigentlich nicht der Typ, für den er sich, hätte er die Wahl gehabt, entschieden hätte, doch Loveridge wusste, dass es ihm kaum gelingen würde, irgendjemanden von Barretts Format zu finden.
Der Zwangsaufenthalt im Hafen gewährte seinen Passagieren immerhin eine Verschnaufpause. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn der Großteil seiner Passagiere an Land gegangen und dort geblieben wäre, um sich von den auszehrenden Nachwirkungen lang anhaltender Seekrankheit zu erholen. Aber Singapur war eine ungesunde Stadt, und Lyle Horwood forderte: »Wir haben das Schlimmste doch sicher hinter uns, Captain. Deshalb lautet der einstimmige Beschluss: weiterfahren!«
Der Kapitän schmunzelte. Horwoods Frau war entsetzlich seekrank gewesen, doch ihr ältlicher Gatte hatte die Stürme mit der Gleichmut eines alten Seebären hingenommen. Er und dieser junge Kerl, Willoughby, hatten keine einzige Mahlzeit ausfallen lassen, und während sie in der Bar herumlungerten und Karten spielten, wurden sie enge Freunde – obwohl sie nach Loveridges Meinung Welten trennten.
Horwood war ein distinguierter Herr, Direktor der Oriental Shipping Line, Willoughby hingegen ein eher ungeschliffener Diamant. Der Kapitän hatte den Eindruck, dass dieser große, schlaksige Kerl weit besser auf einem Pferderücken zu Hause war als auf den Planken eines Schiffes.
Die China Belle war Loveridges Lieblingsschiff aus der Flotte der Oriental Line. Sie führte eine beträchtliche Fracht von Reis und Tee, aber nur wenige Passagiere. Es gab nur sechs Kabinen, allesamt erster Klasse, für eine exklusive, wohlhabende Klientel. Loveridge hoffte, nach dem Luxus seiner geliebten China Belle nie wieder zurück auf überfüllte Passagierschiffe zu müssen.
Er seufzte, spähte hinüber zu einer weiteren grünen, von einem weißen Küstenstreifen gerahmten Insel und einer Ausbreitung helleren Wassers, die auf ein Riff unter der Oberfläche hinwies, und drehte das Steuerrad, um das Riff weiträumig zu umfahren.
»Kennen Sie sich in diesen Gewässern aus?«, fragte er Tussup.
»Nicht allzu gut, Sir. Dank der Riffe, die hier wie Konfetti verstreut liegen, sind sie unberechenbar.«
»Ja, es ist auch ohne diese Tücken schon schwierig genug, dem großen Riff nicht zu nahe zu kommen. Manchmal denke ich, es wäre klüger, außen herum zu fahren.«
Tussup hob verdutzt den Blick. »Gott bewahre! Wir kämen vom Kurs ab. Das hier ist die offizielle Route!«
»Ich weiß. War nur so ein Gedanke. Um sicherzugehen, würde ein Mann im Topmast nicht schaden. Sag dem Bootsmann, er soll jemanden raufschicken, der nach diesen verdammten Riffen Ausschau hält – einen von den Malaien.«
Seine Mannschaft bestand, abgesehen von den zwei Offizieren und dem Bootsmann, aus Malaien und Chinesen. Die Asiaten arbeiteten als Köche und Stewards – insgesamt zweiundzwanzig Seemänner, von denen Loveridge möglicherweise einige in Brisbane austauschen wollte. Zugegeben, das Schiff war von den haushohen Wogen während der Stürme ordentlich durchgeschüttelt worden, doch das war kein Grund für die ablehnende und mürrische Haltung der Mannschaft ihm gegenüber, als hätte er die Jungs absichtlich in Gefahr gebracht. Die Wahrheit war schließlich, dass er sie, auch wenn er gelegentlich zur Peitsche greifen und ihnen lautstark und grob die Panik austreiben musste, doch sicher durch eine Situation geführt hatte, in der andere Kapitäne vielleicht versagt hätten. Er hatte mit dem Bootsmann über die mürrische Stimmung gesprochen, die immer noch über dem Schiff lag.
»Was zum Teufel ist los mit denen? Bring sie auf Vordermann! Die Sonne scheint, und bis Brisbane haben wir jetzt ruhige See.«
»Ich weiß nicht. Sie sind immer noch voller Angst nach den Erlebnissen im Chinesischen Meer, glauben, das Schiff wäre verdammt und die Götter ließen es auf ein verstecktes Riff auflaufen. Ein abergläubischer Haufen!«
»Dann sag Tom, er soll sie bei der Stange halten. Wenn nötig, soll er ihnen die Rationen kürzen.«
Während der Bootsmann zustimmend nickte, wusste Loveridge, dass es sinnlos war, Tom Ingleby, seinem Zweiten Offizier, zu befehlen, die Mannschaft mit der Peitsche zur Ordnung zu rufen. Tom war ein guter Seemann, aber ein schwacher Mensch. Nicht gerade eine Respektsperson. Es würde Matt Flesser, dem Bootsmann, überlassen bleiben, die elenden Jammergestalten, die nicht begriffen, dass die Pechsträhne vorüber war, ins Joch zu zwingen.
Wie auch immer, Loveridge konnte sich angesichts des bedeutenden Passagiers an Bord keine missmutige Mannschaft erlauben, und so beschloss er, es allen recht zu machen, indem er verkündete, dass bei Nacht nicht gesegelt würde. Während der Dunkelheit sollte das Schiff vor Anker liegen, geschützt vor den scharfen Klauen der Korallen.
Loveridge selbst fühlte sich besser nach diesem Entschluss. Der Albtraum der Atlanta-Katastrophe würde ihn plagen bis an sein Lebensende. Er war erst siebzehn gewesen, gemeiner Matrose, als sie zuschanden kam, weil ihr Kapitän den Rat, bei Nacht die Meerenge von Bass zu meiden, in den Wind geschlagen hatte … Judd klang noch immer das Krachen berstenden Holzes in den Ohren, als das Schiff den Felsen rammte, das Schreien und Rufen und das ungestüme Eindringen des Wassers, als trieben sie durch einen stockdunklen Tunnel, in dem die Menschen umherflogen wie Kieselsteine.
Er hatte sich aus der Tiefe hochgekämpft und Luft geschnappt, wenigstens das, und war dann blindlings geschwommen, bemüht, den Kopf über den erbarmungslos wogenden Wellen zu halten, ohne zu wissen, wohin er strebte, ob ans Ufer oder aufs Meer hinaus, was ihm aber seltsamerweise gleichgültig war. An Land wäre er gerannt, in panischer Angst vor einer Macht, die sein junges Leben bedrohte, davongerannt. Um Abstand zu gewinnen.
Judd Loveridge gehörte zu den vier Überlebenden des Schiffsunglücks, das zweiunddreißig Männern den Tod gebracht hatte. Sein Vater, Captain Arnold Loveridge, war mit seinem Schiff untergegangen.
Nicht alle Passagiere waren mit der neuen Regelung einverstanden. Horwood beklagte sich über den Zeitverlust.
»Ich halte das für eine Überreaktion, Captain. Ich verlange, dass dieses Schiff heute Nacht und in den folgenden Nächten weitersegelt. Unvorstellbar, bei solch ruhiger See zu trödeln.«
Der Kapitän ließ Horwood ausreden, gab eine ausweichende Antwort und zuckte mit den Schultern, als der Direktor davonstürmte. Die Riffe und Inseln vor dieser Küste waren noch nicht exakt kartiert, und er schätzte sich glücklich, dass sie ohne Zwischenfälle so weit gekommen waren. Seit sie von der Torres-Straße aus in diese Gewässer gekommen waren, rechnete er jede Minute damit, das gefürchtete Scharren und Knirschen der Katastrophe zu vernehmen, und nachdem er nun seinen Entschluss gefasst hatte, verspürte er große Erleichterung und gönnte es sich, den prachtvollen Ausblick zu genießen. Die kleinen Inseln glichen Edelsteinen, gefasst in saphirblaues Wasser, und er nahm sich vor, diese Beschreibung in sein Logbuch einzutragen.
Es sollte der letzte Eintrag sein.
Lyle Horwood war, als er sich zum Dinner umkleidete, übelster Laune, nestelte an seiner Krawatte und beschwerte sich, dass sein Hemd zu steif gestärkt sei.
»Warum überprüfst du das nicht, wenn der Junge meine Hemden aus der Wäscherei bringt?«, fuhr er seine Frau an. »Das wäre doch wohl nicht zu viel verlangt. Und was hast du da für einen Fetzen an? Sieht schlampig aus, verdammt!«
Constance warf einen Blick in den Spiegel. Sie mochte dieses Kleid aus fließendem geblümten Georgette in gedämpften Herbstfarben. Es war exzellent geschnitten und bestens geeignet für diese warmen Nächte.
»Das ist kein Fetzen, Liebling.« Sie lächelte, um ihn zu besänftigen. »Es hat eine gehörige Stange Geld gekostet, wie du wohl weißt. Und es ist schlicht genug für heute Abend. In diesem kleinen Kreis möchte ich nicht zu auffällig gekleidet erscheinen.«
»Willst du meinen Geschmack in Frage stellen? Lass dir gesagt sein, ich habe schon in vornehmen Kreisen gespeist, als du noch nicht mal mit Messer und Gabel essen konntest. Los, zieh was Besseres an.«
Constance wandte sich ihm zu. »Ist das denn so wichtig, Lyle? Du liebe Zeit, ich glaube wirklich nicht, dass wir es nötig haben, Eindruck zu schinden. Und dieses Kleid ist …«
Wütend packte er sie, im selben Moment, als sie sich umdrehte, am Kleid, und das gute Stück riss an der Taille auf. »Nun sieh dir das an!«, schnauzte er. »Zieh dich um. Ich gehe schon vor.«
Erschüttert blickte sie an ihrem zerrissenen Kleid herunter, zog es langsam aus und fragte sich, was diesen Wutausbruch heraufbeschworen haben mochte, während Lyle nach der Bürste mit dem silbernen Monogramm griff und sich rasch über das dichte weiße Haar fuhr.
Er ist so stolz auf seine ›Mähne‹, dachte Constance verächtlich und mit den Tränen kämpfend. Oh ja, und er war ein Bild von einem Mann … Sehr erfolgreich. Begütert. Hoch geachtet. Ein echter Gentleman. Und zudem noch Witwer!
Das war ein Teil des Lobes, das ihr Vater, Percy Feltham, auf Horwoods Reputation gehäuft hatte, als er mit der großartigen Nachricht für seine Tochter nach Hause kam, dass er einen alten Freund getroffen habe.
»Ich muss ihn dir vorstellen. Er wird dir gefallen …«
»Wieso? Wie sieht er aus? Bring mich bitte nicht in Verlegenheit, Vater, indem du mich einem alten Tattergreis zur Besichtigung vorführst. Ich habe keine Eile, was das Heiraten angeht.«
»Mein Schätzchen, du bist fünfundzwanzig, fast schon eine alte Jungfer. Allerdings bin ich zugegebenermaßen froh, dass du deine Verlobung mit Reggie gelöst hast. Er hat nicht zu dir gepasst, aber glaube mir, mit Lyle Horwood verhält es sich anders.«
»Wie sieht er aus?«, wiederholte Constance misstrauisch.
»Er ist ein feiner, aufrechter Bursche! Groß, distinguiert. An seiner Seite wirst du dich gut machen. Und eine Schönheit wie du – er wird dir nicht widerstehen können.«
Trotz ihres Misstrauens angesichts der väterlichen Begeisterung und ihres eigenen Desinteresses an Männern seines Alters fühlte Constance sich zu ihrer Überraschung zu Lyle Horwood hingezogen und war beeindruckt von seiner Großzügigkeit. In der Zeit der Brautwerbung war er, wie sie sich verbittert erinnerte, während sie auf der Suche nach einem anderen Kleid ihren Schrank inspizierte, der netteste, charmanteste Mann, dem sie je begegnet war, und binnen weniger Monate waren sie verlobt.
Nach der Hochzeit gingen sie in großer Aufregung an Bord eines Schiffes der Oriental Line, das sie nach Hongkong bringen sollte, in ihr neues Heim, das Herrenhaus der Horwoods mit Blick über den Hafen.
Constance wandte sich seufzend wieder der Gegenwart zu und entschied sich widerwillig für ein Kleid aus roter Seide mit schmaler Taille und weich fallendem Rock. Es war sehr tief ausgeschnitten, würde ihrem Mann also gefallen. Und weil dazu noch etwas fehlte, griff sie nach einem zierlichen, mit Diamanten besetzten Halsband.
Im Grunde ist es sein Halsband, überlegte sie böse, denn er entschied, wann sie es zu tragen hatte. Wie ihren übrigen Schmuck auch, bewahrte er es in der Bank auf. Um etwas von den teuren Stücken, die er ihr geschenkt hatte, zu tragen, musste sie ihm frühzeitig Bescheid geben, und das ärgerte sie so sehr, dass sie sich manchmal gar nicht die Mühe machte, um den Schmuck zu bitten.
Das Halsband, ein Hochzeitsgeschenk, hatte ihr die Sprache verschlagen und Percy Feltham in Entzücken versetzt. Er war überzeugt, dass seiner Tochter mit seinem steinreichen Freund ein Leben in Saus und Braus bevorstand. Und es war, wie Constance sich erinnerte, zunächst auch wunderschön. Mit dem größten Vergnügen brüstete Lyle sich mit seiner schönen jungen Braut. Er ließ sogar ein Porträt von ihr anfertigen, das er in der Bibliothek ihres Hauses aufhängte. Nach Constances Meinung schmeichelte es ihr: Die Augen waren blauer, das Haar blonder, doch Lyle behauptete charmant, es würde ihr nicht gerecht, und seine Freunde pflichteten ihm bei.
In Hongkong führten sie ein umtriebiges gesellschaftliches Leben, und ihr Mann kaufte ihr Kleider und Accessoires, schickte ihr Couturiers mit Körben voller Stoffe ins Haus, damit sie das Passende auswählte. Er überraschte sie gern mit Schmuckstücken: Diamant- und Saphirringe, Perlen, eine Brosche aus Rubinen und Perlen, eine Diamantnadel – jede Gelegenheit war ihm recht, solange ein Publikum zugegen war, das applaudierte und ihre Freude teilte. Constance brauchte geraume Zeit, bis sie sein Bedürfnis nach öffentlicher Zurschaustellung seiner Großzügigkeit durchschaut hatte, aber es störte sie im Grunde nicht. Es stützte sein Selbstbewusstsein und hielt ihn bei Laune, vorübergehend zumindest. In letzter Zeit war seine Stimmung übler als gewöhnlich, womöglich weil er dem Plan, vorübergehend in sicherere Gefilde nach Australien überzusiedeln, unwillig gegenüberstand.
Constance ließ sich jetzt absichtlich Zeit, hatte keine Eile, sich dem Gesellschaftstrubel vor dem Dinner anzuschließen. Sie kam sich albern vor, als sie die tropfenförmigen Diamanten-Ohrgehänge anlegte, die zum Halsband passten, denn ihr war klar, dass sie in dem kleinen Speisesalon in dieser Aufmachung völlig fehl am Platze wäre.
Sie setzte sich an den Frisiertisch, nestelte an den losen blonden Locken, die den Kämmchen in ihrem anmutigen Chignon entwichen waren. Ihr langer, schlanker Hals war perfekt für das Halsband. Für ein Halsband, das Fannie gehört hatte!
Constance schauderte noch immer vor Beschämung, wenn sie an das auf dem Silvesterball belauschte Gespräch dachte …
»Natürlich, das Halsband, das sie da trägt, hat Fannie gehört«, sagte eine Frau. »Seiner ersten Frau. Jedes Schmuckstück, das er seiner Frau überreicht, hat Fannie gehört. Ihre Mutter, eine deutsche Gräfin, hat ihn ihr hinterlassen. Lyle hat nicht ein einziges Stück selbst gekauft.«
Die andere Frau lachte. »Ich hätte nichts gegen derartigen Schmuck aus zweiter Hand einzuwenden. Er nutzt sich ja schließlich nicht ab.«
»Ein bisschen altmodisch ist er aber schon, findest du nicht? Ich würde einfach alles neu fassen lassen …«
Die Stimmen entfernten sich, und Constance blieb gekränkt und verwirrt an der Tür stehen. Hätte er es ihr nicht sagen müssen? Ihr nicht wenigstens die Geschichte des Schmucks erzählen müssen? Vielleicht auch nicht, dachte sie damals und fand Entschuldigungen für ihn, Entschuldigungen, die immer fadenscheiniger wurden und sich zuletzt in nichts auflösten, als sie sich eingestand, dass sie den Typ Mann geheiratet hatte, den man landläufig als »Straßenengel« bezeichnet. Weil er zu Hause keineswegs ein Engel war.
In Abwesenheit seiner Freunde und Bekannten war er ein übellauniger Mann, der seine Frau mit absichtlicher Missachtung behandelte. Sein Verhalten wurde noch schlimmer durch seine Widersprüchlichkeit. Manchmal konnte er höflich sein, besonders, wenn er Gesellschaft, jemanden zum Reden brauchte, doch dann wieder verwandelte er sich ohne Vorwarnung in den Haustyrannen, der das Personal umherscheuchte und die Nerven seiner Frau strapazierte.
Erst kürzlich hatte Constance mit ihrem Vater darüber gesprochen, als er zur Feier ihres dreißigsten Geburtstags nach Hongkong gekommen war, doch Feltham war so beeindruckt von der Opulenz des Hauses und der Gärten, von dem Lebensstandard, den seine Tochter erreicht hatte, dass er kein Wort der Klage hören wollte.
»Schlägt er dich?«
»Nein, aber er schlägt die Dienstboten ziemlich brutal, und ich …«
»Aber, Connie. Wahrscheinlich haben sie es verdient. Du verstehst nichts von orientalischen Dienstboten, im Gegensatz zu ihm.«
»Aber Vater, er hat oft schlimme Wutanfälle.«
»Lieber Himmel, Connie, was willst du eigentlich? Dann verärgere den Mann eben nicht. Ich möchte sagen, meine Liebe, jede andere Frau würde ihre Seele verkaufen, um mit dir tauschen zu können. Der Mann verwöhnt dich – schau dir doch nur diese Perlen an, sie sind prachtvoll –, und es schmerzt mich, dass du so undankbar bist.«
Vor seiner Abreise unternahm sie einen weiteren Versuch. »Kann ich mit dir zurück nach London, Vater? Nur für kurze Zeit? Ich habe schreckliches Heimweh nach London.«
Er tat ihre Bitte lässig ab. »Finde dich endlich ab, Connie. Ständig höre ich nur Klagen von dir. Wenn deine Mutter noch lebte, wäre sie überglücklich zu sehen, wie gut du es getroffen hast. Du hast alles, was man für Geld kaufen kann. Versuch doch bitte, deinen Mann nicht so kritisch zu betrachten. Wir haben alle unsere Fehler, weißt du?« Er küsste sie auf die Wange. »Ich werde für dich beten.«
»Habe ich tatsächlich alles?«, fragte sie verbittert ihr Bild im Spiegel. »Nichts habe ich. Ich besitze gar nichts. Ich habe nie mehr als ein paar Pfund, mein Taschengeld, wie ein Schulmädchen. Er bezahlt alle Rechnungen, mein Schmuck wird weggeschlossen und nur hervorgeholt, wenn es ihm passt …«
Sie erhob sich und ging zur Kabinentür. Ihre kostbare Robe rauschte dabei wie Wellen, die gegen das ankernde Schiff schlugen. Doch dann zögerte sie.
»Ich sehe aus wie ein Weihnachtsbaum«, sagte sie leise zu sich selbst. »Völlig unpassend für diesen Abend. Und ich habe keine Lust, mich zum Narren zu machen. Was ist in mich gefahren, dass ich ihm so etwas durchgehen lasse?«
Eilig legte sie den störenden Schmuck ab, verstaute ihn in den dazugehörigen Samtbeuteln, verschloss ihren Schmuckkasten und ließ den Schlüssel an der feinen Silberkette in einer versteckten Unterrocktasche verschwinden …
Mit einem nervösen Lachen verließ sie die Kabine. Vielleicht merkte er gar nicht, dass ihre Robe ein wenig schmucklos wirkte.
Er sah sich längst nicht mehr als Lyle Horwood, sondern als Sir Lyle, als müssten die beiden Worte zwangsläufig eines Tages eine Verbindung eingehen, wenn die gute Queen, wie er hoffte, ihn für seine Dienste für die Krone und die Kolonie Hongkong zum Ritter schlug. Deshalb ärgerte es ihn umso mehr, als Neville Caporn, dieser Emporkömmling, ihn beim Eintritt in die Bar schlicht und einfach mit Lyle ansprach.
»Da ist wenigstens schon mal einer«, sagte Caporn zu seiner Frau und hob dem Neuankömmling sein Sherryglas entgegen. »Dachte schon, wir müssten allein speisen. Wo sind die anderen, Lyle?«
»Ich habe keine Ahnung, Mr. Caporn«, antwortete er steif.
»Na, dann. Wird Ihre hinreißende Frau uns denn Gesellschaft leisten?«
»Natürlich!« Horwood bemerkte, dass Mrs. Caporn, eine attraktive Rothaarige, in einer violetten Seidenrobe der Form Genüge zu tun suchte, doch Constance würde sie in jeder Hinsicht überstrahlen.
»Wie nett«, sagte die Frau. »Nachdem wir auf dem Weg von Hongkong dermaßen durchgerüttelt worden sind, ist es so nett, wieder Gesellschaft zu haben. Und stellen Sie sich vor, Lyle«, sie kicherte, »man hat uns wohl vor Piraten gewarnt, nicht aber vor solch stürmischer See.«
»Piraten?«, fuhr er auf. »Die würden ein Schiff wie dieses niemals angreifen. Die feige Meute hält sich an kleinere Schiffe.«
»Dann können wir uns vor ihnen sicher fühlen? Das hoffe ich doch sehr.«
Ihr Mann stöhnte auf. »Esme, Piraten würden sich nie so weit nach Süden wagen. Hör doch bitte auf, dich zu sorgen.«
Lyle blickte zur Tür, die sich gerade öffnete, und erwartete seine Frau, doch es war Eleanor, die Cousine von Fannie, seiner verstorbenen ersten Frau. Jetzt hieß sie Eleanor Plummer. Er hatte sie erst an diesem Abend, kurz bevor er nach unten ging, um sich zum Dinner umzukleiden, flüchtig gesehen und konnte es nicht fassen, dass diese Hexe sich an Bord befand. Ihm war wohl bekannt, dass in Singapur eine Frau namens Mrs. Plummer an Bord gekommen war und Kabine sechs belegte, hatte aber keine Ahnung gehabt, wer sie war. Offenbar hatte sie zum zweiten Mal geheiratet. Und wenn dem so war, wo steckte dann der Gatte?
»Die Dame in Nummer sechs«, hatte er den Steward gefragt, »ist sie Deutsche?«
»Ja, Sir. Sie spricht auch nicht immer Englisch.«
»Ein Wunder, dass ich sie bisher nie gesehen habe. Nimmt sie die Mahlzeiten in ihrer Kabine ein?«
»Die Dame war indisponiert«, erklärte der Steward wichtig. »Krank! Aber jetzt geht es ihr besser. Kommt heute zum Dinner mit allen anderen Passagieren. Gut, nicht?«
»Verdammt noch mal«, fluchte Lyle leise und stürmte zurück zu seiner Kabine. Hätte er gewusst, dass diese Unruhestifterin sich ihnen anschließen würde, hätte er das Schiff mit Constance in Singapur verlassen.
Doch jetzt war sie hier, in Lebensgröße, in maßgeschneiderter weißer Seide mit marineblauer Paspelierung und einer hübsch drapierten Tornüre. Pariser Modell, urteilte er spontan … Kein Schmuck, bis auf den großen Diamantring, dem Gegenstück zu dem Ring, den er Constance zur Verlobung geschenkt hatte. Zwillingsringe, sieh an, wütete er innerlich. Geschenke an Fannie und Eleanor von der Großmutter mütterlicherseits, die ihre beiden Enkelinnen sehr geliebt hatte.
»Wie geht es dir, Lyle?«, fragte Mrs. Plummer kalt, nachdem sie die anderen begrüßt hatte.
»Könnte nicht besser sein, meine Liebe. Du hast wohl deinen Mann verloren? Reist du allein?«
»Nein. Ich weiß, wo er sich aufhält. Du ziehst vermutlich nach Brisbane um?«
»Kann sein«, antwortete er bemüht desinteressiert.
»Sehr vernünftig«, bemerkte sie gedehnt. »Ich denke, die englische Abordnung in Hongkong nimmt sich entschieden zu wichtig.«
»Und zu welcher englischen Abordnung zählt sich Mr. Plummer?«
»Zu gar keiner. Er ist Amerikaner. Oh … da kommt deine junge Frau. Was für ein hinreißendes Ballkleid!«
Ein Steward hielt ihr die Tür auf, als Constance in Begleitung des Kapitäns eintrat, und jetzt, unter dem Eindruck von Eleanors Spott, bereute Lyle, dass er Constance gezwungen hatte, sich umzuziehen. Das Rotseidene war tatsächlich ein wenig übertrieben für eine so kleine Tischrunde. Aber immerhin hatte sie das Halsband nicht angelegt, das gewöhnlich zu dem Kleid gehörte.
»Gott sei Dank«, brummte er vor sich hin, während er zu ihr trat und sie zur anderen Seite des geräumigen Salons führte.
»Wer ist diese Frau?«, flüsterte sie mit einem Blick über die Schulter hinweg, als er sie zu den Caporns dirigierte. »Ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Sie ist eine bedeutende Persönlichkeit, nicht wahr?«
»Mrs. Plummer? Die alte Schnepfe! Das glaube ich kaum. Ah, da kommt Lewis. Ich muss mit ihm reden.«
Doch Lewis ignorierte sein Winken und zog es vor, an der Seite der Dame zu bleiben, die er in den Salon geleitet hatte, Willoughbys Frau. Eine weitere Kröte, die er auf dieser verfluchten Reise schlucken musste.
Lyle hielt Willoughby für einen umgänglichen Burschen, ganz angenehme Gesellschaft, wenn man keine andere Wahl hatte, doch er war schockiert, als er erfuhr, dass der Mann eine Chinesin geheiratet hatte. So etwas war in Horwoods Kreisen absolut außerhalb der Grenzen des Erlaubten, doch nachdem er sich mit dem Mann angefreundet hatte, musste er nun auch die Gattin ertragen.
Constance blinzelte belustigt. Er war immer noch gereizter Stimmung, wenn auch nicht mehr interessiert an ihrer Garderobe, wie sie erleichtert feststellte. Aber diese umwerfend aussehende Frau eine alte Schnepfe zu nennen, das war lächerlich. Mrs. Plummers Haar, das in weichen Wellen ihr Gesicht rahmte, mochte grau sein, aber sie war tatsächlich schön und mit Sicherheit wesentlich jünger als Lyle.
Soll er doch reden, dachte sie und wandte sich Esme Caporn zu, die eine Menükarte ergattert hatte und vorlas, was der Abend noch zu bieten hatte.
»Captain, wer ist diese entzückende Chinesin?«, fragte Eleanor Plummer.
»Ah«, er lächelte. »Das ist Mrs. Willoughby.«
»Freilich. Das kann ja gar nicht anders sein … Ich habe ihren Mann vorhin an Deck gesehen. Man kommt nicht umhin, so viel Schönheit an einem Mann zu bewundern.«
»Und deshalb passen sie so gut zueinander«, pflichtete er ihr bei.
»Und was wissen Sie über Mrs. Willoughby?«
»Nicht viel, abgesehen davon, dass sie in großem Stil von Lakaien der Familie Xiu an Bord begleitet wurden.«
»Der Familie Xiu! Wirklich hochkarätig! Vielleicht will Mr. Willoughby mit seiner Dame im Süden residieren.«
»So sieht es aus.«
»Dann will ich das mal in Erfahrung bringen, denn sie sind wunderbare Menschen, und ich mag sie jetzt schon.«
Der Kapitän lachte. »Ausgezeichnet, aber ich wünschte, der junge Herr würde sich endlich hier einfinden. Er verzögert das Dinner. Möchten Sie ein Gläschen trinken, Mrs. Plummer?«
»Danke, gern. Champagner. Die Nacht ist so schön, und ich bin froh, dass Sie uns die Reise in Muße genießen lassen. Und jetzt müssen Sie mich mit Mrs. Willoughby bekannt machen.«
Er hieß Mal Willoughby, doch seine Freunde nannten ihn Sonny. Freunde, die sich nach vier Jahren Abwesenheit noch an ihn erinnerten. Er freute sich jetzt riesig auf die Heimkehr, auch wenn seine Heimat kein bestimmter Ort war, sondern eher der Busch, der Duft von Eukalyptus, die vertrauten Stimmen, das laute Vogelgezwitscher. »Und«, wie er zu sich selbst sagte, »die Weite.«
China verfügte über endlose Weite, ein riesiges Land, kein Zweifel. Da er im australischen Outback aufgewachsen war, schüchterte solche Weite ihn nicht ein, aber in China gab es so viele Menschen! Überall so viel Betriebsamkeit und Geschnatter! Seine Frau, Jun Lien, wollte kaum glauben, dass man in seinem Land tagelang reisen konnte, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Sogar wochenlang, wenn man verrückt genug war, bis man dann auf Aborigines traf, die sich davon allerdings bedroht fühlten.
»Und auch in den Städten gibt es nicht so viele Menschen«, hatte er erklärt, doch sie lachte ihn aus.
»Ach, Unsinn! Wie kann das sein? Dein Land ist so groß wie China, entsprechend wird auch die Bevölkerung sein.«
Er fasste sie leicht am Arm, als sie sich dem Salon näherten. »Da kommt Mr. Lewis. Geh schon mit ihm hinein. Ich möchte vor dem Dinner noch einen letzten Rundgang an Deck machen. Ich glaube, da braut sich was zusammen.«
»Das bildest du dir ein«, sagte sie. »Auf diesem Schiff ist alles in Ordnung. Ich fürchte, die Probleme meiner Familie in den vergangenen Jahren haben dich übervorsichtig werden lassen. Aber das liegt hinter uns, mein Liebster, das ist vorbei …«
»Geh schon hinein«, sagte er. »Ich komme gleich nach.«
Leise schritt er übers Deck, so leise, wie es ihm in den Abendschuhen möglich war, die er am liebsten ausgezogen hätte. Er stieg die paar Stufen zur Kajütsklasse herab und schlich bis zum Ende des Korridors, wo er nach links zu den Waschräumen abbog, die er überprüfte und leer vorfand.
Auf dem Rückweg schlüpfte er in seine Kabine und schnallte sich ein Messer ans Bein, eine Waffe, die ihm in China schon bei zahlreichen unangenehmen Begegnungen zu Diensten gewesen war.
Diese Schiffspassage ist teuer, überlegte er, und man sollte annehmen, die Stewards wären über jeden Zweifel erhaben. Das waren sie auch bis zu einem gewissen Punkt, solange es um den Dienst an den Passagieren ging, doch er hatte ein Murren unter den Chinesen bemerkt, zu viele finstere Blicke und mehrere Zusammenkünfte des Stewards der Horwoods mit den Malaien unter Deck. Da war etwas faul. Der Steward, Sam Lum, war viel zu weibisch, um sich mit Gorillas wie Bartie Lee, Mushi Rana oder anderen aus dieser Truppe einzulassen. Worüber also mochten sie reden?
Mal empfand das Leben auf einem Schiff als einengend. Für ihn war es normal, umherzuschlendern und sich mit der Mannschaft zu unterhalten, sogar beim Segelsetzen mit anzupacken, nur, um etwas zu tun zu haben, und so konnte ihm nicht entgehen, dass Spannung in der Luft lag. Vielleicht irgendwelche Zwistigkeiten zwischen den Malaien und den Chinesen. So etwas konnte leicht passieren, und solche Kämpfe konnten übel enden. Es beunruhigte ihn.
Seine Jahre in China hatte er als Kompagnon von Xiu Tan Lan zugebracht, des Patriarchen der Familie Xiu, der ständig auf der Hut war vor Verschwörern und Attentätern, selbst auf den Goldfeldern in Queensland, wo sie sich kennen gelernt hatten. Mal war schwer beeindruckt gewesen von dem chinesischen Gentleman, der in großem Stil reiste, mit Dienern und mehr als fünfzig Kulis, und der erstaunlich gut informiert war über die Gegenden, die er bereiste. Ihm gehörte eine große, komfortable Dschunke, die im Mary River vor Anker lag, und als er beschloss, mit einem Vermögen, angelegt in Gold, nach China zurückzukehren, begleitete ihn Mal, der selbst auch nicht schlecht verdient hatte, und freute sich über die Aussicht, fremde Länder bereisen zu können.
Erst zu diesem Zeitpunkt wurde ihm klar, dass Mr. Xius Angst vor Feinden unter den Chinesen wohl begründet war.
»Auch wenn du es offenbar nicht bemerkt hast«, erklärte Xiu ihm, »gibt es hier im Norden Australien doppelt so viele Chinesen wie Europäer. Meine Familie gehört zu den Manchu, und wir haben die Ehre, von der kaiserlichen Familie begünstigt zu werden. Doch wir haben viele Feinde, geheime Gesellschaften mit gegen die Manchu gerichteten Zielen, und illegale Opiumhändler, die die Banden und Piraten finanzieren. Überall lauern Spione, und deshalb sind wir stets und ständig gut bewaffnet.«
Die gleiche Art von Wachsamkeit bestimmte das Leben im großen Haushalt der Familie Xiu, und zuerst hielt Mal sie für einen finsteren Haufen, besonders, wenn Geschichten kursierten, dass jemand erstochen wurde, oder wenn Aufstände Straßenschlachten nach sich zogen. Doch allmählich gewöhnte er sich an die chinesische Lebensweise und bereiste mit Mr. Xiu zuerst als Tourist, dann als bewaffneter Gefährte und schließlich als Pelzhändler die Provinzen. Xiu selbst bestand darauf, dass er dieses lukrative Geschäft erlernte, damit er seine Reisen auch als Erfolg verbuchen konnte.
»Wenn du dann heimkehrst, könntest du Pelze importieren und das Geschäft weiterführen. Dann wäre deine Zeit hier nicht vergeudet.«
Zurück an Deck, immer noch voller Unruhe, ging Mal weiter, um einen Blick ins Ruderhaus zu werfen, wo er glaubte, zwei Offiziere streiten zu hören. Unter normalen Umständen hätte er sich nicht eingemischt, doch an diesem Abend erschien ihm alles etwas merkwürdig. So trat er durch die offene Tür ein und fand die Männer über Karten gebeugt.
»Wie ich hörte, bleiben wir heute Nacht vor Anker liegen.«
Überrascht blickten sie zu ihm auf, dann grinste Tussup. »Ja, warum auch nicht? Ist ja nur für ein paar Nächte.«
Mal wies mit einer Kopfbewegung auf den Kartentisch. »Was gibt’s denn?«, spöttelte er. »Können Sie sich nicht entscheiden, wo wir uns befinden?«
Tom Ingleby wirkte eindeutig schuldbewusst, doch Tussup blieb gleichgültig. »Kleine Meinungsverschiedenheit, Mr. Willoughby.« Er grinste erneut. »Nach meiner Rechnung liegen wir östlich von Endeavour Bay, aber Tom meint, wir sind schon weit im Norden.«
»Was gibt’s in Endeavour Bay?«
»Jetzt nichts mehr. Captain Cooks Schiff Endeavour musste dort wegen notwendiger Reparaturen anlegen, und er hat der Bucht den Namen gegeben.«
»Ich glaube, das Land an dieser Küste ist überhaupt noch nicht erschlossen«, sagte Tom hastig. »Da gibt’s nur Urwald.«
»Mag sein«, antwortete Mal desinteressiert und kam sich ein bisschen dumm vor, als die Männer sich wieder der großen Karte zuwandten und mit ihren Instrumenten Messungen vornahmen, immer noch geteilter Meinung, jedoch nicht mehr so verbissen.
Er überließ sie ihrem Streit, schlenderte über das Deck und blickte hinaus auf den dunklen Küstenstreifen.
»Aber da irren sie sich«, sagte er zu sich selbst. Nichts war einfach nur Urwald. Seit Tagen hatte er die grün bewachsenen Berge dort drüben betrachtet, schon seit sie die kleine Siedlung Somerset an der äußersten Spitze des Kontinents verlassen hatten. Das bewaldete Land dort war mit Sicherheit eine Wunderwelt voller fremdartiger Pflanzen und Tiere. Und hinter diesen Bergen? Was war da draußen? Auf diese Weise hatte Mal sich gute Kenntnisse über Neusüdwales und das südöstliche Queensland angeeignet: Immer musste er herausfinden, was hinter dem nächsten Hügel lag. Und auf diesen Reisen, auf denen er Arbeit als Viehtreiber oder Farmhelfer annahm, war er auch in die Hügel von Gympie und den erstaunlichen Wahnsinn der Goldfelder geraten.
Ohne Zwischenfall umrundete er noch einmal das Deck, blieb an der Reling stehen, blickte auf die ruhige See hinaus und dachte an die Dschunkenreise nach Norden. Im Gegensatz zu diesem Schiff musste Xius Dschunke jeden der wenigen Häfen längs der Küste ansteuern, um Trinkwasser und Proviant aufzunehmen. Trinity Bay war die letzte Station, bevor sie die hundert Meilen bis nach Somerset in Angriff nahmen.
Mr. Horwood hatte gesagt, die Siedlung Trinity Bay sei inzwischen ein Hafen namens Cairns, und Mal bedauerte, dass die China Belle diesen nicht ansteuerte, damit er Jun Lien die malerische Bucht zeigen konnte, die seinem Leben beinahe einen anderen Verlauf gegeben hätte.
»Als ich die Bucht mit den hohen geheimnisvollen Bergen im Hintergrund sah«, erklärte er Horwood, »hätte ich meine Chinareise um ein Haar abgebrochen. Wäre dort beinahe an Land gegangen, um mich ein bisschen umzuschauen, wollte ein Pferd kaufen und die Gegend erforschen, aber letzten Endes erschien mir die Chinareise dann doch als das größere Abenteuer.«
Doch nach ein paar Jahren beschlich ihn das Heimweh nach dem Busch, und er bereitete schon die Heimkehr nach Australien vor, als man ihn mit Jun Lien, Mr. Xius Enkelin, bekannt machte und er sich Hals über Kopf in sie verliebte. Und dann wurde er in das komplizierte Intrigenspiel der Familie hineingezogen, als man ihm zuflüsterte, dass Jun Lien ihn attraktiv fand. Und liebenswert. Er errötete noch immer beim Gedanken an diese Eröffnung.
Er hatte vier Monate gebraucht, wie er sich warm erinnerte, bis er die Erlaubnis erhielt, sich öffentlich mit ihr zu treffen, wenn auch nur unter den Augen verschiedener Tanten. Er hatte ihr monatelang in aller Form den Hof gemacht, um dann um ihre Hand anzuhalten, und das zog allerlei Streit und Ärger nach sich, bis Mr. Xiu schließlich zustimmte, allerdings unter einem Vorbehalt, der Mal in Erstaunen versetzte.
»Sie liebt dich innig, und ich sehe wohl, dass du Jun Lien verehrst, und deshalb soll die Hochzeit stattfinden. Du wirst in Peking im Haushalt der Wongs bei ihrer Familie wohnen, damit ihre Eltern diese Verbindung ruhigen Herzens akzeptieren lernen, und nach sechs Monaten packst du deine Sachen und ziehst mit deiner Frau nach Australien.«
»Wie bitte?« Mal hatte gehofft, dass es eines Tages so kommen würde, hatte aber nicht gewagt, diesen Vorschlag zu äußern. Es war schon schwer genug gewesen, die Erlaubnis zu erringen, dass Jun Lien einen Fremden heiratete.
»Schwere Zeiten liegen vor uns«, sagte Mr. Xiu. »Ernste Probleme. Es würde mich sehr beruhigen, Jun Lien in deinem Land in Sicherheit zu wissen. Ich habe die Frage mit ihrem Vater besprochen, und er ist einverstanden. Danach löst er seinen Haushalt auf und zieht sich auf seinen Landsitz zurück, wo er dem Schlimmsten zu entkommen hofft, aber wir sind nicht sehr optimistisch.«
Juns Mutter, Xiu Ling Lu, eine stolze starke Frau, war nicht so leicht zu überzeugen, doch als Mal versicherte, ohne ihren Segen würden sie nicht abreisen, kapitulierte sie und nahm ihm das Versprechen ab, dass er ihre Tochter unter Einsatz seines Lebens beschützen würde.
Mal lächelte in Gedanken daran, wie überrascht und gleichzeitig erfreut Ling Lu war, als sie hörte, dass Mal nicht in Betracht zog, sich eine weitere Frau oder Konkubine zu nehmen. Und dadurch hatte er sie, wie Jun verriet, gewonnen.
Jetzt hielt er es für angebracht, sich endlich zum Dinner zu begeben, doch als er sich umwandte, hörte er etwas, das wie das Rascheln von trockenem Laub klang, etwas, das sich im Busch regte, aber natürlich war hier nicht der Busch, sondern nur der kahle Umriss des hölzernen Decks und keine Menschenseele weit und breit.
Mal schauderte. Jun Lien war die Liebe seines Lebens. Er betete sie an. Er hielt sich für den glücklichsten Menschen auf der Welt, weil er dieses liebliche, schöne Mädchen gefunden und geheiratet hatte. Berauscht vor Glück, nicht ständig auf der Lauer liegend. Vielleicht hatte Jun Lien Recht. In China hatte er zu viel Intrigen erlebt, besonders in den Wochen vor ihrer Abreise, und deshalb zuckte er jetzt bei jedem Geräusch zusammen.
Er erinnerte sich an das erste Mal, als es ihnen gelang, den stets wachsamen Augen zu entkommen und sich in seinem abgelegenen Orangenhain zu treffen, und an seine Freude, sie endlich in seinen Armen halten zu dürfen. Doch die Art, wie sie reagierte, traf ihn unvorbereitet; er konnte kaum fassen, dass er ihr so viel bedeutete, und fürchtete, dass alles nur ein Traum war im Nebel der fremdartigen, farbenfrohen Umgebung.
Später, als die Etikette es zuließ, saßen sie oft im Mondgarten und lachten, während Jun vorgab, ihm klassische chinesische Gedichte vorzulesen, während sie in Wirklichkeit ihr idyllisches Leben in Australien planten. Mal liebte es, das Strahlen in ihren Augen zu sehen, wenn er ihr von der großen Schaffarm erzählte, die er zu kaufen gedachte, auf der sie die Herrin über alle, ihren Gatten eingeschlossen, sein sollte.
Mal lächelte, er liebte die Art, wie sie über diese Geschichten leise perlend lachte.
Typisch Mal, dachte seine Frau nervös. Er musste sich vergewissern, ob alles in Ordnung war, bevor er sich selbst Ruhe gönnte, doch er verstand offenbar nicht, dass sie sich unter diesen englischen Leuten noch befangen fühlte. Zumal keine weiteren Chinesen zu ihrer moralischen Unterstützung zugegen waren.
Gewöhnlich war Jun Lien, wie ihre Mutter auch, ausgesprochen selbstbewusst. Sie war sehr gebildet in kulturellen Dingen und sprach fließend Englisch. Xiu Tan Lans starker Wille hatte sie vor eingeschnürten Füßen und einer Verheiratung im Kindesalter bewahrt, und sie durfte, was ihren Vater zur Verzweiflung trieb, auf Familien- und Geschäftskonferenzen stets offen ihre Meinung äußern, doch hier, auf dem Schiff, in einem Raum mit lauter Engländern, war sie furchtbar schüchtern und blickte sehnsüchtig auf die Tür, die zum Deck führte. Um sich von ihrem Problem abzulenken, versuchte sie herauszufinden, woher diese Leuten kamen, eingedenk Mals Behauptung, dass nicht alle Engländer waren.
»Ich bin Australier«, erinnerte er sie. »Mr. Lewis ebenfalls – Mr. Raymond Lewis. Er ist Abgeordneter des Parlaments von Queensland. Die übrigen sind Engländer, glaube ich.«
Mrs. Plummer war zu ihr getreten, um sich mit ihr zu unterhalten – um sie zu retten, wie Jun Lien es nach der Vorstellung empfand.
»Sie sprechen so weich«, sagte die ältere Dame. »Es ist eine Freude, Ihrer Stimme zu lauschen. Lassen Sie sich von diesen lärmenden englischen Stimmen nicht einschüchtern.«
»Bitte verzeihen Sie meine Neugier, Mrs. Plummer, aber ich übe mich darin, verschiedene Akzente zu unterscheiden. Sie sprechen zwar englisch, aber es klingt anders als bei den anderen.«
»Das liegt daran, dass Englisch nicht meine Muttersprache ist. Ich bin in Deutschland geboren.«
»Oh! Ich verstehe. Ich glaube, Deutschland ist wunderschön.«
»Ja, es ist schön. Aber sagen Sie, was ist Ihr Reiseziel? Es ist ungewöhnlich, eine junge Chinesin so fern ihrer Heimat auf Reisen zu sehen …«
Als Willoughby gegangen war, wurde Tom nervös. »Glaubst du, er hat was gehört?«
»Was soll er denn gehört haben? Dass wir unterschiedlicher Meinung über unsere derzeitige Position sind? Aber ich glaube, du hast Recht. Wir müssen weiter, ich schätze, wir könnten es lange vor Tagesanbruch schaffen.«
»Ich glaube immer noch, dass Willoughby uns auf die Schliche gekommen ist. Er spioniert doch ständig herum.«
»Nein, ist er nicht. Das ist nur dein schlechtes Gewissen … ganz eindeutig. Willoughby ist ein Buschläufer, falls du weißt, was das bedeutet. Er ist es gewohnt, im Busch umherzustreifen, er kennt seine Umgebung wie seine Westentasche, und weißt du auch, warum?«
»Nein.«
»Weil es im Busch nichts anderes zu tun gibt!« Tussup lachte dröhnend. »Das stört ihn hier. Er hat nichts zu tun, und deshalb rennt er herum wie ein Tiger im Käfig.«
»Wenn er dabei wenigstens auf dem Kajütsdeck bleiben würde. Er macht mich nervös. Hast du mit dem Bootsmann gesprochen?«
»Ja. Ist aber zwecklos. Er ist gegen uns.«
»Was?«, fuhr Tom hoch. »Du hast gesagt, er würde mit beiden Händen zugreifen, weil er doch ständig über den erbärmlichen Lohn mault, den die Oriental zahlt.«
»Nun, dann hab ich mich eben geirrt.«
»Himmel! Und jetzt? Wie kannst du so ruhig dastehen …«
»Ach, reg dich nicht auf. Ich habe ihn in einer freien Kabine eingeschlossen.«
Tom sprang auf, im Begriff, zur Tür zu stürzen. »Was hast du? Er schlägt die Tür ein. Du bist verrückt, Tussup.«
»Um Himmels willen! Ganz so verrückt bin ich nicht. Ich habe dafür gesorgt, dass er keinen Mucks von sich gibt.«
»Was soll das heißen? Du hast gesagt, wir würden keine Gewalt anwenden.«
Tussup seufzte, verärgert über diesen dummen Schwächling. »Er ist gefesselt und geknebelt. Keiner wird ihn vermissen, bis wir so weit sind, also beruhige dich endlich. Unser Plan läuft wie am Schnürchen. Da kann gar nichts schief gehen. Alles ist klar, bis auf die Tatsache, dass der verdammte Loveridge beschließen musste, über Nacht vor Anker zu bleiben und so die Fahrt zu verzögern. Beinahe hätte ich deswegen Streit mit ihm gekriegt.«
»Gut, dass es dazu nicht gekommen ist. Er nimmt es ziemlich krumm, wenn die Mannschaft seine Befehle in Frage stellt.«
»Ach, wirklich?« Der Australier lachte. »Dann wird er bald Grund haben, so manches ganz gehörig krumm zu nehmen.«
Jake Tussup war im Busch geboren, vor dreißig Jahren, auf einer öden, windgepeitschten Farm in den Hügeln hinter Goulburn. Seine Eltern, beide Fabrikarbeiter, waren im Rahmen des Immigrationsprogramms der anglikanischen Kirche nach Australien gekommen. Sie träumten von endlosen Sonnentagen, ihrer eigenen kleinen Farm, davon, selbst Herr im Hause zu sein, von unbeschwerten rosigen Kindern, Obstgärten, die überquollen von Früchten, Orangen und Zitronen, sogar Bananen und, Inbegriff des Exotischen, Ananas. Der Traum hielt sie aufrecht während der langen, erbärmlichen Reise übers Meer, und je mehr sie über das bevorstehende Leben redeten und schwärmten, desto mehr gingen sie in ihren Träumen ins Detail. Sie entwarfen das Haus: Backstein mit Sprossenfenster und Efeu an den Mauern, ein Tor in der Hecke, das durch sein Knarren vor Besuchern warnte …, und sie lachten viel und gern, wenn sie überlegten, wie sie das Tor zum Knarren bringen könnten.
Die Realität traf sie hart. Sie konnten beide weder lesen noch schreiben, hatten jedoch bereitwillig ihre Kreuzchen unter den Vertrag gesetzt, der ihnen freie Überfahrt gewährte, denn stimmte es etwa nicht, dass freie Siedler Land zugewiesen bekamen? Schwer zu glauben, aber es entsprach der Wahrheit, versicherte man Tessie und Ted Tussup. Man bekam Land einzig und allein fürs Kommen, denn es gab ja so viel davon und nicht genug Menschen, die es bewohnten und die Franzosen fern hielten. Und man bekam ungefähr vierzig Morgen, wie sie gehört hatten, wenn sie auch keine Ahnung hatten, wie viel ein Morgen war, aber solange es genug war, um ein Haus darauf zu bauen und ein paar Äcker anzulegen, würden sie zugreifen. Auf jeden Fall!
»Nichts kann uns aufhalten«, sagte Tessie fest.
Der Vertrag enthielt noch eine weitere Klausel – nämlich, dass Ted zwei Jahre lang eine Beschäftigung an einer ihm zugewiesenen Arbeitsstelle ausüben musste, sonst …
»Sonst müssen wir die Überfahrt bezahlen«, jammerte Ted, als er an ihrem dritten Tag in Sydney seiner Frau die schlechte Nachricht überbrachte.
Sie kamen vorübergehend in einem Obdachlosenasyl am Hafen unter, was nach Tessies optimistischer Meinung gar nicht übel war. Immerhin stimmte es, was sie über die Sonnentage gehört hatten. Es war warm in Sydney, und es war schön, durch die Straßen zu schlendern, ohne angerempelt zu werden, und die tollen Lebensmittel auf den Märkten zu bewundern.
Bald war auch über den Arbeitsplatz entschieden. Edward Tussup erhielt Anweisung, sich im Gefängnis von Darlinghurst als Wärter zu melden.
»Und wo ist das, Sir?«, fragte Ted, die Mütze in der Hand, den Beamten.
»Weit, weit weg, Kumpel. Am Samstagmorgen um sechs Uhr holt der Lastwagen dich hier ab.«
»Und Mrs. Tussup, meine Frau, Sir? Gibt es für sie auch Arbeit in diesem Gefängnis, Kochen, Putzen oder etwas in der Art?«
Der Beamte warf einen Blick auf Mrs. Tussups gewölbten Leib. »Nicht unter diesen Umständen.«
»Aber sie kann doch trotzdem mitkommen? Auf dem Lastwagen?«
»Ja, wenn sie das Rütteln und Holpern aushält, aber dann musst du sie da draußen irgendwo unterbringen.«
»Nun ja, das ist immerhin ein Anfang«, tröstete Ted seine Frau. »Es ist gar nicht so schlecht, sofort eine Stelle zu bekommen. Da können wir für unsere Farm sparen.«
»Ja. Ich glaube, es ist sogar besser so, Ted. Ohne Geld wäre es sehr schwer, eine Farm aufzubauen. Wir suchen uns eine Unterkunft in der Stadt, und wenn das Baby da ist, kann ich auch arbeiten.«
An jenem höchst bedeutsamen Samstagmorgen saß Tessie vor dem Gefängnis auf einem Stein, während Ted zu einem Vorstellungsgespräch mit Sergeant Skorn hineingeführt wurde. Er wurde hochoffiziell registriert als Wärter im Gefängnis Ihrer Majestät in Goulburn in der Kolonie Neusüdwales. Man hielt ihm einen Vortrag über seine Pflichten und über den Distrikt Goulburn, der laut Skorns Erklärung ein Zentrum des aus Wolle und Viehzucht gewonnenen Wohlstands sei.
Der Sergeant hört sich wohl gern reden, dachte Ted, bemerkte jedoch Tessie gegenüber: »Ich bin höflich geblieben, obwohl ich kaum noch sitzen konnte auf dem harten Stuhl.«
Es kam ihm vor, als hätte Skorn einen Spleen hinsichtlich der Hierarchie in der Gefängniswelt. Er wies ihn nämlich an, sobald er in Goulburn wäre, nicht zu vergessen, dass er sich von der Towrang-Meute fern halten sollte. Dabei handelte es sich offenbar um eine Strafkolonie, eine Baustelle, auf der Strafgefangene arbeiteten, bewacht von einem in Goulburn stationierten Regiment.
»Und mach auch einen Bogen um die Polizei. Der Bezirk Goulburn und die Hügel drum herum wimmeln von Buschkleppern. Aus diesem Lager brechen immer wieder Sträflinge aus, verstehst du?«
Ted nickte.
»Deswegen gibt es dort ein großes Polizeiaufgebot. Hauptsächlich berittene Polizei. Sie haben ein Gerichtsgebäude und einen Knast, ihre eigenen Hütten und Häuschen und sogar eine Polizeikoppel für ihre Ersatzpferde. Werden behandelt wie Prinzen, diese Soldaten und Bullen, aber wir haben nichts mit denen zu schaffen. Verstanden?«
»Ja, Sir.«
»Lass dich nicht mit denen ein. Was in unseren Gefängnissen vor sich geht, hat nichts mit denen zu tun. Wir haben gewöhnliche Sträflinge in unseren Gefängnissen, nicht diese Schwerverbrecher. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie alle ersäufen, bevor sie überhaupt dort ankommen. Einfach über Bord stoßen. Also, hier musst du unterschreiben …«
Es dauerte nicht lange, bis Ted der Witz zu Ohren kam, dass Skorns Großeltern Sträflinge gewesen waren, wenngleich er das nie zugab. Sie verbüßten ihre siebenjährige Strafe und ließen sich dann in den Randbezirken von Sydney als Milchbauern nieder.
Der von vier Pferden gezogene Wagen hatte hohe Bretterseiten zum Schutz der Passagiere, die auf der Ladefläche zwischen Säcken voll Zucker und Mehl saßen. Als einzige Frau auf dieser Fahrt durfte Tessie vorn beim Kutscher sitzen, was ihr ganz recht war, denn zwischen den anderen Reisenden herrschten Spannungen, wie sie nervös bemerkte. Augenscheinlich weigerte sich der Gefängniswärter, der Ted begleitete, mit aneinander geketteten Sträflingen und deren Polizeieskorte zu reisen, doch er wurde überstimmt.
»Hat sowieso nichts zu sagen«, erklärte der Kutscher Tessie. »Polizisten stehen rangmäßig über den Wärtern.«
Sie schaute sich um und sah sechs Männer mit schwarzgelb gestreifter Gefängniskluft unter den wachsamen Augen und Schlagstöcken von vier Polizisten unbeholfen auf den Wagen steigen. Als alle einen Platz gefunden hatten, brach man auf.
»Wo genau liegt Goulburn?«, fragte sie den Kutscher.
»An der Great South Road, Missus. Etwa hundertundzwanzig Meilen von hier, mit etwas Glück.«
»Nie im Leben!«, hauchte sie. »Wir hatten keine Ahnung, dass es am anderen Ende des Landes liegt. Das hat mein Ted nicht gewusst!«
Sie drehte sich um und versuchte, Ted auf sich aufmerksam zu machen, doch er wurde vom breiten Rücken eines Sträflings verdeckt.
»O Gott«, sagte sie.
»Ist nicht so schlimm, Missus. So lernen Sie das Land kennen. Ist wirklich schön. Diese Sträflinge, die tun Ihnen schon nichts. Die armen Kerle, entschuldigen Sie, aber für sie ist es wie Urlaub, auch wenn sie Fußeisen tragen. Sie werden da rausgeschafft, um Straßen und Brücken zu bauen. Weiß nicht, was wir ohne sie tun würden.«
»Aber es ist dunkel, bevor wir ankommen.«
Er lachte. »Nein, ich sorge schon dafür, dass wir die Etappe des letzten Tages bis Mittag geschafft haben.«
»Wieso des letzten Tages?«
»Solange es nicht regnet, kommen wir gut voran – aber wenn es wie aus Eimern schüttet, weichen die Straßen so auf, dass sogar die Enten stecken bleiben. Wir übernachten in Gaststätten oder Wagenschuppen. Die Wärter kriegen die Übernachtungen bezahlt, also machen Sie sich keine Sorgen. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie die Fahrt.«
»Genießen«, schnaubte sie noch des Öfteren während der holprigen Reise über Sandwege, durch dichten Busch, beim Durchqueren von Furten und Umfahren von Hügeln. Manchmal stieg sie ab, um sich die Beine zu vertreten und steile Hügel hinaufzuklettern, während die Männer den Wagen schoben, und dann wieder stemmten sich alle zurück, wenn es steil bergab ging, und hielten mit Seilen den Wagen zurück, damit er nicht die Pferde überrollte.
Trotz ihrer Haube zog Tessie sich einen Sonnenbrand im Gesicht zu, und ihr einziges gutes Kostüm verstaubte völlig, doch die Reisegefährten waren fröhlich, besonders die Sträflinge, wie der Kutscher es vorausgesagt hatte, und als sie schließlich die Hauptstraße von Goulburn entlangfuhren, waren sie ein recht munterer Haufen.
Als sie wieder einmal neben einer Ochsenkarawane hielten, die Proviant und Waren transportierte, verspotteten die Sträflinge die Ochsenführer als Feiglinge, die Angst vor ihrem eigenen Schatten hätten, und schlimmer. Die Wachen lachten.
Die Tussups fanden Unterkunft in einem Schuppen hinter der Getreidemühle, in der Tessie nach Jakes Geburt arbeitete, doch zu ihrer großen Enttäuschung wurde es im Winter bitterkalt in Goulburn. Es schneite sogar. Im Schuppen herrschten eisige Temperaturen, und der Säugling zog sich eine Erkältung nach der anderen zu.
Noch vor ihrem zweiten Winter bewarb Ted sich um eine Landzuweisung, musste jedoch erfahren, dass dieses Vorgehen eingestellt worden war und das Regierungsland jetzt blockweise versteigert wurde.
Als Jake fünf Jahre alt war, hatten sie genug Geld gespart, um sich ein großes Stück Land an einem Hügel mehrere Meilen von der Stadt entfernt zu kaufen. Sie stellten fest, dass die Regel, die Wärtern den Kontakt mit Polizei und Soldaten verbot, einzuhalten war, das allgemeine Verbot des privaten Austausches zwischen Bevölkerung und Strafgefangenen jedoch ignoriert wurde. Wo man ging und stand, traf man auf diese Männer mit Hacke und Schaufel, und es war unvermeidlich, sie namentlich kennen zu lernen.
Ted pflegte sie stets auf die landesübliche Weise zu grüßen und erfuhr bald mehr über sie. Die »Siebenjährigen«, die »leichte« Strafen für Delikte wie Diebstahl eines Laibs Brot oder tätlicher Angriff abbüßten, brauchten keine Fußeisen zu tragen. Sie betreuten die Pferde, fällten Bäume und transportierten Proviant. Die Kettengangs hatten härtere Strafen, und einige von diesen Männern waren gemeingefährlich. Viele jedoch waren im Grunde Exilierte, abgeschoben von Regierungsbeamten, die meinten, politische Aufrührer, unbelehrbare Dissidenten und ähnliche Subjekte nähmen in den ohnehin schon überfüllten Gefängnissen zu viel Platz weg. Jetzt allerdings, nachdem sie, sofern sie nicht ausbrechen konnte, quer über die Welt verschleppt wurden, hatten die Sträflinge Spaß daran, sich der Autorität zu entziehen. Sich gegen das System aufzulehnen war gang und gäbe in der Sträflingsgemeinschaft, und als Ted dies bewusst wurde, verstand er auch, warum die einheimischen Kriminellen von den überführten getrennt gehalten wurden.
Gleichzeitig bildeten ihre »gegen die Regierung gerichteten Aktivitäten«, wie man es nannte, eine Quelle der Erheiterung in den lokalen Gemeinden, und Geschichten vom Wagemut der Sträflinge, manchmal wahr, manchmal auch übertrieben, machten die Runde.
Als Ted anfing, sein Haus zu bauen, fand er heraus, dass es billige, von Sträflingen hergestellte Backsteine zu kaufen gab und dass die Sträflinge, die vorbeikamen, sich für seine laienhaften Anstrengungen interessierten. Sie gaben ihm Ratschläge, zeichneten Pläne für ihn in den Schlamm, zeigten ihm, wie er den Schornstein mauern musste, wie er mit Lehm beworfenes Flechtwerk einsetzen und sogar, wie er billige Möbel zimmern konnte. Ihre Wärter betrachteten diese kleinen Ablenkungen, sofern ihnen Brot und Käse und Tee angeboten wurde, mit Interesse, so dass das Tussup’sche Zwei-Zimmer-Haus in freundlicher Stimmung Fortschritte machte und binnen Wochen fertig wurde.
Im Sommer war es heiß, und das lehrte die Familie, unter einer Markise zu schlafen. Im Winter wurde Feuer im Ofen gemacht, und die Tussups waren glücklich. Ted hatte sich ein ausgedientes Viehtreiber-Pferd zugelegt, mit dem er täglich zur Arbeit ritt, und Tessie legte mit Hilfe der Ratschläge aller, die ihr begegneten, seit die Sträflingsarbeiter weitergezogen waren, einen Gemüse- und Obstgarten an. Und abends, wenn Ted zu Hause war, saßen die drei Tussups vor ihrer Haustür und blickten über das Tal hinweg, froh, endlich in der wachsenden Gemeinde Fuß gefasst zu haben.
Dennoch tat Ted sein Bestes, um sich von Soldaten und Polizisten fern zu halten. Der Oberwärter im Gefängnis wurde nicht müde, diese Warnung zu wiederholen.
»Und dazu hat er jeden Grund«, erklärte Ted seiner Frau. »Die Betrügereien, die er sich erlaubt, sollten mal polizeilich untersucht werden. Er kürzt den Sträflingen die Rationen, und jeder Galgenvogel kriegt Straferlass, wenn er dafür bezahlen kann. Sogar Huren, wenn sie Geld haben.«
Als sie dies hörte, war Tessie eher beunruhigt als schockiert. »Was sagen die anderen Wärter dazu?«
»Wenn sie schlau sind, machen sie mit.«
»Und du?«
»Ich sitze zwischen den Stühlen, Schatz. Ich sollte mich um eine Versetzung bemühen, aber wir haben hier unser Häuschen …«
Einige Jahre später, als auf den rachsüchtigen Abschiedsbrief eines Insassen hin, der im Gefängnis zu Goulburn gehängt worden war, die Polizei sich mit der Untersuchung der Korruption im Gefängnis befasste, wurden der Oberwärter und einige seiner im selben Netz gefangenen Untergebenen verhaftet und vor Gericht gestellt. Die meisten von ihnen, der Oberwärter eingeschlossen, erhielten Haftstrafen, die in Sydney abzuleisten waren.
Ted wurde nur wegen geringfügiger Vergehen belangt, die letzten Endes ad acta gelegt wurden, doch er verlor seine Stelle und war danach als Aushilfsarbeiter auf die Gnade der Stadtbewohner angewiesen, die bereits unter einer Wirtschaftskrise litten.
Der kleine Tussup scheute keine schwere Arbeit, als die Tussups sich derartig plagten, doch seine Eltern bestanden darauf, dass er die staatliche Schule am Ort besuchte, und sie achteten streng darauf, dass er keinen Tag versäumte.
Trotz ihrer Rückschläge hielt das Trio fest zusammen, und Jake freute sich stets auf den Sonntag, wenn er und sein Vater Jagdausflüge unternahmen und Kaninchen und Wildenten und Wachteln schossen. Die Beute versorgte sie zumindest mit einer guten Mahlzeit, bevor sie Tessie den Rest überlassen mussten. Sie bereitete das Fleisch zu, und Jake verkaufte es auf dem Weg zur Schule in der Stadt. Im Alter von dreizehn Jahren galt er als guter Schütze und hatte bereits einige Wettkämpfe gewonnen und eine Trophäe eingeheimst, die er postwendend an einen anderen Jungen verkaufte.
Etwa zu dieser Zeit brachen bessere Zeiten für die Familie an. Ted fand Arbeit als Maurer, und Jake ging zu einem Bäcker in die Lehre.
Tessies Gemüsegarten gedieh, und als sie eines Tages zwischen ihren Tomatenpflanzen arbeitete, kam ein Reiter vorbei und bat sie um eine Kleinigkeit zu essen.
»Ich komme um vor Hunger, Missus. Ich kann Ihnen zwar heute nichts bezahlen, aber ich bin es gewohnt, meine Schulden zu begleichen.«
Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Nicht nötig. Sie sehen völlig erschöpft aus. Setzen Sie sich drüben beim Wassertank in den Schatten, dann mache ich Ihnen Tee und sehe nach, was die Vorratskammer hergibt.«
Er nannte seinen Namen nicht, und Tessie fragte ihn auch nicht. Sie ließ ihn in Frieden seinen Tee trinken und ein Käsebrot essen, denn er sah wirklich sehr mitgenommen aus. Zu ihrer Verwunderung schlief er dann ein, ausgestreckt im langen Gras, und sie nahm sein Pferd am Zügel, ein Tier, das besser genährt aussah als sein Besitzer, und führte es zum Trog, wo es gierig trank. Sie band es an einem Posten an und ging zurück an ihre Arbeit.
Eine Stunde später näherte der Fremde sich ihr so geräuschlos, dass Tessie zusammenfuhr, doch er bedankte sich nur und wollte sich wieder auf den Weg machen.
»Hier«, sagte sie. »Stecken Sie sich ein paar Tomaten in die Tasche, Sir. Die schmecken gut.«
»Sehr freundlich von Ihnen, Missus.« Er nahm die Früchte dankend an.
Am Tor drehte er sich um und winkte ihr zu, und Tessie atmete erleichtert auf. Sie hatte die von Fußeisen stammenden Narben an seinen Knöcheln gesehen, und sie wusste, dass er ein Zuchthäusler war, hatte jedoch keine Ahnung, ob er seine Zeit abgeleistet hatte oder geflohen war.
»Geht mich nichts an«, sagte sie zu sich selbst. Aber sie hätte schon gern gewusst, wer der Fremde war.
Ted wusste es, und als er seine Frau aufklärte, platzte Jake fast vor Aufregung.
»Er war hier, Ma? Dinny Delaney?«
»Sieht ganz so aus. Es war ein Ire, ein kräftiger Kerl mit schwarzem Haar und schwarzem Bart, schon grau gesprenkelt.«
»Er ist berühmt! Ein Buschklepper. Hat drüben in den Hügeln seine Bande.«
Tessie zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, was er dann hier zu suchen hatte. Er scheint nicht sehr erfolgreich zu sein. Hungrig wie ein Wolf war er.«
»Er war in der Stadt, Mutter«, erklärte Ted. »Um sein Liebchen zu besuchen, wie man so hört. Aber irgendwer hat ihn verraten, und Sergeant Hawthorne hätte ihn beinahe geschnappt. Hat ihm immerhin sein Pferd abgejagt, und Delaney musste zu Fuß flüchten. Sie suchen ihn schon seit Tagen, also wird er sich wohl versteckt haben.«
»Genau!«, rief Jake. »Er hat sich versteckt, und sein Hunger wurde immer größer, bis er die Möglichkeit hatte, ein Pferd zu klauen.«
»Das Pferd war gestohlen?«, fragte Tessie.
»Ja. Aus Porky Grimwades Stall. Hat Delaney gesagt, wohin er will?«
»Hör gut zu«, sagte Ted streng. »Er ist nie hier gewesen, stimmt’s, Mutter? Du hast überhaupt keinen Fremden gesehen.«
»Keine Menschenseele«, antwortete sie und blickte Jake streng an. »Seit es die neue Straße gibt, sehen wir nie Leute auf diesem Weg hier. Vergiss das nicht! Prahl nicht mit der Geschichte vor deinen Freunden, und bring mich nicht in Schwierigkeiten. Wahrscheinlich war er es sowieso nicht.«
Jake nickte grinsend. Er hätte seinen Freunden ohnehin nichts erzählt, denn Dinny Delaney hatte ja gesagt, er würde zurückkommen, um fürs Essen zu bezahlen. Und Jake war sicher, dass er das tat. Er konnte es kaum erwarten.
Und er behielt Recht. Eines frühen Samstagmorgens ritt Delaney den Hügel hinauf. Wie ein Gespenst im Nebel, dachte Jake und rannte ihm entgegen.
»Ist dein Dad zu Hause?«, fragte der Buschklepper.
»Mein Dad? Ja.« Jake stürmte ins Haus, doch Ted war bereits auf dem Weg nach draußen, das Gewehr in der Hand.
»Himmel, Dad, du wirst ihn doch nicht erschießen!«, schrie Jake.
Ted drängte sich an ihm vorbei. »Beruhige dich. Ich will nur dafür sorgen, dass er mich nicht erschießt.«
»Nicht schießen!«, schrie Delaney. »Ich bringe was für Ihre Missus. Nur ein paar Kleinigkeiten, weil sie freundlich zu einem Fremden war, und zwei Shilling für mein Mittagessen.«
Nach Teds Meinung sah er in seiner Schaffelljacke, mit dem säuberlich gestutzten Bart und dem breitkrempigen Lederhut eher wie ein Siedler aus, nicht wie ein Buschklepper. »Sie sind Delaney?«, fragte er nervös.
»Zu Ihren Diensten, Sir«, erwiderte der Fremde, schwang sich behände aus dem Sattel und schnallte eine Satteltasche auf. »Ich habe hier ein wenig Waldhonig und eine Dose mit Kaffeebohnen, und die zwei Shilling.«
Er überreichte die Gaben, und um sie entgegenzunehmen, musste Ted sich der Büchse entledigen, die er behutsam neben der Haustür an die Mauer lehnte.
»Und ob ich wohl ein Wörtchen mit Ihnen reden könnte, Sir?«, bat Delaney.
»Worüber?«
»Geschäftliches. Darf ich reinkommen? Ich mache Ihnen keine Umstände.«
»Na gut.« Ted mochte Delaney auf Anhieb. Er war ein netter Kerl – und höflich obendrein.
Er wandte sich Jake zu, der um sie herumstrich, um etwas von dem Gespräch aufzuschnappen. »Du bleibst hier.«
Delaney erkannte Jakes Enttäuschung und lachte. »Ich wäre dir dankbar, wenn du ein bisschen die Augen aufhalten könntest, Junge.«
Tessie bedankte sich und setzte den Kessel auf. Genauso wie Ted hatte sie dem Mann nichts vorzuwerfen; das war Sache der Gerichtsbarkeit, und der brachte man in dieser Gegend ohnehin nicht viel Respekt entgegen.
Sie redeten übers Wetter und über die auf den Hügeln verstreut grasenden Schafe.
»Hab noch nie im Leben so viele Schafe gesehen«, sagte Delaney.
»Ich auch nicht«, bestätigte Ted. »Man sagt, Grimwade hätte über tausend auf seinem Land.«
»Tatsächlich. Das ist ’ne ganze Menge, wie?«
Ted nickte. Tessie stellte drei Tassen auf den Tisch und die Zuckerdose samt Löffel. Und den kleinen Milchkrug. Und einen Teller mit Keksen. Delaney nickte und griff mit dankbarem Lächeln zu.
»Es geht um Folgendes«, sagte er zu Ted. »Ich hab einen Kumpel in der Stadt, der Proviant für mich kauft. Da, wo ich lebe, gibt es nun mal nicht viele Geschäfte. Und deshalb hab ich überlegt, ob er die Sachen nicht vielleicht in Ihrem Schuppen lassen könnte … Ich habe nämlich Vertrauen zu Ihnen, verstehen Sie? Sie müssten einfach nur die Augen zumachen, und ich sorge dafür, dass es Ihr Schaden nicht ist. Fünf Pfund für jedes Mal …«
»Könnte sein, dass meine Missus Angst hat«, setzte Ted an.