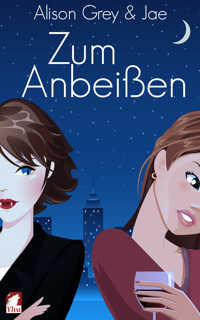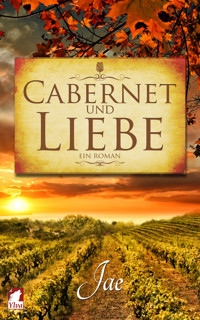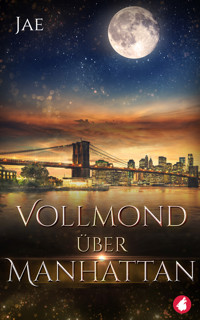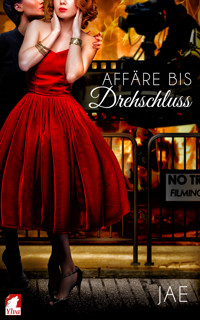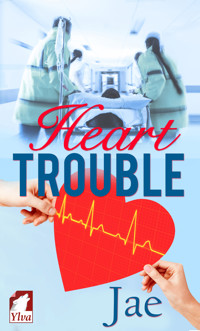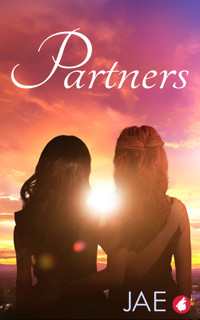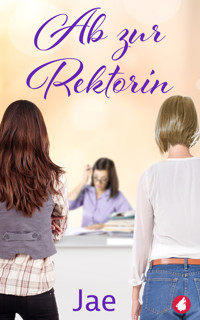Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ylva Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Freiburg-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine arrogante Großstädterin, eine sture Angestellte und eine aufdringliche Katze – ein humorvoller, romantischer Liebesroman über zweite Chancen, kleine Wunder und die Magie von Tinte und Papier. Susanne Wolff ist wenig erfreut, als sie für drei Monate von Berlin nach Freiburg ziehen soll, um den Schreibwarenladen ihres Onkels vor dem Bankrott zu retten. Freiburg ist ihr zu provinziell und Papier und Füller hält sie ohnehin für veraltet. Anja Lamm, die einzige Angestellte des Ladens, findet ihre arrogante neue Chefin auf Anhieb unsympathisch. Doch dank einer aufdringlichen Katze, eines Ausflugs zur Schreibwarenmesse in Frankfurt und einer Flotte Papierschiffe beginnt Anja bald, Susanne in einem neuen Licht zu sehen, und Susanne entdeckt, wie sexy Notizbücher, Tinte und eine gewisse sture Angestellte sein können. Am Ende der drei Monate steht Susanne vor einer Entscheidung: Soll sie wie geplant nach Berlin zurückkehren oder gibt es für sie und Anja eine Zukunft voller Tintenträume?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Von Jae außerdem lieferbar
DANKSAGUNG
VORWORT DER AUTORIN
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
Ebenfalls im Ylva Verlag erschienen
Über Jae
Sie möchten keine Neuerscheinung verpassen?
Dann tragen Sie sich jetzt für unseren Newsletter ein!
www.ylva-verlag.de
Von Jae außerdem lieferbar
Alles eine Frage der Chemie
Falsche Nummer, richtige Frau
Eine Mitbewohnerin zum Verlieben
Tintenträume
Ein Happy End kommt selten allein
Alles nur gespielt
Aus dem Gleichgewicht
Hängematte für zwei
Herzklopfen und Granatäpfel
Vorsicht, Sternschnuppe
Cabernet und Liebe
Die Hollywood-Serie:
Liebe à la Hollywood
Im Scheinwerferlicht
Affäre bis Drehschluss
Die Portland-Serie:
Auf schmalem Grat
Rosen für die Staatsanwältin
Die Serie mit Biss:
Zum Anbeißen
Coitus Interruptus Dentalis
Fair-Oaks-Serie:
Perfect Rhythm – Herzen im Einklang
Beziehung ausgeschlossen
Die Gestaltwandler-Serie:
Vollmond über Manhattan
Oregon-Serie:
Westwärts ins Glück (Band 1 & 2)
Angekommen im Glück
Verborgene Wahrheiten (Band 1 & 2)
DANKSAGUNG
Nach sechzehn Romanen, die mittlerweile von mir erhältlich sind, hat sich mein Team aus Betaleserinnen wunderbar eingespielt und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, ohne meine fleißigen Helferinnen ein Buch zu verfassen. Mein herzlicher Dank gilt meinen Betaleserinnen Christiane, Gaby, Melanie, Peggy, Pia, Sandra, Stephie und Susanne.
Außerdem möchte ich meiner Zwillingsschwester danken, die zwar wenig Ähnlichkeit mit der Zwillingsschwester in diesem Roman aufweist, aber trotzdem mindestens ebenso klasse wie Franzi ist.
VORWORT DER AUTORIN
Tintenträume ist eine Liebesgeschichte in mehr als nur einer Hinsicht. In diesen Roman sind viele der Dinge eingeflossen, die mir lieb sind: meine Familie, Haustiere, Schreibwaren und Freiburg im Breisgau.
Während meine bisherigen Romane alle in den USA spielen, habe ich mir für dieses Buch einen Handlungsort in Deutschland ausgesucht, nämlich Freiburg, die Stadt, in der ich lebe. Ich freue mich sehr darüber, einige der Plätze und Eigenheiten, die Freiburg so besonders machen, mit meinen Leserinnen und Lesern teilen zu können.
Viele schöne Lesestunden mit Susanne und Anja wünscht
Jae
KAPITEL 1
Bitte, bitte frag nicht, flehte Susanne in Gedanken.
Doch natürlich stellte ihre Mutter die Frage, noch bevor das Feuerwerk am Nachthimmel von Berlin-Charlottenburg völlig verblasst war. Susanne hatte es befürchtet. Immerhin wollte ihre Mutter schon seit ihrer Kindheit jedes Jahr an Silvester dasselbe von ihr und ihrer Schwester wissen. »Welche Vorsätze habt ihr für das neue Jahr gefasst?« Ihre Mutter lehnte sich gegen das Balkongeländer und sah zwischen Susanne und ihrer Zwillingsschwester hin und her.
Susanne stieß Franziska mit dem Ellbogen an. Komm schon, Schwesterherz. Hilf mir aus der Klemme.
Aber Franzi stupste sie nur ebenfalls an.
»Warum muss ich immer die Erste sein, die antwortet?«, grummelte Susanne.
»Weil du die Ältere bist«, sagte Franzi.
Susanne schnaubte. »Ja, um ganze sieben Minuten.«
»Acht. Und außerdem tust du sonst auch immer so, als wären diese paar Minuten fürchterlich wichtig.«
»Mädels«, sagte ihre Mutter. »Bitte keinen Streit am Silvesterabend.«
»Wir streiten doch gar nicht«, sagte Susanne.
»Du hast meine Frage noch nicht beantwortet.«
Mist. Susanne hatte gehofft, ihre Mutter würde sich ablenken lassen. Aber dieses Glück hatte sie nicht. Lügen kam nicht infrage. Ihre Mutter würde früher oder später die Wahrheit herausfinden und Susanne wollte sie nicht noch zusätzlich enttäuschen, indem sie schwindelte.
Rauchschwaden vernebelten die Sicht auf die Gründerzeitbauten auf der anderen Seite des Innenhofs, doch für Susanne gab es kein Verstecken im grauen Dunst.
Komm schon. Seit wann bist du ein solcher Angsthase? Normalerweise fehlte es ihr nicht an Selbstvertrauen. Erst vor wenigen Tagen war sie in das Büro ihres Chefs marschiert und hatte ihm die Kündigung auf den Tisch geknallt. Doch es ihrer Mutter zu gestehen, war etwas ganz anderes.
Franzi trat neben sie, sodass ihre Arme sich berührten, so als spürte sie, dass Susanne ihre Unterstützung benötigte.
»Dieses Jahr habe ich nur einen einzigen Vorsatz«, sagte Susanne.
Ihre Mutter winkte in einer Heraus-damit-Geste.
Susanne atmete tief durch. »Ich, ähm, werde morgen damit anfangen, mich nach einem neuen Job umzusehen.«
Ihre Mutter stellte ihr Sektglas ab, während Susanne sich krampfhaft an ihrem eigenen festhielt. »Sag nicht, du bist entlassen worden.«
»Nein. Ich habe gekündigt.«
In den Augen ihrer Mutter war das vermutlich noch schlimmer. Ihr Vater hatte es in keinem Job lange ausgehalten. Ständig hatte er neue Geschäftsideen, die alle innerhalb kürzester Zeit scheiterten.
Die Böller in ihrer Straße waren verklungen und die Stille schien plötzlich ohrenbetäubend.
»Ach, dein Chef war ohnehin ein Chauvinistenschwein.« Franzi zuckte mit den Schultern und tat, als wäre die Kündigung keine große Sache, aber es kam nicht ganz glaubhaft herüber. »Ich hätte schon vor langer Zeit gekündigt. Außerdem kannst du jetzt einen Job finden, bei dem du nicht ständig auf Achse bist, sondern mehr Zeit zu Hause verbringen kannst.«
Susanne warf ihr einen dankbaren Blick zu. Doch ihre Mutter würde das sicher anders sehen. Vielleicht würde sie sogar annehmen, dass Susanne ganz nach ihrem Vater kam.
Ihre Mutter griff blindlings nach ihrem Glas und leerte es in einem Zug. »Ach, das ist eigentlich sogar richtig gut.«
Susanne schüttelte den Kopf, als hätte sich etwas in ihrem Gehörgang festgesetzt. Sicher hatte sie sich verhört. Okay, wer bist du und was hast du mit meiner Mutter gemacht? »Tatsächlich?«, fragte sie mit einem zögerlichen Lächeln.
»Ja. Du musst dich nicht nach einem neuen Job umsehen. Ich habe schon etwas für dich im Auge.«
Oh, oh. Susanne warf ihrer Schwester einen Blick zu. Warum hatte sie bloß das Gefühl, dass sie nicht mögen würde, was ihre Mutter gleich sagen würde?
»Dein Onkel braucht Hilfe mit seinem Laden.«
Die Anspannung in Susannes Schultern ließ etwas nach. »Klar. Ich kann mich gern mal mit Onkel Bernhard treffen und ihm ein paar Tipps geben.«
»Ich rede nicht von Bernhard. Onkel Norbert braucht deine Hilfe.«
»Auch kein Problem. Ich kenne mich mit Schreibwaren zwar nicht aus, aber ich schätze, es ist auch nicht anders als andere Firmen. Ich rufe ihn morgen mal an.«
»Nein. Mit einem Anruf ist es nicht getan. Er braucht wirklich Hilfe, sonst ist er noch vor dem Frühling bankrott.«
Susanne hatte nichts von Onkel Norberts Problemen geahnt. Das lag wohl daran, dass sie wenig Kontakt mit ihm oder der Verwandtschaft auf der Seite ihres Vaters hatte. Wenig? Wohl eher so gut wie keinen. »Steht es wirklich so schlimm?«
Ihre Mutter nickte. »Ja. Deshalb möchte ich, dass du für eine Weile nach Freiburg ziehst.«
Jetzt war Susanne diejenige, die ihren restlichen Sekt in einem Zug austrank. »I-ich soll nach Freiburg ziehen?«
»Ja. Ich weiß gar nicht, warum du so entsetzt klingst. Es ist eine charmante kleine Stadt.«
»Ja, mit Betonung auf klein. Mama, ich bin an Berlin, London und Chicago gewöhnt. Freiburg ist mir zu klein. Zu provinziell. Wer immer der Stadt den Spitznamen Schwarzwaldmetropole verpasst hat, hatte einen in der Krone.«
Ihre Schwester grinste. »Kann man demjenigen nicht verdenken. Der Wein in Baden ist richtig gut.«
Susanne warf ihr einen düsteren Blick zu. »Ich ziehe nicht ans andere Ende des Landes, nur weil der Wein dort gut schmeckt. Wenn du Freiburg so toll findest, warum gehst du dann nicht?«
»Ich bin Zahnärztin. Falls Onkel Nobby nicht gerade eine Wurzelbehandlung braucht, kann ich ihm nicht helfen. Du hingegen bist als Unternehmensberaterin ideal für den Job.«
Na, herzlichen Dank, du Verräterin.
»Genau das habe ich auch gedacht.« Ihre Mutter strahlte. »Außerdem hast du deinen Onkel ohnehin schon viel zu lange nicht mehr besucht. Ich habe nie verstanden, warum du nie mitkommen wolltest.«
»Ich habe dir doch gesagt, dass ich zu …«
»Zu viel auf der Arbeit zu tun hattest. Ja, ich weiß.« Ihre Mutter winkte ab. »Aber jetzt hast du keine Arbeit mehr. Das passt perfekt. Du kannst dich nach einem neuen Job umsehen und ein wenig Zeit mit Onkel Norbert verbringen, während du ihm ein paar Monate mit dem Laden hilfst.«
»Ein paar Monate?« Susanne hatte eher an ein oder höchstens zwei Wochen gedacht.
»Nur bis Ostern.«
»Bis Ostern?« So langsam kam Susanne sich vor wie ein Papagei, der alles nachplapperte, was ihre Mutter sagte. Ihr Gehirn kam einfach nicht mit. Fast hätte sie meinen können, ihre Mutter hätte das alles schon geplant, bevor sie überhaupt von Susannes Kündigung erfahren hatte. »Aber das sind ja fast drei Monate!«
»Ja.« Ihre Mutter grinste noch immer, als hätte sie Onkel Norberts Probleme bereits im Alleingang gelöst. »Ende März ist das Wetter in Freiburg oft schon herrlich und du kannst noch ein paar schöne Wochen in der sonnigsten Stadt Deutschlands verbringen. Das wird sicher toll, meinst du nicht?«
Nur durch jahrelange Erfahrung am Verhandlungstisch gelang es Susanne, ihr Pokerface beizubehalten und nicht das Gesicht zu verziehen. Ja, ungefähr so toll wie die Wurzelbehandlung, die Franzi vorhin erwähnt hat.
»Onkel Norbert hat Freunde in der Wiehre«, fuhr ihre Mutter fort. »Er könnte dir helfen, dort eine Wohnung zu finden. Der Stadtteil hat dir sehr gefallen, als wir damals dort gewesen sind, weißt du noch?«
»Mama, ich war ein Kind. Ich habe mir vorgestellt, ich wäre eine Prinzessin und würde in einer der Jugendstilvillen darauf warten, dass ein Prinz vorbeikommt und mich rettet.« Sie schnaubte. »Ich habe schon keine Rettungsaktion mehr gebraucht und keinen Prinzen – oder sonst irgendeinen Mann – mehr gewollt, seit ich sechs war.«
Franzi zwinkerte ihr zu. »Ich hab gehört, die Frauen in Freiburg sollen auch ziemlich hübsch sein.«
»Ich ziehe da weder für den Wein noch für eine Frau hin.«
Ihre Mutter stellte ihr Sektglas beiseite, trat näher und legte beide Hände auf Susannes Schultern. Aus nur wenigen Zentimetern Entfernung warf sie ihr einen ihrer berühmten Blicke zu. Es war derselbe Blick, der Susanne und Franzi als Kinder dazu gebracht hatte, ihre Teller leer zu essen, selbst wenn sich darauf Spinat befunden hatte. »Er gehört zur Familie, Susanne.«
Niemand sonst betonte ihren Namen wie ihre Mutter. Susanne zuckte zusammen. »Ich weiß. Es ist nur …«
»Wenn du dich weigerst, ihm zu helfen, verliert er seinen Laden. Das würde ihm das Herz brechen. Der Laden ist sein ganzer Stolz und hat schon deinem Großvater gehört.«
Oh Mann. Susanne rieb sich das Gesicht. Wie konnte sie jetzt noch Nein sagen? »Aber nur bis Ende März, dann gehe ich wieder. Mach das bitte klar, wenn du mit Onkel Norbert redest.«
Strahlend drückte ihre Mutter Susannes Schultern und ließ dann los. »Mach ich. Keine Sorge. Es wird alles ganz wunderbar werden und ich helfe dir auch mit der doppelten Miete und den Umzugskosten.«
Susanne atmete tief durch und versuchte, die Sache positiv zu sehen. Vielleicht würde es ja wirklich nicht so schlimm werden. Immerhin hatte sie bei ihrer alten Firma genau dasselbe getan. Sie war an ihren Einsatzort gereist, hatte dort für Ordnung gesorgt und war wieder verschwunden, sobald das Problem gelöst war.
In Freiburg würde es sicher genauso laufen, denn schließlich gab es in dieser Provinzstadt nichts, was sie zum Bleiben bewegen könnte.
KAPITEL 2
»Sonnigste Stadt Deutschlands, dass ich nicht lache!«, murmelte Susanne, als sie aus der Straßenbahn stieg und den Regenschirm öffnete. Die Sonne hatte sie nicht für eine Sekunde gesehen, seit sie am Freitagnachmittag in Freiburg angekommen war. Das Kopfsteinpflaster in der Kaiser-Joseph-Straße, Freiburgs Haupteinkaufsstraße, war glitschig unter ihren Lieblingsstiefeln aus Wildleder und auf den Hügeln hinter der Altstadt lag sogar eine dünne Schneeschicht.
Den Straßenmusikanten, der an der Ecke Akkordeon spielte, schien das Wetter genauso wenig zu stören wie die Touristengruppe, die von einem jungen Mann in einem mittelalterlichen Kostüm durch die Stadt geführt wurde.
Susanne sah sich um, doch mehrere Leute, die aus einer weiteren Straßenbahn stiegen, versperrten ihr die Sicht. Jemand öffnete einen Regenschirm so abrupt, dass die Wassertropfen ihr ins Gesicht spritzten. Sie knirschte mit den Zähnen und zählte bis zehn, zuerst auf Deutsch, dann auf Englisch und schließlich in ihrem eingerosteten Schulfranzösisch.
Wieso zum Teufel hatte sie gedacht, es wäre eine gute Idee, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren?
Allerdings hatte sie kaum eine andere Wahl. Freiburgs Innenstadt war eine Fußgängerzone, die für Autos gesperrt war. In der Nähe einen Parkplatz zu finden, glich einem Lottogewinn. Deshalb hatte sie ihren BMW in der Tiefgarage gelassen. Nachher würde sie Onkel Norbert fragen, ob es in der Nähe des Ladens eine Parkmöglichkeit gab und wie sie eine Sondergenehmigung bekommen konnte, sodass sie mit dem Auto zur Arbeit fahren konnte.
Als die Menschenmenge sich endlich lichtete, sah sie sich um und warf einen Blick auf ihr Handy, um zu prüfen, in welche Richtung sie gehen musste. Ein bronzenes Reiterstandbild befand sich in der Mitte der geschäftigen Kreuzung, wo sich alle Straßenbahnlinien trafen. Laut Google Maps musste sie ein Stück in die Richtung gehen, aus der sie gekommen war. Sie drehte sich um und ging in Richtung Martinstor. Die Straßenbahn war auf dem Weg in die Stadt durch einen der Torbögen des mittelalterlichen Turms hindurchgefahren. Das grüne Kupferdach und die beiden Ecktürme überragten die umliegenden Gebäude. Dunkel erinnerte sie sich daran, wie ihr bei ihrem letzten Besuch in Freiburg vor über zwanzig Jahren jemand erzählt hatte, dass das Tor im Mittelalter Teil der Stadtbefestigung gewesen war. Doch jetzt befand sich statt bewaffneter Wachen ein großes McDonald’s-Zeichen über dem rechten Torbogen.
Kopfschüttelnd überquerte Susanne die Straße, sodass sie durch das Tor hindurchgehen konnte.
Eine Straßenbahn klingelte wild, um sie zur Eile anzutreiben.
Susanne erschrak und sprang auf den Gehweg. Sie hatte das verdammte Ding nicht gesehen, weil der Regenschirm ihr die Sicht nahm. »Keine Sorge. Es wird alles ganz wunderbar werden«, ahmte sie ihre Mutter nach. »Ja, aber nicht, wenn ich am ersten Arbeitstag von einer Straßenbahn überfahren werde.«
Ein Mann, der ein Fahrrad schob, warf ihr einen neugierigen Blick zu, doch sie ignorierte ihn und ging weiter.
Auf der anderen Seite des Tors begrüßte sie ein vertrautes grün-weißes Firmenlogo.
Na, wenigstens hatte Freiburg eine Starbucks-Filiale. Halbwegs getröstet hielt sie darauf zu. Ohne Kaffee würde sie diesen Tag nicht überleben.
Doch als sie die lange Warteschlange sah, beschloss sie, dass sie Koffein doch nicht so dringend brauchte. Der Schreibwarenladen ihres Onkels öffnete um zehn und falls sie zu spät kam, würden die Angestellten sie nicht ernst nehmen. Falls er überhaupt Angestellte hatte.
Sie folgte der Karte auf ihrem Handy und bog links in die Gerberau ein. Die schmalere Kopfsteinpflasterstraße war hübsch anzusehen, das musste sie zugeben. Niedliche kleine Ladengeschäfte, Cafés, eine Bäckerei, ein indisches Restaurant und eine Confiserie säumten die Straße. Sie kam an einem türkischen Restaurant vorbei, dessen Hauswand von mehreren aufgesprühten Gemälden geziert wurde. Eines zeigte das Martinstor und ein anderes einen bärtigen Mönch, der Bier zapfte. Zu ihrer Rechten floss ein Bächle, einer der schmalen Wasserläufe, die durch die Altstadt plätscherten.
Schließlich entdeckte sie Tintenträume, das Ladengeschäft ihres Onkels. Zwei Drehständer voller Grußkarten waren unter eine blaue Markise geschoben worden, um sie vor dem Regen zu schützen.
Sie ging auf die weiß-gerahmte Tür mit Messinggriff zu, doch noch bevor sie diese erreichte, stieg ihr ein unwiderstehliches Aroma in die Nase.
Susanne sah sich um.
Oh! Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich ein kleines Café. Ohne lange nachzudenken, machte sie einen großen Schritt über das dahinplätschernde Bächle und stapfte über das Mosaik, das in das Kopfsteinpflaster des Gehwegs eingelassen worden war.
Kurz darauf hielt sie den größten Kaffeebecher, den das Café führte, in der Hand und nahm sofort den ersten Schluck. Mmm. Ein wahres Lebenselixier. Jetzt war sie so weit, sich dem Desaster im Laden ihres Onkels zu stellen. Entschlossen trat sie auf die Eingangstür zu.
»Vorsicht!«, rief die Besitzerin des Cafés ihr hinterher.
Susanne versuchte noch, stehenzubleiben, aber es war bereits zu spät. Statt auf dem Kopfsteinpflaster landete ihr Fuß im klaren – und ziemlich kalten – Wasser des Bächles.
Heißer Kaffee schwappte über ihre Finger und durchtränkte den Ärmel ihres Wollmantels und ihr rechtes Hosenbein.
»Autsch! Verdammt!« Sie zog ihren Fuß aus dem Bächle und blies auf ihre verbrannten Finger, während sie gleichzeitig versuchte, weder den Kaffee noch ihren Schirm fallen zu lassen.
»Alles in Ordnung?«, rief die Cafébesitzerin.
»Ja, alles ganz wunderbar.« Wenn sie die Zähne noch fester zusammenbiss, musste sie einen Termin in der Praxis ihrer Schwester vereinbaren. Sie starrte auf das klatschnasse Wildleder an ihrem linken Fuß hinab.
Ihr Aufenthalt in Freiburg fing ja gut an.
Fluchend überquerte sie die Straße und stieß die Ladentür mit etwas zu viel Schwung auf.
Die Glocke über der Tür klingelte stürmisch.
Sie schloss ihren Schirm und rammte ihn in den Ständer am Eingang. Dann zupfte sie mit der nun freien Hand an ihrer nassen Hose. Na toll. Das war es dann mit ihrem Vorhaben, am ersten Arbeitstag einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Sie ließ die Tür hinter sich zufallen und sah sich um.
Die Wand zur Linken wurde von einem beleuchteten Glaskasten eingenommen, in dem glänzende Füllfederhalter zur Schau gestellt wurden. Ein verschlossener Glaskasten für Füller? War das nicht etwas übertrieben? So etwas kannte sie sonst nur aus Juweliergeschäften. Nicht, dass sie sich damit groß auskannte, denn sie trug kaum Schmuck und keine ihrer Beziehungen hatte je lange genug gehalten, um einen Ring zu kaufen.
Rechts reichten Regale mit Notizbüchern, Schulheften und Blöcken in allen Größen und Farben bis hinauf zur Decke. Große Papierbögen hingen auf Rollen hinter der Kassentheke am anderen Ende des Raums. In einer Ecke befanden sich Radiergummis, Bleistifte, Schreibfedern, Tintenfässer, Stempel und andere Schreibwaren, die Susanne nicht kannte.
Wer zum Teufel brauchte all das Zeug im Zeitalter des Smartphones? Kein Wunder, dass ihr Onkel kurz vor dem Bankrott stand.
Da der Laden eben erst geöffnet hatte, gab es noch keine Kundschaft, doch eine kleine Frau sah von den ledergebundenen Notizbüchern auf, die sie auf der Verkaufsinsel in der Mitte des Raums gruppiert hatte.
Zuerst dachte Susanne, es würde sich um eine Praktikantin oder eine studentische Aushilfe handeln, die stundenweise für ihren Onkel arbeitete, doch auf den zweiten Blick wurde ihr klar, dass ihr feingliedriger Körperbau, ihre großen Augen und ihr zierliches Gesicht die Frau jünger wirken ließen, als sie war. Feine Fältchen um Augen und Mund verrieten, dass sie ungefähr in Susannes Alter – achtunddreißig – sein musste. Die Fremde hatte keinen Versuch unternommen, sie unter einer Make-up-Schicht zu verstecken.
Sie war keine Schönheit im klassischen Sinne. Ihre Haare waren zu dunkel, um blond zu sein, und zu hell, um als braun bezeichnet zu werden, zu wellig, um glatt zu sein, aber nicht wellig genug, um als lockig zu gelten. In erster Linie war ihr Haar zerzaust.
Obwohl sie ganz und gar nicht Susannes Typ war, erregte die Frau doch ihre Aufmerksamkeit. Wenn sie nicht gerade so verärgert gewesen wäre, hätte sie die Fremde vielleicht sogar süß gefunden.
Aber süß hin oder her, so hatte eine Verkäuferin nicht auszusehen. Hielt ihr Onkel seine Mitarbeiter nicht dazu an, sich professionell zu kleiden? Die Frau trug Jeans! Susanne musste zugeben, dass sie toll darin aussah, aber das war nicht der springende Punkt.
»Guten Morgen.« Die Stimme der Frau war erstaunlich tief und rauchig für so ein kleines Persönchen. Sie schenkte Susanne ein freundliches Lächeln. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
Wenigstens war sie nicht unwirsch zu potenziellen Kundinnen. Susanne ging auf sie zu.
Platsch, Platsch, Platsch. Ihr linker Stiefel hinterließ mit jedem Schritt kleine Pfützen auf dem Parkettboden. Sie versuchte, es zu ignorieren und vollkommen professionell zu wirken. »Mein Name ist Susanne Wolff. Ich möchte zu Norbert. Ist er da?«
»Ja, natürlich. Ähm, Nobby?«, rief die Frau nach hinten, wo eine offene Tür entweder zum Lager oder einem Büroraum führte. »Hier ist jemand für dich. Und könntest du bitte den Mopp mitbringen?«
Nobby? Ihr Onkel ließ sich von seiner Angestellten nicht nur duzen, sondern gestattete ihr sogar, ihn mit seinem Spitznamen anzusprechen? Solche Vertraulichkeiten mit Angestellten waren selten eine gute Idee. Höchste Zeit, dass hier jemand das Ruder übernahm, der Ahnung davon hatte, wie man ein Geschäft führte.
Hier würde sich einiges ändern, dafür würde sie sorgen. Aber zuerst einmal musste sie diesen nassen Stiefel loswerden.
Ihr Onkel betrat den Verkaufsraum. Er war etwas grauer und etwas kahler, als sie ihn in Erinnerung gehabt hatte, doch er stellte sofort den Mopp beiseite und kam mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. »Susi! Schön, dich zu sehen!«
»Susanne ist mir lieber.« Nur ihre Zwillingsschwester durfte sie noch mit dem Spitznamen aus ihrer Kindheit ansprechen.
»Oh. Natürlich.« Er umarmte sie herzlich, ließ dann los und trat einen Schritt zurück, um sie zu betrachten. »Du siehst großartig aus. Ganz dein Vater. Aber, ähm, was ist denn mit deinem Stiefel passiert?«
Mit ihrem Vater verglichen zu werden, verbesserte Susannes Stimmung nicht gerade. Knurrend betrachtete sie ihren Stiefel. Ihre kalten, nassen Zehen fühlten sich an, als würden sie gleich abfallen. »Ich bin in die Gosse getreten.« Sie zeigte mit dem Daumen auf die gemeingefährliche Stolperfalle.
»Das ist keine Gosse, sondern ein Bächle«, sagte die Angestellte sanft.
»Ich weiß, wie man es nennt, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Wer kam bloß auf die Idee, ungeschützte Wasserläufe mitten auf der Straße zu platzieren? Da kann man sich ja ein Bein brechen.«
Die Angestellte hielt Susannes Blick stand. Durch ihr zierliches Gesicht und ihre zarte Figur wirkte sie wie jemand, der Konfrontationen aus dem Weg ging, doch ihr störrisch vorgeschobenes Kinn mit einem kleinen Grübchen verriet, dass sie sich nicht so leicht einschüchtern ließ. »Betrachten Sie es doch mal von der positiven Seite.«
Ein Schnauben entfuhr Susanne. Oh Himmel. Sag bloß, sie ist eine dieser ewigen Optimistinnen, bei denen das Glas immer halb voll ist. Sie hatte nichts gegen eine positive Einstellung, aber durch eine rosarote Brille zu schauen, würde nicht dabei helfen, den Laden zu retten. »Es gibt eine positive Seite daran, dass meine Lieblingsstiefel womöglich ruiniert sind?«
»Klar doch.« Das Lächeln der Frau war unerschütterlich. »Der Legende nach wird jede, die aus Versehen in ein Bächle tritt, einen Mann aus Freiburg heiraten.«
Susanne hätte fast den Schluck Kaffee, den sie eben genommen hatte, wieder ausgespuckt. »Das ist das Letzte, was ich möchte.«
Onkel Norbert lachte und tätschelte ihr den Rücken. »Eine Frau aus Freiburg. Einen Mann zu heiraten, wäre für meine Nichte nicht gerade ein Happy End.«
Die großen, braunen Augen der Frau weiteten sich. »Sie … Sie sind …?«
Na toll. Gerade als sie gedacht hatte, der Tag könnte nicht mehr schlimmer werden, stellte sich heraus, dass sie drei Monate lang mit einer Frau aus der Provinz arbeiten musste, die tat, als wäre sie noch nie einer homosexuellen Person begegnet. Sie konnte nur hoffen, dass sie nicht homophob war. Die schwulen- und lesbenfeindlichen Einstellungen an ihrem früheren Arbeitsplatz waren einer der Gründe gewesen, warum sie gekündigt hatte. Im Laden ihres Onkels würde sie so etwas auf keinen Fall dulden.
Sie bemühte sich, so würdevoll und stolz auszusehen, wie das in kaffeedurchtränkter Kleidung und nassem Schuhwerk nur möglich war. »Ja, ich bin lesbisch. Ist das ein Problem für Sie?«
»W-was? Nein! Das ist nicht … Das wollte ich nicht … Ich meinte doch nur …«
Susanne winkte ab. Sie wollte die gestammelten Ausreden nicht hören.
Onkel Norbert schlang je einen Arm um sie beide und strahlte, als würde er die Anspannung zwischen ihnen nicht bemerken. »Susi, äh, Susanne, darf ich dir Anja Lamm, meine Lieblingsmitarbeiterin, vorstellen?«
»Ich bin deine einzige Mitarbeiterin«, warf Frau Lamm ein.
Lamm. Susanne verkniff sich ein Grinsen. Genau so hatte Frau Lamm sie eben angesehen – als wäre sie ein Lamm, das eben einen Wolf gesehen hatte. Sie nickte ihr kurz zu, denn sie war nicht in der Stimmung, bedeutungslose Höflichkeitsfloskeln auszutauschen, und wandte sich dann an ihren Onkel. »Kann ich mich hier irgendwo abtrocknen?«
»Ja, natürlich.« Er nahm sie sanft am Ellbogen und geleitete sie zur Tür, die nach hinten führte.
Susanne verließ den Raum, ohne Frau Lamm eines weiteren Blickes zu würdigen.
Anja hielt sich an dem Mopp fest, den Nobby zurückgelassen hatte, sank gegen die Verkaufsinsel und starrte den beiden hinterher. Das war Nobbys Nichte?
Es war unschwer zu erkennen, dass die hochgewachsene Frau nicht aus der Gegend stammte. In ihrer eleganten, schwarzen Hose, dem cremefarbenen Kaschmirpullover und dem langen, schwarzen Wollmantel wirkte sie eher wie eine Anwältin, die für eine Verhandlung in der Stadt war, oder wie eine Gastrednerin an der Uni.
So sehr sie sich auch anstrengte, Anja konnte einfach keine Familienähnlichkeit mit Nobby feststellen. Selbst nachdem sie ins Bächle getreten war, saß jedes einzelne kastanienbraune Haar in der Hochsteckfrisur genau da, wo es sein sollte. Der Ring grauer Haare, der Nobbys Glatze umgab, widerstand hingegen jeglicher Schwerkraft und stand oft in alle Richtungen ab, was ihn aussehen ließ wie die badische Version von Einstein. Seine Nichte hatte eindeutig nicht seine O-Beine geerbt und auch nicht seine Freundlichkeit. Ihre grauen Augen waren so kühl wie das Wetter draußen.
Kein Wunder. Sie denkt, du hättest ein Problem mit ihrer sexuellen Orientierung.
Anja stöhnte. Nichts könnte der Wahrheit ferner liegen.
Als Schritte erklangen, tat sie rasch, als wäre sie damit beschäftigt, das Wasser am Boden aufzuwischen, weil sie nicht den Eindruck vermitteln wollte, sie hätte Susanne hinterhergestarrt.
Doch es war nur Nobby, der allein zurückkehrte.
»Das ist deine Nichte?«, flüsterte Anja. Sie behielt die Tür im Auge, die zum Lager, Nobbys winzigem Büro und der genauso kleinen Toilette führte.
»Sieht man das nicht? Wir haben dieselben wohlgeformten Wangenknochen, oder?« Seine blauen Augen funkelten, als er seine bärtigen Wangen tätschelte.
»Und denselben schlanken Körperbau.« Sanft stupste sie seinen kugelförmigen Bauch.
»Ja, das auch.«
Anja deutete zu den hinteren Räumen. »So hat sie auf dem Foto, das du mir gezeigt hast, aber nicht ausgesehen.«
Nobby kratzte sich am Bart. »Na ja, das Foto habe ich gemacht, als sie das letzte Mal mit ihrer Mutter und ihrer Schwester zu Besuch war, es ist also schon ein paar Jahre alt.«
»Jahre? Wohl eher Jahrzehnte!« Auf dem Foto war Susanne eine schlaksige Jugendliche von ungefähr siebzehn gewesen.
Er neigte den Kopf zur Seite. »Ist das ein Problem?«
»Ja! Jetzt glaubt sie, ich hätte sie angestarrt, weil ich ein Problem mit ihrer sexuellen Orientierung habe, nicht weil ich eine viel jüngere Nichte erwartet habe.«
»Oh.« Er sah sie hilflos an und zuckte dann die Schultern. »Sag ihr doch einfach, dass du bisexuell bist.«
Es wunderte Anja noch immer, wie völlig unbefangen ihm das über die Lippen kam. Ihrem Vater war das nie so leichtgefallen. »Nein. Das kann ich nicht.«
»Wieso nicht? Soll ich es ihr sagen?« Er machte einen Schritt auf das Hinterzimmer zu.
Sie hielt ihn am Ärmel fest. »Nein! Sonst denkt sie noch, du willst uns verkuppeln.«
»Warum wäre das so schlimm? Wie wir eben festgestellt haben, hat sie mein gutes Aussehen geerbt. Und da sie ins Bächle getreten ist, ist ihr vorherbestimmt, eine Frau aus Freiburg zu heiraten.« Er zwinkerte ihr zu. »Du könntest die Glückliche sein.«
»Nein, danke.« Anja hielt sich zurück und sagte ihm nicht, dass sie auf weniger schroffe und überhebliche Frauen und Männer stand. »Bitte sag nichts. Wir werden uns sicher auch so gut verstehen.« Außerdem war es schließlich nicht so, als müsste sie großartig mit Susanne interagieren. Laut Nobby hatte sie beruflich viel um die Ohren und würde sicher nicht lange bleiben. Anja würde ihr höflich zunicken, wenn sie kurz im Laden vorbeisah, und nach ein paar Tagen würde Susanne wieder weg sein.
Susanne betrat den Verkaufsraum und marschierte entschlossen zur Tür. »Auf dem Weg hierher habe ich ein Schuhgeschäft gesehen. Ich besorge mir trockene Schuhe und bin dann gleich wieder da, um einen Blick in die Bücher zu werfen.«
Noch ehe Nobby oder Anja antworten konnten, fiel die Tür hinter ihr zu.
Anja starrte ihr nach und musste grinsen, als sie sah, wie Susanne die Straße entlangging und dabei sorgsam Abstand zum Bächle zu ihrer Linken hielt. »Sie will einen Blick in die Bücher werfen? Sie meint nicht unsere Notizbücher, oder?« Sie deutete auf die Reihen der Moleskin- und Leuchtturm-Produkte. »Oder spricht sie von Reiseführern über Freiburg?«
Nobby fuhr sich mit beiden Händen über die Haare, doch sie widerstanden jedem Versuch, sie zu glätten. »Nein. Sie ist nicht hier, um sich die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Ihre Mutter hat sie gebeten, eine Weile im Laden auszuhelfen.«
Ein ungutes Gefühl überkam Anja. »Sie soll hier eine Weile aushelfen?«
»Nur bis Ostern.«
Dann würde Susanne nicht wie gedacht nur einige Tage, sondern fast drei Monate bleiben? »Warum das denn? Du und ich haben hier doch alles voll im Griff.«
»Ja, schon, aber …« Nobby wandte den Blick ab und schob eines der ledergebundenen Notizbücher auf der Verkaufsinsel ein wenig weiter nach links. »Manchmal hilft es, wenn jemand von außen ohne unseren Tunnelblick mal einen Blick auf alles wirft.«
Warum sollte eine solche Hilfe von außen notwendig sein, vor allem von einer so überheblichen Person? Sie zupfte an seinem Ärmel, damit er sie ansah. »Was ist los, Nobby? Warum hast du mir nicht früher gesagt, dass deine Nichte zu Besuch kommt und hier aushelfen soll?« Es sah ihm gar nicht ähnlich, Geheimnisse vor ihr zu haben.
Er hielt den Blick weiter auf das Notizbuch gerichtet und berührte das Leder, als würde ihn das beruhigen. »Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber …«
Die Glocke über der Tür kündigte die erste Kundin des Tages an.
Nobby setzte ein freundliches Lächeln auf und eilte auf die Kundin zu, als wäre auch sie eine Verwandte, die er lange nicht gesehen hatte.
Die Kundin brauchte ewig, um sich umzusehen. Sie schien durch jedes einzelne Notizbuch im Laden zu blättern und bat dann darum, einige Füller ausprobieren zu dürfen.
Normalerweise hätte Anja stolz die Schreibgeräte präsentiert, aber jetzt wartete sie ungeduldig, bis die Frau ging – nachdem sie nur ein billiges Heft und einen Bleistift gekauft hatte.
Doch gerade als Anja den Mund öffnete, um mit Nobby zu reden, läutete wieder die Glocke und Susanne kehrte zurück. Sie trug neue Stiefel, deren schwarzes Leder glänzte. »Wir sind hinten im Büro«, sagte sie zu Anja, als sie an ihr vorbeiging und Nobby mit sich zog. »Können Sie bitte ein Auge auf den Laden haben?«
Die Tür schloss sich hinter den beiden, bevor Anja antworten konnte. Wer zum Teufel hat sie denn zur Königin des Universums ernannt? Nobby hatte gesagt, seine Nichte wäre zum Aushelfen hier, nicht um Befehle zu erteilen, als wäre sie die Chefin. Scheinbar hatte Susanne das niemand klargemacht. Anja hoffte, dass sie sich nicht während der gesamten drei Monate hier so aufführen würde.
Legende hin oder her, falls eine Freiburgerin diese Frau heiraten würde, dann ganz bestimmt nicht Anja.
KAPITEL 3
Als Susanne endlich an ihrer Mietwohnung südlich der Altstadt ankam, war es bereits dunkel geworden und sie konnte kaum noch die Umrisse der wunderschönen Jugendstilvillen in ihrer Straße ausmachen.
Sie betrat das Haus und schloss die Tür zu ihrer geräumigen Wohnung im Erdgeschoss auf. Ihre Schritte hallten durch das fast leere Esszimmer, das durch zwei bogenförmige Durchgänge mit der Küche verbunden war.
Der Kühlschrank war genauso leer wie der Rest der Wohnung. Tja, dann gibt es wohl Müsli zum Abendessen.
Wenigstens standen nicht überall Umzugskartons herum, denn sie hatte nur ein paar Koffer, Reisetaschen und einen Karton mit Geschirr und Töpfen mitgebracht. Je weniger sie mitnahm, desto weniger musste sie wieder mit zurück nach Berlin schleppen, wenn ihr Exil endlich zu Ende war.
Ohne Möbel wirkte das Esszimmer deprimierend, deshalb nahm sie sich eine Schüssel Müsli und ging ins Wohnzimmer, das nicht ganz so karg war. Vom Vormieter hatte sie einen Sessel und einen Couchtisch übernommen.
Der Parkettboden knarrte unter ihren Stiefeln. Nachdem sie den ganzen Tag nicht zu Hause gewesen war, begrüßte sie nun abgestandene Luft. Susanne öffnete die Glastür, die hinaus zum Garten führte, den sie sich mit den anderen Mietern teilte. Die Luft war kühl, doch zumindest regnete es nicht mehr.
Sie lehnte sich gegen den Türrahmen und atmete tief den Geruch von nassem Gras ein.
In einer Tanne am Rand des Grundstücks rief ein Käuzchen. Keinerlei Verkehrslärm unterbrach die friedliche Atmosphäre. Nur das Knurren ihres Magens war zu hören. Sie hatte sich nicht die Zeit für eine Mittagspause und ein anständiges Essen genommen. Stattdessen hatte sie ein paar Erdnüsse gegessen, während sie sich Onkel Norberts Kassenbuch und seine Kontoauszüge ansah. Das hatte ihr ohnehin den Appetit verdorben. Ihr Onkel war als Geschäftsmann genauso untalentiert wie sein Bruder. Tintenträume steckte in ernsthaften Schwierigkeiten. Der Laden warf seit Jahren keinen Gewinn mehr ab. Meistens reichte es gerade so, um Strom, Heizung und den Lohn von Frau Lamm und einer Aushilfe zu bezahlen. Wenn weitere Kosten anfielen, benutzte Onkel Norbert sein eigenes Geld, um die Rechnungen zu begleichen, doch so konnte das nicht weitergehen. Wenn sich nicht bald etwas änderte, musste der Laden verkauft werden.
Vielleicht wäre das die beste Lösung. Warum an einem Geschäft festhalten, das dem Untergang geweiht war? Das war reine Sentimentalität. Ihr Onkel könnte seine Bestände einfach verkaufen und mit anderen Produkten neu anfangen oder aber den Laden dicht machen und seine wohlverdiente Rente genießen. Aber so weit waren sie noch nicht. Susanne gab nie auf, ohne zuerst alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben. Morgen würde sie erst einmal die Bestände durchgehen und sich genauer anschauen, was im Laden überhaupt verkauft wurde.
Ein Seufzen entfuhr ihr, als sie ihre Stiefel und Socken abstreifte und in den Sessel sank. Auf ihrer Ferse hatte sich eine Blase gebildet, wo das neue Leder gegen ihren Fuß gerieben hatte.
Na, heute blieb ihr aber auch gar nichts erspart. Nichts lief wie am Schnürchen, seit sie diese Stadt betreten hatte.
Sie legte ihre schmerzenden Füße hoch und griff nach der Müslischüssel. Doch als sie ihr improvisiertes Abendessen genießen wollte, musste sie feststellen, dass sie einen Löffel vergessen hatte.
Stöhnend stemmte sie sich hoch, stellte die Schüssel auf den Couchtisch und humpelte in die Küche.
Als sie mit dem Löffel zurückkam, streifte ein kühler Windhauch ihre nackten Füße. Sie fröstelte und durchquerte den Raum, um die Tür zum Garten zu schließen. Als sie an ihrem Sessel vorbeikam, sah sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung.
Sie wirbelte herum und hob den Löffel wie eine Waffe, mit der sie den Eindringling vertreiben konnte.
Doch statt des Einbrechers, den sie erwartet hatte, stand eine weiß-braune Katze auf dem Sessel, die Vorderpfoten auf dem Couchtisch, und schlabberte die Milch aus ihrem Müsli.
»Was hast du denn hier zu suchen?«
Die Katze hob den Kopf und sah sie an. Ein brauner Streifen quer über der Nase ließ das Tier irgendwie niedlich aussehen, aber Susanne war entschlossen, sich dadurch nicht erweichen zu lassen. Sie deutete streng auf die offene Tür. »Raus mit dir!«
Die Katze miaute und schlabberte weiter Susannes Milch.
»Mann, du hast ja vielleicht Nerven, Katze.« Das Tier war wohlgenährt und hatte ein glänzendes Fell, war also offenbar kein Streuner. Da sie das Müsli nun ohnehin nicht mehr essen konnte, beschloss sie, der Katze die gestohlene Mahlzeit zu überlassen. »Aber nur dieses eine Mal. Glaub bloß nicht, dass das hier während der nächsten drei Monate eine kostenlose Frühstückspension für dich werden wird.«
Als die Milch ausgetrunken war, nahm die Katze ihre Pfoten vom Tisch, rollte sich im Sessel zusammen und putzte sich die Schnurrhaare.
»Oh nein. Ich habe dich nicht zum Bleiben eingeladen.« Sie wollte die Katze hochnehmen, um sie nach draußen zu tragen, aber das Tier fauchte und rollte sich noch enger zusammen, sodass Susanne sie nicht greifen konnte.
Nicht, dass sie es versucht hätte. Bei dem Glück, das sie heute hatte, wäre sie vermutlich vollkommen zerkratzt worden. »Das ist doch albern.« Sie stand barfuß in ihrem fast leeren Wohnzimmer, während ihr Magen knurrte, weil eine Katze ihr Abendessen gestohlen hatte. »Du hast die Wahl. Hörst du mir zu?«
Die Katze drehte die Ohren in ihre Richtung, was Susanne als Ja interpretierte.
»Entweder begibst du dich jetzt freiwillig nach draußen oder ich werde …« Ja, was denn? Die Polizei rufen und ihnen sagen, dass sie schnell kommen und den gefährlichen Eindringling verhaften sollten? Wohl kaum. »Oder ich werde einen anderen Weg finden müssen, dich zum Gehen zu bewegen, und glaub mir, den wirst du nicht mögen.«
Die Katze rührte sich nicht.
»Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.« Sie packte die Rückenlehne und schob den Sessel samt Katze über den Parkettboden zur Glastür.
Ihr pelziger Besucher stieß ein erschrockenes Fauchen aus.
»Ich habe dir doch gesagt, dass du es nicht mögen wirst.« Als sie die Treppenstufe erreichte, die hinab zum Garten führte, kippte sie den Sessel nach vorn.
Die Katze rutschte über das Leder und landete auf den Steinplatten vor der Terrassentür. Von dort warf ihr das Tier einen anklagenden Blick zu.
Rasch schob Susanne den Sessel aus dem Weg und schloss die Tür, bevor die Katze wieder in die Wohnung schlüpfen konnte. Durch die Glasscheibe hindurch warf sie ihrem unwillkommenen Besucher ein triumphierendes Grinsen zu, zog dann den halb durchsichtigen Vorhang zu und ging sich eine neue Schüssel Müsli holen.
»Miau!« Der Klagelaut folgte ihr bis in die Küche, dann erklang das Trommeln einer Pfote gegen das Glas. »Miiiiiauuuu!«
Stöhnend lehnte Susanne ihre Stirn gegen den Kühlschrank. »Bleib stark.« Sie war hier, um ihrem Onkel zu helfen, nicht um Freundschaften zu schließen – noch nicht einmal mit einer Katze.
»Und dann hat sie Nobby ins Büro gezerrt und ich habe sie zum Glück den Rest des Tages kaum gesehen.« Anja blieb auf dem Steg über den See stehen und wartete auf Miris Reaktion.
Gino, die zottelige Promenadenmischung ihrer Freundin, nutzte die Gelegenheit, die Liebesschlösser zu beschnuppern, die verliebte Paare am Geländer der Brücke angebracht hatten.
Unter ihnen platschte etwas im Wasser, aber in der Dunkelheit konnte Anja nicht erkennen, was es war. Womöglich ein Schwan oder eine Schildkröte.
»Zum Glück?«, wiederholte Miri. »Warum wäre es so schlimm gewesen, wenn du sie öfter gesehen hättest? Hast du nicht eben gesagt, sie wäre umwerfend heiß?«
»Hast du mir nicht zugehört? Sie ist total eingebildet. Kommt einfach in ihren tropfnassen Fünfhundert-Euro-Schuhen hereinspaziert und denkt, sie kann den Laden an sich reißen! Außerdem habe ich nie gesagt, dass sie heiß ist.«
»Doch hast du.«
»Nein, habe ich nicht.«
Ein Jogger mit einer Stirnlampe lief an ihnen vorbei und lachte.
Jetzt war Anja dankbar für die Dunkelheit, die ihr Erröten verbarg.
Miri schien es nichts auszumachen, dass er einen Teil ihres Gesprächs mitgehört hatte. Als der Jogger um eine Biegung des Pfads, der um den See führte, verschwand, fragte sie: »Also? Ist sie nun heiß oder nicht?«
»Na ja, ich schätze, sie sieht einigermaßen gut aus.«
Miri lachte. »Einigermaßen gut? Na, jetzt bin ich mir sicher, dass ich mal zum Laden kommen und sie mir ansehen muss!«
Anja packte sie am Ärmel. »Wage es bloß nicht. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Ich glaube, sie mag mich nicht.«
»Was gibt es da nicht zu mögen?« Miri knurrte wie eine Bärin, deren Junges angegriffen wurde.
Ihre Reaktion wärmte Anja trotz des kühlen Januarwinds. Sie schlang einen Arm um ihre beste Freundin, während sie weitergingen. Obwohl Miri um einiges größer war, passten sich ihre Schritte einander problemlos an, wohl weil sie schon seit fast fünfzehn Jahren jeden Abend gemeinsam am See spazieren gingen.
Anja studierte Miris lachsfarbene Lieblingslaufschuhe, die förmlich im Dunkeln leuchteten. Ihre Wangen hatten vermutlich dieselbe Farbe angenommen. »Sie denkt, ich hätte etwas gegen Homosexuelle.«
»Ausgerechnet du?« Miri nahm Ginos Leine kürzer, als sie das Ende der Brücke erreichten und ein Radfahrer an ihnen vorbeisauste. »Wie kommt sie denn darauf?«
»Das ist eine lange Geschichte.« Nach dem heutigen Tag hatte Anja nicht die Energie für Erklärungen. »Als ich erfahren habe, wer sie ist, habe ich sie erstaunt angestarrt und das hat sie wohl missverstanden.«
»Wenn sie es persönlich genommen hat, dann ist sie vermutlich nicht heterosexuell, oder?«
»Nein, sie ist lesbisch und macht kein Geheimnis daraus, sagt Nobby. Seine lesbische Nichte ist vermutlich auch der Grund, warum er so locker damit umgegangen ist, als ich ihm damals gesagt habe, dass ich bi bin.«
Miri stieß einen lang gezogenen Pfiff aus, der Gino zum Bellen brachte. »Dann ist sie also heiß und an Frauen interessiert!«
»Vergiss es«, sagte Anja mit Nachdruck.
»Was denn? Es war eine ganz sachliche Feststellung.«
»Na klar. Nur eine Feststellung. So wie damals, als du versucht hast, mich mit dem Typen aus der Eisdiele zu verkuppeln, der meinte, nur weil ich bi bin, wäre ich scharf auf einen flotten Dreier mit ihm und einer Frau.«
»Hey, woher hätte ich wissen sollen, dass er so drauf ist? Er schien nett zu sein.«
»Tja, Susanne Wolff hingegen ist alles andere als nett, also vergiss es.«
Miri kicherte los. »Ihr Nachname ist Wolff?«
»Was ist daran so witzig?«
»Wolff … Lamm.« Miri zeigte zwischen Anja und einer unsichtbaren Person hin und her. »Kapierst du’s nicht?«
»Doch, aber dieses Lamm wird sich auf keinen Fall vom großen, bösen Wolf anknabbern lassen.« Anja gab einem Ast, der im Weg lag, einen Tritt und sah zu, wie Gino hinterherjagte, bis die Leine ihn zurückriss.
»Nur damit du’s weißt, ich halte mich heldenhaft davor zurück, einen schlüpfrigen Witz über das zu machen, was du da eben gesagt hast.«
Anjas Wangen glühten. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass sie etwas Doppeldeutiges gesagt hatte. »Danke.«
»Aber mal im Ernst, du solltest offener sein, was das Kennenlernen neuer Leute angeht.« Nun war jeglicher Humor aus Miris Stimme verschwunden.
Nicht schon wieder diese Predigt. »Ich lerne im Laden jeden Tag neue Leute kennen.«
»Ich rede nicht von Kunden. Tintenträume allein reichen nicht, um dich glücklich zu machen. Du bist schon seit der Steinzeit mit niemandem mehr ausgegangen, von einer Beziehung mal ganz zu schweigen. Ich bin auf Facebook mit einer Frau befreundet, die genau dein Fall sein könnte.«
Anja stöhnte. »Kein Facebook. Du weißt genau, dass ich mit den sozialen Medien nichts am Hut habe. Wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann persönlich, nicht übers Internet.«
»Wie ich eben sagte: Steinzeit«, murmelte Miri.
Anja ignorierte die Bemerkung. »Vielleicht hast du bei mir ja einfach so viel Eindruck hinterlassen, dass ich jetzt an keiner anderen mehr interessiert bin.«
»Oh bitte! Wir haben uns nur ein einziges Mal geküsst und dieser eine Kuss hat ausgereicht, um dich eine Weile daran zweifeln zu lassen, ob du wirklich bi bist.«
Anja lachte. »So schlimm war es nun auch wieder nicht.«
Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen, dann sagten sie gleichzeitig: »Okay, es war schlimm.«
Ihr gemeinsames Lachen hallte durch die Dunkelheit.
Sie hatten sich kennengelernt, nachdem Anja vom Dorf in die Stadt gezogen war und endlich ihre Sexualität erkunden wollte. Doch sie hatte nicht den Mut gehabt, die wenigen Bars und Veranstaltungen für Schwule und Lesben in der Gegend zu besuchen, und auch der queere Sportverein war nicht ihr Ding gewesen. Schließlich hatten sie und Miri sich während der Freiburger Lesbenfilmtage kennengelernt.
Sie hatten sich sofort prima verstanden. Nach ihrer dritten Verabredung hatte Miri sie geküsst, aber der Funke war einfach nicht übergesprungen. Es hatte sich angefühlt, als würde sie eine Cousine küssen und das hatte Anja eine Weile in Verwirrung gestürzt. Sie hatte einige Zeit gebraucht, bis sie verstanden hatte, dass sie sich sehr wohl auch zu Frauen hingezogen fühlte, nur eben nicht zu allen Frauen.
Zu Susanne Wolff fühlte sie sich definitiv nicht hingezogen.
Sie blieben stehen, als sie die Stelle erreichten, an der sich der Weg gabelte und Anja nach rechts abbiegen musste, während Miri und Gino nach links gehen würden.
»Bist du sicher, dass ich morgen nicht im Laden vorbeischauen soll?«, fragte Miri. »Nicht, um ein Auge auf Nobbys heiße Nichte zu werfen. Nur um dich moralisch zu unterstützen. Ich könnte mich als Kundin ausgeben, damit du sie mit deinem Verkaufstalent beeindrucken kannst.«
Anja lachte, schüttelte aber den Kopf. »Nein, danke. Ich lege es gar nicht darauf an, sie zu beeindrucken. Sie ist nur hier, um eine Weile auszuhelfen, nicht um den Laden zu übernehmen.«
»Bist du sicher? Wie alt ist Nobby inzwischen? Zweiundsechzig? Dreiundsechzig?«
Der vegetarische Yufka, den sie vor dem Spaziergang gegessen hatte, lag Anja plötzlich wie ein Klumpen Lehm im Magen. »Du glaubst doch nicht …?« Sie schloss hastig den Mund, weil sie die Worte nicht aussprechen wollte.
Miri zuckte mit den Schultern. »Vielleicht schnüffelt seine Nichte hier herum, weil sie den Laden übernehmen will, wenn er in Rente geht.«
Anja fürchtete schon seit Jahren den Tag, an dem Nobby in Rente gehen würde, aber er hatte ihr wiederholt versichert, dass es für sie immer einen Arbeitsplatz im Laden geben würde, ganz egal, was auch passierte. Aber wenn seine Nichte Tintenträume übernahm, dann war sich Anja dessen nicht so sicher. Und genauso wenig sicher war sie sich, ob sie überhaupt für Susanne Wolff arbeiten wollte.
Zum ersten Mal freute sie sich nicht darauf, morgen zur Arbeit zu gehen.
KAPITEL 4
Langsam verstand Susanne, wie die Katze sich gestern Abend gefühlt haben musste, nämlich wie ein unwillkommener Eindringling.
Anja Lamm stand hinter der Ladentheke und beobachtete jede ihrer Bewegungen, während sie so tat, als blätterte sie durch eine Zeitschrift, auf deren Cover ein rot-schwarz-gestreifter Füller abgebildet war.
Oh Mann, meint sie im Ernst, ich würde ihre geliebten Notizbücher oder Füller klauen? Ich bin hier, um zu helfen! Susanne versuchte, die Blicke zu ignorieren, als sie von einem Produkt zum nächsten ging und sich Notizen zu den Preisen und anderen Details in einer App ihres iPhones machte. Was war schon dabei, wenn Frau Lamm sie nicht mochte? Das war ihr egal. In ihrem früheren Job als Unternehmensberaterin war sie auch nicht überall mit offenen Armen begrüßt worden. Wenn sie losgeschickt wurde, bedeutete das, dass die Firma in Schwierigkeiten steckte, deshalb wurde sie selten gern gesehen.
Dennoch fühlte es sich diesmal anders an. Irgendwie persönlicher. Aus genau diesem Grund war es keine gute Idee, mit Familienmitgliedern oder Menschen, denen man nahestand, zu arbeiten. Aber ihre Mutter hörte nicht auf sie und ihr Onkel war genauso unbelehrbar.
Warum zum Teufel bezahlte er jemanden dafür, herumzustehen und Zeitschriften zu lesen? Immerhin konnte Frau Lamm gut mit den Kunden umgehen. Susanne musste zugeben, dass sie nicht halb so viel Geduld mit Leuten gehabt hätte, die sich eine gefühlte Ewigkeit im Laden umsahen und Dutzende von Fragen stellten, nur um dann mit einem billigen Kugelschreiber von dannen zu ziehen.
Das bisschen Geld, das sie mit solchen Kunden verdienten, rechtfertigte es nicht, Angestellte zu haben.
Susanne nahm eines der ledergebundenen Notizbücher von der Verkaufsinsel in die Hand, um nach dem Preisschild zu suchen. Als sie es fand, hätte sie das Buch fast fallengelassen. Hundert Euro für das bisschen Papier? Kein Wunder, dass sie den ganzen Tag über noch kein einziges Notizbuch verkauft hatten.
Als sie das teure Produkt vorsichtig beiseitelegte, drang ein erleichtertes Seufzen durch den Laden.
Himmel, die Frau gab ihr wirklich das Gefühl, ein Schreibwaren-mordendes Ungeheuer zu sein. »Stimmt das Preisschild auf dem Notizbuch?«
»Wenn da neunundneunzig Euro steht, dann stimmt es.«
Wenigstens schien sie die Preise sämtlicher Produkte auswendig zu kennen. Komplett nutzlos war sie also nicht.
»Es ist nachfüllbar«, sagte Frau Lamm in einem defensiven Ton.
»Das ist mein Smartphone auch«, murmelte Susanne. Kopfschüttelnd ging sie weiter zu dem Glaskasten mit den Füllfederhaltern. Sie beugte sich vor, um durch das Glas die winzigen Preisschilder neben jedem Füller auszumachen. Ihr Blick fiel auf das Schreibgerät in der Mitte. Es handelte sich um einen dunkelblau-silbernen Füller, in den Buchstaben der Alphabete verschiedener Sprachen eingraviert worden waren.
Wie bitte? Zweitausend Euro? Sie wirbelte herum.
Frau Lamm wandte rasch den Blick ab, als wäre sie bei etwas Verbotenem ertappt worden.
Hatte sie Susanne etwa auf den Hintern gestarrt? Quatsch. Sie hat wie ein verängstigtes kleines Mädchen herumgestottert, als sie herausgefunden hat, dass ich lesbisch bin. Auf keinen Fall ist sie auch lesbisch. Vermutlich hatte sie Susanne nur im Auge behalten, um sicherzugehen, dass sie auch ja keine Fingerabdrücke auf dem Glaskasten hinterließ, den sie vorhin so sorgfältig poliert hatte.
»Könnten Sie mal dieses Füllerpornoheft weglegen und mir das erklären?«
»W-wie bitte?«, stammelte Frau Lamm.
Susanne biss sich auf die Lippe. Mit ihrem professionellen Verhalten war es heute aber auch nicht weit her. Hätte sie so etwas gesagt, wenn sie für irgendeine andere Firma gearbeitet hätte? Ganz sicher nicht.
Es ärgerte sie, dass sie nach Freiburg geschickt worden war, um einem weiteren Familienmitglied zu helfen, das als Geschäftsmann gänzlich ungeeignet war. Als Susanne ein Kind gewesen war, hatte ihre Mutter mehr als einmal die zum Scheitern verurteilten Geschäftsideen ihres Vaters retten müssen. Sie hatte sogar eine Kreditbürgschaft für ihn übernommen und deshalb fast ihre eigene Firma verloren.
Susanne hatte alles hilflos mit ansehen müssen und nun merkte sie, dass sie die alte, aufgestaute Wut an Frau Lamm ausgelassen hatte. Von nun an würde sie ihre Arbeit in Freiburg wie jeden anderen Job ausüben.
»Die Zeitschrift.« Sie deutete auf das Heft. »Könnten Sie die weglegen und zu mir kommen … bitte«, fügte sie nach kurzem Zögern hinzu.
Frau Lamm legte die Zeitschrift beiseite und kam mit dem Gesichtsausdruck einer Gefangenen, die zur Hinrichtung geführt wurde, auf Susanne zu.
»Wer bestimmt hier im Laden die Preise?«, fragte Susanne.
Frau Lamm verschränkte die Arme vor der Brust, was Susannes Aufmerksamkeit auf das Stück glatte Haut lenkte, das die beiden offenen Knöpfe an ihrer Bluse enthüllten.
Ärgerlich mit sich selbst riss sie ihren Blick davon los.
»Das entscheiden Nobby und ich zusammen, je nachdem, was wir unseren Lieferanten bezahlt haben und was die Konkurrenz für ähnliche Produkte verlangt«, antwortete Frau Lamm.
Das war eine vernünftige Strategie. »Na ja, aber zweitausend Euro für einen Füller erscheint mir doch ziemlich übertrieben.«
»Es ist ein Montblanc Meisterstück Solitaire LeGrand 146.« Als Susanne sie nur reglos ansah, fügte Frau Lamm hinzu: »Eine limitierte Sonderausgabe von einem der führenden Füllerhersteller der Welt.«
»Trotzdem. Wer gibt schon so viel Geld aus, wenn es ein billiger Stift für zwei Euro auch tut?« Susanne deutete auf die Kugelschreiber in der Ecke.
Frau Lamm seufzte. Sie öffnete den Mund, schloss ihn dann aber wieder. Schließlich sagte sie: »Was für ein Auto fahren Sie?«
»Wie bitte?«
»Was für ein Auto fahren Sie?«, wiederholte sie langsamer, so als hätte Susanne Probleme, die Frage zu verstehen.
»Einen BMW.« Dieses winzige bisschen persönliche Information herauszurücken, gab ihr das Gefühl, zu viel enthüllt zu haben. Vermutlich lag es daran, dass sie in ihrem alten Job ihr Privatleben vor ihrem homophoben Chef und seinen treuen Jungs hatte schützen müssen. »Was hat das denn bitte mit dem Preis dieses Füllers zu tun?«
»Warum geben Sie so viel Geld für ein Auto aus? Warum kaufen Sie nicht einfach einen gebrauchten Ford Ka oder einen kleinen Fiat, der Sie genauso gut von A nach B bringen kann?«
»Weil ich Autos liebe. Beim Autofahren geht es nicht nur darum, von A nach B zu kommen. Ein Auto ist ein Lebensgefühl. Ein Ausdruck meiner Persönlichkeit.«
»Und ein Statussymbol«, fügte Frau Lamm hinzu.
Susanne zuckte mit den Schultern. »Ja, das auch. Niemand wäre beeindruckt, wenn eine Unternehmensberaterin in einem winzigen Gebrauchtwagen vorfährt.«
Frau Lamm nickte vielsagend.
»Wollen Sie damit andeuten, dass es bei Füllern genauso ist?« Susanne sah sie skeptisch an.
»Für Sie vielleicht nicht. Aber für unsere Kunden schon. Ich persönlich ziehe mein Fahrrad einem BMW vor, aber wenn ich genug verdienen würde, um es mir leisten zu können, würde ich nicht zögern, zweitausend Euro für eine Schönheit wie diesen auszugeben.« Sie warf dem Füller einen liebevollen Blick zu und strich mit dem Finger in einer sinnlichen Geste über den Glaskasten.
Susannes Mund wurde trocken. Das kam sicher nur daher, dass sie bei der Arbeit das Trinken vergaß. Vielleicht sollte sie sich noch einen Kaffee holen. Sie räusperte sich. »Wie viele dieser BMW-Füller haben wir dieses Jahr schon verkauft?«
»Es ist erst Mitte Januar.«
»Also keinen.«
Frau Lamm schlang ihre Arme noch enger um ihren Oberkörper, hielt aber Blickkontakt, obwohl sie den Kopf heben musste, um Susanne in die Augen zu sehen. »Im Januar laufen Füller nicht so gut. Die meisten verkaufen wir in der Vorweihnachtszeit und wenn es auf Valentinstag zugeht.«
Wenn es so weiterging, dann war der Laden noch vor dem Valentinstag bankrott.
»Stellen Sie mir all diese Fragen aus einem bestimmten Grund, Susanne?«
Die beiläufige Benutzung ihres Vornamens überraschte Susanne. In ihrem alten Job hatte sich niemand solche Vertraulichkeiten erlaubt. Dem musste sie sofort Einhalt gebieten, sonst würde es später zu Problemen führen. »Frau Wolff.«
»Wie bitte?«
»Dies ist Ihr Arbeitsplatz, Frau Lamm. Ich glaube kaum, dass es angemessen ist, wenn Sie mich beim Vornamen nennen.«
Frau Lamms ohnehin schon große Augen weiteten sich noch mehr. Durch ihre elfenhaften Gesichtszüge sah sie so verletzlich aus, dass Susanne sich fragte, ob sie zu grob gewesen war.
Fang bloß nicht an, an dir zu zweifeln. Eine Firma kann man nicht retten, indem man die Angestellten mit Samthandschuhen anfasst, das weißt du doch.
»A-aber Ihr Onkel und ich duzen uns seit Jahren. Ich durfte ihn von Anfang an mit dem Vornamen ansprechen und das hat nie zu Problemen geführt.«
Die Art, wie ihr Onkel sein Geschäft führte, hatte ihn erst in diese Misere gebracht. »Mein Onkel trifft seine eigenen Entscheidungen. Mir ist es auf jeden Fall lieber, Sie sprechen mich mit dem Nachnamen an.«
»Wenn Sie das wünschen, Frau Wolff.« Sie nickte Susanne steif zu. Ihre braunen Augen, die so warm leuchteten, wenn sie mit Nobby oder einem Kunden sprach, wirkten nun verschlossen.
Doch das musste Susanne egal sein. Sie war nie davor zurückgeschreckt, alles Nötige zu tun, um ihre Arbeit gut zu machen, und das würde sich jetzt nicht ändern. Wenn das bedeutete, dass sie Frau Lamms Gefühle verletzen musste, dann war das eben so.
Anja griff wieder zu ihrer Zeitschrift und versuchte, neue Produkte zu finden, die für ihre Kunden von Interesse sein könnten, doch selbst die Rezensionen der neuesten Diamine-Tinten konnten sie jetzt nicht mehr fesseln.
Sie blätterte so abrupt um, dass beinahe die Seite einriss. Ihr Körper vibrierte förmlich vor Anspannung. Wie war aus ihrem geliebten Arbeitsplatz nur diese Bitte-keine-Vornamen-Situation geworden? Die Frau hatte vielleicht Nerven!
Susanne – oder vielmehr Frau Wolff – hatte den ganzen Tag schon an allem herumgemeckert, jeden Zentimeter des Ladens kritisch beäugt und sich jedes von ihr wahrgenommene Problem aufgeschrieben. Anja war nicht überrascht, dass sie dafür eine App auf ihrem Smartphone statt Papier und Stift benutzt hatte.