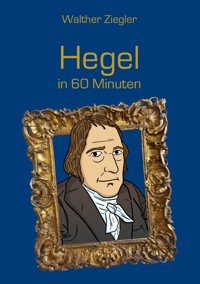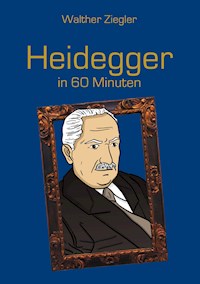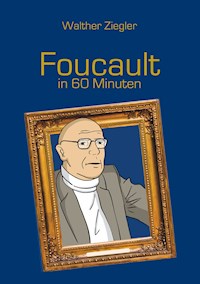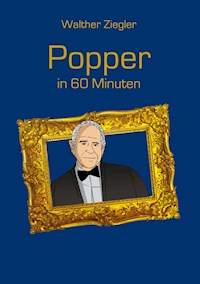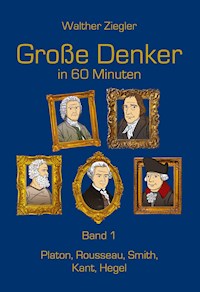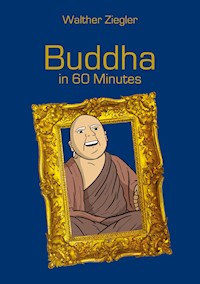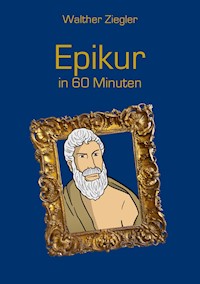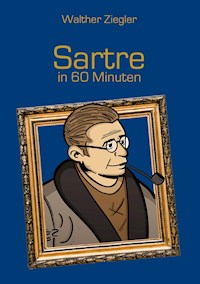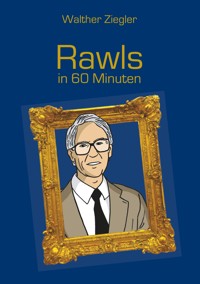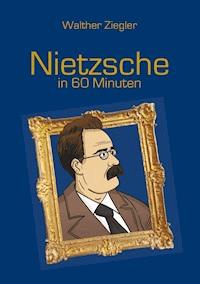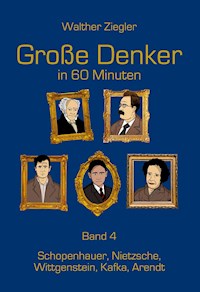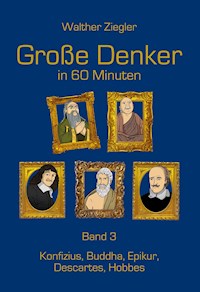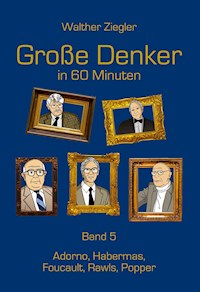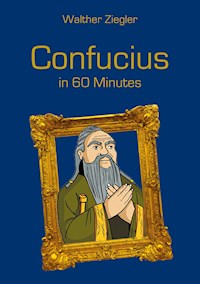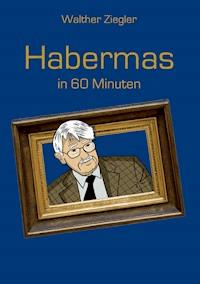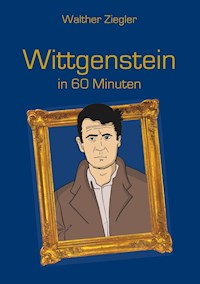
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ludwig Wittgenstein ist der ganz große Philosoph der Sprache. Mit seinem weltberühmten "Tractatus logico-philosophicus" leitet er einen epochalen Wandel ein, den sogenannten "Linguistic Turn" weg von der klassischen Philosophie hin zur Sprachphilosophie. Denn allein die Sprache, so sein Kerngedanke, bestimmt die Art und Weise, wie wir die ganze Welt und uns selbst wahrnehmen. Weder ein Philosoph, noch irgendein anderer Mensch ist in der Lage, jenseits von Wörtern und Sätzen auch nur einen einzigen Gedanken zu fassen. Wir erlernen die Sprache schon in frühester Kindheit und ab diesem Zeitpunkt bestimmt sie unsere gesamte Weltsicht. Deshalb, so Wittgenstein, besteht die erste und wichtigste Aufgabe der Philosophie darin, endlich die Sprache selbst als ihr grundlegendes Erkenntniswerkzeug zu verstehen. Im "Tractatus" analysiert er präzise, was wir mit Hilfe von Wörtern und Sätzen über die Welt aussagen können - und was nicht. Sein Ergebnis ist radikal. Nur solche Aussagen sind zulässig, die man logisch exakt aussprechen und experimentell nachprüfen kann. Und: "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen." Doch Wittgenstein macht noch eine zweite folgenschwere Entdeckung. In seinem Spätwerk zeigt er, dass erst die konkreten "Sprachspiele", also die vielen alltäglichen Gespräche zwischen Kindern, Bauarbeitern, Theologen, Wissenschaftlern oder Fußballspielern den Wörtern einen Sinn geben und unsere gesamte Weltwahrnehmung beeinflussen. Er entwickelt seine berühmte Theorie der "Sprachspiele". Bestimmen Sprachspiele tatsächlich unseren Alltag und unsere gesamte Lebenswirklichkeit? Und wenn ja - was nutzt uns Wittgensteins Entdeckung heute? Das Buch "Wittgenstein in 60 Minuten" erklärt sowohl den "Tractatus" als auch die faszinierende "Theorie der Sprachspiele" anhand der 100 besten Originalzitate. Es ist in der beliebten Reihe "Große Denker in 60 Minuten" erschienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dank an Rudolf Aichner und Melanie Tintera für ihre unermüdliche und kritische Redigierung, Silke Ruthenberg für die feine Grafik, Angela Schumitz, Lydia Pointvogl, Eva Amberger, Christiane Hüttner, Dr. Martin Engler für das Lektorat und Dank an Prof. Guntram Knapp, der mich für die Philosophie begeistert hat.
Inhalt
Wittgensteins große Entdeckung
Wittgensteins Kerngedanke
Was ist die Welt? Die Welt besteht nur aus Tatsachen, die wir in Sätzen abbilden
Sätze über Tatsachen müssen sinnvoll sein!
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen!
Wittgenstein, Popper und der Schürhaken
Die Welt als Sprachspiel
Du bist, was du sprichst: Worte, Sätze, Lebensformen
Was nutzt uns Wittgensteins Entdeckung heute?
Mut zur Veränderung: Sprachspiele und Lebensformen wechseln!
Wittgensteins brillante Verknüpfung von Sprache und Lebensform: Die Wechselwirkung erkennen!
„Ein Reich, ein Volk, ein Führer!“ – Politische Sprachspiele zur Manipulation von Lebensformen
Wittgensteins Erben: Wie Rhetorik-Coaches mit Sprache und Grammatik Wirklichkeit verändern
Die Welt als Sprachspiel erkennen und kritisieren: Der tiefe Stachel des Ludwig Wittgenstein
Zitatverzeichnis
Wittgensteins große Entdeckung
Ludwig Wittgenstein (1889–1951) gilt als der Pionier der Sprachphilosophie und zählt damit zu den wirkungsmächtigsten Denkern des zwanzigsten Jahrhunderts. Er leitete mit dem „Linguisitic Turn“ einen epochalen Wandel ein: die Abkehr von der klassischen Philosophie hin zur Sprachphilosophie.
Wurde noch vor Wittgenstein die Frage nach dem Sinn des Lebens spekulativ oder materialistisch beantwortet, etwa als „Entfaltung des Weltgeistes“, als „Entwicklung der Menschheitsgeschichte in Klassenkämpfen“ oder als „Wille zur Macht“, wendet sich Wittgenstein erstmals der Sprache als dem wichtigsten Phänomen unseres Lebens zu. Die Sprache, so sein Kerngedanke, ist entscheidend für unser Verständnis der Welt.
Seine Entdeckung der Sprache als Brennpunkt jeder Erkenntnis stellte die gesamte bisherige Philosophie in Frage. Denn, so Wittgenstein, ganz unabhängig davon, was die einzelnen Philosophen von der Antike bis zum heutigen Tag als Kern der Wirklichkeit erkannt haben, es ist und bleibt eine Tatsache, dass sie ihre jeweiligen Erkenntnisse über die Welt stets nur innerhalb der Grenzen der Sprache gewinnen konnten. Weder ein Philosoph, noch irgendein anderer Mensch ist nach Wittgenstein in der Lage, jenseits von Wörtern und Sätzen auch nur einen einzigen sinnvollen Gedanken zu fassen:
Es gibt letztlich, so Wittgenstein, kein Entkommen aus dem „Käfig der Sprache“, so sehr man auch versuchen mag, einen Gedanken wenigstens ein einziges Mal ganz ohne Worte und Sätze zu denken:
Auch der volkstümliche Satz „Die Gedanken sind frei“ ist eine Illusion, denn unsere Gedanken können wir immer nur sprachlich ausdrücken. Jenseits der Sprache gibt es nichts:
Die Sprache ist also das „Vehikel“ beziehungsweise das „Fahrzeug“ unseres Denkens. Und das heißt, alles, wirklich alles, was in unserem Kopf vor sich geht – jeder Gedanke, jede Erkenntnis und jede Idee – vollzieht sich in Wörtern und Sätzen. Wir erlernen die Sprache in frühester Kindheit und ab diesem Zeitpunkt bestimmt sie unsere gesamte Weltwahrnehmung und alles, was wir von der Welt wissen. Deshalb, so Wittgenstein, besteht die erste und wichtigste Aufgabe der Philosophie darin, endlich die Sprache selbst als ihr grundlegendes Erkenntniswerkzeug zu analysieren und zu verstehen. Wir müssen herausfinden, was die Menschheit mit der Sprache logisch erfassen kann und was nicht. Denn nur so ist es möglich, falsche und unsinnige Aussagen über die Welt von sinnvollen zu unterscheiden:
Jahrtausendelang hätten die Philosophen nur missverständliche und widersprüchliche Gedankengebäude errichtet, ohne zuvor ihre eigenen logischen Voraussetzungen sauber geklärt zu haben:
Indem wir nun endlich die Sprachlogik analysieren und verstehen, was sich überhaupt sinnvoll sagen lässt und was nicht, bekommen die vielen philosophischen Probleme erst ihren verdienten Stellenwert oder lösen sich auf:
Tatsächlich inspirierte Wittgenstein mit seiner Forderung, endlich die Sprache zu erforschen, neue philosophische Richtungen auf der ganzen Welt: Die „Ordinary Language Philosophy“ in England, die „Sprechakttheorie“ und die „Theorie des kommunikativen Handelns“ in Deutschland, die strukturalistische „Semiotik“ in Frankreich, die neopositivistische Philosophie des Wiener Kreises in Österreich und die „sprachliche Relativitätstheorie“ in Amerika.
Aber auch in unserem Alltag blieb Wittgensteins Entdeckung der großen Bedeutung der Sprache nicht ohne Folgen. Hatte man die Sprache jahrhundertelang nur als unmittelbares Werkzeug der Verständigung angesehen, wird sie heutzutage gezielt zur Beeinflussung von privaten und öffentlichen Diskursen sowie zur Manipulation ganzer Lebensformen eingesetzt. Ein Heer von Rhetorik-Lehrern, Marketingstrategen und Politik-Beratern versucht tagtäglich unsere Wirklichkeit durch den gezielten Einsatz von Wörtern und Sätzen zu beeinflussen. Seien es Werbekampagnen, Propagandafeldzüge, Sprachtherapien, Selbstmotivationen oder auch gemeinsame Gebete – Sprache wird seit Wittgenstein erstmals als das erkannt, was sie wirklich ist, als ein Kraftfeld, das unsere gesamte Lebenswirklichkeit widerspiegelt und beeinflusst:
Wittgenstein selbst wollte die Sprache immer nur analysieren und auf keinen Fall instrumentalisieren.
Er warnte sogar davor. Und doch öffnete er mit seiner Entdeckung des Zusammenhangs von Sprache und Lebensform die Büchse der Pandora. Nachdem nämlich die Bedeutung der Sprache für unser Leben erst einmal erkannt war, wurde mehr denn je versucht, mit ihrem gezielten Einsatz zu manipulieren.
Wittgenstein wird heute in einer Reihe mit Kant, Heidegger oder Sartre genannt, obgleich er die Philosophie zunächst scharf kritisierte und eigentlich Ingenieur werden wollte. Man könnte sogar sagen, er war Philosoph wider Willen. Als achtes Kind des führenden österreichischen Stahlmagnaten Karl Wittgenstein interessierte er sich zunächst für Technik und Mathematik. Wie zuvor sein Vater studierte er Ingenieurwissenschaften.
Als er gerade Berechnungen für einen neuen Flugzeugmotor anstellte, erfasste ihn, entgegen seiner Pläne, die Philosophie mit einer solchen Wucht, dass sich seine Schwester Sorgen um seinen Gesundheitszustand machte: „Zu dieser Zeit […] ergriff ihn plötzlich […] das Nachdenken über philosophische Probleme, so stark und völlig gegen seinen Willen, dass er schwer unter der doppelten und widerstreitenden inneren Berufung litt […]. Ludwig befand sich in diesen Tagen fortwährend in einer unbeschreiblichen, fast krankhaften Aufregung […].“ 9
Der junge Wittgenstein konnte nicht mehr anders, als sich die großen philosophischen Fragen zu stellen: Was ist die Welt? Wie kann ich sie erkennen und wahre Aussagen über sie machen? Er widmete sich nun ganz dem Studium der Logiker Frege, Russel und Moore. Und noch bevor er sein Philosophiestudium abgeschlossen hatte, gab er der Welt im Tractatus logico-philosophicus seine Antwort. Die kleine Schrift hatte gerade mal achtzig Seiten, was für ein philosophisches Werk mehr als ungewöhnlich ist. Und doch machte sie Wittgenstein schon zu Lebzeiten berühmt.
Der zeitlose Erfolg des Tractatus logico-philosophicus liegt in seiner messerscharfen Struktur. Wie ein Chirurg mit einem Skalpell beantwortete Wittgenstein die Frage „Was ist die Welt?“ in sieben, logisch aufeinander folgenden Thesen. Diese hat er wie Bibelverse durchnummeriert und mit Unterpunkten versehen, sodass die sieben streng wissenschaftlichen Thesen des Tractatus von der ganzen Anmutung her einen dogmatisch messianischen Charakter bekamen. Ausgehend von seinem Kerngedanken, dass jede Erkenntnis der Welt immer nur in Worten und Sätzen formuliert werden kann, erklärt Wittgenstein Punkt für Punkt, wie die Menschen absolut korrekte und unzweifelhafte Aussagen über die Welt machen können. Künftig, so sein Ergebnis, darf ein Wissenschaftler nur noch solche Sätze formulieren, die logisch sinnvoll und in der Wirklichkeit überprüfbar sind. Alle anderen Sätze muss er als „Unsinn“ erkennen und für sich behalten. So lautet die letzte, vielzitierte siebte These des Tractatus:
Dieser Schlusssatz war deshalb so provokativ, weil er im Grunde nur noch naturwissenschaftliche Aussagen über die Welt zuließ und die Philosophie außer Kraft setzte:
So muss die Philosophie gemäß Wittgenstein sogar hinsichtlich ihrer klassischen Aufgabenfelder der Gerechtigkeit und der Ethik schweigen. Denn man kann moralische Sätze wie „Du sollst nicht stehlen!“ oder den kategorischen Imperativ „Du sollst so handeln, dass dein Handlungsgrundsatz zum allgemeinen Gesetz erhoben werden kann!“ niemals experimentell überprüfen, da sie sich auf die Zukunft richten und sich von vorneherein jeder Überprüfung entziehen:
Indem der junge Wittgenstein solchermaßen im Tractatus alle Fragen und Theorien für „unsinnig“ erklärt, die man wissenschaftlich nicht beantworten und beweisen kann, glaubt er sich selbst und die Welt ein für allemal von den quälenden Problemen der Philosophie befreit zu haben: