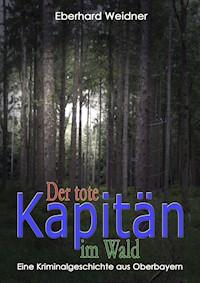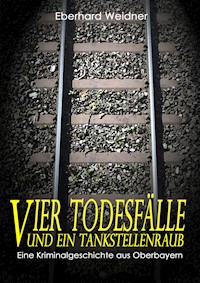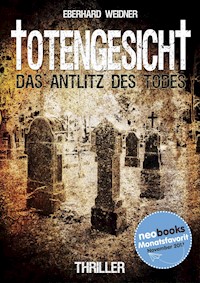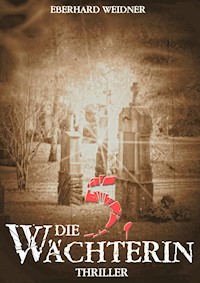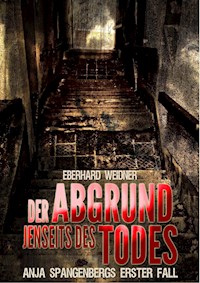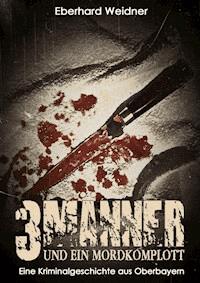
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Zwei Verkehrsunfälle und ein Suizid an ein und demselben Tag lassen Kriminalhauptkommissar Franz Schäringer von der Kripo Fürstenfeldbruck noch nicht misstrauisch werden. Doch dann ergeben die Untersuchungen der Spurensicherung, dass bei allen drei Vorfällen dasselbe Fahrzeug beteiligt war. Und der Gerichtsmediziner stellt darüber hinaus fest, dass der angebliche Selbstmord der Fahrzeughalterin gar keiner war, sondern die Frau vermutlich ermordet wurde. Schäringer geht daher davon aus, dass nur der Eindruck erweckt werden sollte, es würde sich um Unfälle und eine anschließenden Selbsttötung handeln. Als am nächsten Tag im Kofferraum eines Wagens, der an einem Unfall beteiligt war, eine weitere Leiche gefunden wird, glaubt zunächst niemand, dass es einen Zusammenhang zu den Ereignissen des Vortages gibt, denn der Mann wurde erstochen und damit eindeutig ermordet. Doch Schäringers Bauchgefühl sagt ihm, dass es dennoch eine Verbindung geben muss, auch wenn er momentan noch keine Beweise dafür hat. Um diese zu beschaffen, beginnt er mit seinem Kollegen Lutz Baum zu ermitteln und den wenigen Hinweisen nachzugehen, die sie in der Hand haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
COVER
TITEL
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ANMERKUNGEN DES AUTORS
NACHWORT
WEITERE TITEL DES AUTORS
LESEPROBE
EINS
»Das macht dann 17 Euro 80, Frau Moritz.«
Elisabeth Moritz runzelte unzufrieden die ohnehin faltige Stirn. Der Einkauf beim Metzger wurde auch jedes Mal teurer. Fast 18 Euro für ein paar Scheiben Salami und Lachsschinken, zwei Paar Wiener und das bisschen Geschnetzelte, das sie mittags für Hannes und sich selbst zum Essen machen wollte. Aber was soll’s?, dachte sie. Wenn man gute Qualität haben will, muss man eben auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen! Und die Alternative, die darin bestand, ihre Fleisch- und Wurstwaren in Zukunft im Supermarkt und nicht mehr bei ihrem Stammmetzger zu kaufen, bei dem sie seit mindestens dreißig Jahren Kundin war, kam für sie nicht infrage.
Also schenkte sie der übergewichtigen Metzgereifachverkäuferin hinter der Theke, deren schwarz gefärbte Haare an den Ansätzen schon wieder grau waren, das einstudierte Lächeln, das sie bei jeder Gelegenheit und in jeder Stimmung hervorzaubern konnte und auch den Kunden ihres Gästehauses zeigte, egal, wie nervtötend diese gerade waren, und zog einen 20-Euro-Schein aus ihrem Portemonnaie.
»Dann bekommen Sie von mir noch 2 Euro 20 zurück«, sagte die Verkäuferin, als wäre Elisabeth senil und nicht mehr selbst in der Lage, auszurechnen, wie viel sie herausbekam, und legte ihr das Wechselgeld in die ausgestreckte Handfläche. »Danke für Ihren Einkauf, Frau Moritz, und beehren Sie uns doch bald wieder.«
»Vielen Dank und auf Wiedersehen«, sagte Elisabeth Moritz, ohne die junge Frau daran zu erinnern, dass sie nun schon seit vielen Jahren jeden Freitagvormittag in die Metzgerei kam, obwohl sie große Lust verspürte, genau das zu tun.
Doch es wäre der Mühe nicht wert gewesen, denn die Verkäuferin hatte sich bereits von ihr weggedreht und den anderen Kunden zugewandt. »Wer kommt als Nächstes dran?«
Elisabeth wandte sich also ohne ein weiteres Wort um und verstaute ihr Portemonnaie und die Tüte mit der Wurst und dem Fleisch in ihrer Einkaufstasche, die sie unter dem linken Arm trug.
Obwohl sie im kommenden Winter erst ihren 68. Geburtstag feierte, sah sie mindestens fünf Jahre älter aus. »Das sind Sorgenfalten«, pflegte sie stets vorauseilend zu sagen, da es natürlich niemand wagte, die Falten von sich aus zu erwähnen. Weder die Falten noch das silbergraue Haar, das schulterlang war, von ihr aber meistens am Hinterkopf zu einem altmodischen Knoten geflochten wurde, der sie noch strenger aussehen ließ. Außerdem war sie für eine Frau erstaunlich groß, beinahe 1,80, dafür aber sehr dünn, und hatte spinnenartige, dürre Gliedmaßen.
»Daran sind die unzähligen Sorgen, die mir Hannes bereitet, die viele Arbeit im Gästehaus und der ständige Stress schuld«, sagte sie jedem, selbst denen, die es gar nicht wissen wollten. »Nur deshalb bin ich vorzeitig ergraut, habe mehr Falten im Gesicht als der Grand Canyon und wiege trotz meiner Größe weniger als fünfzig Kilo.«
Elisabeth nickte einer flüchtigen Bekannten zu, die in der Schlange vor dem Tresen stand, deren Name ihr aber partout nicht einfallen wollte. Der Frau, die nur unwesentlich jünger als sie selbst war, war anzusehen, dass sie nichts gegen ein kleines Schwätzchen einzuwenden hatte, um sich die Wartezeit zu verkürzen. Doch Elisabeth stand augenblicklich nicht der Sinn danach, sich einzig um des Redens willen über oberflächliche Themen zu unterhalten. Außerdem wäre es ihr zu peinlich, wenn sie die andere Frau nicht mit ihrem Namen ansprechen konnte. Was die dann wohl von mir denken würde?, fragte sie sich. Vermutlich, dass ich langsam dement werde oder Alzheimer kriege. Aber derartige Gerüchte wollte sie erst gar nicht aufkommen lassen. Deshalb warf sie einen demonstrativen Blick auf ihre Armbanduhr, bevor sie ihrer Bekannten einen bedauernden Blick zuwarf und eilig an ihr vorbei zur Tür schritt.
Elisabeth, die ein marineblaues Kleid, einen dazu passenden gleichfarbigen Blazer und bequeme, flache Schuhe trug, verließ die Metzgerei und blieb dann auf dem Bürgersteig stehen, um zu überlegen, ob sie auch tatsächlich alles erledigt hatte, was sie sich zu Hause vorgenommen hatte. Wie üblich hatte sie ihre freitägliche Einkaufstour im Supermarkt begonnen. Nachdem sie ihre dortigen Einkäufe im Auto verstaut hatte, war sie zu Fuß zum Bäcker und zum Metzger gegangen. Danach kehrte sie in der Regel zum Wagen zurück und fuhr nach Hause.
Moment!
Ihr fiel ein, dass sie noch zur Apotheke musste, um sich neue Schmerztabletten zu besorgen. Seit Kurzem hatte sie des Öfteren stechende Kopfschmerzen, gegen die die Tabletten, die sie zu Hause hatte, nichts ausrichteten. Noch machte sie sich keine Sorgen, es könnte etwas Ernsthaftes dahinterstecken. Außerdem hoffte sie, dass Tabletten mit einem anderen, eventuell stärkeren Wirkstoff ihr Leid linderten. Wenn die Schmerzattacken allerdings anhielten, würde sie wohl oder übel zum Arzt gehen müssen. Dabei gab es auf dieser Welt wenig, was Elisabeth mehr hasste und fürchtete als Ärzte. Was allerdings weniger an den Medizinern lag, sondern eher an Elisabeths ständiger Angst, sie könnten bei ihr eine schwere, unter Umständen sogar tödliche Krankheit diagnostizieren.
Da sie nicht länger als unbedingt nötig an tödliche Krankheiten denken wollte, sah sie sich suchend um. Die nächstgelegene Apotheke lag etwas versetzt auf der anderen Straßenseite und praktischerweise auf ihrem Weg zum Parkplatz, wo sie ihren Wagen abgestellt hatte. Elisabeth hielt nach einem Zebrastreifen Ausschau, doch der lag mindestens zweihundert Meter in der anderen Richtung, was nicht nur einen Umweg, sondern auch einen Zeitverlust bedeutet hätte. Sie hatte es zwar nicht eilig, doch je früher sie nach Hause und zurück in ihr Büro kam, desto früher konnte sie sich auch um diverse Angelegenheiten kümmern, die sie heute noch zu erledigen hatte. Sie sah erneut auf die Uhr, dieses Mal jedoch nicht, um jemandem vorzutäuschen, sie hätte es eilig, sondern weil sie tatsächlich wissen wollte, wie spät es war. Viertel vor zehn. Wenn sie sich beeilte, konnte sie noch einiges tun, bevor sie nach einem kurzen Mittagsschläfchen für Hannes und sich selbst Essen kochen musste.
Elisabeth hatte ihren Mann Franz-Xaver erst im reifen Alter von dreißig Jahren kennengelernt. Danach war allerdings alles Weitere Schlag auf Schlag und in einem nahezu perfekten 12-Monats-Rhythmus erfolgt, denn ein Jahr später hatten sie geheiratet, im Jahr drauf war ihr Sohn Hannes zur Welt gekommen und elfeinhalb Monate später hatte Franz-Xaver, der zu diesem Zeitpunkt erst 35 Jahre alt war, einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Nach seinem Tod hatte sich die Witwe ganz allein um das Gästehaus und ihren Sohn kümmern müssen. Mit viel Fleiß, harter Arbeit und noch mehr Durchsetzungsvermögen hatte Elisabeth es nicht nur geschafft, das Gästehaus vor dem Ruin zu bewahren, sondern auch von Jahr zu Jahr erfolgreicher zu werden. Bei der Erziehung ihres Sohnes war sie allerdings weniger erfolgreich gewesen. Normalerweise erbten Kinder von ihren Eltern sowohl gute als auch schlechte körperliche und charakterliche Merkmale, doch Hannes schien von Vater und Mutter nur die schlechten Dinge mitbekommen zu haben. Denn allzu schnell nach der Einschulung stellte sich heraus, dass er absolut keine Begabungen besaß. Hannes konnte im Grunde gar nichts, weder gut lesen, schreiben oder rechnen, noch zeichnen, malen, werken oder sporteln. Er war praktisch ein Versager auf ganzer Linie und schaffte es nicht einmal, die Schule ordentlich abzuschließen. Ohne Schulabschluss war an eine anschließende Lehre natürlich nicht zu denken. Aber zum Glück besaß er wenigstens ein Mindestmaß an handwerklichem Geschick, sodass Elisabeth ihn als Hausmeister im Gästehaus einsetzen konnte. Ihr graute allerdings vor dem Tag, an dem sie sterben und Hannes zwangsläufig das Gästehaus erben würde. Vermutlich würde er alles, was sie in den letzten 34 Jahren aufgebaut und erreicht hatte, in kürzester Zeit zerstören. Er lag ihr in letzter Zeit ohnehin schon ständig in den Ohren mit der wahnwitzigen Bitte, ihm die Leitung des Gästehauses schon jetzt, zu ihren Lebzeiten, zu übertragen und sich zur Ruhe zu setzen. Als wenn sie dann tatsächlich ihre Ruhe gehabt hätte. Aber das konnte er sich abschminken. Freiwillig würde sie ihm das Gästehaus bestimmt nicht übertragen. Wenn, dann musste er es ihr schon aus ihren kalten, starren Händen reißen.
Nur über meine Leiche!, dachte Elisabeth grimmig, die trotz der Kopfschmerzen, die sie auch jetzt plagten, nicht vorhatte, allzu bald zu sterben. Auch wenn Hannes sie manchmal so ansah, als würde er den natürlichen Lauf der Dinge nur schwerlich abwarten können und deshalb am liebsten selbst nachhelfen wollen. Doch auch dazu war er ihrer Meinung nach gar nicht fähig. Wenn er sie tatsächlich irgendwann umbringen wollte, dann hatte sie ohnehin nichts zu befürchten, da er sich sogar dabei mit Sicherheit erbärmlich anstellen und versagen würde.
Obwohl sie in diese unschönen Gedanken vertieft war, achtete Elisabeth dennoch wie immer auf den Verkehr. Andernfalls wäre sie vermutlich auch nicht 67 Jahre alt geworden. Sie blieb am Rand des Gehsteigs stehen und sah in beide Richtungen. Wenn mehr Autos unterwegs gewesen wären, dann hätte sie vermutlich sogar den Zebrastreifen benutzt, doch momentan war ohnehin wenig Verkehr. Beide Fahrbahnen waren frei, und in beiden Richtungen waren keine näher kommenden Fahrzeuge zu sehen. Wenn sie sich beeilte, konnte sie auf der anderen Seite sein, bevor das nächste Auto kam. Links von ihr stand ungefähr zwanzig Meter entfernt eine schwarze BMW-Limousine mit laufendem Motor am Straßenrand, doch der Fahrer, den sie hinter der spiegelnden Scheibe nicht erkennen konnte, machte keinerlei Anstalten, loszufahren. Vermutlich wartete er auf jemanden.
Such dir gefälligst einen richtigen Parkplatz und verschmutz hier nicht die Umwelt!, sandte Elisabeth ihm eine gedankliche Botschaft, obwohl sie nicht an solchen Unfug wie Gedankenübertragung glaubte, bevor sie den Blick wieder nach vorn richtete und die Straße betrat.
Sie hatte erst zwei große Schritte gemacht, als ganz in der Nähe ein Motor laut aufheulte und Reifen protestierend quietschten, sodass sie erschrocken zusammenzuckte. Das Motorengeräusch wurde daraufhin erschreckend schnell lauter. Elisabeth blieb stehen und wandte den Kopf in die Richtung des Lärms, ohne allerdings gleich zu begreifen, dass die Lärmquelle eine Gefährdung für sie darstellen könnte.
Als sie den schwarzen BMW erneut erblickte, war er nicht mehr zwanzig, sondern nur noch fünf Meter von ihr entfernt. Außerdem stand er nicht mehr am Straßenrand, sondern bewegte sich mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Und die Motorhaube war genau auf sie gerichtet. Auch ohne die exakte Geschwindigkeit des Wagens zu kennen, wusste Elisabeth, dass der Wagen und sie in Kürze unweigerlich miteinander kollidieren würden. Es war gewissermaßen unaufhaltsam, und weder sie noch der Fahrer konnten noch etwas tun, um es zu verhindern.
Die zweite Erkenntnis, die ihr in diesem Augenblick kam, der sich in ihrer Wahrnehmung scheinbar zu Minutenlänge dehnte, war sogar noch erschreckender. Denn ihr wurde jäh bewusst, dass ihr alter, dürrer Körper und ihre spröden Knochen der Masse, der Robustheit und der Wucht des BMW nichts entgegenzusetzen hatten. Beinahe glaubte sie schon jetzt, die Schmerzen spüren zu können, die sie unweigerlich haben würde, wenn ihre Knochen unter dem heftigen Aufprall zerbrachen und ihr Körper aufgerissen wurde.
Es war der letzte bewusste Gedanke, den Elisabeth Moritz in ihrem Leben hatte, das nach beinahe 68 Jahren auf dieser Straße enden würde, denn nicht einmal 0,6 Sekunden später riss ihr die Front des Fahrzeugs die Beine unter dem Körper weg, deren Knochen wie morsche Äste an mehreren Stellen brachen. Doch entgegen ihrer Vorstellung spürte sie keine Schmerzen, als sie auf die Motorhaube krachte und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe knallte, was unweigerlich weitere Knochenbrüche zur Folge hatte, unter anderem einen mehrfachen, schweren Schädelbruch.
Für den Bruchteil einer Sekunde lag sie völlig reglos auf der Motorhaube des fahrenden Wagens, ihre linke Wange gegen die Windschutzscheibe gepresst. Aus dieser Nähe hätte sie vermutlich sogar einen Blick durch die Scheibe auf den Fahrer werfen können. Doch in ihrer misslichen Lage kam sie nicht einmal auf den Gedanken, so etwas zu tun. Außerdem war der Augenblick zu kurz, denn schon wurde sie von den erbarmungslosen Kräften, die auf ihren wehr- und hilflosen Körper einwirkten, wie eine Gliederpuppe über das Wagendach geschleudert. Sie landete mehrere Meter hinter dem Wagen auf der Straße, die sie hatte überqueren wollen, während der BMW nicht etwa anhielt, sondern im Gegenteil rasant beschleunigt wurde und davonfuhr. Doch davon bekam Elisabeth Moritz schon nichts mehr mit. Ebenso wenig von der Tatsache, dass der mörderische Aufprall auf dem Asphalt nahezu sämtliche anderen bis dahin unversehrt gebliebenen Knochen in ihrem toten Körper zerschmetterte.
»Beeil dich! Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen.«
Lisa Bernert hatte die Worte noch immer im Ohr, obwohl es nun schon beinahe zehn Minuten her war, dass Norbert sie am Telefon zu ihr gesagt hatte.
Und sie hatte sich in der Tat beeilt. So schnell hatte sie nach dem Ende des Telefonats ihre Schuhe noch nie angezogen. Danach war sie in Rekordzeit die Stufen des Mietshauses, in dessen drittem Stock ihre kleine Wohnung lag, nach unten geeilt, wo ihr roter Daihatsu Cuore stand, hinter dessen Steuer sie nun saß und hoch konzentriert auf die schmale Landstraße starrte, die sich vor ihr zwischen abgeernteten Feldern wand und zeitweise durch kleine Waldstücke schlängelte.
Nach dem Losfahren hatte sie kurz überlegt, die längere Strecke zu nehmen, die über die wesentlich breitere und geradere Bundesstraße führte und die sie entschieden lieber fuhr als die enge, kurvige Landstraße über die Dörfer. Doch dann hatte sie sich dagegen entschieden, denn sonst hätte sie mindestens doppelt so lange gebraucht, um zu Norberts Haus zu kommen. Und das nicht nur, weil Norbert ihr am Telefon gesagt hatte, dass sie unbedingt die kürzere Strecke nehmen sollte. Nein, sie selbst wollte so wenig Zeit wie möglich verlieren und so schnell wie möglich bei ihm sein.
Lisa umklammerte das Lenkrad so fest, dass ihre Fingerknöchel ganz blutleer waren und aussahen, als wären sie aus Elfenbein geschnitzt. Sie wagte es auch kaum, ihren Blick von der Straße vor ihr zu nehmen, und schaute nur gelegentlich in den Rückspiegel, um zu sehen, ob jemand hinter ihr fuhr. Denn das mochte sie überhaupt nicht. Dass ein anderer Autofahrer ihr auf dieser Strecke im Nacken saß, weil er ohne ihren Kleinwagen vor sich viel schneller fahren konnte, aufgrund der teilweise sehr engen Straße und der vielen unübersichtlichen Kurven aber nicht in der Lage war, sie zu überholen. Sie fühlte sich dann immer dazu gedrängt, schneller zu fahren, als ihr lieb war, weil sie niemanden aufhalten wollte und den Unmut der anderen über ihre vorsichtige und langsame Fahrweise beinahe körperlich spüren konnte. Es kam ihr dann vor, als würde der andere Fahrer sie vor sich herjagen. Und wenn sie dann schneller und schneller fuhr, begann sie sich immer unsicherer zu fühlen, sodass ihr der Schweiß ausbrach und ihr Herz rasend schnell schlug, weil sie Angst hatte, einen Fehler zu machen.
Hätte ich nur die andere Strecke genommen!, dachte sie und riskierte einen kurzen Blick in den Innenspiegel. Doch hinter ihr war zum Glück kein anderes Auto zu sehen. Wenigstens etwas!
Es würde schon nichts passieren. Sie war die Strecke erst einmal gefahren und hatte danach immer den längeren Weg über die Bundesstraße genommen, doch damals war auch alles gut gegangen.
Da es ein Stück geradeaus ging, wagte es Lisa, die rechte Hand vom Lenkrad zu nehmen und sich eine vorwitzige Strähne ihres langen rotblonden, lockigen Haars aus der Stirn zu streichen, die ihr ins Gesicht gefallen war. Lisa war vierundzwanzig Jahre alt, mittelgroß und schlank. Sie hatte leuchtend hellgrüne Augen und ein hübsches herzförmiges Koboldgesicht mit hohen Wangenknochen und einem vorwitzig spitzen Kinn. Die Brille mit der schwarzbraunen Kunststofffassung und den schmalen, ovalen Gläsern trug sie nur zum Autofahren und zum Fernsehen. Sie war ein fröhlicher Mensch, der gern und viel lachte, doch im Augenblick blickte sie in tödlichem Ernst und mit gerunzelter Stirn hochkonzentriert auf die Straße, die vor ihr lag.
Lisa studierte Design an der Fachhochschule München, hatte heute aber vorlesungsfrei. Norberts Anruf war für sie überraschend gekommen, denn sie hatte schon nicht mehr damit gerechnet, dass er sich noch einmal bei ihr melden würde. Sie hatten sich vor einem Dreivierteljahr kennengelernt, als sie mehrere Grafikdesigner in der Umgebung abgeklappert hatte, um einen Praktikumsplatz zu bekommen. Norbert hatte ihr nicht helfen können, da er allein in einem Büro in seinem Wohnhaus arbeitete und keine Zeit hatte, sich auch noch um eine Praktikantin zu kümmern. Außerdem würde, so sagte er damals, seine Frau Karin bestimmt eifersüchtig werden, wenn er eine so hübsche Praktikantin beschäftigte. Lisa hatte dann zum Glück woanders einen Praktikumsplatz bekommen, doch Norbert war ihr danach nicht mehr aus dem Kopf gegangen, sodass sie sich irgendwann eingestehen musste, dass sie sich in ihn verliebt hatte. Dumm nur, dass er verheiratet und Vater zweier Kinder war. Also hatte sie sich bemüht, ihn wieder zu vergessen. Doch wie der Zufall es wollte, traf sie ihn wenige Tage später beim Einkaufen im Supermarkt. Sie unterhielten sich in der Kühlabteilung zwischen Fertigpizzen und gefrorenen Hähnchenschenkeln sehr angeregt und vergaßen dabei die Zeit, sodass Lisa am nächsten Tag einen leichten Schnupfen hatte. Allerdings hatte diese Begegnung nicht nur unangenehme Folgen, denn sie verabredeten sich am darauffolgenden Nachmittag in einem Café. Dort gestand Norbert ihr, dass er sich in sie verliebt habe. Vom Café ging es daher direkt in ihre Wohnung, wo sie sich, kaum dass die Tür hinter ihnen zugefallen war, sofort gegenseitig die Kleider vom Leib rissen und es gerade noch ins Bett schafften, wo sie sich so leidenschaftlich liebten, wie Lisa es vorher noch nie erlebt hatte. Seitdem trafen sie sich mehr oder weniger regelmäßig und hatten eine Beziehung, die man vermutlich als Verhältnis, Affäre oder Liebschaft bezeichnen musste. Lisa drängte Norbert nie dazu, seine Frau und seine Kinder zu verlassen. Sie ahnte, dass sie dadurch auch das Gegenteil erreichen und ihn verlieren konnte, und das wollte sie nicht, weil sie ihn über alles liebte. Sie hoffte allerdings, dass er mit der Zeit von allein die richtige Wahl treffen und sich für sie entscheiden würde. Doch das geschah nicht. Es sah beinahe so aus, als hätte Norbert sich mit der Situation arrangiert und wäre mit ihr zufrieden. Im Gegensatz zu Lisa, die ihn nur ungern mit einer anderen Frau teilte, aber nicht wusste, wie sie das ändern sollte, ohne ihn zu vergraulen. Norbert hingegen schien es zu genießen, sowohl die Annehmlichkeiten einer Ehe und des Familienlebens als auch die einer heimlichen Geliebten zu haben, obwohl er ihr stets aufs Neue versicherte, dass er nur sie lieben würde, aber seine Frau momentan wegen der Kinder nicht verlassen könne. Doch dann, vor drei Wochen, veränderte sich die Situation schlagartig, als Lisa erfuhr, dass sie schwanger war.
Sie schreckte hoch und stellte fest, dass sie eine ganze Weile in Gedanken versunken gewesen und völlig unbewusst gefahren war. Es war nichts passiert, dennoch hatte es ihr einen Schrecken eingejagt, und ihr Herz klopfte rasend schnell. Sie verringerte die ohnehin nicht sehr hohe Geschwindigkeit noch mehr, als eine weitere enge Kehre kam, und lenkte den Daihatsu mit beiden schweißfeuchten Händen am Lenkrad hinein. Sie atmete auf, als sie den Scheitelpunkt passierte, ohne dass ihr ein anderes Fahrzeug entgegengekommen wäre – ein weiterer Albtraum auf dieser Strecke –, und es wieder ein Stück geradeaus ging.
Sie nahm eine Hand vom Steuer und wischte sich mit dem Ärmel ihres hellgrauen Kapuzenpullis den Schweiß von der Stirn. Außer dem Pulli trug sie hellblaue Jeans und weiße Turnschuhe. Bequeme, zweckmäßige Kleidung, die sie nicht nur in ihrer Freizeit, sondern ständig trug. Sie hielt nichts davon, sich aufzustylen und herauszuputzen, um möglicherweise wie jemand auszusehen, der sie gar nicht sein wollte. Deshalb schminkte sie sich auch nur dezent und trug allenfalls ein bisschen Lippenstift und Eyeliner auf.
Der Gedanke an ein Kind hatte in Lisas Überlegungen bis vor Kurzem kaum eine Rolle gespielt. Natürlich wollte sie irgendwann Kinder, aber auf keinen Fall jetzt, bevor sie ihr Studium abgeschlossen und im Berufsleben Fuß gefasst hatte. Der Schock war deshalb groß, als ihre Frauenärztin ihr mitteilte, sie sei in der 6. Woche schwanger. Sie hatte zwar schon davor Anzeichen festgestellt, die auf eine Schwangerschaft hindeuteten – ihre Regelblutung war ausgeblieben, ihre Brüste spannten unangenehm, sie spürte ein Ziehen im Unterleib, war oft müde und hatte unerklärliche Stimmungsschwankungen –, doch sie hatte es nicht wahrhaben wollen. Bis ihr Dr. Beckmann breit lächelnd verkündete: »Herzlichen Glückwunsch, Frau Bernert, Sie sind schwanger.«
Schwanger!
Das Wort hallte danach noch stundenlang wie das Läuten einer Totenglocke in ihrem Verstand wider.
Schwanger!
Was sollte sie jetzt tun? Abtreiben kam für sie nicht infrage. Es war schließlich ihr Kind, ihr Fleisch und Blut. Und natürlich das Kind des Mannes, den sie liebte. Doch wie sollte es jetzt weitergehen? Auf dem Weg von der Praxis nach Hause wurde ihr allmählich klar, dass sich damit die Grundlage ihrer Beziehung zu Norbert entscheidend verändert hatte. So wie bisher konnte es nicht mehr weitergehen. Norbert musste Verantwortung für das Kind übernehmen. Und nicht nur das. Er musste sich endlich entscheiden, für oder gegen Lisa und das Kind. Denn jetzt konnte er die beiden Kinder mit seiner Ehefrau nicht länger als Ausrede benutzen, warum er Karin nicht verlassen konnte, weil es ein weiteres Kind gab, auch wenn es noch gar nicht auf der Welt war.
Nachdem Lisa nach dem Arztbesuch in ihre Wohnung zurückgekehrt war, wobei sie sich kaum an den Nachhauseweg erinnern konnte, weil sie ihn wie eine Schlafwandlerin zurückgelegt hatte, rief sie ihn sofort an. Sie wusste, dass er um diese Zeit allein zu Hause war und keine Gefahr bestand, dass seine Frau oder die Kinder ans Telefon gehen könnten.
»Hallo, ich bin’s«, meldete sie sich, ohne ihren Namen zu nennen. Schließlich konnte Karin oder eines der Kinder krank geworden und deshalb zu Hause sein und möglicherweise mithören. Daher hatte Norbert verlangt, dass sie sich nie namentlich meldete, wenn sie bei ihm zu Hause anrief. »Bist du allein?«
»Ja. Was ist los, Spatzi? Wieso rufst du an? Wir sehen uns doch ohnehin morgen Vormittag.«
»Vielleicht.«
»Was heißt hier vielleicht? Wir haben das doch schon ausgemacht. Außerdem muss ich dich unbedingt sehen, Spatzi. Ich kann an nichts anderes denken als an deinen wunderschönen nackten Körper. Das macht mich noch ganz wahnsinnig. Schon allein deshalb müssen wir uns morgen treffen!«
»Mal sehen.«
»Was ist los mit dir? Bist du betrunken?«
»Schön wär’s. Aber es ist …« Sie seufzte. »… etwas anderes.«
»Wovon redest du, Lisa? Allmählich machst du mir Angst. Steckt etwa ein anderer Mann dahinter? Hast du jemanden kennengelernt? Tu mir das bitte nicht an, Lisa!«
»Nein, das ist es auch nicht.«
»Was dann? Jetzt rede endlich!«
»Ich … ich bin schwanger.«
Für eine Weile, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam, herrschte Stille. Keiner von ihnen sagte etwas. Es schien sogar, als hielten beide die Luft an. Lisa kam die Stille unheilvoll vor. Ein düsteres Vorzeichen dessen möglicherweise, was noch folgen würde. Und irgendwie hatte sie schon jetzt das Gefühl, dass es nichts Angenehmes sein würde.
»Schwanger? Aber wie konnte das denn passieren, Herrgott noch mal? Du nimmst doch die beschissene Pille.«
Lisa atmete einmal ganz tief durch und zwang sich, ruhig zu bleiben. »So was kann trotzdem passieren, Norbert. Freust du dich denn gar nicht?«
»Freuen?« Norbert lachte. Doch es war kein fröhliches Lachen, wie sie es von ihm gewohnt war, sondern eins, aus dem Verzweiflung herauszuhören war. »Wieso sollte mich das freuen, Lisa? Ich hab schon zwei Kinder. Ich kann ums Verrecken nicht noch eins gebrauchen!«
»Aber das ist unser Kind, Norbert! Deins und meins!«
Er seufzte. »Ja, das stimmt schon. Ich würde mich ja auch gerne darüber freuen. Aber im Moment, also, da ist das ganz, ganz schlecht.«
»Wieso?«
»Das weißt du doch, Lisa. Es ist wegen Karin und den Kindern.«
»Was soll ich deiner Meinung nach also tun?«
»Hör mal! Das ist auch für mich nicht leicht. Aber es gibt Möglichkeiten …« Er verstummte, wollte vermutlich nicht derjenige sein, der es aussprach. Wollte, dass sie selbst auf den Gedanken kam und ihn in Worte fasste.
»Du willst also, dass ich unser Kind abtreibe?«
»Das hab ich nicht gesagt. Das war deine Idee. Aber im Grunde ist es doch die einzig vernünftige Alternative. Im Moment jedenfalls. Das musst du doch einsehen, Lisa!«
»Vergiss es, Norbert!«
»Was …?«
»Ich werde nicht abtreiben.«
»Jetzt sei doch vernünftig, Spatzi.«
»Lass das! Außerdem bin ich vernünftig. Unvernünftig wäre es, die Frucht unserer Liebe zu töten.«
Schweigen. Lisa konnte Norbert atmen hören. Sie stellte sich vor, wie er fieberhaft überlegte und seine Augen rastlos hin und her huschten, während er nachdachte und nach einem Ausweg aus diesem Dilemma suchte.
»Hör zu, Lisa! Ich glaube, wir sollten ein andermal darüber sprechen. Am besten morgen, wenn wir uns ohnehin treffen. Wenn wir beide eine Nacht über die Sache nachdenken und uns wieder beruhigen konnten, dann sieht alles schon ganz anders aus.«
»Nein!«
»Wieso bist du auf einmal so stur, Lisa? So kenne ich dich gar nicht.«
»Das sind vermutlich Stimmungsschwankungen. Die hat man, wenn man schwanger ist, weil die Hormone verrücktspielen. Aber glaub bloß nicht, dass ich morgen anders über die Sache denke. Ich werde das Kind bekommen! Und du, Norbert …!«
»Jetzt sei doch endlich …«
»Unterbrich mich gefälligst nicht, Norbert, sonst beende ich dieses Telefonat auf der Stelle!«
Er erwiderte nichts darauf.
»Also, ich habe mich bereits für das Kind entschieden. Und du, Norbert, musst dich jetzt ebenfalls entscheiden. Dazu hast du …« Sie überlegte und nannte dann den ersten Zeitraum, der ihr in den Sinn kam. »… genau drei Wochen Zeit.«
»Was soll das sein? Ein Ultimatum?«
»Ja. Drei Wochen. Keinen einzigen Tag länger.«
»Und was soll ich genau entscheiden?«
»Ob du weiterhin bei Karin und den Kindern bleiben oder mit unserem Kind und mir zusammen sein willst.«
»Tu das nicht, Lisa! Damit machst du doch bloß alles kaputt.«
»Nein, Norbert. Nicht ich mache alles kaputt, sondern du, wenn du dich gegen uns entscheidest. Aber du musst es nicht gleich tun. Du hast drei Wochen Zeit dafür.«
»Und falls ich mich gegen dich und dafür entscheiden sollte, bei Karin zu bleiben. Was würdest du dann tun?«
»Falls du das wirklich tust, werde ich deine Frau anrufen und ihr alles erzählen. Außerdem werde ich allen sagen, wer der Vater des Kindes ist. Und natürlich werde ich dich auf Unterhalt verklagen, wenn du nicht freiwillig zahlst.«
»Ja, bist du denn jetzt komplett wahnsinnig geworden?«
»Nein. Ganz im Gegenteil. Ich hab mich noch nie so vernünftig gefühlt.«
»Das … das kannst du mit mir nicht machen?«
»Doch! Und wie ich das kann. Und unsere Treffen kannst du dir vorerst auch abschminken. Ruf mich erst wieder an, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Bis dahin will ich dich weder sehen noch hören.«
»Ich …«
Doch Lisa hatte genug von ihm und legte einfach auf. Danach rief er noch ein halbes Dutzend Mal bei ihr an. Sie sah seine Nummer auf dem Display, nahm aber nicht ab.
Und seitdem hatte sie tatsächlich nichts mehr von ihm gehört. Und da die Frist, die sie ihm gesetzt hatte, mit dem Ende des heutigen Tages abgelaufen wäre, hatte sie auch nicht mehr damit gerechnet.
Bis er vor fünfzehn Minuten angerufen hatte.
»Ja?«, fragte Lisa kühl, nachdem sie abgenommen hatte, denn sie hatte natürlich seine Nummer erkannt.
»Ich war ein Idiot, Lisa«, sagte Norbert anstelle einer Begrüßung.
Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Nach dem, was er bei ihrem letzten Telefonat gesagt hatte, hatte sie eigentlich damit gerechnet, dass er ihr mitteilen würde, er wolle bei seiner Frau bleiben. Doch seine Worte klangen nicht danach und gaben ihr neue Hoffnung.
»Um das zu erkennen, hast du aber lange gebraucht.« Noch bemühte sie sich, sich von ihren Gefühlen nichts anmerken zu lassen.
»Es war eine schwere Entscheidung. Deshalb musste ich es mir auch gut und lange überlegen. Außerdem wollte ich ganz sicher sein, das Richtige zu tun. Aber jetzt weiß ich endlich, was ich will.«
»Und was …« Sie musste schlucken, bevor sie weitersprechen konnte. »… willst du?«
»Ich will dich, Lisa.«
Sie zitterte am ganzen Körper vor Freude und Aufregung, während ihr Herz pochte, als wollte es zerspringen.
»Bist du dir wirklich sicher?«
»Ja.«
»Und das Kind?«
»Ich will dich und das Kind.«
Lisa lächelte selig. Zum Glück war niemand anderes in ihrer Wohnung, der sie sehen konnte, denn sie sah bestimmt wie ein Trottel aus. Sie hatte, wenn sie ehrlich war, nicht mehr damit gerechnet, aber im Gegensatz zu ihrem letzten Telefonat sagte Norbert dieses Mal genau das, was sie von ihm hören wollte. Er war wie ausgewechselt. Ihr Ultimatum musste ihn nicht nur zum Nachdenken, sondern sogar zum Umdenken gebracht haben. Doch trotz aller Freude blieb ein Teil ihres Verstandes misstrauisch und mahnte zur Vorsicht.
»Wann sagst du’s Karin?«
»Das hab ich schon getan.«
Sie glaubte ihren Ohren nicht zu trauen. Endlich entwickelte sich alles so, wie sie es sich gewünscht hatte. »Wann?«
»Vor einer Viertelstunde. Karin …« Er stockte und seufzte schwer. »Sie hat es zum Glück relativ gefasst aufgenommen und keine Szene gemacht. Vielleicht hat sie ja schon etwas geahnt. Auf jeden Fall ist sie mit den Kindern weggefahren. Wenn sie in zwei Stunden zurückkommt, muss ich meine Koffer gepackt haben und verschwunden sein.«
»Soll ich …?«
»Ja. Komm bitte her und hol mich ab. In dein winziges Spielzeugauto passt zwar nicht viel rein, aber den Rest kann ich auch ein anderes Mal holen. Und beeil dich! Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen.«
»Mir geht es genauso.«
»Fahr über die Dörfer, dann bist du schneller da.«
»Aber …«
»Tu es einfach, Spatzi! Mir zuliebe. Um diese Zeit ist auf der Strecke ohnehin nichts los. Und je eher du da bist, desto früher kann ich dich wieder in meinen Armen halten und können wir ein neues, gemeinsames Leben beginnen. Ich hab dich so vermisst.«
»Ich dich auch. Ich leg dann jetzt auf und fahr sofort los.«
»Gut. Ich warte auf dich.«
»Ich liebe dich«, sagte sie, doch Norbert hatte bereits aufgelegt. Macht nichts, dachte sie. In ungefähr zwanzig Minuten kann ich es ihm ins Gesicht sagen.
Die Erinnerung an das Telefonat hatte ein verträumtes Lächeln auf Lisas Gesicht gezaubert. Sie wurde allerdings sofort wieder ernst, als sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung im Seitenspiegel registrierte. Sie nahm die Augen von der Straße und blickte in den Spiegel. Was sie darin sah, verjagte die Glücksgefühle und trieb ihr erneut den Angstschweiß auf die Stirn.
»Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt«, sagte sie und behielt das Fahrzeug, das sich ihr mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte, noch einen Moment länger im Auge, ehe sie sich losriss und wieder nach vorn sah. Gerade noch rechtzeitig, denn da kam auch schon die nächste Kurve. Mit dem anderen Auto hinter sich bremste sie nicht so stark ab, wie sie es getan hätte, wenn sie allein auf der Strecke gewesen wäre. Dennoch kam sie gut durch die Kurve. Danach ging es wieder ein Stück geradeaus weiter, sodass Lisa es wagen konnte, wieder in den Rückspiegel zu schauen.
Sie stöhnte auf, denn der andere Wagen war schon direkt hinter ihr. Zwischen den beiden Fahrzeugen hätte kein anderes Auto mehr gepasst. Der andere musste wie ein Wahnsinniger durch die Kurve gefahren sein, um die Lücke so schnell zu schließen.
Lisa sah wieder auf die Straße. Die nächste Kurve war noch mehrere Hundert Meter entfernt. Außerdem war die Straße an dieser Stelle breit genug, sodass zwei Autos gefahrlos nebeneinander fahren konnten.
»Überhol doch endlich!«
Doch als sie in den Rückspiegel sah, war der andere noch immer hinter ihr. Es handelte sich um einen schwarzen Wagen, vermutlich ein BMW. Den Fahrer konnte sie nicht erkennen, da sich der weißblaue Himmel in der Frontscheibe widerspiegelte. Sie hatte das unangenehme Gefühl, das andere Auto wäre noch näher gekommen, sodass die Entfernung zwischen ihnen nicht mehr in Metern, sondern nur noch in Zentimetern gemessen werden konnte.
»Was soll das denn, du Idiot? Und wieso überholst du nicht?«
Obwohl sie eigentlich gar nicht schneller fahren wollte, trat Lisa dennoch aufs Gas, um den Abstand zu vergrößern. Für einen Moment klappte das auch, doch dann fuhr auch der andere schneller und hing erneut wie eine Klette an ihr.
Zum Glück war sie heute ausnahmsweise angeschnallt. In der Regel mochte sie es nicht, weil sie sich dabei immer so eingeengt fühlte. Doch weil Norbert sie gebeten hatte, diese Strecke zu fahren, hatte sie eine Ausnahme gemacht und den Gurt genommen. Jetzt war sie froh darüber.
Sie fuhr noch schneller und sah nach vorn. Noch etwa zweihundert Meter bis zur Kurve.
Was soll ich nur tun, wenn wir dort sind?, fragte sie sich panisch, denn ihrer Meinung nach fuhr sie zu schnell für die scharfe Kurve. Und wenn sie abbremste, fuhr ihr möglicherweise der Idiot hinter ihr ins Heck. Sie sah auf den Tacho und erschrak. Sie hatte gedacht, sie würden achtzig fahren. Doch laut Geschwindigkeitsanzeige hatte sie bereits über hundert Sachen drauf.
»Das ist doch der Wahnsinn!«
Es war nicht mehr weit bis zu dem kleinen Ort, in dem Norbert wohnte. Doch wenn der Schwachkopf hinter ihr so weitermachte, käme sie dort nie heil an.
Sie sah wieder in den linken Seitenspiegel und atmete erleichtert auf. Der BMW war endlich zum Überholen auf die andere Spur ausgeschert und schob sich jetzt langsam neben sie. Bei der hohen Geschwindigkeit, mit der sie fuhren, hatten sie die Kurve schon beinahe erreicht.
Lisa wollte bremsen.
Doch bevor sie dazu kam, sah sie aus dem Augenwinkel, dass das andere Auto in ihre Richtung schwenkte, obwohl es noch immer neben ihr fuhr und sie noch nicht überholt hatte. Sie riss das Lenkrad herum, um auszuweichen, schaffte es jedoch nicht. Mit einem lauten Krachen prallte der schwere BMW seitlich in ihren Daihatsu. Der Kleinwagen hatte gegen die Masse des viel schwereren Autos keine Chance und wurde zur Seite geschleudert. Die rechten Räder kamen von der Straße ab und holperten über den schmalen Grasstreifen, der die Straße von der steilen Böschung trennte, hinter der die Felder lagen.
Für einen Moment hatte Lisa die Hoffnung, dass der Fahrer des anderen Wagens ihr nach der unabsichtlichen Kollision Platz machen würde und sie ihr Auto wieder auf die Straße lenken könnte. Doch schon eine Sekunde später krachte der BMW erneut in ihr Auto und schob es endgültig von der Straße.
Der Daihatsu stellte sich schräg und raste die steile Böschung hinunter. An ihrem Ende bohrte sich die vordere rechte Ecke des Fahrzeugs in die Erde des Ackers.
Durch den Krach wurde eine Schar Krähen aufgeschreckt, die auf dem abgeernteten Feld nach Körnern gesucht hatte, und erhob sich mit einem protestierenden, vielstimmigen Krächzen in die Luft.
Lisa schrie ebenfalls laut, als sie nach vorn geworfen wurde und in den Sicherheitsgurt fiel, der sich ruckartig spannte und in ihren Leib bohrte. Den Bruchteil eines Augenblicks später entfalteten sich mit einem lauten Knall die Airbags und pressten sie in den Sitz zurück.
Der Wagen wurde hochgeschleudert, landete auf dem Dach und überschlug sich dann mehrmals auf dem Feld.
Um Lisa herum herrschten nur noch infernalischer Lärm und wirbelnde, übelkeitserregende Bewegung, sodass sie sich wie in einer Waschmaschine im Schleudergang vorkam. Der Gurt hielt sie allerdings in ihrem Sitz und verhinderte, dass sie durch die Fahrgastzelle oder durch die zerschmetterten Fenster nach draußen geschleudert wurde. Von den dreieinhalb Überschlägen bekam die junge Frau allerdings nur die ersten anderthalb mit. Denn als das Auto das zweite Mal auf dem Dach landete, schlug Lisas Kopf so heftig gegen etwas, das härter und unnachgiebiger als ihr Schädelknochen war, dass die chaotische Welt um sie herum für sie augenblicklich zu existieren aufhörte.
Nach zwei weiteren Überschlägen kam der Daihatsu völlig demoliert auf dem Dach zu liegen. Nur die vier Reifen drehten sich noch eine Weile munter weiter, bis schließlich auch sie zum Stillstand kamen. Danach war nur noch das Ticken von heißem Metall zu hören, das sich langsam abkühlte, denn das Motorengeräusch des ohne Halt davongefahrenen BMW hatte sich längst in der Ferne aufgelöst.
Ansonsten war es für eine Weile geradezu totenstill. Und nichts bewegte sich, weder innerhalb noch außerhalb des Wracks.
Dann kamen die Krähen zurück, die auf einem nahen Baum Zuflucht gesucht hatten, landeten rund um das zerstörte Fahrzeug und suchten wieder nach Essbarem.
»Verdammter Mist!«
Er wäre gern schneller gefahren, doch ausgerechnet heute hatte der Scheinwerfer seines Keeway-Motorrollers seinen Geist aufgegeben. Michi wusste nicht, ob nur die Birne defekt oder sogar ein neuer Scheinwerfer fällig war. Letzteres wäre noch ärgerlicher, denn das würde ein Loch in sein derzeit ohnehin geringes Barvermögen reißen.
Er fuhr langsam über den schmalen Kiesweg, der an dieser Stelle durch ein dichtes Waldstück führte und eigentlich nur für Spaziergänger und Wanderer gedacht war. Hier war es besonders dunkel. Die einzige Orientierungshilfe bot ein schmaler Streifen Nachthimmel über ihm, der nur geringfügig heller war als die Baumkronen rechts und links, weil der sichelförmige Mond sich hinter eine dichte Wolkendecke zurückgezogen hatte. Wenigstens kannte Michi den Weg, sonst hätte er auf diesem Teil seines Heimwegs noch langsamer fahren oder den Motorroller vielleicht sogar schieben müssen. Er hoffte nur, dass nicht plötzlich ein Reh oder Wildschwein vor ihm auf dem Weg stand, denn wenn er das Tier zu Gesicht bekäme, wäre es zu spät, um den Roller noch rechtzeitig anzuhalten.
Seine Mutter würde toben. Wahrscheinlich hatte sie schon unzählige Male versucht, ihn auf seinem Handy zu erreichen. Da er jedoch keine Lust hatte, sich ihre Tirade anzuhören, hatte er es ausgeschaltet. Wenn er nach Hause kam, würde er sich ohnehin einiges anhören müssen. Es reichte also, wenn er ihre Schimpfkanonade einmal über sich ergehen ließ.
Dabei hatte er heute gar nicht vorgehabt, so lange bei seinem besten Freund Max zu bleiben, weil er noch Hausaufgaben – ausgerechnet in seinem »Lieblingsfach« Mathe – machen und ein paar Seiten in diesem blöden Kannibale und Liebe, oder wie der Schinken hieß, lesen musste. Er fragte sich jedes Mal, wieso dieser Schiller nicht so hatte schreiben können, dass auch ein normaler Fünfzehnjähriger verstand, worum es ging. Aber dann hatten Max und er noch eine Runde FIFA 15 gespielt und noch eine und … Na ja, irgendwie hatte er die Zeit vergessen, und als er dann doch einmal auf die Uhr gesehen hatte, war es später als gedacht und draußen schon dunkel gewesen.
Michi bremste vorsichtig, um auf dem lockeren Kies nicht die Kontrolle zu verlieren, denn in wenigen Metern musste eine Kurve kommen. Es fehlte ihm gerade noch, dass er jetzt zu allem Überfluss auch noch seinen Roller schrottete. Er hatte zu lange darauf gespart und konnte sich momentan keine größeren Reparaturen leisten. Eine neue Birne für den Scheinwerfer war okay, doch alles, was darüber hinausging, wäre schmerzhaft. Da kam die Kurve auch schon. Michi durchfuhr sie vorsichtig und starrte angestrengt ins Dunkel, das vor ihm lag.
Michael Bergmoser, der von allen nur Michi genannt wurde, war fünfzehn Jahre alt und ging in die 10. Klasse des Gymnasiums. Er war für sein Alter recht groß – bei der letzten Messung eins vierundachtzig – und schlank. Er hatte kurzes hellbraunes Haar, braune Augen und bis auf ein paar Härchen auf der Oberlippe noch keinen nennenswerten Bartwuchs. Michi lebte mit seiner Mutter im – wie er es nannte – allerletzten Kuhkaff. Deshalb war er froh gewesen, als er endlich den Mofa-Führerschein machen und sich von seinen Ersparnissen den gebrauchten Motorroller kaufen konnte, denn damit wurde er endlich unabhängig von der Gnade seiner Mutter, die ihn zu seinem Leidwesen nicht immer dorthin gebracht hatte, wo er hingewollt hatte. Aber die Zeiten, in denen er sie anbetteln oder Hausarbeiten gegen Chauffeurdienste verrichten musste, waren zum Glück vorbei.
Allerdings würde sie heute Abend wieder einmal besonders angepisst sein, weil er erst nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kam und sein Handy ausgeschaltet hatte. Michi zuckte mit den Schultern. Seit sein Vater sie verlassen hatte und mit einer wesentlich jüngeren Frau zusammengezogen war, kannte seine Mutter ohnehin nur drei Gemütszustände: ärgerlich, wütend und fuchsteufelswild. Er tippte darauf, dass heute wieder einmal fuchsteufelswild an der Reihe war. Also würde er ihre Schimpftirade schweigend über sich ergehen lassen, schließlich sah er ausnahmsweise sogar ein, dass er sie verdient hatte, und sich reumütig zeigen, bis sie sich allmählich wieder beruhigte und nur noch ärgerlich war. Am Ende würde sie ihn fragen: »Hast du deine Hausaufgaben überhaupt schon gemacht?« Und er würde lügen und sagen, dass er es getan habe. Und dann wäre er entlassen und könnte in sein Zimmer gehen, während Mutter sich wieder auf die Couch im Wohnzimmer zurückzog, irgendeinen Scheiß im Fernsehen ansah und eine Flasche Wein, Hugo oder was auch immer leerte. Immer das Gleiche!
Michi fuhr behutsam um die nächste Kurve, um im Kies nicht auszurutschen, und atmete erleichtert auf, als er endlich das Ende des Waldstücks vor sich sah. Wenn er den Wald erst hinter sich hatte, konnte er auch wieder schneller fahren. In spätestens fünfzehn Minuten wäre er dann zu Hause. Er gab schon jetzt wieder etwas mehr Gas, da er sehen konnte, dass es zwischen ihm und dem Waldrand keine Hindernisse gab, weder umgekippte Baumstämme noch lebende nachtaktive Tiere. Dann hatte er es endlich geschafft und fuhr aus dem Wald. Der Weg machte einen scharfen Rechtsknick und führte zunächst ein kleines Stück am Waldrand entlang. Dann ging es nach links, und an dem einsamen Ahornbaum, der an einer Gabelung stand, musste er nach rechts abbiegen.
Er fuhr durch die Biegung und gab anschließend Gas.
Da sah er das Feuer.
Auf den ersten Blick sah es so aus, als würde der ganze Ahornbaum in Flammen stehen. Hören konnte Michi jedoch nichts, da der Helm, den er trug, die Geräusche seiner Umgebung dämpfte. Er fuhr unwillkürlich schneller, während sein Blick weiterhin auf den Flammen ruhte, die am Fuß des großen Baumes loderten. Zuerst vermutete er, betrunkene Jugendliche hätten sich einen Scherz erlaubt oder ein Lagerfeuer gemacht, das dann außer Kontrolle geraten war. Doch er sah niemanden in der Nähe des Feuers. Er ließ seinen Blick umherschweifen auf der Suche nach denjenigen, die für das Feuer verantwortlich sein mussten. Dabei sah er ein Auto, das ohne Licht fuhr und schon im nächsten Augenblick in der Dunkelheit außerhalb des Lichtkreises, den die lodernden Flammen schufen, verschwand, als hätte es nie existiert.
Michi folgte dem Kiesweg, der sich vom Wald entfernte und direkt auf den Ahornbaum zuführte. Er konnte jetzt besser sehen, was sich unter den ausladenden Ästen des Baumes befand, und erkannte ein Auto. Es war gegen den Stamm geprallt und stand lichterloh in Flammen.
Was ist denn hier passiert?, fragte er sich und versuchte, sich ein Szenario vorzustellen, bei dem zwei Autos und ein Ahornbaum eine Rolle spielten und eines der Autos gegen den Baum prallte und in Flammen aufging. Es gelang ihm allerdings nicht. Diese Gegend war viel zu abgeschieden. Er hatte hier draußen noch nie auch nur ein einziges Auto gesehen, sondern immer nur Traktoren, Mähdrescher und Fahrräder. Außerdem war der Feldweg viel zu schlecht für Autos und zu schmal, um darauf Rennen zu fahren.
Michi stoppte den Motorroller in ausreichendem Abstand zum brennenden Fahrzeug. Er hatte im Fernsehen genug explodierende Autos gesehen, um seinen kostbaren Roller besser keinem Risiko auszusetzen. Ohne den Blick von den Flammen zu nehmen, schaltete er den Motor aus und bockte den Roller auf. Dann ging er langsam auf das Feuer zu, behielt dabei aber sicherheitshalber den Helm auf.
Das Innere des Fahrzeugs, das er hinter den Scheiben sehen konnte, war bereits ein einziges Flammenmeer. Es war vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis das Glas aufgrund der Hitze zersprang. Aber auch über die Motorhaube, das Dach und den Kofferraum leckten schon gierige Feuerzungen, sodass der schwarze Lack Blasen warf. Manche Flammen züngelten sogar schon an der Rinde des Baumstamms empor.
Michi erkannte, dass es sich bei dem Auto um einen BMW handelte. Da er sich von der Beifahrerseite her näherte, umrundete er das Fahrzeug, hielt jedoch einen ausreichenden Sicherheitsabstand. Nicht nur die Angst, der Wagen könnte explodieren, hielt ihn auf Abstand, sondern auch die Hitze, die sogar mehrere Meter vom Brandherd entfernt enorm war. Obwohl er nur Jeans und einen dünnen Pulli trug, brach ihm der Schweiß aus.
Als er auf der Fahrerseite angekommen war, sah er, dass die vordere Seitenscheibe offen war. Die Flammen schlugen nach draußen und leckten am Rahmen. Mittlerweile konnte er trotz des Helms auch das Prasseln und Tosen des Feuers hören.
Er überlegte, was er tun sollte. Natürlich musste er umgehend die Feuerwehr rufen. Aber was, wenn sich jemand im Inneren befand? Musste er das den Rettungskräften nicht mitteilen?
Da ist keiner mehr drin!, sagte sich Michi. Er wusste jedoch nicht, woher er die Überzeugung dafür nahm. Vermutlich war es nur die Hoffnung, dass keiner mehr im Wagen gewesen war, als dieses Feuer angefangen hatte, denn den Hochofen, in den sich das Fahrzeuginnere mittlerweile verwandelt hatte, konnte niemand überlebt haben.
Er dachte an das Fahrzeug, das sich entfernt hatte, ohne das Licht anzuschalten. Wer immer das gewesen war, hatte anscheinend etwas zu verbergen. Michi stellte sich Bankräuber vor, die ihren Fluchtwagen angezündet hatten, um alle Spuren, die sie möglicherweise hinterlassen hatten, zu vernichten. Aber wieso waren sie mit dem BMW dann auch noch gegen den Ahornbaum gerast? Das ergab doch keinen Sinn!
Michi wollte sich schon abwenden, um sein Handy herauszuholen und die Feuerwehr zu rufen, als er eine Bewegung im Fahrzeuginneren sah. Er glaubte, sein Herz würde aufhören zu schlagen und sich dann nie mehr in Gang setzen lassen.
Das kann nicht sein!
Dennoch sah er es ganz deutlich. Ein dunkler Umriss neigte sich in Richtung des offenen Fensters. Michi erschauderte. Als seine Fantasie ihm eine Vorschau dessen lieferte, was gleich geschehen würde, sah er darin eine verkohlte Leiche, die die Fahrertür öffnete, aus dem Wagen stieg und steifbeinig auf ihn zu stakste, während die Flammen sie noch immer wie ein lebender Umhang umhüllten. Im Nachhinein hätte er sich nicht einmal gewundert, wenn er sich in diesem entsetzlichen Moment in die Hose gemacht hätte. Aber zum Glück blieb ihm diese Schmach erspart.
Die Bewegung, sofern es eine solche überhaupt gegeben hatte, kam zum Stillstand. Dann fuhr ein leichter Windstoß durch das offene Fenster ins Feuer, sodass sich für einen Augenblick eine Lücke im dichten Flammenvorhang auftat, durch die Michi einen Blick auf die geschwärzte, unmenschlich wirkende Gestalt auf dem Fahrersitz werfen konnte.
Hinterher konnte er sich an keine Einzelheiten mehr erinnern, wofür er dankbar war. Er wusste nur noch, dass ihm in diesem Moment klar wurde, dass die Person im Inneren des Wagens mausetot sein musste und gar nicht mehr in der Lage sein konnte, sich zu bewegen. Vermutlich waren nur ihre Muskeln und Sehnen unter dem Einfluss der mörderischen Hitze geschrumpft, sodass sich der verkohlte Schädel in Richtung Fenster geneigt hatte. Und obwohl Michi das erkannte, hatte er dennoch das Gefühl, der Leichnam hätte ihm grüßend zugenickt.
Als sich der lodernde Vorhang wieder schloss und ihm die Sicht verwehrte, wurde Michi sich endlich wieder bewusst, dass er einen Körper hatte und sich bewegen konnte. Außerdem wurde ihm so übel wie noch nie in seinem fünfzehnjährigen Leben. Er wirbelte herum, lief ein paar Schritte, bis die Hitze erträglicher war und nur noch seinen Rücken wärmte. Es gelang ihm gerade noch, sich den Helm vom Kopf zu reißen. Dann konnte er die Gummibärchen, die Chips und die Cola, die er bei Max bekommen hatte, nicht mehr länger bei sich behalten. Als er sich nicht mehr würgend übergeben musste, war ihm zwar immer noch übel, doch wenigstens war der Brechreiz weg. Er wischte sich den Mund mit dem Ärmel ab und ging auf wackligen Beinen zurück zu seinem Roller. Dabei vermied er es, noch einen Blick auf den brennenden BMW zu werfen. Er hatte viel zu viel Angst, er könnte auf dem Beifahrersitz oder den Rücksitzen noch weitere schwarz verkohlte Leichen entdecken, die sich bewegten und ihn dann bis in seine Albträume verfolgen würden. Er setzte sich auf den Roller und holte sein Handy heraus. Nachdem er es angemacht hatte, sah er, dass er sechs Anrufe von seiner Mutter bekommen hatte. Aber die war momentan seine geringste Sorge. Statt die Feuerwehr anzurufen, wie er es eigentlich vorgehabt hatte, wählte er die 110. Schließlich saß ein toter Mensch im Wagen, für den jede Rettung zu spät kam, und dafür war seiner Meinung nach in erster Linie die Polizei zuständig.
Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!
(Die Nacht entweiche, jeder Stern erbleiche! Jeder Stern erbleiche, damit der Tag ersteh und mit ihm mein Sieg!)
Er summte die Opernarie Nessun dorma, die den britischen Handyverkäufer Paul Potts in der Castingshow Britain’s Got Talent 2007 schlagartig berühmt gemacht hatte, ergänzte den italienischen Text allerdings nur in Gedanken, während er unter der Dusche stand und sich den Schaum aus dem vollen, mittelblonden Haar spülte. Zu Hause sang er die Arie immer laut, wenn er duschte, obwohl seine Frau und die Kinder ihn hinterher immer damit aufzogen. Natürlich wusste er selbst, dass er nicht so gut singen konnte wie Paul Potts, seiner Meinung nach klang es aber auch nicht so schlecht, wie sie sagten. Trotzdem hätte er es nie gewagt, an einem Ort wie diesem, dem Bad seines Gästezimmers, laut zu singen, weil er keinen der anderen Gäste stören wollte.
Gerhard Biermann hörte auf zu summen und stellte das Wasser ab. Dann öffnete er die Tür der Duschkabine und griff nach dem Handtuch, das er in der Nähe bereitgelegt hatte, um sich abzutrocknen. Während er das tat, dachte er über den Tag nach, der bald zu Ende gehen würde.
Er war eigentlich recht erfolgreich verlaufen, denn er hatte heute sämtliche Termine einhalten und eine ganze Reihe von Ärzten und Apotheken in und um Fürstenfeldbruck besuchen können. Morgen würde er nach Möglichkeit den Rest auf seiner Liste abhaken, bevor er zum nächsten Ort weiterzog. Gerhard war Pharmaberater und lebte mit seiner Frau Heike und den beiden Kindern Sarah und Niklas in Mannheim. Nach seinem letzten Termin bei einem Allgemeinmediziner war es bereits dunkel geworden. Also fuhr er gleich zum Gästehaus, in dem er im Lauf des Tages eingecheckt hatte, ging dort auf sein Zimmer und rief zu Hause an, damit er noch mit den Kindern sprechen konnte, bevor sie ins Bett gingen. Danach unterhielt er sich noch eine Weile mit seiner Frau. Zum Schluss versicherten sie sich gegenseitig, wie sehr sie den anderen liebten und vermissten, und beendeten das Gespräch. Anschließend ging Gerhard zu einem späten Abendessen in ein italienisches Restaurant in der Nähe und trank zwei Gläser Wein zu seiner Pizza. Obwohl er danach schon recht müde war und sich am liebsten nur noch ins Bett gelegt hätte, ging er dennoch wie jeden Abend unter die Dusche.
Als er sich abgetrocknet hatte, trat er aus der Duschkabine und vor den Spiegel, der beschlagen war. Er nahm ein Handtuch und wischte ein Oval in der Mitte der spiegelnden Fläche frei. Obwohl schon viele behauptet hatten, Gerhard sähe so unscheinbar aus, dass man sein Gesicht schon wieder vergessen hatte, sobald er aus dem Zimmer gegangen war, war er dennoch zufrieden mit dem, was er sah. Und Heike war es wohl auch, sonst hätte sie ihn bestimmt nicht geheiratet. Er hatte kurzes mittelblondes Haar, ein glatt rasiertes, gleichmäßiges Gesicht ohne besondere Merkmale und blassgraue Augen. Außerdem war er von durchschnittlicher Größe und Statur.
Gerhard nahm die Bürste und kämmte sein trocken gerubbeltes Haar. Dann sprühte er sich Deo unter die Arme. Fertig! Jetzt konnte er sich endlich ins Bett legen und schlafen, denn morgen war bestimmt wieder ein anstrengender und langer Tag.
Er öffnete die Tür und trat in den schmalen Flur, der von der Zimmertür zum Gästezimmer führte. Da er das Licht hatte brennen lassen, sah er sofort den Eindringling, der neben dem Bett stand und augenscheinlich auf ihn gewartet hatte, denn er sah ihn erwartungsvoll an.
»Wer sind Sie?«, fragte Gerhard aufgebracht. Trotz seiner Entrüstung fühlte er sich unwohl, da er nur ein Handtuch um die Hüften trug und sich darin entblößt und nackt vorkam. »Und was haben Sie in meinem Zimmer zu suchen?«
Der andere Mann sagte nichts, sondern starrte ihn nur an. Dann hob er die Hand, die er bislang hinter seinem Körper verborgen gehalten hatte, sodass Gerhard zum ersten Mal das große Küchenmesser sehen konnte, das der Fremde bei sich hatte. Gerhard schloss für einen Moment die Augen, als sich das Licht der Deckenlampe in der Klinge spiegelte und ihn blendete.
»Was wollen Sie von mir?«
»Das weißt du ganz genau, Ladykiller!«
Gerhard war verwirrt. Was sollte das? Und wer bitte schön war dieser Ladykiller, von dem der andere sprach? Er verspürte den drängenden Impuls, sich augenblicklich herumzuwerfen, zur Tür zu rennen und fluchtartig das Zimmer zu verlassen. Doch ein anderer Teil seines Verstandes überzeugte ihn davon, dass es vermutlich besser war, dem anderen klarzumachen, dass er sich geirrt hatte, im falschen Zimmer gelandet war und demzufolge auch den falschen Mann bedrohte. Es war der Teil von ihm, der auch der Ansicht war, dass man durch ein vernünftiges Gespräch jedes Problem lösen konnte.
»Sie täuschen sich«, sagte er daher. »Ich bin nicht der, für den Sie …«
Weiter kam er jedoch nicht, da er plötzlich von hinten an den Armen gepackt wurde.
»Was …«
Im nächsten Augenblick wurde ihm etwas über den Kopf gezogen. Es fühlte sich nach einem Stoffsack oder Kissenbezug an. Trotz der Angst, die ihn erfüllte, war Gerhard froh, dass es wenigstens kein Plastikbeutel war und er noch immer atmen konnte. Der Stoff war nicht völlig undurchsichtig, und so konnte er schemenhaft erkennen, dass der Mann mit dem Messer auf ihn zukam. Gerhard wand sich und versuchte verzweifelt, seine Arme aus den Griffen der Personen zu befreien, die hinter ihm standen und die er zunächst gar nicht wahrgenommen hatte. Bei einem, vermutlich demjenigen, der ihm auch den Sack über den Kopf gestülpt hatte, gelang es ihm sogar. Er riss die rechte Hand im gleichen Moment hoch, als der Mann vor ihm auf ihn einstach. Die Klinge traf seine Handkante und schnitt tief ins Fleisch, bis sie auf einen Knochen traf. Gerhard schrie vor Schmerz, aber wenigstens hatte er das Messer aufhalten können, bevor es in seinen Leib fuhr und Schlimmeres anrichtete.
»Haltet ihn gefälligst fest!«, zischte der Mann vor ihm ärgerlich. »Und bringt ihn zum Schweigen!«
Dann wurde auch schon Gerhards Arm gepackt, nach unten gerissen und eng an den Körper gepresst, sodass er sich nicht noch einmal befreien konnte, sosehr er es auch versuchte. Gerhard konnte fühlen, wie das Blut an seiner Hand und seinen Fingern hinunterlief, von deren Spitzen es vermutlich auf den Teppichboden tropfte. Er riss den Mund auf, um erneut zu schreien, viel lauter dieses Mal, um jemandem in einem der anderen Zimmer auf sich und seine Notlage aufmerksam zu machen. Doch noch ehe er auch nur einen Ton von sich geben konnte, legte sich eine Hand auf seinen Mund, um ihn zu verschließen und jeden Schrei im Ansatz zu ersticken. Was er daraufhin von sich gab, klang dumpf und erstickt und konnte außerhalb dieses Zimmers unmöglich gehört werden.