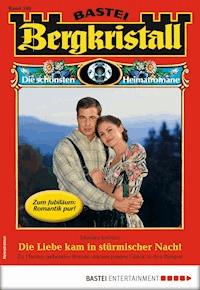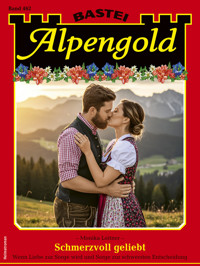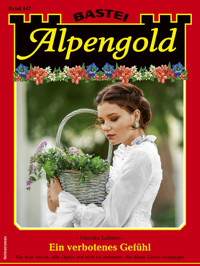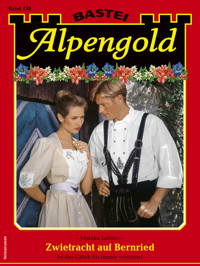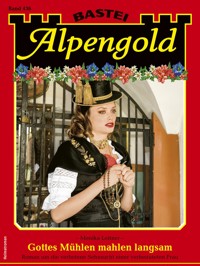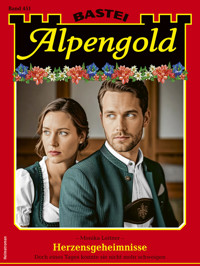
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sonntag ist‘s, und die Sonne scheint durch die bunten Kirchenfenster auf die Dörfler, die andächtig dem Hochamt folgen. Manche sind allerdings mit ihren Gedanken nicht ganz bei der heiligen Handlung. Den schwerreichen Schwaiger, zum Beispiel, quält der Neid auf einen, der noch reicher ist als er. Und dieser, den sie Kirchberger nennen, schaut voller Begierde auf die liebreizende blutjunge Schwaiger-Tochter. Seit er sie heimlich oben am Bergsee beobachtet hat, will er sie besitzen - und jedes Mittel ist ihm dazu recht! Regine spürt seine heißen Blicke, und unwillkürlich erschaudert sie. Fühlt sie, dass ihr Schicksal mit dem dieses Mannes auf böse Weise verbunden ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Herzensgeheimnisse
Vorschau
Impressum
Herzensgeheimnisse
Doch eines Tages kommt alles ans Licht
Von Monika Leitner
Sonntag ist's, und die Sonne scheint durch die bunten Kirchenfenster auf die Dörfler, die andächtig dem Hochamt folgen. Manche sind allerdings mit ihren Gedanken nicht ganz bei der heiligen Handlung. Den schwerreichen Schwaiger, zum Beispiel, quält der Neid auf einen, der noch reicher ist als er. Und dieser, den sie Kirchberger nennen, schaut voller Begierde auf die liebreizende blutjunge Schwaiger-Tochter. Seit er sie heimlich oben am Bergsee beobachtet hat, will er sie besitzen – und jedes Mittel ist ihm dazu recht!
Regine spürt seine heißen Blicke und erschaudert. Fühlt sie, dass ihr Schicksal mit dem dieses Mannes auf böse Weise verbunden ist?
Noch vor Sonnenaufgang stand Regine Schwaiger leise auf. Sie musste sich beeilen, wenn sie draußen sein wollte, bevor das Gesinde erwachte und an die Arbeit ging.
Regine zog sich das lange, selbst genähte Nachthemd über den Kopf und warf es mit einer widerwilligen Bewegung auf das Bett. Heutzutage gab es so viele hübsche Sachen, die man zum Schlafen anziehen konnte, aber ihr waren sie verwehrt.
Einmal hatte sie sich ein Nachthemd aus feinem, zart gestreiftem Stoff zugeschnitten und zu nähen begonnen und sich darauf gefreut. Da hatte der Vater es entdeckt und mit einer wütenden Gebärde in den Kamin gestopft.
»Da kannst du dich ja auch gleich nackt ins Bett legen!«, hatte er sie angefahren. »So was hat bei uns da nix zum Suchen! Du bleibst mir anständig, solange du unter meinem Dach haust und mein Brot isst, verstanden?«
Gabriel Schwaiger hatte sich aufgeführt, als hätte Regine sonst was verbrochen, und wieder einmal hatte sie nur ergeben den Kopf gesenkt, die Tränen um den hübschen Stoff hinuntergeschluckt und nichts erwidert. Es hätte ja doch nichts genützt.
So war der Vater eben seit dem frühen Tod seines einzigen Hoferben, dem die Mutter dann bald gramgebeugt nachgefolgt war. Nun hatte er nur noch Regine.
Sie würde auch einst den Schwaigerhof übernehmen, zusammen mit dem richtigen Mann, den der Vater ihr schon seit Langem ausmalte. Regine konnte sicher sein, dass er sich mit keinem zufriedengeben würde als dem, der seinen Wunschvorstellungen entsprach.
Regine war erst achtzehn Jahre alt, und bisher wusste sie von der Liebe nur, was sie in den schönen Romanen las, die ihre Freundin Bärbl ihr heimlich zusteckte. Denn ins Kino gehen ließ Gabriel Schwaiger seine Tochter nicht. Und einen Fernseher würde er, solange er am Leben war, auf dem Schwaigerhof nicht dulden.
Musik gab es im Radio. Dagegen hatte der Bauer nichts einzuwenden, wenn er selbst sich auch vor allem für den Wetterbericht und die Landwirtschaft betreffende Vorträge interessierte.
Das Gesinde hatte seine eigenen Radiogeräte, und der Schwaighofer konnte nichts dagegen machen, wenn sie stundenlang eine Musik dudeln ließen, die ihm selbst in den Ohren und noch mehr im Gemüt wehtat. Aber erwachsenen Leuten konnte er nichts befehlen, zumal es schwer war, gute Kräfte für die trotz aller Maschinen und modernen Techniken immer noch schwere Bauernarbeit zu finden.
So war Regine diejenige, die alles vom Vater einstecken musste und die immer mehr zu geschwindelten Ausflüchten und Lügen greifen musste, wenn sie sich da und dort ein Stückerl Freiheit erkaufen wollte.
Barfuß tappte sie nun die Stiege hinunter, geschickt umging sie eine Stufe, deren Knarzen womöglich den Vater aufgeweckt hätte. Leise wie ein Geist huschte sie durch die Küche, nahm sich ein Stück Brot und einen Apfel aus der Speisekammer und schlüpfte durch die Hintertür ins Freie.
»Pst, pst«, zischte Regine ganz leise zur Hütte des zotteligen schwarzen Hofhundes Troll hinüber, der angespannt wie eine Feder dasaß und ihr erwartungsvoll entgegensah. Aber der heiß ersehnte Ruf kam nicht von Regines Lippen. Da kroch er enttäuscht in seine Behausung zurück.
Regine streifte ihre Sandalen über. Leichtfüßig stieg sie den Obstanger hinauf. Wie Schnee rieselten die Blütenblätter der Spätkirschen auf sie hinab, die der morgendliche Wind in Bewegung gebracht hatte. Tautropfen fielen von den Zweigen.
In den Schlafästen der Vögel begann es sich zu rühren. Zaghaft erhob sich eine erste leise Stimme, andere antworteten so federleicht, wie Regine auch ihr eigener Körper schien, als sie den Hang förmlich hinaufflog.
Auf der Kuppe blieb sie stehen. Unter ihr wogten noch die Nebel über den Wiesen, ein graues Gespinst zwischen Nacht und Tag, und um ihre nackten Knöchel schlug kalt und feucht das Gras.
Der Schwaigerhof lag noch dunkel da, nur im abseits gelegenen, kleinen Zuhäusl des Altknechts Luis brannte schon Licht. Der Schmerz wird den armen Kerl, den das Pferd so bös geschlagen hat, nicht schlafen lassen, dachte Regine mitleidig und nahm sich vor, ihm später eine gute Portion guten Tabaks hinüberzubringen. Rauchen war seine Passion!
In der Küche des Nachbarhofs, der an das Schwaigeranwesen grenzte, war es schon hell. Wenn die Ahrntalerin oder gar der Hofsohn Stefan sie sahen, konnte Regine sicher sein, dass darüber nicht geredet wurde. Im Gegenteil, die Nachbarn hatten sie schon oft gegen den Vater in Schutz genommen, wenn dieser gar zu streng gegen sie vorgegangen war.
Regine überquerte die Hangwiese und verschwand im Wald. Unter ihren Füßen knackte es, eine dornige Ranke schlug ihr ins Bein. Weiter oben jedoch drang ihr der betörende Duft reifer Waldbeeren entgegen, die sie später sammeln wollte.
Nach einer halben Stunde kam Regine zum Ziel ihrer Sehnsucht. Vor ihr lag der dunkle Moorsee, eingebettet zwischen einem Kranz von lichten Birken und weithin sich dehnendem niedrigen Buschwerk bis zur hochragenden schwarzgrünen Wand der Tannen. Dahinter lagen der Mischwald und die Almböden, gekrönt vom Silberhorn mit seinem ewigen Mantel aus Eis und Schnee und dem riesigen Gipfelkreuz, das funkelte und schimmerte.
Jetzt zerriss das feine Nebelgespinst. Verschleiertes Licht blühte auf zu rotgoldenem Glanz, als die Sonne drüben, über den östlichen Bergen, aufstieg und den neuen Tag einläutete.
Mit unwillkürlich gefalteten Händen, die sie an die Brust presste, stand Regine da. In ihrem noch kindlichen zarten Gesicht lag das Entzücken über all die Herrlichkeiten ringsum.
Weiter oben hörte sie Kuhglocken, und vom Grün der Almhänge über dem Wald hoben sich, ihren scharfen Augen sichtbar, weiße Punkte ab, die sich ständig bewegten. Regine lächelte über die springlebendigen Lämmer, die sich da schier überpurzelten vor ungestümer Lebensfreude.
Und die war jetzt auch in ihr, als sie sich hinter einem Busch die Kleider vom Leib streifte und über den glitschig nassen kleinen Hang ins Wasser glitt. Es war wie lauter Bernstein um sie, als die Sonnenstrahlen die Wasserfläche trafen und das kühle Nass sie ganz und gar umspülte.
Regine tauchte, mit offenen Augen schwamm sie nahe dem Grund wie durch ein braungrünes Gewölbe, stieg auf und lachte prustend und übermütig, losgelöst aus der eisernen Klammer ihrer Pflichten. Eine gute Stunde nur, die sie sich da stahl, aber sie gab ihr Kraft und eine solche Freude, dass sie den oft so bedrückenden Tag ausleuchtete.
Frei wie ein Fisch im Wasser fühlte sie sich. Als sie dann später aus dem Wasser gestiegen war und sich ins kurze braune Gras am Ufer setzte, glaubte sie, zu den schwirrenden schwarzblauen Libellen zu gehören, die über sie hinwegflogen mit durchsichtigen Flügeln.
Rasch streifte sie ihr Unterkleid – ein zartes Gespinst von Spitzenstoff und Batist, das einzige schöne Wäschestück, das sie bisher vor den strengen Blicken des Vaters verstecken konnte – über die nasse Haut und zog ihr langes blondes Haar auseinander, um es trocknen zu lassen.
Und so saß Regine eine ganze Weile mit geschlossenen Augen da und genoss die Stille und die Einsamkeit ...
***
Nicht einen Augenblick dachte sie daran, dass jemand sie sehen könnte in ihrem gut gewählten Versteck. Hier, vor sich das Schilf und im Rücken die Sträucher und Bäume, in denen sich Bergfinken tummelten, fühlte sie sich geborgen. Sie hob ihre Hand einem taumelnden Schwarm kleiner Schmetterlinge entgegen, die wie eine blaue Wolke über sie hinspielten.
Regine hörte nicht die Schritte des Mannes, der sich ihr auf dem federnden Moorboden näherte, nachdem er sie durch sein Jagdglas vom seitlich liegenden Wald her schon eine Weile beobachtet hatte. Erst als er schon ganz nahe war und mit seinem genagelten Stiefel auf einen aus dem Boden ragenden Stein stieß, fuhr Regine auf.
»Nicht erschrecken, schöne Nixe! Ich bin kein Unhold, bloß der Ritter aus dem Märchen, den es um diese Stunde ebenso hierher verschlagen hat wie dich«, hörte sie eine fremde, aber angenehm klingende Stimme sagen.
Regine war entsetzt, dass ein Mann sie beinahe so sah, wie Gott sie erschaffen hatte. Das schöne Unterkleid war ein geringer Schutz. Bitter bereute sie, Troll nicht wie sonst mitgenommen zu haben.
Unwillkürlich krümmte sich Regine zusammen und kreuzte die Arme vor der Brust, dann warf sie den Kopf nach vorne, sodass ihr langes, dichtes Haar wie ein schützender Mantel um die Schultern fiel.
Der nicht mehr ganz junge Mann, der einen teuren Jagdanzug trug, schluckte vor Erregung. Entweder ging er auf der Stelle weg von diesem Ort der Versuchung, oder er musste diese Waldfee küssen! Aber schon zu lange hatte er seinen Augen den Spaziergang über dieses bezaubernde Wesen erlaubt, als dass sein Blut so einfach zu beruhigen gewesen wäre.
Er griff nach dem Arm des Madls, hart pressten seine Finger sich in das feste gebräunte Fleisch, dann strich er ihr mit einer herrischen Bewegung das Haar zurück.
Regine war wie hypnotisiert vor Angst, doch dann sprang sie auf, ungeachtet ihrer so spärlichen Bekleidung, in der sie nun ganz vor seinen gierigen Blicken stand, und er verlor vollends den Kopf.
Der Mann packte Regine und presste sie an sich, dann bog er ihren Kopf zur Seite, wie rasend suchten seine Lippen ihren Hals, ihre Wange. Alle Sinne des Mannes, dem die wohlfeilen Genüsse seiner Kreise in der Stadt längst schal geworden waren, schäumten über, sodass er kein Halten mehr kannte.
Gellend schrie Regine um Hilfe, zugleich sprangen ihr die Tränen aus den Augen, als ihr bewusst wurde, dass es hier keine Hilfe geben konnte.
Ihr Schrei hatte den Angreifer erschreckt, seine Umklammerung ließ sekundenlang nach, und da schoss aus dem Wald in gestrecktem Lauf, alle Hindernisse mit weiten Sprüngen überwindend, ein großer rotbrauner Hund. Getrieben vom Befehl seines Herrn: »Fass, Jori!«, jagte das Tier vorwärts, bis es Regines Angreifer erreicht hatte.
»Hau ab, Köter!« Mit einem Fußtritt wollte der so unsanft Ernüchterte den Hund verjagen, doch daraufhin verbiss sich dieser in das Handgelenk des Mannes, der vor Schmerz aufschrie.
Regine war frei! Noch konnte sie das Wunder kaum fassen. Fast blind vor Tränen stolperte sie fort, dann begann Regine zu laufen und lief geradewegs in die Arme von Stefan Ahrntaler, der seinem Hund nachgehetzt war. Kraftlos sank sie an seine Brust.
Stefan riss sich den Leinenjanker herunter und legte ihn um Regine, der ihr Aufzug gar nicht mehr bewusst war in all der entsetzlichen Aufregung.
»Such dein Gewand zusammen, geh an den Steg und warte dort auf mich«, sagte Stefan scharf, um Regine wieder auf diese Erde zurückzubringen. »Derweil knöpf ich mir den Kerl vor!«
Er hielt sie noch einen Augenblick in seinen Armen, spürte ihre Weichheit, den frischen Duft ihres jungen Körpers und zugleich ein Gefühl, als würde es sein Innerstes durch einen Krampf durchschütteln.
»Reiß dich zusammen!« Er gab ihr einen Klaps auf die Wange, bis sie die Augen aufmachte und ihn bloß wortlos ansah. »Reiß dich zusammen«, rief Stefan aber zugleich auch sich selbst zu, der nichts lieber getan hätte, als Regine noch eine Ewigkeit so in seinen Armen zu halten.
Das alles hatte nur Augenblicke gedauert, während Jori, der Schweißhund des Ahrntalers, zwar das Handgelenk des Fremden aus seinem Fang gelassen, sich jedoch so in den Ärmelstoff des Jagdrocks verbissen hatte, dass der Mann ihm nicht auskommen konnte.
Jetzt eilte der baumlange junge Ahrntaler herbei.
»Fuß, Jori!«, rief Stefan dem Hund zu, und augenblicklich ließ der Hund den Fremden los.
Stefan wusste, dieser würde jetzt nicht mehr fortlaufen. Aus seinem Arm tropfte Blut und auch der Fang von Jori zeigte Blutspuren. Stefan tätschelte seinen Hund.
»Hätte schlimm ausgehen können, wenn der Jori Sie an der Kehle gepackt hätte! Haben Sie was zum Verbinden dabei?«
Der Verletzte, ein Baron und als Gast eines Freundes auf dessen naher Jagd, schüttelte den Kopf. Stefan kannte ihn von der letzten Treibjagd. Verächtlich schaute er ihn an, nahm Verbandszeug aus seinem Rucksack, desinfizierte rasch die Wunde mit einem Alkoholtupfer und legte den Verband an.
»Geimpft gegen Tetanus?« Mehr als das Nötigste wollte Stefan mit diesem Kerl nicht reden. Und wenn er zwanzig Zacken in seiner Adelskrone gehabt hätte, für ihn war er nichts weiter als ein Lump, der über ein wehrloses Madl hergefallen war und es zu vergewaltigen versucht hatte.
Als Stefan fertig war, nahm der Baron seine kostbare goldene Uhr mit zitternden Fingern ab und hielt sie Stefan hin.
»Wir sind alle nur Menschen, Ahrntaler. Nehmen Sie das als Dank und schweigen Sie um Himmels willen über den peinlichen Vorfall!«
»Ja, wir sind nur Menschen oder ab und zu auch Viecher. Nein, schlechter als die, weil wir unseren Verstand brauchen. Ihre Uhr können Sie behalten, ich pfeif drauf! Komm, Jori!«
Stefan warf die Uhr ins Gras, wobei er sich beherrschen musste, nicht noch draufzuspucken, dann wandte er sich ab und ging mit großen Schritten davon.
Niemand von den Beteiligten aber wusste, dass es noch jemanden gab, der alles mit ansah. Auf einem Hochsitz verborgen hockte ein Mann, der unweit von hier einem jenseits der Grenze verbotene Ware gebracht und viel Geld dafür bekommen hatte.
Als er von Weitem ein Madl vorhin zum See hatte kommen sehen, war er auf den Hochsitz geklettert, um sich zu verstecken. Wer immer sie auch sein mochte, sie brauchte ihn nicht zu sehen oder gar zu erkennen.