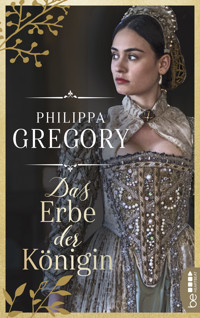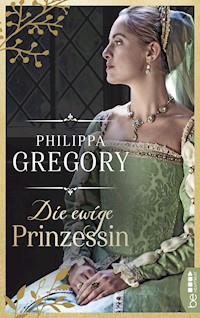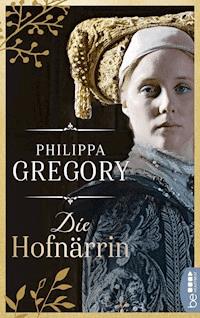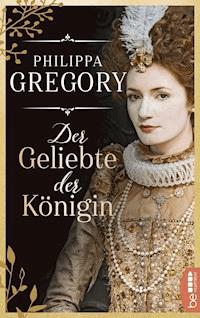12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Fairmile-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die »Hexe« Alinor ist zurück: »An dunklen Wassern« ist der 2. Teil der historischen Familiensaga aus dem 17. Jahrhundert von Bestseller-Autorin Philippa Gregory. An einem Mittsommerabend des Jahres 1670 erhält Alinor gleich zweimal überraschenden Besuch: Der erste, der sie in ihrem kleinen Lagerhaus am Südufer der Themse aufstöbert, ist James Avery – der Mann, der sie vor 21 Jahren verlassen hat, nachdem sie ihr Leben für ihn riskiert hatte und beinahe als Hexe ertränkt worden wäre. James, der es als Günstling von König Charles II. zu Wohlstand gebracht hat, ist auf der Suche nach seinem Sohn und Erben. Die zweite Besucherin ist eine schöne junge Witwe aus Venedig. Sie begrüßt Alinor als ihre Schwiegermutter und überbringt die traurige Nachricht, dass Alinors Sohn Rob in den dunklen Fluten der Lagune von Venedig ertrunken sei. Während Alinor und James immer mehr von der Vergangenheit eingeholt werden, wachsen in Alinor Zweifel an Robs Schicksal. Kann sie ihn doch noch retten? Geheimnisvoll, dramatisch und brillant recherchiert, entführt der Nr.-1-Bestseller aus England in die ärmlichen Gassen von London ebenso wie in die goldenen Straßen Venedigs und bis ins ferne, hart umkämpfte Amerika. Der erste Teil der historischen Familiensaga ist unter dem Titel »Gezeitenland« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PhilippaGregory
An dunklen Wassern
Roman
Aus dem britischen Englisch von Ute Brammertz
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
An einem Mittsommerabend des Jahres 1670 betritt ein wohlhabender Mann einen schäbigen Laden am Südufer der Themse: James Avery ist auf der Suche nach der Frau, die seinetwegen vor 21 Jahren beinahe als Hexe verbrannt worden wäre – und nach ihrem gemeinsamen Sohn Rob. Doch Alinor ist alles andere als erfreut, ihn zu sehen, und Rob ist nicht da. Kurz darauf muss Alinor einen weiteren unwillkommenen Gast empfangen: Die junge Venezianerin behauptet, Robs Witwe zu sein. Will Alinor ihrer merkwürdigen Geschichte auf den Grund gehen, bleibt ihr keine andere Wahl, als sich mit James zu verbünden …
Inhaltsübersicht
Mittsommerabend, 1670, London
Anmerkung der Autorin
Reekie Wharf, Southwark, London, Mittsommerabend
Lieber Ned, mein liebster Bruder,
ich muss Dir schreiben, weil wir einen Brief von Robs Frau aus Venedig erhalten haben.
Es sind schlechte Nachrichten. Die schlimmsten Nachrichten. Sie schreibt, dass Rob ertrunken und tot ertrunken ist. Robs Frau Witwe sagt, sie wird mit seinem Säugling nach England kommen. Ich schreibe Dir jetzt, weil ich es nicht glauben kann weil ich weiß, dass Du es auf der Stelle erfahren wollen würdest. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll.
Ned – Du weißt, ich würde es spüren, wenn mein Sohn tot wäre.
Ich weiß, dass er es nicht ist lebt.
Ich schwöre Dir bei meiner Seele, dass er lebt.
Ich werde wieder schreiben, sobald sie eingetroffen ist und uns mehr erzählt hat. Du wirst sagen Ich glaube, Du wirst sagen, dass ich mich selbst belüge – dass ich die Nachricht nicht ertragen kann und mir einrede, alle außer mir sind im Unrecht.
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wissen. Aber ich glaube doch, dass ich es weiß.
Es tut mir leid, dass ich so einen schlimmen einen traurigen Brief schreiben muss. Es ist unmöglich, dass er tot ist und ich es nicht weiß. Ich hätte es gespürt, es ist unmöglich, dass er ertrunken ist.
Wie ist es möglich, dass ich aus tiefem Wasser hochgekommen bin, und einundzwanzig Jahre später soll es ihn unten behalten?
In Liebe, Deine Schwester Alinor.
Natürlich bete ich darum, dass es Dir gut geht. Schreib mir.
Mittsommerabend, 1670, London
Das baufällige Lagerhaus stand auf der falschen Flussseite, dem Südufer. Hier drängten sich die Häuser dicht an dicht, und die kleinen Boote entluden ein lächerliches bisschen Fracht für wenig Profit. Der Reichtum Londons fuhr an ihnen vorüber, segelte flussaufwärts zu dem halb fertigen Custom House, dem Zollhaus, dessen cremefarbene Steinfassade breit am schnell dahinströmenden Fluss stand. Es sah aus, als wolle es jeden Tropfen des aufgewühlten, dreckigen Wassers besteuern. Die größten Schiffe glitten, im Gefolge eifriger Schleppkähne, an den kleinen Pieren vorüber, als wären die Kais nichts als Strandgut, Stöcke und Kopfsteine, die an Ort und Stelle verrotteten. Zweimal am Tag ließ sogar die Flut sie im Stich, sodass Uferdämme aus stinkendem Schlamm und Piere mit unkrautbewachsenen Rampen, die wie alte Knochen aus dem Wasser ragten, zurückblieben.
Dieses Lagerhaus und alle anderen, die wie achtlos ins Regal gestellte Bücher daran lehnten und sich am Uferdamm aneinanderreihten, sehnten sich nach dem Reichtum, der mit dem neuen König auf dem Schiff, das einst Oliver Cromwells gewesen war, ins Land segelte. Ein Land, das einst frei gewesen war. Diese armen Kaufleute, die mithilfe des Handels auf dem Fluss ein kümmerliches Dasein fristeten, hörten viel von dem neuen König und seinem prächtigen Hof in Whitehall. Doch seine Rückkehr an die Macht hatte ihnen nichts eingebracht. Nur ein einziges Mal hatten sie ihn gesehen, als er vorübersegelte, das Schiff voller flatternder königlicher Fähnchen, ein einziges Mal und dann nie wieder: nicht hier unten, am südlichen Flussufer, im Osten der Stadt. An diesen Ort kam man nicht. Es war ein Ort, den man verließ. Hier war noch niemals eine vornehme Kutsche oder ein edles Pferd gesichtet worden. Der zurückgekehrte König hielt sich im Westen der City auf, umgeben von aristokratischen Günstlingen und adeligen Huren, allesamt auf freizügiges Vergnügen aus, von Fortuna aus ihrer Misere gerissen, ohne dass auch nur einer von ihnen dieses glückliche Los verdient hätte.
Doch das kleine Lagerhaus hielt an den alten puritanischen Prinzipien von harter Arbeit und Sparsamkeit fest, genau wie sich die Häuser am Hafendamm festhielten: So dachte der Mann, der davorstand und zu den Fenstern hochstarrte, als hoffe er, einen Blick auf jemanden im Innern zu erhaschen. Sein brauner Anzug war ordentlich, die weiße Spitze an Kragen und Manschetten bescheiden in diesen Zeiten modischer Exzesse. Sein Pferd stand geduldig hinter ihm, während er die unscheinbare Fassade des Lagerhauses musterte – den Flaschenzug an der Wand und die beiden weit offen stehenden Torflügel. Dann wandte er sich um zum trüben Fluss und sah den Hafenarbeitern dabei zu, wie sie einen angelegten Lastkahn entluden, wobei sie sich schwere Getreidesäcke zuwarfen, einer zum anderen, während sie einen monotonen Singsang anstimmten, um im Takt zu bleiben.
Der Gentleman auf dem Hafendamm fühlte sich hier ebenso fremd wie auf seinen seltenen Besuchen bei Hofe. In diesem neuen England schien es überhaupt keinen Platz mehr für ihn zu geben. In den glitzernden Palästen war er eine unelegante Mahnung an eine heikle Vergangenheit, wo ihm höchstens mit einem schnell wieder vergessenen Versprechen auf den Rücken geklopft wurde, bevor man ihn verabschiedete. Doch hier auf dem Hafendamm in Bermondsey stach er noch viel mehr als Fremder hervor: ein reicher Müßiggänger, eine stumme Erscheinung unter dem ständigen Kreischen des Flaschenzugs, dem Grollen rollender Fässer, den geschrienen Befehlen und den schwitzenden Hafenarbeitern. Bei Hofe stand er einem gedankenlosen Reigen des Vergnügens im Weg, war er den Menschen zu freudlos. Hier stand er dem Fortgang der Arbeit im Weg, wo Männer keine Individuen waren, sondern sich im Einklang bewegten, jeder ein Rädchen im Getriebe. Seiner Meinung nach war die Welt kein Ganzes mehr, sondern hatte sich entzweit in Land und Hof, Gewinner und Verlorene, Protestanten und Ketzer, Royalisten und Anhänger des Parlaments, die ungerechterweise Gesegneten und die zu Unrecht Verdammten.
Seine eigene Welt aus selbstverständlich hingenommenem Luxus – heißes Wasser in einem Porzellankrug im Schlafgemach, am Morgen für ihn herausgelegte saubere Kleidung, Dienstboten, die alles erledigten – wirkte hier sehr fern. Und doch musste er diese fremde Sphäre betreten, um das von ihm verübte Unrecht aus der Welt zu schaffen, um eine brave Frau glücklich zu machen, um die Wunden seines eigenen Versagens zu heilen. Wie der König war er zum Zweck einer Restauration gekommen.
Er band sein Pferd an den Eisenring eines Pfostens, trat an den Rand des Kais und blickte in den Lastkahn mit dem flachen Boden, der schwer auf der Rampe neben dem Kai auflag.
»Woher kommt Ihr?«, rief er zu dem Mann hinunter, den er für den Kapitän des Bootes hielt, da er das Entladen beaufsichtigte und die Säcke in einem Hauptbuch abhakte.
»Von der Insel Sealsea in Sussex«, erwiderte der Mann gedehnt in dem alten, vertrauten Dialekt. »Der beste Weizen in ganz England, Weizen aus Sussex.« Er blinzelte nach oben. »Seid Ihr zum Kaufen da? Wollt Ihr in Sussex gebrautes Ale? Oder gepökelten Fisch? Haben wir alles da.«
»Ich bin nicht zum Kaufen da«, antwortete der Fremde. Ihm hämmerte das Herz in der Brust bei der Erwähnung der Insel, die einst sein Zuhause gewesen war: ihr Zuhause.
»Nee, natürlich nicht. Ihr seid für ein Tänzchen im Ballsaal der Damen hier, was?«, scherzte der Kapitän, und einer der Hafenarbeiter lachte schallend, als der Gentleman sich aufgrund dieser Unverschämtheit abwandte und wieder zu dem Haus hochblickte.
Es stand an der Ecke einer Zeile aus heruntergekommenen dreistöckigen Lagerhäusern, die aus Planken und dem Holz ehemaliger Schiffe erbaut waren, das wohlhabendste einer ärmlichen Reihe. Weiter unten am Kai, wo das Flüsschen Neckinger in einem dreckigen Wasserwirbel in die Themse mündete, stand ein Galgen mit einem vor langer Zeit Erhängten, dessen verblichenes Gerippe von ein paar Stofffetzen zusammengehalten wurde. Ein Pirat, dessen Strafe der Strang gewesen war und der dort als Mahnmal für andere hängen gelassen wurde. Der Gentleman erschauderte. Für ihn war es unvorstellbar, wie die Frau, die er einst gekannt hatte, in Hörweite der quietschenden Kette des Galgens leben konnte.
Ihr blieb keine andere Wahl, das wusste er, und sie hatte mit dem Kai das Bestmögliche erreicht. Das Lagerhaus war offenkundig ausgebessert und umgebaut worden. Jemand hatte die Kosten und Mühen auf sich genommen, an der einen Ecke des Hauses ein kleines Türmchen zu errichten, das auf die Themse und den Neckinger hinausging. Sie konnte aus der Glastür treten und von einem kleinen Balkon aus nach Osten blicken, flussabwärts in Richtung Meer, oder nach Westen, flussaufwärts zur Londoner City. Sie konnte das Fenster öffnen, um dem Geschrei der Möwen zu lauschen und zu beobachten, wie die Flut unter ihrem Fenster anschwoll und absank und die Waren am Kai eintrafen.
Vielleicht erinnerte es sie an ihr Zuhause, vielleicht saß sie an manchen Abenden da, wenn der Nebel den Fluss heraufstieg und den Himmel so grau wie das Wasser färbte, und dachte an andere Abende und das Donnern des sich drehenden Rads der Gezeitenmühle. Vielleicht blickte sie quer über den unruhigen Fluss nach Norden, über die schmale Gasse aus Kerzenmachern und Lebensmittelhändlern, vorbei an den Marschlandschaften, wo die Meeresvögel unter Geschrei kreisten. Vielleicht stellte sie sich die Hügel des Nordens vor und den weiten Himmel über dem Anwesen eines Mannes, den sie einst geliebt hatte.
Der Gentleman trat an die Eingangstür des Lagerhauses, das offensichtlich Heimstatt, Geschäft und Lagerraum in einem war. Dann hob er den Elfenbeingriff seiner Reitgerte und klopfte laut an. Er wartete, vernahm den Widerhall von nahenden Schritten auf hölzernen Flurdielen, dann ging die Tür auf, und ein Dienstmädchen in einer verdreckten Arbeitsschürze stand vor ihm. Entgeistert starrte es auf das seidige Fell seines französischen Zylinders und die auf Hochglanz polierten Stiefel.
»Ich möchte gern …« Hier war er nun, doch auf einmal kam ihm in den Sinn, dass er gar nicht wusste, welchen Namen sie benutzte, und auch nicht den Namen des Lagerhausbesitzers kannte. »Ich möchte die Dame des Hauses sprechen.«
»Welche?«, wollte sie wissen und wischte eine schmutzige Hand an ihrer Sackleinenschürze ab. »Mrs Reekie oder Mrs Stoney?«
Beim Namen ihres Ehemannes und der Erwähnung ihrer Tochter stockte ihm der Atem. Wenn es ihn derart mitnahm, nur von ihr zu hören, wie würde er sich dann erst bei ihrem Anblick fühlen? »Mrs Reekie«, erwiderte er, etwas gefasster. »Sie ist es, die ich sprechen möchte. Ist Mrs Reekie zu Hause?«
Der Spalt der Haustür wurde breiter, auch wenn sie die Tür nicht öffnete, um ihn eintreten zu lassen. Es war, als hätte sie noch niemals einen Besucher eingelassen. »Wenn es um eine Fracht geht, solltet Ihr ans Hoftor gehen und mit Mrs Stoney sprechen.«
»Es geht um keine Fracht. Ich möchte Mrs Reekie einen Besuch abstatten.«
»Warum?«
»Würdet Ihr ihr Bescheid geben, dass ein alter Freund da ist und sie sehen möchte?«, erwiderte er geduldig. Seinen Namen zu nennen, wagte er nicht. Ein silbernes Sixpencestück wanderte von seinem Reithandschuh in die von der Arbeit schmutzige Hand der jungen Frau. »Bitte richtet ihr aus, sie möge mich empfangen«, wiederholte er. »Und schickt den Knecht, damit er mein Pferd in den Stall bringt.«
»Einen Knecht haben wir nicht«, antwortete sie, ließ die Münze jedoch in ihrer Schürze verschwinden und musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Bloß den Fuhrmann, und es gibt nur den Stall für das Pferdegespann und einen Hof, wo wir die Fässer lagern.«
»Dann sagt dem Fuhrmann, er soll mein Pferd in den Hof bringen«, wies er sie an.
Sie öffnete die Haustür gerade so weit, dass er eintreten konnte, und ließ sie offen stehen, sodass die Männer auf dem Hafendamm sehen konnten, wie er verlegen in der Diele stand, den Hut in der einen Hand, Reitgerte und Handschuhe in der anderen. Sie ging wortlos an ihm vorbei zur Hintertür, von wo aus sie rief, jemand solle das Hoftor öffnen – nicht für eine Lieferung, sondern bloß für einen Mann, der sein Pferd nicht auf dem Hafendamm stehen lassen wolle. Peinlich berührt sah er sich in der Diele um, betrachtete die Holztüren mit ihren zum Schutz vor Flutwasser erhöhten Steinschwellen, die schmale Holztreppe, den einzelnen Stuhl und wünschte sich von ganzem Herzen, er wäre nie hergekommen.
Er hatte damit gerechnet, dass die Frau, der er den Besuch abstattete, viel ärmer war. Er hatte sich ausgemalt, wie sie aus einem Fenster am Hafendamm Arznei verkaufte und den Ehefrauen von Matrosen und Kapitänshuren bei ihren Geburten beistand. So oft hatte er sie vor seinem inneren Auge in Not gesehen, wie sie Flicken auf die Kleidung des Kindes nähte, wie sie sich selbst zurückhielt, um ihm eine Schüssel Haferbrei anbieten zu können, händeringend auf Arbeitssuche, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Er hatte sie sich so vorgestellt, wie er sie früher gekannt hatte – eine arme, aber stolze Frau, die jeden Penny verdiente, den sie konnte, jedoch niemals bettelte. In seiner Vorstellung war dies vielleicht eine Art Pension am Hafendamm gewesen, und er hatte gehofft, sie würde dort als Haushälterin arbeiten. Er hatte darum gebetet, dass sie zu nichts Schlimmerem gezwungen war.
Jedes Jahr hatte er ihr einen Brief geschrieben, in dem er ihr alles Gute wünschte und ihr versicherte, dass er immer noch an sie dachte, mit einer Goldmünze unter dem Siegel. Geantwortet hatte sie allerdings nie. Er wusste noch nicht einmal, ob sie die Post jemals erhalten hatte. Er gestattete sich niemals, das kleine Lagerhaus am Fluss aufzusuchen, hatte sich noch nicht einmal erlaubt, mit einem Boot flussabwärts zu fahren und nach ihrer Tür Ausschau zu halten. Er hatte Angst davor gehabt, was er sehen könnte. Doch in diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr, genau in diesem Monat und an diesem Tag, war er dann tatsächlich hergekommen.
Das Dienstmädchen kehrte in die Diele zurück und schlug die Haustür zum Schutz vor dem Lärm und dem grellen Licht des Hafendamms zu, sodass er das Gefühl hatte, endlich ins Haus eingelassen worden zu sein – und nicht einfach nur in der Diele abgeliefert wie ein Ballen Waren.
»Wird sie mich empfangen? Mrs Reekie?«, fragte er.
Bevor sie antworten konnte, ging eine weitere Tür auf, und eine Frau um die dreißig trat auf den Flur. Sie trug das dunkle, ehrbare Gewand einer Kaufmannsgattin und darüber eine einfache Arbeitsschürze, die eng um ihre Taille gebunden war. Ihr Kragen war von bescheidener Höhe, schlicht und weiß, gar nicht nach der extravaganten Mode der Zeit. Das goldbraune Haar trug sie zurückgekämmt und beinahe vollständig unter einer weißen Haube verborgen. An den Augenwinkeln hatte sie Fältchen, und ihre gerunzelte Stirn war von einer tiefen Furche durchzogen. Weder senkte sie den Blick wie eine Puritanerin, noch kokettierte sie wie eine Hofdame. James sah sich voller Beklommenheit dem direkten, wenig freundlichen Blick Alys Stoneys ausgesetzt.
»Ihr«, sagte sie ohne Überraschung. »Nach all der Zeit.«
»Ich«, pflichtete er ihr bei und verbeugte sich tief. »Nach einundzwanzig Jahren.«
»Es ist kein guter Zeitpunkt«, erklärte sie schroff.
»Früher konnte ich nicht kommen. Darf ich mit Euch reden?«
Zur Antwort neigte sie kaum merklich den Kopf. »Ich gehe einmal davon aus, dass Ihr hereinkommen wollt«, sagte sie und trat in das angrenzende Zimmer, wobei sie ihm bedeutete, ebenfalls über die erhöhte Schwelle zu steigen. Ein kleines Fenster gewährte Aussicht auf das ferne Flussufer, versperrt durch Masten, fest gereffte Segel und den lauten Kai vor dem Haus, wo die Hafenarbeiter immer noch den Wagen beluden und Fässer ins Lagerhaus rollten. Sie zog einen Vorhang vor, sodass für die auf dem Kai arbeitenden Männer nicht zu sehen war, wie sie ihm einen einfachen Holzstuhl anbot. Er setzte sich, während sie, eine Hand auf dem Kaminsims, stehen blieb und in die leere Feuerstelle starrte.
»Ich habe Geld geschickt, jedes Jahr«, sagte er verlegen.
»Ich weiß«, sagte sie. »Ihr habt einen Louisdor geschickt. Ich habe ihn jedes Mal an mich genommen.«
»Sie hat nie auf meine Briefe geantwortet.«
»Sie hat sie nie zu Gesicht bekommen.«
Er keuchte auf, als habe sie ihm einen Schlag in die Magengrube versetzt. »Meine Briefe waren an sie adressiert.«
Sie zuckte mit den Schultern, als sei es ihr einerlei.
»Bei aller Ehre, Ihr hättet ihr die Briefe geben müssen. Sie waren privater Natur.«
Sie wirkte vollkommen ungerührt.
»Gemäß den Gesetzen dieses Landes gehören sie ihr, oder sie hätten mir zurückgegeben werden sollen«, protestierte er.
Sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu. »Ich bezweifle, dass einer von uns beiden viel mit dem Gesetz zu schaffen hat.«
»Tatsächlich bin ich in meiner Grafschaft Friedensrichter«, erklärte er steif. »Und Abgeordneter im House of Commons. Ich achte und wahre das Gesetz.«
Als sie den Kopf neigte, gewahrte er das sarkastische Funkeln in ihren Augen. »Verzeiht mir, Euer Ehren! Aber ich kann sie nicht zurückgeben, weil ich sie verbrannt habe.«
»Ihr habt sie gelesen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Sobald ich das Gold unter dem Siegel hervorgeholt hatte, war mein Interesse an ihnen erloschen«, sagte sie. »Oder an Euch.«
Ihn überkam eine Atemnot, als sei er gerade dabei, unter schweren Wassermassen zu ertrinken. Er durfte nicht vergessen, dass er ein Gentleman war. Alys war ein Bauernmädchen gewesen und gab sich nun als Hausherrin eines ärmlichen Lagerhauses aus. Er durfte nicht vergessen, dass er ein Kind gezeugt hatte, das hier lebte, an diesem unerfreulichen Ort der Arbeit, und dass er Rechte besaß. Er durfte nicht vergessen, dass sie eine Diebin war und man ihrer Mutter Schlimmeres vorgeworfen hatte, wohingegen er ein adeliger Gentleman mit seit Generationen vererbten Ländereien war. Er ließ sich weit hinab, indem er ihnen diesen Besuch abstattete, bereit zu einem außergewöhnlichen Akt der Güte, um dieser armen Familie unter die Arme zu greifen.
»Ich hätte alles Mögliche schreiben können«, sagte er scharf. »Ihr hattet kein Recht …«
»Ihr hättet alles Mögliche schreiben können«, räumte sie ein. »Und trotzdem hätte es mich nicht interessiert.«
»Aber sie …«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, was sie von Euch hält«, sagte sie. »Auch das interessiert mich nicht.«
»Sie muss doch von mir gesprochen haben!«
Das Gesicht, das sie ihm zuwandte, war ausdruckslos. »Ach, muss sie das?«
Die Vorstellung, dass Alinor in all den Jahren nie von ihm gesprochen hatte, traf ihn wie ein Hieb gegen die Brust. Wenn sie vor einundzwanzig Jahren in seinen Armen gestorben wäre, hätte sie ihn nicht stärker im Geiste verfolgen können. Er hatte jeden Tag an sie gedacht, hatte sie jeden Abend in seine Gebete eingeschlossen, hatte von ihr geträumt, hatte sich nach ihr gesehnt. Es war unmöglich, dass sie nicht an ihn gedacht hatte.
»Wenn Ihr nicht das leiseste Interesse an mir hegt, dann wollt Ihr bestimmt auch nicht wissen, warum ich jetzt hier bin!«, sagte er herausfordernd.
Sie biss nicht an. »Ja«, bestätigte sie. »Ihr habt recht. Nicht im Geringsten.«
Er stand auf, ging an ihr vorbei zum Fenster und schob den Vorhang einen Spalt beiseite, um hinauszusehen. Er versuchte, seinen Zorn im Zaum zu halten und gleichzeitig das Gefühl niederzukämpfen, dass die Härte, mit der sie ihm begegnete, so unerbittlich wie die hereinkommende Flut war. Er vernahm das Schleifen der Bootsfender, als das Wasser den Lastkahn von der Rampe hob, und das Klackern der Schoten an den hölzernen Masten. Geräusche dieser Art waren für ihn immer das Echo des Exils gewesen, die Musik seines Lebens als Spion, als Fremder in seinem eigenen Land. Diese erneute Ahnung von Einsamkeit und Gefahr war ihm unerträglich.
Er drehte sich wieder zum Zimmer zurück. »Um es kurz zu machen, ich bin hergekommen, um mit Eurer Mutter zu sprechen, nicht mit Euch. Und ich möchte das Kind sehen: mein Kind.«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie kann Euch nicht empfangen, und das Kind wird es auch nicht tun.«
»Ihr könnt nicht für die beiden sprechen. Sie ist Eure Mutter, und das Kind – mein Kind – ist mittlerweile mündig.«
Sie erwiderte nichts, sondern wandte lediglich den Kopf ab und blickte wieder nach unten in die leere Feuerstelle. Zwar konnte er seinen Zorn nur mühsam zurückhalten, musste sich jedoch eingestehen, dass sie zu einer starken, markanten Schönheit herangereift war. Sie sah wie eine Frau von Autorität aus, der es gleichgültig war, wie sie auf andere wirkte, aber ganz und gar nicht, was sie tat.
»Das Kind ist jetzt einundzwanzig Jahre alt, und er kann selbst entscheiden«, erklärte er beharrlich.
Abermals sagte sie nichts.
»Es ist doch ein Junge?«, fuhr er zögerlich fort. »Ist es ein Junge? Ich habe einen Sohn?«
»Mit einundzwanzig Goldstücken in Jahresraten lässt sich kein Sohn kaufen«, sagte sie. »Ebenso wenig lässt sich damit ein Moment ihrer Zeit erkaufen. Ihr seid jetzt vermutlich ein wohlhabender Mann. Ihr habt Euer Herrenhaus und die Ländereien wiedererlangt, Euer König ist erneut auf dem Thron, und Ihr seid bekannt als einer derjenigen, die ihn zurück nach England gebracht haben. Und Ihr seid belohnt worden. Er hat an Euch gedacht, auch wenn er so viele andere vergisst, nicht wahr? Es ist Euch gelungen, Euch ganz nach vorn zu kämpfen, als er seine Gunst verteilte. Ihr habt dafür gesorgt, dass man Euch nicht übersehen hat, nicht wahr?«
Er neigte den Kopf. Seine Miene sollte nicht die Bitterkeit darüber verraten, dass die Gefahr, in die er sich über Jahre begeben hatte, nichts anderes bewirkt hatte, als einen närrischen Lustmolch auf den Thron zu befördern. »Ich bin wieder im vollen Besitz der Ländereien und des Vermögens meiner Familie«, bestätigte er leise. »Ich habe mich nie dazu herabgelassen, mich einzuschmeicheln. Was Ihr andeutet, ist … unter meiner Würde. Ich habe erhalten, was mir zusteht. Meine Familie war durch unsere Königstreue in den Ruin getrieben worden. Man hat es uns vergolten. Nicht mehr und nicht weniger.«
»Dann sind einundzwanzig Goldstücke für Euch nicht der Rede wert«, triumphierte sie. »Es wird Euch kaum aufgefallen sein. Aber wenn Ihr darauf besteht, kann ich sie Euch zurückzahlen. Soll ich das Geld Eurem Gutsverwalter in Eurem Herrenhaus in Yorkshire schicken? Ich habe es im Moment nicht in bar. So eine Summe haben wir nicht im Haus, so eine Summe verdienen wir nicht in einem Monat. Aber ich werde mir etwas borgen und Euch im Laufe der Woche entschädigen.«
»Ich will Eure Münzen nicht. Ich will …«
Erneut brachte ihn ihr kalter Blick zum Schweigen.
»Mrs Stoney.« Behutsam benutzte er ihren Ehenamen, und sie widersprach ihm nicht. »Mrs Stoney, ich habe meine Ländereien, aber ich habe keinen Sohn. Mein Titel wird mit mir sterben. Ich bringe diesem Jungen – Ihr zwingt mich dazu, ganz offen mit Euch zu sprechen, nicht mit seiner Mutter und nicht mit meinem Sohn, wie es mir lieber wäre – ich bringe ihm ein Wunder, ich werde einen Gentleman aus ihm machen, ich bringe ihm Reichtümer, er wird mein Erbe sein. Und ihre Wiederherstellung wird es auch sein. Ich sagte einst, sie werde die Lady eines großen Hauses sein. Das wiederhole ich jetzt. Ich bestehe darauf, es vor ihr persönlich zu wiederholen, damit ich mir sicher sein kann, dass sie es erfährt, damit sie genau Bescheid weiß über das großartige Angebot, das ich ihr unterbreite. Und ich bestehe darauf, es vor ihm zu wiederholen, damit er die Möglichkeit kennt, die sich ihm eröffnet. Ich bin bereit, ihr meinen Namen und meinen Titel zu geben. Er wird einen Vater und Familienbesitz haben. Ich werde ihn anerkennen …« Die gewaltigen Ausmaße des Angebots verschlugen ihm den Atem. »Ich werde ihm meinen Namen geben, meinen ehrenwerten Namen. Ich biete ihr meine Hand.«
Am Ende seine Rede ging sein Atem keuchend, doch es kam keine Antwort, nur wieder tiefes Schweigen. Er wähnte sie völlig verblüfft über den Reichtum und das glückliche Los, von denen die Familie wie ein Donnerschlag ereilt worden war. Er glaubte, es habe ihr die Sprache verschlagen.
Doch dann ergriff Alys Stoney das Wort. »Oh, nein, sie wird nicht mit Euch sprechen«, antwortete sie ihm beiläufig, als weise sie einen Hausierer an der Tür ab. »Und in diesem Haus gibt es kein Kind, das Euren Namen trägt. Auch keines, das auch nur von Euch gehört hat.«
»Es gibt einen Jungen. Ich weiß, dass es einen Jungen gibt. Lügt mich nicht an. Ich weiß …«
»Mein Sohn«, sagte sie ruhig. »Nicht Eurer.«
»Ich habe eine Tochter?«
Das brachte alles durcheinander. Vor seinem geistigen Auge hatte er so lang seinen Jungen gesehen, der auf dem Kai heranwuchs, ein Junge, der in der rauen Atmosphäre der Straßen groß wurde, doch der – da war er sich sicher – eine gewisse Bildung genossen hatte, der sorgfältig erzogen worden war. Die Frau, die er geliebt hatte, konnte keinen Jungen haben, ohne einen Mann aus ihm zu machen. Er hatte ihren Jungen, Rob, gekannt: Sie konnte gar nicht anders, als einen braven jungen Mann heranzuziehen und in ihm Neugier und Hoffnung und die Fähigkeit zur Freude zu wecken. Doch wie dem auch sei – seine Gedanken überschlugen sich –, eine Tochter konnte seine Ländereien ebenso gut erben, er konnte sie adoptieren und ihr seinen Namen geben, er konnte sie gut verheiraten, und dann würde er einen Enkelsohn auf Northside Manor haben. Er konnte ihren Sohn zum Erben seines Landes bestimmen und darauf bestehen, dass die neue Familie seinen Namen trug. In der nächsten Generation würde es einen Jungen geben, der den Namen Avery am Leben erhielt. Er würde nicht der Letzte sein, er würde Nachkommen haben.
»Meine Tochter«, verbesserte sie ihn abermals. »Nicht Eure.«
Sie hatte ihn verblüfft. Flehend sah er sie an, so blass, dass sie glaubte, er werde möglicherweise in Ohnmacht fallen. Doch sie bot ihm noch nicht einmal einen Tropfen Wasser an, obwohl seine Lippen grau waren und er eine Hand an den Hals hob und den Kragen lockerte. »Wollt Ihr nach draußen gehen und frische Luft schnappen?«, fragte sie ihn gleichgültig. »Oder einfach gehen?«
»Ihr habt mein Kind als Eures ausgegeben?«, flüsterte er.
Sie neigte den Kopf, antwortete jedoch nicht.
»Ihr habt mein Kind an Euch genommen? Gestohlen?«
Beinahe lächelte sie. »Wohl kaum. Ich wart nicht da, um bestohlen werden zu können. Ihr wart weit weg. Ich glaube nicht, dass wir auch nur den Staub hinter Eurer prächtigen Kutsche zu Gesicht bekommen haben.«
»War es ein Junge? Oder ein Mädchen?«
»Sowohl das Mädchen als auch der Junge sind von mir.«
»Aber wer von beiden war von mir?« Er litt Qualen.
Sie zuckte mit den Schultern. »Jetzt keiner von beiden.«
»Alys, um Himmels willen! Ihr werdet mir doch wohl mein Kind zurückgeben. Für seinen großen Besitz? Damit es mein Vermögen erben kann?«
»Nein«, antwortete sie.
»Was?«
»Nein, danke«, sagte sie unverfroren.
Im Zimmer herrschte lange Zeit Schweigen, während von draußen die Rufe der Männer hereindrangen, als der letzte Getreidesack vom Lastkahn hochgewuchtet wurde und sie begannen, den Kahn mit Gütern für die Rückfahrt zu beladen. Sie hörten, wie Fässer mit französischem Wein und Zucker den Hafendamm entlanggerollt wurden. Immer noch sagte er nichts, doch seine Hand zupfte an dem Spitzenkragen an seiner Kehle. Immer noch sagte sie nichts, sondern hielt den Kopf von ihm abgewandt, als hege sie keinerlei Interesse an seinem Schmerz.
Überrascht fuhr ihr Kopf herum, als auf dem Kopfsteinpflaster vor dem Fenster das laute Geklapper von Rädern ertönte.
»Ist das eine Kutsche? Hier?«, fragte er.
Sie sagte nichts, sondern stand lauschend, ausdruckslos da, während eine Kutsche geräuschvoll den kopfsteingepflasterten Kai hoch zum Lagerhaus fuhr und auf der Straße vor der Eingangstür hielt.
»Die Kutsche eines Gentlemans?«, fragte er ungläubig. »Hier?«
Sie vernahmen Hufgetrappel, als die Pferde zum Stehen gebracht wurden, dann sprang der Lakai hinten ab, öffnete die Kutschentür, kam zur Eingangstür des Lagerhauses und hämmerte dagegen.
Rasch ging Alys an James vorbei, durchquerte das Zimmer und schob den Vorhang ein Stück beiseite, um nach draußen auf den Kai spähen zu können. Sie erblickte nur die offene Tür der Kutsche, einen sich bauschenden dunklen Seidenrock, einen winzigen Seidenschuh, an dessen Spitze eine schwarze Rose geheftet war. Dann hörten sie das Dienstmädchen, das den Flur entlangstampfte, die schäbige Eingangstür öffnete und angesichts des überaus vornehmen Lakaien von der Kutsche zurückschreckte.
»Die Nobildonna«, verkündete er, und Alys beobachtete, wie der Saum des Kleids die Kutschenstufen herunterfegte, über die Kopfsteine, hinein in die Diele. Hinter dem reichen Kleid folgte ein schlichter Saum einer Bediensteten, und Alys drehte sich zu James um.
»Ihr müsst gehen«, sagte sie hastig. »Ich habe nicht damit gerechnet … Ihr werdet …«
»Ich gehe nicht ohne eine Antwort.«
»Ihr müsst!« Sie ging auf ihn zu, als wolle sie ihn mit Gewalt durch die schmale Tür schieben, doch es war zu spät. Das verblüffte Hausmädchen hatte bereits die Tür der Stube aufgerissen, es ertönte ein Rascheln von Seide, und die verschleierte Fremde betrat das Zimmer. Sie hielt auf der Schwelle inne und musterte den wohlhabenden Gentleman mit raschem Blick. Sie durchquerte das Zimmer, nahm Alys in die Arme und küsste sie auf beide Wangen.
»Ihr erlaubt? Ihr verzeiht mir? Aber ich konnte an keinen anderen Ort!«, sprudelten die Worte mit italienischem Akzent aus ihr hervor.
James sah mit an, wie die bis eben noch so eiskalte Alys heftig errötete, ihr Farbe in Hals und Wangen stieg, und er bemerkte, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten, als sie sagte: »Natürlich musstet Ihr kommen! Ich dachte nicht …«
»Und das hier ist mein Kind«, erklärte die Dame ohne Umschweife mit einem Wink nach hinten zu dem Dienstmädchen, das einen schlafenden, in feinste venezianische Seide gekleideten Säugling trug. »Das ist sein Sohn. Das ist Euer Neffe. Wir haben ihn Matteo genannt.«
Alys stieß einen leisen Schrei aus und streckte die Arme nach dem Säugling aus, blickte hinab auf das makellose Gesicht, während ihr Tränen in die Augen stiegen.
»Euer Neffe?« James trat vor, um sich das kleine, von Spitzenborte umrahmte Gesichtchen anzusehen. »Dann ist das Robs Junge?«
Ein zornentbrannter Blick aus Alys’ Augen hinderte die Dame nicht daran, einen schwungvollen Knicks vor ihm zu machen und ihren dunklen Schleier zurückzuwerfen, sodass ein ausdrucksstarkes, schönes Gesicht zum Vorschein kam, die Lippen mit Rouge gerötet, mit einem dunklen, halbmondförmigen Muttermal neben dem Mund.
»Es ist mir eine Ehre, Lady …?«
Alys gab den Namen der Dame nicht preis, ebenso wenig nannte sie seinen. Verlegen und wütend stand sie da und sah beide an, als könnte sie ihnen die höfliche Geste einer Vorstellung verweigern und dafür sorgen, dass sie sich niemals kennenlernten.
»Ich bin Sir James Avery von Northside Manor, Northallerton in Yorkshire.« James neigte sich über die Hand der Dame.
»Nobildonna da Ricci«, erwiderte sie. Und dann wandte sie sich an Alys. »So sagt man doch? Da Ricci? Habe ich recht?«
»Ich glaube wohl«, sagte Alys. »Aber Ihr müsst sehr müde sein.« Sie blickte aus dem Fenster. »Die Kutsche?«
»Ach, die ist gemietet. Sie werden meine Schrankkoffer abladen, wenn Ihr sie bezahlen würdet?«
Alys sah entsetzt aus. »Ich weiß nicht, ob ich genug …«
»Ihr gestattet«, unterbrach James sie gewandt. »Als Freund der Familie.«
»Ich werde sie bezahlen!«, sagte Alys beharrlich. »Ich bekomme das Geld schon zusammen.« Sie riss die Tür auf und rief dem Dienstmädchen einen Befehl zu. Dann wandte sie sich zu der Witwe um, die dieses Gespräch Wort für Wort mitverfolgt hatte. »Ihr werdet Euch ausruhen wollen. Folgt mir nach oben, und ich werde Tee holen.«
»Allora! Bei den Engländern gibt es immer Tee!«, rief sie und warf die Hände in die Luft. »Aber ich bin nicht müde und ich will keinen Tee. Und ich fürchte, ich habe Euch gestört. Seid Ihr geschäftlich hier, Sir James? Bitte bleibt! Bitte fahrt fort!«
»Ihr stört nicht, und er wollte gerade gehen«, widersprach Alys mit Nachdruck.
»Ich werde morgen zurückkehren, nachdem Ihr etwas Bedenkzeit hattet«, warf James rasch ein. Er wandte sich an die Dame: »Ist Robert bei Euch, Lady da Ricci? Ich würde ihn gern wiedersehen. Er war mein Schüler und …«
Der entsetzte Ausdruck auf beiden Gesichtern besagte ihm, dass er sich einen schrecklichen Fauxpas geleistet hatte. Alys schüttelte den Kopf, als wünschte sie, sie hätte die Worte nicht gehört, und etwas in ihrem Gesicht verriet James, dass die prunkvolle Trauerkleidung der italienischen Dame Rob galt, dem kleinen Rob Reekie, vor einundzwanzig Jahren ein brillanter zwölfjähriger Junge, der nun tot war.
Der Mund der Witwe zitterte. Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen und bedeckte das Gesicht mit ihren schwarz behandschuhten Händen.
»Es tut mir so leid, so leid.« Er verbeugte sich vor der Dame. Dann wandte er sich an Alys. »Mein Beileid angesichts Eures Verlusts. Ich hatte ja keine Ahnung. Wenn Ihr es mir gesagt hättet, wäre ich nicht so plump gewesen. Es tut mir so leid, Alys, Mrs Stoney.«
Sie hielt den Säugling, den vaterlosen Jungen, in den Armen. »Warum sollte ich Euch irgendetwas sagen?«, wollte sie grimmig wissen. »Geht einfach! Und kommt nicht wieder!«
Doch die Dame streckte ihm, das Gesicht noch verborgen, blind die Hand entgegen, wie auf der Suche nach Trost. Er kam nicht umhin, die warme Hand in dem eng anliegenden schwarzen Spitzenhandschuh zu ergreifen.
»Aber er hat von Euch gesprochen!«, flüsterte sie. »Jetzt entsinne ich mich. Ich weiß, wer Ihr seid. Ihr seid sein Tutor gewesen, und er hat erzählt, Ihr habt ihm Latein beigebracht und wärt sehr geduldig mit ihm gewesen, als er noch ein kleiner Junge war. Dafür war er Euch dankbar. Das hat er mir gesagt.«
James tätschelte ihre Hand. »Mein allertiefstes Beileid«, sagte er. »Verzeiht mir meine Plumpheit.«
Mit verschleiertem Blick lächelte sie zu ihm empor und blinzelte Tränen aus den dunklen Augen. »Ist bereits verziehen«, erwiderte sie. »Und vergessen. Wie hättet Ihr so eine Tragödie erraten sollen? Aber besucht mich, wenn Ihr wiederkommt, dann könnt Ihr mir erzählen, wie er als Junge war. Ihr müsst mir alles aus seiner Kindheit erzählen. Versprecht Ihr, dass Ihr das tun werdet?«
»Das werde ich«, antwortete James rasch, bevor Alys die Einladung zurückweisen konnte. »Ich werde morgen herkommen, nach dem Frühstück. Und jetzt werde ich Euch verlassen.« Er verbeugte sich vor den beiden Frauen, nickte dem Kindermädchen zu und ging schnell aus dem Zimmer, bevor Alys ein weiteres Wort sagen konnte. Sie hörten, wie er das Dienstmädchen um sein Pferd bat, dann wurde die Haustür zugeknallt. Schweigend saßen sie da und vernahmen, wie das Pferd aus dem Hof geführt wurde, wie es ruhig dastand, während er aufstieg und dann unter Hufgetrappel verschwand.
»Ich dachte, er hieße anders«, stellte die Witwe fest.
»Damals schon.«
»Ich wusste nicht, dass er ein Adeliger ist?«
»Damals war er es nicht.«
»Und wohlhabend?«
»Jetzt wohl schon.«
»Ach.« Die Dame musterte ihre Schwägerin. »Ist es in Ordnung, dass ich hergekommen bin? Roberto hat mir gesagt, ich solle zu Euch fahren, sollte ihm jemals … sollte ihm jemals … sollte ihm jemals etwas zustoßen.« Ihr Gesicht war tränenüberströmt und gerötet. Sie zog ein winziges, mit schwarzem Band gesäumtes Taschentuch hervor und tupfte sich die Augen ab.
»Natürlich«, versicherte Alys. »Natürlich. Und betrachtet dies so lange als Euer Zuhause, wie Ihr bleiben möchtet.«
Der schlafende Säugling stieß ein Glucksen aus, und Alys nahm ihn von der Schulter, um den Jungen in den Armen zu halten und das verkniffene Gesichtchen nach Ähnlichkeiten mit Rob abzusuchen.
»Ich finde, er sieht Eurem Bruder sehr ähnlich«, sagte die Witwe leise. »Das ist mir ein großer Trost. Beim Verlust meiner Liebe, meines über alles geliebten Robertos, glaubte ich, ich würde vor Gram sterben. Nur dieser kleine … dieser kleine Engel hat mich überhaupt am Leben erhalten.«
Alys drückte die Lippen an dem warmen Köpfchen auf die Stelle, wo der Puls so stark pochte. »Er riecht unglaublich süß«, staunte sie.
Ihre Ladyschaft nickte. »Mein Retter. Darf ich ihn seiner Großmutter zeigen?«
»Ich bringe Euch zu ihr«, antwortete Alys. »Es ist ein schrecklicher Schlag für sie gewesen, für uns alle. Wir haben Euren Brief mit der Nachricht von seinem Tod erst letzte Woche erhalten und dann vor drei Tagen Euren Brief aus Greenwich. Wir tragen noch nicht einmal Trauer. Es tut mir so leid.«
Die junge Frau blickte auf, die Wimpern tränennass. »Das macht nichts, das macht nichts. Was zählt, ist das Herz.«
»Ihr wisst, dass sie krank ist? Aber sie wird Euch sofort willkommen heißen wollen. Ich werde eben nach oben gehen und ihr Bescheid geben, dass Ihr eingetroffen seid. Kann ich Euch etwas bringen lassen? Wenn nicht Tee, dann vielleicht eine heiße Schokolade? Oder ein Glas Wein?«
»Nur ein Glas Wein mit Wasser«, erwiderte die Dame. »Und bitte richtet Eurer werten Mutter aus, dass ich ihr keine Umstände bereiten möchte. Ich kann morgen mit ihr sprechen, wenn sie jetzt gerade ruht.«
»Ich werde sie fragen.« Alys reichte den Säugling dem Kindermädchen und verließ das Zimmer, durchquerte die Diele und stieg die schmale Treppe hoch.
Über den Brief gebeugt saß Alinor an einem runden Tisch in dem verglasten Türmchen und versuchte mühsam, ihrem Bruder Nachrichten zu schreiben, die so schlecht waren, dass sie sie selbst nicht glauben konnte. Die warme Brise, die mit der Flut hereinkam, lüpfte eine vereinzelte Haarlocke von ihrem Gesicht, das zu einem Stirnrunzeln verzogen war. Sie war von ihrem Handwerkszeug umgeben: Werke der Pflanzenheilkunde, über ihr an Schnüren trocknende Kräutersträuße, die sich im Luftzug vom Fenster regten, kleine Flaschen mit Ölen und Essenzen, aufgereiht auf den Regalen am anderen Zimmerende, und auf dem Boden darunter große, mit Korken verschlossene Gläser voller Öl. Zwar war sie noch keine fünfzig, doch ihr wunderschönes Gesicht war von Schmerz und Verlust gezeichnet, ihre Augen waren von einem dunkleren Grauton als ihr schlichtes Kleid, um die schmale Taille trug sie eine weiße Schürze, am Hals einen weißen Kragen.
»War sie das? So bald schon?«
»Du hast die Kutsche gesehen?«
»Ja – ich war gerade dabei, einen Brief an Ned zu schreiben. Um ihm Bescheid zu geben.«
»Ma – es ist Robs … es ist …«
»Robs Witwe?«, fragte Alinor, ohne zu zögern. »Das habe ich mir schon gedacht, als ich ihr Kindermädchen gesehen habe, das den Säugling trug. Es ist Robs kleiner Junge?«
»Ja. Er ist so klein und hat schon eine so weite Reise hinter sich! Soll ich sie heraufbringen?«
»Will sie bleiben? Ich habe die Schrankkoffer auf der Kutsche gesehen …«
»Ich weiß nicht, wie lange …«
»Ich bezweifle, dass es hier gut genug für sie ist.«
»Für das Kindermädchen und den Säugling werde ich Sarahs Zimmer herrichten, und ihr werde ich Johnnies Zimmer unter dem Dach anbieten. Ich hätte mich längst darum kümmern sollen, aber mir wäre im Traum nicht eingefallen, dass sie schon so bald hier eintreffen würde. Sie hat sich in Greenwich eine Kutsche gemietet.«
»Rob hat geschrieben, dass sie eine wohlhabende Witwe war. Das arme Kind, sie muss das Gefühl haben, dass ihr altes Leben verloren ist.«
»Genau wie wir damals«, stellte Alys fest. »Heimatlos und mit den Neugeborenen.«
»Nur dass wir keine Mietkutsche und kein Kindermädchen hatten«, stellte Alinor fest. »Wer war der Gentleman? Von oben habe ich nur seine Hutspitze gesehen.«
Unsicher, was sie sagen sollte, zögerte Alys. »Niemand«, log sie. »Ein Kommissionär und Gentleman. Er hat einen Anteil an einem Sklavenschiff zur Küste von Guinea verkauft. Hat eine hundertfache Rendite versprochen, aber das Risiko ist zu hoch für uns.«
»Ned würde es missfallen.« Alinor blickte auf den unzulänglichen Brief an ihren Bruder, weit fort in Neuengland, auf der Flucht aus seinem Heimatland, das sich für die Knechtschaft unter einem König entschieden hatte. »Ned würde niemals mit Sklaven handeln.«
»Ma …« Alys zauderte, da sie nicht recht wusste, wie sie mit ihrer Mutter reden sollte. »Du weißt, dass es keinen Zweifel geben kann?«
»Am Tod meines Sohnes?« Alinor sprach den Verlust aus, den sie nicht fassen konnte.
»Seine Witwe ist jetzt hier. Sie kann es dir selbst erzählen.«
»Ich weiß. Ich werde es glauben können, wenn sie es mir erzählt, da bin ich mir sicher.«
»Möchtest du auf dem Sofa liegen, wenn ich sie nach oben bringe? Es ist dir nicht zu viel?«
Alinor stand auf, ging das halbe Dutzend Schritte zum Sofa und setzte sich, während Alys ihre Beine hochhob und das Kleid unter ihren Fußknöcheln feststeckte.
»Bequem? Bekommst du Luft, Ma?«
»Ja, mir geht es gut. Lass sie jetzt heraufkommen.«
Juni 1670, Hadley, Neuengland
Ned befand sich in einem Land ohne König, allerdings nicht ohne Obrigkeit.
Als er gerade im Garten des kleinen Fährhauses arbeitete, das lediglich über zwei Zimmer verfügte, ertönte ein ohrenbetäubendes Läuten. Es kam von dem an einer rostigen Eisenstange herabbaumelnden alten Hufeisen, mit dem man den Fährmann, wo auch immer er stecken mochte, herbeirufen konnte. Von dem Garten hinter dem Haus erklomm Ned den Uferdamm, wischte sich die Erde von den Händen und hielt oben inne, um zu sehen, wer diesen Lärm veranstaltete. Er blickte auf den Neuankömmling hinab, ein Mitglied des Stadtrats von Hadley, der den ganzen Weg vom Nordtor der Stadt gerannt, dann den Flussdamm hoch und an der anderen Seite wieder hinunter geklettert war zu dem wackligen Holzsteg der Fähre.
»Es ist nicht nötig, die Toten aufzuwecken. Ich bin bloß in meinem Garten gewesen.«
»Edward Ferryman?«
»Ja. Wie Ihr sehr gut wisst. Wollt Ihr die Fähre benutzen?«
»Nein, ich dachte nur, Ihr wärt vielleicht im Wald, also habe ich nach der Fähre geläutet, um Euch zu holen.«
Schweigend zog Ned die Augenbrauen in die Höhe, wie um anzudeuten, der Mann dürfe zwar die Fähre rufen, jedoch nicht den Fährmann.
Der Mann wies auf das Papier in seiner Hand. »Das hier ist offiziell. Ihr werdet in der Stadt gebraucht.«
»Nun, ich kann den Quinnehtukqut nicht allein lassen.« Ned deutete auf den in seinen sommerlichen Untiefen langsam dahinströmenden Fluss.
»Was?«
»Der Fluss. So lautet sein Name. Wie kommt es, dass Ihr das nicht wisst?«
»Wir nennen ihn den Connecticut.«
»Das ist das Gleiche. Es bedeutet langer Fluss, ein langer Gezeitenfluss. Ich darf die Fähre bei Tageslicht nicht allein lassen, ohne dass jemand das Boot übernimmt. Das solltet Ihr wissen. Diese Vorschrift stammt von der Stadt selbst.«
»Ist das Französisch?«, fragte der andere neugierig. »Der Quin… wie auch immer Ihr ihn genannt habt? Bezeichnet Ihr ihn mit einem französischen Namen?«
»Die hiesige Muttersprache. Das Volk der Dawnlands, vom Land der Morgendämmerung.«
»So nennen wir die Indianer nicht.«
Ned zuckte mit den Schultern. »Vielleicht tut Ihr das, vielleicht nicht, aber so lautet ihr Name. Weil sie die Ersten sind, die die Sonne aufgehen sehen. Und dieses Land heißt Dawnlands, das Land der Morgendämmerung.«
»Neuengland«, verbesserte der Mann ihn.
»Seid Ihr den ganzen Weg hergekommen, um mir beizubringen, wie man redet?«
»In der Stadt hieß es, dass Ihr die Sprache der Eingeborenen sprecht. Die Gemeindeältesten sagen, Ihr müsst kommen, um einem der Indianer eine Urkunde zu erläutern.«
Ned seufzte. »Ich spreche sie nur leidlich. Nicht genug, um von Nutzen zu sein.«
»Wir brauchen einen Übersetzer. Wir wollen mehr Land kaufen, jenseits des Flusses, weiter im Norden, dort drüben.« Er winkte in Richtung der gewaltigen Bäume, die bis zum Ufer standen und gebogene Äste in das spiegelglatte Wasser neigten. »Ihr hättet dort doch wohl auch gerne Land, um den Landungssteg Eurer Fähre herum?«
»Wie viel Land?«, fragte Ned neugierig.
»Nicht viel, noch mal um die zweihundert Morgen.«
Kopfschüttelnd rieb Ned sich Erde von den Händen. »Ich bin nicht Euer Mann. Ich habe die alte Heimat verlassen, um von der ganzen Geldmacherei und dem gegenseitigen Halsabschneiden fortzukommen. Bei der Rückkehr des Königs ging es zu wie beim Einfall einer Horde Ratten in einer Mälzerei. Ich will hier nicht von vorn damit anfangen.« Er drehte sich um und wollte wieder in den Garten hinter seinem Haus gehen.
Verständnislos sah ihn der Mann an. »Ihr redet wie ein Leveller!« Er kletterte den niedrigen Damm hoch und stellte sich neben Ned.
Die Erinnerung an alte, vor langer Zeit verlorene Schlachten ließ Ned ein wenig zusammenzucken. »Mag sein. Aber ich würde lieber in Frieden gelassen werden, als ein Vermögen zu machen.«
»Aber warum?«, wollte der Stadtrat wissen. »Alle sind hierhergekommen, um reich zu werden. Gott belohnt seine Gefolgsleute. Ich bin hier, um besser zu leben als in der alten Heimat. Genau wie alle anderen auch. Dies ist eine ganz neue Welt. Immer mehr Menschen treffen ein, immer mehr werden geboren. Wir wollen ein besseres Leben! Für uns und unsere Familien. Es ist Gottes Wille, dass es uns hier gut geht, es ist sein Wille, dass wir hier sind und seinen Gesetzen gemäß leben.«
»Ja, aber manch einer hat auf eine neue Welt ohne Gier gehofft«, gab Ned zu bedenken. »Einschließlich meiner Wenigkeit. Vielleicht ist es Gottes Wille, dass wir ein Land ohne Herren erschaffen und uns den Garten wie Eden teilen.« Er drehte sich um und stieg die unebenen Stufen zurück hinunter in seinen Garten.
»Wir teilen ihn sehr wohl!«, sagte der Mann mit Nachdruck. »Teilen ihn unter den Gottseligen. Ihr habt hier dank des Wohlwollens des Pfarrers Euren eigenen Anteil.«
»Die Gemeindeältesten täten besser daran, einen der Indianer um Hilfe zu bitten.« Ned band die Schnur an seinem Gartentor auf und trat ein. »Dutzende von ihnen sprechen gut genug Englisch. Manche sind sogar Christen. Was ist mit John Sassamon? Der Lehrer? König Philips Prediger? Er ist in der Stadt, ich habe ihn heute Morgen übergesetzt. Er wird für Euch übersetzen, wie er es für den Gouverneursrat tut. Er ist gebildet, er hat das Harvard College besucht! Ich hingegen wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll.«
Ned verschloss das kleine, handgemachte Gatter hinter sich und befahl seinem Hund zu sitzen. »Kommt nicht näher«, erklärte er dem unwillkommenen Besucher mit Bestimmtheit. »Ich habe Sämlinge hier drinnen, auf denen nicht herumgetrampelt werden soll.«
»Wir wollen keinen Indianer. Um ehrlich zu sein: Wir vertrauen keinem von ihnen bei der Übersetzung einer Urkunde zum Landkauf. Wir wollen nicht in zehn Jahren herausfinden, dass sie es eher als Leihgabe denn als Verkauf bezeichnet haben. Wir wollen einen von uns.«
»Er ist einer von uns«, beharrte Ned. »Als Engländer erzogen, mit Engländern an der Universität gewesen. Ist heute Morgen auf meiner Fähre übergesetzt, in Stiefeln und Kniehose, mit einem Hut auf dem Kopf.«
Der Mann beugte sich über den Gartenzaun, als fürchtete er, der tiefe Fluss könnte ihnen zuhören oder die langen, grasbewachsenen Uferdämme würden lauschen. »Nein, wir trauen keinem von denen«, sagte er. »Es ist nicht, wie es mal war. Sie sind nicht, wie sie mal waren. Sie sind wütend geworden. Sie sind nicht, wie sie zur Zeit ihres alten Königs waren, als sie uns willkommen geheißen haben und mit uns Handel treiben wollten, als sie noch einfache Wilde waren.«
»Einfach? War es damals wirklich so einfach?«
»Mein Vater behauptet es«, antwortete der Mann. »Sie haben uns Land gegeben, wollten mit uns handeln. Haben uns willkommen geheißen, um Hilfe gegen ihre Feinde gebeten – gegen die Mohawk. Jeder weiß, dass sie uns eingeladen haben. Also, hier sind wir! Damals haben sie uns Land gegeben, und jetzt müssen sie uns mehr geben. Und wir werden einen gerechten Preis zahlen.«
»Womit?«, fragte Ned skeptisch.
»Was?«
»Womit werdet Ihr Euren gerechten Preis bezahlen?«
»Oh! Was immer sie fordern. Wampume. Oder Mützen oder Mäntel, was immer sie wollen.«
Angesichts des Tausches von vielen Morgen Land gegen mit Schnitzereien verzierte Muschelperlen schüttelte Ned den Kopf. »Wampume haben an Wert verloren«, stellte er fest. »Und Mäntel? Ihr würdet mit ein paar Mänteln für hundert Morgen Felder zahlen, die sie gerodet und bepflanzt haben, und Wälder, die sie für die Jagd gehegt haben, und nennt das gerecht?« Er hustete aus und spuckte auf den Boden, wie um den Geschmack von Betrug aus dem Mund zu bekommen.
»Sie mögen unsere Mäntel«, sagte der Mann beleidigt.
Ned wandte sich von dem Gatter ab, um das Streitgespräch zu beenden, sank auf die Knie und griff nach seiner Stockhacke, um zwischen seinen Kürbisranken Unkraut zu jäten.
»Was ist dieser Gestank, den Ihr da verbreitet?«
»Fischinnereien«, antwortete Ned, ohne auf den Geruch zu achten. »Hering. Ich vergrabe einen in jedem kleinen Hügel.«
»Das machen die Indianer so!«
»Ja, von denen habe ich es gelernt.«
»Und was ist das, was Ihr da benutzt?«
Ned beäugte die alte Stockhacke, die mit Fett eingerieben und in Asche geröstet worden war, bis sie hart war, und angespitzt, bis sie so gut wie gehämmertes Eisen war. »Das hier? Was ist damit?«
»Das Werk Eingeborener«, erklärte der Mann verächtlich.
»Die Hacke habe ich im gerechten Tausch erworben, und sie funktioniert. Mir ist es gleich, wer sie hergestellt hat, solange sie gut ist.«
»Wenn Ihr die Tricks und Werkzeuge von Indianern einsetzt, werdet Ihr wie sie werden.« Er sprach, als handele es sich um einen Fluch. »Seid auf der Hut, oder Ihr werdet selbst ein Wilder sein, und man wird Euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Ihr wisst, was mit Edward Ashley geschehen ist?«
»Vor vierzig Jahren«, sagte Ned müde.
»Nach England zurückgeschickt, weil er wie ein Indianer gelebt hat«, erklärte der Stadtrat triumphierend. »Fangt nur so an, mit dieser Stockhacke, und als Nächstes tragt Ihr Mokassins und seid verloren.«
»Ich bin Engländer, und zwar durch und durch, und werde als Engländer sterben.« Ned unterdrückte seinen Ärger. »Aber ich muss andere nicht verachten. Ich bin nicht hierhergekommen, um mich als König aufzuspielen und auf Untertanen hinabzuschauen, während ich ihnen auf blutigem Wege meine Lebensweise aufzwinge. Ich bin hierhergekommen, um in Frieden mit meinen Nachbarn zu leben. Mit allen meinen Nachbarn: Engländern und Indianern.«
Der Mann blickte nach Osten, flussaufwärts, wo flache Auen auf der anderen Flussseite in tiefen, dichten Wald übergingen. »Selbst diejenigen, die man nicht sehen kann? Diejenigen, die nachts wie Wölfe heulen und einen den ganzen Tag lang von den Sümpfen aus beobachten?«
»Die auch«, sagte Ned gleichmütig. »Die Gottseligen und die Gottlosen, und diejenigen, deren Götter ich nicht kenne.« Er beugte sich über seine Pflanzen zum Zeichen, dass das Gespräch beendet war. Doch der Bote ging noch immer nicht.
»Wir werden übrigens wieder nach Euch schicken.« Der Mann drehte sich von Neds Gartentor weg und machte sich auf den Rückweg in die Stadt. »Jeder muss dienen. Selbst wenn Ihr jetzt nicht mitkommt, werdet Ihr zum Exerzieren der Miliz kommen müssen. Ihr könnt nicht einfach Engländer sein und am Flussufer herumhocken. Ihr müsst unter Beweis stellen, dass Ihr Engländer seid. Ihr müsst gegen unsere Feinde Engländer sein. Auf diese Weise wissen wir, dass Ihr Engländer seid. Auf diese Weise wisst Ihr es selbst. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen müssen!«
»Ich möchte meinen, wir haben ihnen schon eine Lektion erteilt«, murmelte Ned in Richtung der Erde unter seinen Knien. »Uns besser nicht einzuladen, uns besser nicht willkommen zu heißen.«
Juni 1670, London
Die italienische Dame legte ihren Hut, den dunklen Schleier und ihre schwarzen Spitzenhandschuhe ab und wusch sich in der kleinen Dachkammer Gesicht und Hände, bevor sie ihrer Schwiegermutter einen Besuch abstattete. Das Kind schlief noch, doch sie nahm es auf den Arm und betrat – umwerfend schön, wie eine tragische Madonna – das Zimmer. Alinor registrierte das dunkle, tief ausgeschnittene Kleid, die cremefarbene, von schwarzer Spitze verhüllte Haut, die aufgetürmte dunkle Lockenpracht unter der schwarz gesäumten Haube und die großen, traurigen Augen. Doch ihre größte Aufmerksamkeit galt dem schlafenden Säugling.
»Robs Junge«, war alles, was sie sagte.
»Euer Enkelsohn«, flüsterte Lady da Ricci und legte das Kind in Alinors Arme. »Sieht er nicht wie Roberto aus?«
Alinor empfing den Säugling mit dem Selbstvertrauen einer Hebamme, die schon unzähligen Geburten beigewohnt hatte. Sie hielt ihn auf dem Schoß, um auf das schlafende Gesichtchen hinunterschauen zu können, rund wie ein Mond und mit roten Lippen, auf denen eine kleine Luftblase vom Stillen prangte. Sie sagte lange gar nichts, als würde sie die dunklen Wimpern auf den cremefarbenen Wangen und die kleine Stupsnase befragen. Ihr blasses Gesicht war ernst, als sie schließlich zu der neben ihrem Sofa knienden Witwe aufsah. »Wie alt ist er?«
»Ach, er ist erst fünf Monate alt, Gott behüte ihn, da er gerade geboren schon seinen Vater verloren hat.«
»Und die Augen?«
»Ganz dunkelblau, Ihr werdet es sehen, wenn er aufwacht. Dunkel wie die tiefe See.«
Den Schauder, den Alinor nicht unterdrücken konnte, spürte die italienische Dame mehr, als dass sie ihn sah.
»Er ähnelt seinem Vater so sehr«, beteuerte sie, nun mit lauterer Stimme. »Jeden Tag sehe ich es deutlicher.«
»Ach ja?«, fragte Alinor ausdruckslos.
»Er heißt Matteo Roberto, aber Ihr müsst ihn natürlich Matthew nennen. Und Robert, nach seinem Vater. Matthew Robert da Ricci.«
»Da Ricci?«
»Mein Titel und mein Ehename.«
Die Witwe sah, wie sich die Hand ihrer Schwiegermutter fester um die Spitzenborte des weißen Babykleids legte. »Ich werde ihn Matteo nennen, wie Ihr.« Mehr sagte die ältere Frau nicht.
»Hoffentlich wird es Euch ein Trost sein, dass ich Euch, auch wenn Ihr einen Sohn verloren habt, Euren Enkelsohn hergebracht habe.«
»Ich glaube nicht …«
»Ihr glaubt nicht?«, wiederholte die Italienerin, fast, als warne sie Alinor davor, ihren Gedanken zu Ende zu führen. »Was glaubt Ihr nicht, Nonna? Ich will Euch liebste Großmutter nennen, denn Ihr seid seine einzige Großmutter!«
»Ich glaube nicht, dass ein Kind ein anderes ersetzen kann. Noch würde ich es mir wünschen.«
»Aber mit anzusehen, wie er aufwächst? Ein englischer Junge im Land seines Vaters? Wird diese Freude nicht den Schmerz Eures Verlusts mildern? Unseres Verlusts?«
Alinor erwiderte nichts, und die Witwe spürte, dass ihre fröhliche Stimme irgendwie unpassend klang. »Ich sollte Euch nicht mit meinem Kind und meinem Kummer ermüden.«
»Ihr ermüdet mich nicht«, sagte Alinor sanft und reichte ihr das Kind zurück. »Und es freut mich, dass Ihr hergekommen seid und Euren Sohn mitgebracht habt. Es tut mir leid, dass wir noch keine Vorkehrungen für Euch getroffen haben. Wir haben Eure Briefe gerade eben erst erhalten. Aber Ihr sollt Euch hier zu Hause fühlen, solange Ihr das wollt. Rob hat geschrieben, dass Ihr keine eigene Familie habt?«
»Niemanden«, versicherte sie rasch. »Ich habe niemanden. Ich bin eine Waise. Ich habe niemanden außer Euch!«
»Dann sollt Ihr bleiben, solange Ihr es wünscht. Es tut mir nur leid, dass wir Euch nicht mehr zu bieten haben.«
Die Witwe gestattete sich nicht, den Blick durch das Zimmer schweifen zu lassen, bei dem es sich offensichtlich um Arbeitsplatz, Wohnzimmer und Schlafgemach in einem handelte. »Ich möchte nur bei Euch sein. Ist das hier Euer einziges Haus? Was ist mit dem Haus auf dem Land?«
»Dies ist alles, was wir haben.«
»Alles, was ich will, ist hier«, hauchte sie. »Ich will nur bei Euch und bei meiner Schwester Alys leben.«
Alinor nickte, sagte jedoch nichts.
»Wollt Ihr mir Euren Segen erteilen?«, drängte die Schwiegertochter. »Und mich Livia nennen? Und darf ich Euch Mamma nennen? Darf ich Euch mia Suocera nennen, meine Schwiegermutter?«
Alinor wurde bleich im Gesicht, während sie sich eine Weigerung verkniff. »Ja«, sagte sie. »Selbstverständlich. Gott segne Euch, meine Tochter.«
Die beiden jungen Frauen aßen allein in der Stube zu Abend, während das Dienstmädchen ein Tablett die schmale Stiege zu Alinor hochtrug. Das Kindermädchen aß in der Küche und schmollte, weil es keinen Dienstbotentrakt gab. Sie nahm das Kind auf einen Arm und eine Kerze in die andere Hand und stieg die schmale Holztreppe nach oben ins Schlafzimmer im ersten Stock, gegenüber von dem großen Zimmer nach vorne hinaus, das Alinor nur selten verließ.
»Eure Mutter ist krank?«, fragte Livia Alys. »Roberto hat nie erwähnt, dass sie derart krank ist.«
»Sie hatte einen Unfall«, erwiderte Alys.
Livia schüttelte den Kopf. »Ach, wie traurig. Erst kürzlich?«
»Nein, es ist vor vielen Jahren passiert.«
»Aber sie wird genesen?«
»Bei gutem Wetter kann sie nach draußen, aber sie wird sehr schnell müde. Sie ruht sich lieber auf ihrem Zimmer aus.«
»Oh, wie traurig! Sie muss eine schöne Frau gewesen sein. Einen solchen Schicksalsschlag zu erleiden!«
»Ja«, sagte Alys kurz angebunden.
»Roberto hat mir nie davon erzählt. Er hätte es mir sagen sollen!«
»Es war …« Alys verstummte. Es war ihr unmöglich, dieser italienischen Braut, die ihr Bruder auserwählt hatte, an seiner Stelle zu antworten. »Es war ein großer Schlag für uns alle. Wir haben nie davon gesprochen. Wir sprechen überhaupt nie darüber.«
Einen Augenblick ließ die Italienerin sich dies durch den Kopf gehen. »Ein so schrecklicher Unfall, dass man nicht darüber sprechen kann?«
»Genau.«
»Ihr schweigt darüber?«
»Ja.«
Die hübsche junge Frau dachte nach. »War es Eure Schuld?«, fragte sie kühn. »Da Ihr Stillschweigen über diesen Unfall bewahrt?«
Alys’ Gesicht war im Kerzenschein gequält. »Ja, genau. Es war meine Schuld. Daher spreche ich niemals darüber und Ma auch nicht.«
Die jüngere Frau nickte, als seien ihr Geheimnisse nichts Neues. »Na schön. Dann werde ich auch Stillschweigen bewahren. Erzählt mir also vom Rest Eurer Familie. Ihr habt einen Onkel, nicht wahr? Robs Onkel Ned?«
»Ja, aber er ist nicht in London. Er würde hier nicht leben wollen, unter einem König. Er schreibt zu jeder Jahreszeit aus Neuengland, und er schickt uns Waren. Hauptsächlich Kräuter, seltene Kräuter, die wir den Apothekern verkaufen können …«
»Er verlässt seine Heimat, weil er den neuen König nicht mag? Aber wieso sollte er sich an ihm stören?« Die Frau lachte. »Es ist ja nicht so, als wäre es sehr wahrscheinlich, dass sie sich über den Weg laufen!«
»Er hat sehr feste Überzeugungen«, versuchte Alys eine Erklärung. »Er hat ans Parlament geglaubt, er hat in der New Model Army gekämpft, er hasst die Monarchie. Als sein Anführer Oliver Cromwell verstarb und sie Prinz Charles zurückholten, hat mein Onkel mit anderen, die wie er denken, das Land verlassen – darunter viele gute Männer. Sie wollten nicht unter einem König leben, und er hätte sie mit Sicherheit hinrichten lassen.«
»Ist er wohlhabend geworden in der Neuen Welt?«, erkundigte sich Livia. »Besitzt er eine Plantage? Hat er viele Sklaven? Verdient er ein Vermögen?«
»Nein, er hat eine halbe Parzelle und das Fährrecht. Keine Sklaven. Er würde niemals einen Sklaven besitzen wollen. Er ist mit so gut wie nichts losgezogen, er musste unser ganzes Zuhause zurücklassen.«
»Aber es gehört immer noch der Familie?«
»Nein, es ist verloren. Wir waren nur Pächter.«
»Ich dachte, es sei ein Herrenhaus gewesen, mit Dienstboten und einer eigenen Kapelle?«, wollte sie wissen.
»Das war die Propstei, wo Rob als Gefährte vom Sohn des Lords lebte. Mein Onkel Ned hatte nur das Fährhaus, und Ma, Rob und ich wohnten nicht weit davon in einer kleinen Fischerhütte.«
Livia schürzte ihren hübschen Mund. »Ich dachte, Ihr wärt eine höhergestellte Familie als das hier!«
Alys knirschte beschämt mit den Zähnen. »Leider nicht.«
Doch Livia fuhr mit der Familiengeschichte fort. »Ach ja, aber Ihr habt Kinder! Geht es ihnen gut? Ich sehne mich so danach, sie kennenzulernen! Wo sind sie?«
»Es sind Zwillinge. Mein Sohn John ist in der Arbeit, als Lehrling bei einem Kaufmann in der City. Meine Tochter Sarah macht eine Lehre als Hutmacherin, ihre Zeit in dem Laden ist beinahe vorüber. Sie ist sehr geschickt, da schlägt sie ganz nach ihrer Großmutter – nicht nach mir. Die beiden kommen Samstag nach der Arbeit nach Hause.«
»Du meine Güte! Ihr lasst Eure Tochter außer Haus wohnen? In Venedig würden wir einem Mädchen niemals so viel Freiheit gewähren.«
Alys zuckte mit den Schultern. »Sie muss ihren Lebensunterhalt verdienen, sie braucht ein Gewerbe. Sie ist ein vernünftiges Mädchen, und ich vertraue ihr.«
Livias Gelächter tat Alys in den Ohren weh. »Allora! Die jungen Männer sind diejenigen, denen ich nicht vertraue.«
Alys zwang sich zu einem Lächeln, blieb jedoch eine Antwort schuldig.
»Ihr arrangiert für sie keine Heirat mit einem wohlhabenden Gentleman?«
Alys schüttelte den Kopf. »Nein. Es ist besser für sie, ihr eigenes Gewerbe zu haben, finden wir. Und wir kennen keine wohlhabenden Gentlemen.«
»Aber was ist mit Eurem Besucher? Ist er nicht wohlhabend?«
»Eigentlich kennen wir ihn nicht.« Alys beendete die Befragung. »Ihr müsst sehr müde von der Reise sein. Aber es würde mich freuen, wenn Ihr mir morgen von Eurem Leben mit Rob erzählt. Und … und … wie er gestorben ist.«
»Ihr habt doch gewiss unsere Briefe erhalten?«
»Wir bekamen anfangs Briefe von ihm, als er seine Stelle in Venedig antrat, und dann hat er geschrieben, dass Ihr heiraten würdet. Er hat uns von der Geburt des kleinen Matteo berichtet und von Eurem Glück. Doch dann haben wir nichts mehr gehört, bis Ihr uns geschrieben habt, er sei ertrunken. Den Brief haben wir erst letzte Woche erhalten. Und dann vor drei Tagen kam Euer Brief aus Greenwich, der Euer Eintreffen ankündete.«
»Ach, es tut mir so leid! So leid! Ich habe sofort von Venedig aus geschrieben, nach meinem Verlust, und habe den Brief auf der Stelle abgeschickt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so lange brauchen würde! Gleich bei meiner Landung habe ich dann wieder geschrieben. Es ist ja so gut von Euch, mich willkommen zu heißen, obwohl ich derart schlechte Nachrichten bringe!«
Das Dienstmädchen kam ins Zimmer und räumte das Geschirr ab. Die Italienerin sah sich um, als erwarte sie mehr als den einzelnen Teller mit Obst und Gebäck.
»Darf ich Euch Livia nennen?«, fragte Alys. »Ihr könnt mich Alys nennen, wenn Ihr möchtet.«