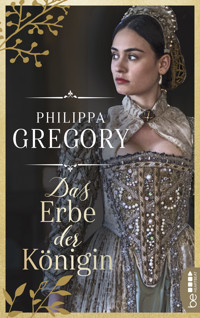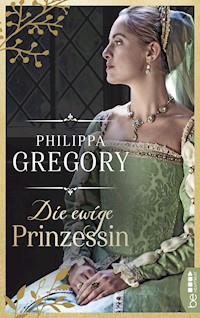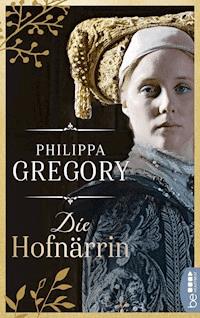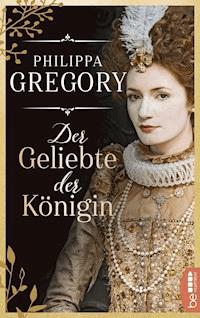12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Fairmile-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Nummer-1-Bestseller aus England: »Die Flut an einem neuen Morgen« ist der dritte Band von Philippa Gregorys fesselnder historischer Familiensaga »Die Fairmile-Trilogie«. 1685 droht England erneut ein Bürgerkrieg, der diesmal auch Alinors Familie spaltet: Ihr Bruder Ned kehrt aus Amerika zurück, um sich der Rebellion gegen den katholischen König anzuschließen. Alinors Tochter Alys dagegen wird von der manipulativen Livia überredet, die Königin vor der bevorstehenden Belagerung zu retten. Ihre Belohnung würde alles verändern: Alinor könnte dort herrschen, wo sie einst weniger als eine Dienerin war. Alinors Enkelsohn Johnnie hat beschlossen, sich aus dem Krieg herauszuhalten – bis Ned wegen Verrats die Hinrichtung droht. Johnnie kann seinen Großonkel nicht einfach sterben lassen. In diesen turbulenten Zeiten gerät Alinors Familie mitten hinein in eine Verschwörung, in deren Zentrum nichts weniger als der Thron von England steht. Mitreißend erzählter und hervorragend recherchierter historischer Roman über das England des 17. Jahrhunderts. Philippa Gregory brilliert auch im dritten Band ihrer historischen Familiensaga als grandiose Bestseller-Autorin und leidenschaftliche Historikerin: »Rasant, fesselnd und akribisch recherchiert – historische Unterhaltung vom Feinsten.« Daily Express Die historischen Romane der »Fairmile-Trilogie« sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Gezeitenland (1648) - An dunklen Wassern (1670) - Die Flut an einem neuen Morgen (1685)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 870
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Philippa Gregory
Die Flut an einem neuen Morgen
Roman
Aus dem Englischen von Ute Brammertz
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
1685 droht England erneut ein Bürgerkrieg, der diesmal auch Alinors Familie spaltet: Ihr Bruder Ned kehrt aus Amerika zurück, um sich der Rebellion gegen den katholischen König anzuschließen. Alinor dagegen wird von der manipulativen Livia überredet, die Königin vor der bevorstehenden Belagerung zu retten. Ihre Belohnung würde alles verändern: Alinor könnte dort herrschen, wo sie einst weniger als eine Dienerin war. Alinors Sohn Rob hat beschlossen, sich aus dem Krieg herauszuhalten – bis Ned wegen Verrats die Hinrichtung droht. Rob kann seinen Onkel nicht einfach sterben lassen. Doch beim Versuch, Ned zu retten, gerät Rob mitten hinein in eine Verschwörung, in deren Zentrum nichts weniger als der Thron von England steht.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Stammbaum
Northside Manor, Yorkshire, Frühling 1685
Boston, Neuengland, Frühling 1685
St. James’s Palace, London, Frühling 1685
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
St. James’s Palace, London, Frühling 1685
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
St. James’s Palace, London, Frühling 1685
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
St. James’s Palace, London, Frühling 1685
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
Amsterdam, Holland, Frühling 1685
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
Amsterdam, Holland, Frühling 1685
Lincoln’s Inn, London, Frühling 1685
Insel Texel, Holland, Frühling 1685
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
Insel Texel, Holland, Frühling 1685
St. James’s Palace, London, Frühling 1685
Auf See, Frühling 1685
Das Kaffeehaus, Serle Court, London, Frühling 1685
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
Gärten im St. James’s Palace, London, Frühling 1685
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
Auf See, Sommer 1685
St. James’s Palace, London, Sommer 1685
Lyme Regis, Sommer 1865
St. James’s Palace, London, Sommer 1685
Lyme Regis, Sommer 1685
St. James’s Palace, London, Sommer 1685
Taunton, Somerset, Sommer 1685
St. James’s Palace, London, Sommer 1685
Reekie Wharf, London, Sommer 1685
Bridgwater, Somerset, Sommer 1685
Reekie Wharf, London, Sommer 1685
Norton St. Philip, Somerset, Sommer 1685
Reekie Wharf, London, Sommer 1685
Bridgwater, Somerset, Sommer 1685
St. James’s Palace, London, Sommer 1685
Westonzoyland, Somerset, Sommer 1685
Reekie Wharf, London, Sommer 1685
St. James’s Palace, London, Sommer 1685
Südwestengland, Sommer 1685
Reekie Wharf, London, Herbst 1685
Taunton, Somerset, Herbst 1685
Foulmire, Sussex, Herbst 1685
Windsor Castle, Herbst 1685
Taunton, Somerset, Herbst 1685
Foulmire, Sussex, Herbst 1685
Taunton, Somerset, Herbst 1685
Foulmire Propstei, Sussex, Herbst 1685
Taunton, Somerset, Herbst 1685
Foulmire Propstei, Sussex, Herbst 1685
Taunton, Somerset, Herbst 1685
Foulmire, Sussex, Herbst 1685
Gefängnis von Taunton Castle, Somerset, Herbst 1685
Foulmire, Sussex, Herbst 1685
Reekie Wharf, London, Herbst 1685
Auf der Straße nach London, Herbst 1685
Foulmire Propstei, Sussex, Herbst 1685
Berry Street, London, Herbst 1685
Foulmire Propstei, Sussex, Herbst 1685
Windsor Castle, Herbst 1685
Foulmire Propstei, Sussex, Herbst 1685
Berry Street, London, Herbst 1685
Gefängnis von Bristol, Herbst 1685
Foulmire, Sussex, Herbst 1685
Gefängnis von Bristol, Herbst 1685
Reekie Wharf, London, Herbst 1685
St. James’s Palace, London, Herbst 1685
Bristol, Herbst 1685
Hatton Garden, London, Herbst 1685
Reekie Wharf, London, Herbst 1685
Bridgetown, Barbados, Winter 1686
St. James’s Palace, London, Winter 1686
Barbados, Winter 1686
Whitehall Palace, London, Winter 1686
Peabody-Plantage, Barbados, Winter 1686
Reekie Wharf, London, Frühling 1686
Peabody-Plantage, Barbados, Frühling 1686
Avery House, London, Frühling 1686
Hatton Garden, London, Frühling 1686
Reekie Wharf, London, Frühling 1686
St. James’s Palace, London, Frühling 1686
Reekie Wharf, London, Sommer 1686
Foulmire Propstei, Sussex, Sommer 1686
Reekie Wharf, London, Sommer 1686
Peabody-Plantage, Barbados, Sommer 1686
St. James’s Palace, London, Sommer 1686
Peabody-Plantage, Barbados, Herbst 1686
Foulmire Propstei, Sussex, Herbst 1686
Tiefe Höhle, Barbados, Herbst 1686
Hatton Garden, London, Herbst 1686
Tiefe Höhle, Barbados, Herbst 1686
Foulmire, Sussex, Herbst 1686
Tiefe Höhle, Barbados, Herbst 1686
Foulmire Propstei, Sussex, Herbst 1686
Tiefe Höhle, Barbados, Herbst 1686
Bridgetown, Barbados, Herbst 1686
Whitehall Palace, London, Winter 1686
Bridgetown, Barbados, Winter 1687
Peabody-Plantage, Winter 1687
Foulmire Propstei, Sussex, Frühling 1687
Reekie Wharf, London, Sommer 1687
Foulmire Propstei, Sussex, Sommer 1687
Whitehall Palace, London, Sommer 1687
Foulmire, Sussex, Sommer 1687
Foulmire Propstei, Sussex, Herbst 1687
Bath, Somerset, Herbst 1687
Christopher Moncks Stadthaus, London, Herbst 1687
White Hart Inn, London, Herbst 1687
Bath, Somerset, Herbst 1687
Das Kaffeehaus, Serle Court, London, Herbst 1687
Whitehall Palace, London, Herbst 1687
Bridgetown, Barbados, Winter 1687
Fairmere Propstei, Sussex, Winter 1687
Peabody-Plantage, Barbados, Winter 1687
Whitehall Palace, London, Winter 1687
Bridgetown, Barbados, Winter 1687
Whitehall Palace, London, Frühling 1688
Reekie Wharf, London, Frühling 1688
Hatton Garden, London, Frühling 1688
Amsterdam, Holland, Frühling 1688
Whitehall Palace, London, Frühling 1688
Goldschmiede Haycroft und Johnson, London, Frühling 1688
Hatton Garden, London, Frühling 1688
Bridewell, Clerkenwell, London, Sommer 1688
Whitehall Palace, London, Sommer 1688
St. James’s Palace, London, Sommer 1688
Hatton Garden, London, Sommer 1688
Reekie Wharf, London, Sommer 1688
Fairmere Propstei, Sussex, Sommer 1688
Bridgetown, Barbados, Sommer 1688
Reekie Wharf, London, Sommer 1688
Hellevoetsluis, Holland, Sommer 1688
Windsor Castle, Herbst 1688
Torbay, Devon, Herbst 1688
Whitehall Palace, London, Herbst 1688
Whitehall Palace, London, Herbst 1688
Auf der Straße nach London, Winter 1688
Fairmere Propstei, Sussex, Winter 1688
Whitehall Palace, London, Winter 1688
Reekie Wharf, London, Winter 1688
Barbados, Winter 1688
Reekie Wharf, London, Winter 1688
Fairmere Propstei, Sussex, Sommer 1689
Anmerkung der Autorin
Northside Manor, Yorkshire, Frühling 1685
Livia Avery kam in einem maßgeschneiderten Reitkostüm aus schwarzem Samt die große Treppe von Northside Manor herunter. Ihre behandschuhte Linke lag leicht auf dem Geländer, und die Absätze ihrer Reitstiefel klackerten auf dem polierten Holz. Ihr Gatte Sir James, der gerade den Steinboden der Eingangshalle überquerte, hob den Blick und bemerkte den Brief in ihrer Hand nebst ihren geröteten Wangen.
»Dein Wunsch ist also endlich in Erfüllung gegangen«, sagte er tonlos. »Du hast ausgesprochen geduldig gewartet. Fünf Jahre ist es nun her, dass du die Herzogin kennengelernt hast, und jetzt ist sie Königin. Ich dachte, du hättest längst aufgegeben.«
Livia schnappte ein wenig nach Luft. »Ich gebe niemals auf.« Dann zeigte sie ihm das königliche Siegel.
»Ist es eine königliche Vorladung?«
»Hier können wir das nicht besprechen!«, entschied sie und ging vor ihm in die Bibliothek. Gewaltige Holzscheite glommen im Kamin. Livia öffnete die Perlmuttknöpfe ihrer dunklen Reitjacke und zupfte an der erlesenen Spitze um ihren Hals. Mit nichts als Überdruss betrachtete Sir James ihre Schönheit. Sie war für ihn wie die überall in seinem Haus stehenden klassischen Statuen – eine Augenweide, aber ohne jede Bedeutung.
Sie ließ sich in dem großen Sessel vor dem Feuer nieder und beugte sich leicht vor, sodass ihr Gesicht im Schein der Flammen leuchtete, als säße sie Modell für ein Porträt. Ihr Haar war immer noch glänzend schwarz, die milchweiße Haut ihrer Wangen glatt, nur um die Augen mit den schwarzen Wimpern herum zeichneten sich ein paar winzige Fältchen ab. Sie wartete, bis er ihr gegenüber Platz genommen hatte, ehe sie sprach.
»Ich bin ganz Ohr«, sagte er.
»Man hat mich an den Hof berufen«, hauchte sie. »James, der Herzog von York, soll zum König gekrönt werden, seine Gattin zur Königin. Für den Bankert des verstorbenen Königs gibt es keinerlei Unterstützung. James II. wird sein Erbe ohne Anfechtung antreten, und meine liebe Freundin Mary von Modena wird Königin.« Sie frohlockte, als hätte sie selbst das englische Volk davon überzeugt, den unbeliebten katholischen Bruder des Königs statt des allseits verehrten protestantischen unehelichen Sohnes zu krönen. »Sie schreibt, sie brauche mich, denn es gehe ihr nicht gut. Selbstverständlich werde ich ihrem Ruf Folge leisten.«
Sir James sagte immer noch nichts.
»Du könntest mitkommen. Ich soll Hofdame werden, wir könnten Avery House wieder öffnen. Ich könnte dir einen Posten bei Hofe beschaffen. Womöglich wäre es ein Neuanfang für uns beide.«
Da räusperte er sich. »Ich glaube eigentlich nicht, dass ich einen Neuanfang möchte. Ja, ich bezweifle, dass ich irgendetwas möchte, das du mir zu bieten hast.«
Verärgert blitzten ihre dunklen Augen auf. »Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich eine königliche Einladung ausschlage. Das ist so gut wie ein Befehl.«
Er wandte das Gesicht von ihr ab. »Tatsächlich? Ich könnte mir vorstellen, dass du sehr wohl ablehnen könntest. Allerdings bin ich felsenfest davon überzeugt, dass du sie umgarnt hast – ihr jede Woche geschrieben, kleine Präsente geschickt, dich all deiner einnehmenden Kniffe bedient –, bestimmt hast du sie angefleht, dich einzuladen. Und jetzt tut sie es.«
»Du solltest mir dankbar sein …«
»Fahr ruhig hin.« Was sie noch zu sagen hatte, interessierte ihn nicht. »Ich werde dich in der Kutsche hinbringen lassen. Gewiss werdet ihr im St. James’s Palace leben, während Whitehall wiederaufgebaut wird. Gehe ich recht in der Annahme, dass du hierher zurückkehren wirst, wenn sie im Sommer nach Windsor umziehen?«
»Du willigst ein?«, wollte sie wissen.
Er zuckte mit den Schultern. »Mach doch, was du willst. So wie immer. Du bist dir aber darüber im Klaren, dass der Hof berüchtigt ist für seine …« Auf der Suche nach dem richtigen Wort verstummte er. »… Extravaganz«, sagte er schließlich. »Korruption«, fügte er hinzu. »Wollust. Aber das wird dir nichts ausmachen.«
Geradezu verächtlich zog sie die Augenbrauen hoch, aber ihr Gesicht blieb blass. »Du kannst ja wohl nicht ernsthaft glauben, dass ich …«
»Nein, ich glaube, dass du dir keinerlei Schwäche leistest. Bestimmt sperrst du deine Schlafzimmertür in London ab, so wie du es hier tust. Dort wirst du vielleicht Grund dazu haben.«
»Mein Ruf wird selbstverständlich über jeden Makel erhaben sein.«
»Und bei der Ausübung deines Glaubens solltest du diskret vorgehen.«
Livia warf den Kopf zurück. »Ihre Gnaden – eigentlich sollte ich Ihre Majestät sagen – und ich sind stolz auf unseren gemeinsamen Glauben«, sagte sie. »Sie wird die königliche Kapelle im St. James’s Palace eröffnen. Sie ernennt den Benediktinerorden …«
»In London wird man es nicht hinnehmen, dass Katholiken ihre Religion in aller Öffentlichkeit praktizieren«, erklärte ihr Sir James. »Den Andachtsraum der Königin im Palast darfst du aufsuchen, aber ich rate dir dringend davon ab, dich außerhalb der Palastmauern in Gotteshäusern zu zeigen. Es wird bestimmt Aufruhr geben, vielleicht sogar noch schwerwiegendere, als wir bisher erlebt haben. Ihre Majestäten sollten diskret vorgehen, so wie der verstorbene König Charles.«
»Wir hängen eben nicht alle unser Fähnlein nach dem Wind!«, versetzte sie zornig.
»Ich habe dem katholischen Glauben abgeschworen, um mein Leben als englischer Gentleman führen zu können«, erwiderte er unerschütterlich. »Die anglikanische Kirche ist mein Glaube und kein Scheitern.«
Livia empfand sein ganzes Leben als Scheitern: Er hatte den Glauben gewechselt; er hatte seine erste Liebe verraten; Livia selbst hatte ihn zum Narren gehalten und ihn um seines Namens und seines Vermögens willen zu einer Heirat überlistet.
»Ich bin Katholikin«, verkündete sie stolz. »Jetzt mehr denn je. Ganz England wird zum wahren Glauben zurückkehren, und dann wirst du auf der falschen Seite stehen.«
Er lächelte. »Es ist doch bewundernswert, wie deine Religiosität mit der Mode zunimmt. Aber du solltest trotzdem besser diskret vorgehen.«
Ihr Blick wanderte vom Feuer zum massiven Holzschnitzwerk des Wappens am Kaminsims und dann zu ihm. Ihre dunklen Augen schmolzen, und ein kleines Lächeln umspielte ihre Lippen. »James, ich möchte mit dir über meinen Sohn sprechen.«
Er schob sich ein wenig tiefer in den Sessel und grub die Absätze in den türkischen Läufer, als machte er sich auf eine Auseinandersetzung gefasst.
»Wieder einmal möchte ich dich bitten, ihn zu adoptieren und als deinen Erben einzusetzen.«
»Und wieder einmal erkläre ich dir, dass ich das nicht möchte.«
»Da ich doch nun an den Hof gebeten worden bin …«, setzte sie an.
»Er ist keinen Deut mehr mein Sohn, als er es vorher war. Und ich möchte doch bezweifeln, dass du gebeten worden bist.«
»Er hat die besten Schulen in ganz London besucht, er wird in den Anwaltskammern der Inns of Court Jura studieren, und von der Familie, die du für ihn ausgesucht hast, wird er als englischer Gentleman großgezogen. Du kannst keine Einwände gegen ihn haben.«
»Ich habe auch nichts gegen ihn einzuwenden«, stimmte er ihr zu. »Ganz gewiss wird er prächtig erzogen. Du hast ihn einer großherzigen Familie mit einem hohen Sinn für Moral überantwortet. Er kann dich in London besuchen, falls du das wünschst – aber du darfst nicht zum Lagerhaus fahren und dich bei seiner früheren Pflegefamilie blicken lassen. Du darfst sie nicht belästigen oder ihnen Kummer bereiten. So lautet die Abmachung.«
Sie verkniff sich eine wütende Entgegnung. »Ich verspüre nicht den geringsten Wunsch, diese Leute wiederzusehen. Warum sollte ich flussabwärts zu einem dreckigen Kai fahren? Ich möchte nicht von ihnen sprechen, ich verschwende niemals auch nur einen Gedanken an sie! Es geht um Matteo! Wir reden von meinem Sohn Matteo …« Sie legte die Hand aufs Herz.
Ungerührt bemerkte er, dass sich in ihren großen Augen Tränen sammelten.
»Wenn du ihn nicht als deinen Sohn und Erben adoptierst, so habe ich geschworen, keinen anderen zur Welt zu bringen«, rief sie ihm in Erinnerung. »Meine Tür wird zugesperrt bleiben, während wir kinderlos altern. Ich werde nicht mitansehen, wie mein Sohn ohne Erbe dasteht. Wenn du nicht zuerst meinem Jungen deinen Namen schenkst, wirst du nie einen rechtmäßigen Sohn haben. Du wirst ohne rechtmäßigen Sohn und Erben sterben!«
Obwohl sie die Stimme erhoben hatte, regte er sich kaum in seinem Sessel. »Dir ist doch wohl bekannt, dass ich per Gesetz Anspruch auf deinen Körper habe?«, vergewisserte er sich. »Aber tatsächlich setze ich meine Ansprüche nicht durch, du hättest auch nicht deine Schlafzimmertür absperren müssen. Ich möchte gar nicht hinein.«
»Wenn du unbedingt wie ein Priester leben willst!«, fuhr sie ihn an.
»Lieber ein Priester als ein Narr«, erwiderte er gelassen.
Sie fuhr mit der Hand in ihren Nacken und steckte eine der dunklen Locken hoch, die über ihren Kragen gefallen war. Ihre Stimme war jetzt warm und seidenweich. »Manch einer würde sagen, du seist ein Narr, mich nicht zu begehren …«
Blind für die verführerische Geste sah James in die Flammen des Kaminfeuers. »Auf diesem Weg wurde ich schon einmal in die Irre geleitet«, sagte er sanft. »Das passiert mir nie wieder. Und wie alt bist du gleich noch einmal? Fünfundvierzig? Ich bezweifle, dass du mir überhaupt einen Sohn schenken könntest.«
»Ich bin zweiundvierzig«, entgegnete sie. »Ich könnte immer noch ein Kind bekommen!«
Er zuckte die Achseln. »Wenn ich ohne Erben sterben sollte, so sei es denn. Ich werde meinen ehrenwerten Namen nicht dem Sohn eines anderen übertragen. Eines Unbekannten obendrein.«
Sie biss die Zähne zusammen, und ihr war anzusehen, dass sie ihre Wut niederkämpfte. Schließlich gelang ihr ein Lächeln. »Was immer du wünschst, mein Ehemann. Aber Matteo braucht ein eigenes Heim. Wenn er kein Avery von Northside Manor sein kann, dann muss er ein Picci von Irgendwo sein.«
»Er kann gerne ein Picci von Sonstwo sein, aber nicht von hier. Ich habe nichts gegen den Jungen und auch nichts gegen dich, Livia. Ich erkenne dich als meine Ehefrau an und ihn als deinen Sohn. Als du mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen geheiratet hast, hast du meinen guten Namen erworben, aber das war meine eigene Torheit, und ich habe dafür bezahlt. Dein Sohn wird mich nicht beerben, aber es steht ihm frei, sich sein eigenes Vermögen zu erarbeiten oder es sich, wenn ihm das nicht gelingen sollte, auf deine Kosten gut gehen zu lassen.«
»Falls du immer noch an sie und ihr Kind denkst …«
Seine Miene zeigte keine Gefühlsregung. »Ich habe dich darum gebeten, nicht von ihr zu sprechen.«
»Aber du denkst noch an sie!«
»Jeden Tag«, räumte er mit einem Lächeln ein, als machte es ihn glücklich. »Ich schließe sie immer in meine Gebete mit ein und werde bis zu meinem Tod an sie denken. Aber ich habe ihr versprochen, dass ich sie nicht belästigen werde. Und du wirst das auch nicht tun.«
Boston, Neuengland, Frühling 1685
Den Kragen gegen den kalten Wind hochgeschlagen, stand Ned Ferryman inmitten des Wirrwarrs aus Kais, Landungsstegen und Anlegeplätzen am Bostoner Hafen und beobachtete, wie seine Kräuterfässer mit getrocknetem Sassafras, Schwarzer Schlangenwurzel und Ginsengblättern den steinernen Kai entlang und dann die Landungsbrücke hinauf in das vertäute Schiff gerollt wurden. Sechs Fässer waren bereits unter Deck verstaut, und Ned spähte mit zusammengekniffenen Augen durch die Ladeluke, um sicherzugehen, dass sie festgezurrt und mit Öltuch abgedeckt waren.
Neben ihm auf dem Kai lachte der Kapitän kurz auf. »Keine Sorge, Mr Ferryman, sie sind sicher an Bord.« Sein Blick wanderte hinunter zu Neds abgewetzter Ledertasche und dem kleinen Sack mit seiner Habe. »Ist das alles, was Ihr in Eure Kajüte mitnehmt? Keine Schrankkoffer?«
»Das ist alles.«
Der Schiffsjunge kam die Landungsbrücke heruntergelaufen und griff nach dem Sack. Ned hängte sich die Tasche über die Schulter.
»Ihr werdet gehört haben, dass der König tot ist?«, erkundigte sich der Kapitän. »Mein Schiff war das Erste, das die Nachricht überbracht hat. Sobald wir ein Tau an Land geworfen hatten, habe ich die Neuigkeit ausgerufen. Wer hätte gedacht, dass ein König mit einem derart ungezügelten Lebenswandel im eigenen Bett sterben würde? König Charles, Gott segne ihn, lebte als Schurke und starb als Papist. Bis zu unserer Heimkehr wird sein Bruder James geschwind auf den Thron geklettert sein.«
»Nur, wenn sie ihn tatsächlich krönen«, stellte Ned skeptisch fest. »James, der Papist? Zusammen mit dieser Katholengattin?«
»Hm, ich habe ja selbst auch nichts für ihn übrig – aber welche andere Wahl bleibt denn?«
»Der Herzog von Monmouth, der leibliche Sohn des Königs, ein Mann, der Freiheit verspricht, auch in Religionsfragen.«
»Aber als Bankert zur Welt gekommen ist. Und wir können doch nicht schon wieder einen Stuart-König fortschicken. Wir haben sie gerade erst wieder zurückgeholt.«
Neds strenges Gesicht verzog sich ausnahmsweise einmal zu einem Lächeln. »Ich begreife nicht, warum sie nicht wieder verschwinden können«, antwortete er. »Was hat denn jemals irgendein Stuart für einen Arbeiter getan?«
»Sobald wir dort ankommen, erfahren wir, was los ist«, fasste der Kapitän die Lage zusammen. »Bei Flut stechen wir in See, kurz nach Mittag. Um zwölf Uhr wird eine Signalkanone abgefeuert.«
»Aye, ich kenne Boston«, erwiderte Ned knapp.
»Ihr seid schon eine Weile hier?« Der Kapitän hätte gern mehr über seinen stillen Passagier mit der tief gebräunten Haut und dem wilden grauen Haarschopf gewusst. »Es ist eine großartige Stadt, um dort ein Vermögen zu verdienen, nicht wahr?«
Ned schüttelte den Kopf. »Aus einem Vermögen, das man den Einheimischen raubt, die anfangs bereitwillig all ihre Habe hergaben, mache ich mir nichts. Ich verdiene mir ein bescheidenes Auskommen, indem ich Kräuter sammle. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass ich nach Hause zurückkehre. Vor zwölf Uhr bin ich an Bord.«
Er wandte sich vom Hafendamm ab, um ins Wirtshaus zurückzugehen und die Zeche zu begleichen. Aus der entgegengesetzten Richtung schleppten sich zwanzig mit geteerten Tauen in einer Reihe aneinandergefesselte Gefangene zu einem Schiff, das zu den Plantagen segelte. Ned erkannte auf Anhieb, dass sie zu unterschiedlichen indianischen Völkern gehörten: die einen mit hohen Haarknoten und rasierten Schädeln, während andere die Haare elegant auf Kinnlänge trugen. Jedes Gesicht zierten andere Tätowierungen: manche hoch oben auf den Wangenknochen, manche auch quer über der Stirn. Ein oder zwei trugen sogar den stolzen, tiefschwarzen Fleck der »Kriegsbemalung«: das Zeichen, dass ein Mann geschworen hatte, bis zum Tod zu kämpfen. Sie waren hintereinander zusammengebunden, trugen die unterschiedlichsten Lumpen und zitterten im kalten Wind. Allen gemein waren der langsam schlurfende Gang – der von den kurzen Seilen behindert wurde – und die hängenden Schultern.
»Netop«, flüsterte Ned auf Pokanoket, als sie an ihm vorübergingen. »Netop.«
Die Männer in seiner unmittelbaren Nähe hörten die Begrüßung – »Freund« in ihrer verbotenen Sprache –, aber sie blickten nicht auf.
»Wohin geht die Fahrt?«, fragte Ned den rotgesichtigen Mann, der sie vor sich hertrieb, die Hände in den Taschen und eine kunstvoll geschnitzte Pfeife im Mundwinkel.
»Zu den Zuckerinseln.« Er drehte den Kopf und blaffte: »Wartet!«
Gehorsam hielt der Zug stockend an.
»Gott stehe ihnen bei«, sagte Ned.
»Das wird er nicht, denn sie sind allesamt Heiden.«
Mürrisch drehte Ned sich weg und spuckte den bitteren Geschmack aus, den er im Mund hatte. Da glaubte er, leise wie ein fallendes Laubblatt im Wald, ein Flüstern zu vernehmen:
»Nippe Sannup!«
Er drehte sich um, als er den vertrauten Klang seines Namens auf Pokanoket hörte: »Wassermann.«
»Wer ruft mich?«
»Webe, pohquotwussinnan wutch matchitut.« Schwarze Augen sahen Ned unverwandt an. Ein junger Bursche, ohne Bart und schmächtig. In seinem Gesicht lag kein Flehen, doch seine Lippen bildeten die Wörter: »Nippe Sannup.«
»Ich brauche einen Jungen, einen Diener«, log Ned. »Ich fahre nach England und suche einen Burschen, der mir auf dem Schiff dient.«
»Da müsst Ihr keinen von denen hier kaufen«, riet der Mann ihm. »Ruft einfach in den Hof des Wirtshauses hinein, und ein halbes Dutzend kleiner weißer Ratten wird die Hälse recken, weil sie unbedingt nach Hause wollen.«
»Nein, ich möchte einen Wilden«, improvisierte Ned rasch. »Ich sammle indianische Kräuter und heidnische Schnitzereien. Dinge wie Eure Pfeife – das ist doch auch Heidenwerk, nicht wahr? Meine Waren lassen sich besser verkaufen, wenn ein junger Wilder sie herumträgt. Ich kaufe Euch gleich jetzt einen von ihnen ab«, erwiderte Ned. Er deutete auf den Jüngling. »Den da.«
»Oh, den kann ich nicht hergeben«, sagte der Mann sofort. »Der da wird wie Unkraut wachsen: voller werden, breitschultriger, der wird mal stark. Für den bekomme ich gutes Geld.«
»Der wird keine drei Sekunden auf den Feldern durchhalten«, widersprach Ned. »Allein die Überfahrt wird ihn umbringen. An dem ist ja nichts dran, außerdem hat er diesen Blick in den Augen.«
»Die krepieren, bloß um sich mir zu widersetzen!«, sagte der Aufseher erbost. »Sie gewöhnen sich einfach nicht an die Sklaverei. Keiner würde so einen kaufen, wenn man stattdessen einen Afrikaner kriegen könnte. Aber Sklave ist Sklave. Man hat ihn ein Leben lang – so lange es eben dauert. Was gebt Ihr mir?«
»Fünfzig Dollar, spanische Dollar«, nannte Ned willkürlich eine Summe.
»Abgemacht«, erklärte der Mann sich so schnell einverstanden, dass Ned merkte, er hatte zu viel geboten. »Sicher den da? Für noch ein Pfund bekommt Ihr den hier, der ist größer.«
»Nein«, sagte Ned. »Ich will einen jungen, denen lässt sich leichter etwas beibringen.«
»Ihr haltet die Pistole, während ich ihn losbinde.« Der Aufseher zog eine Pistole aus dem Gürtel und zeigte sie den Gefangenen, die sich geradezu verächtlich abwandten. Er drückte Ned die Waffe in die Hand. »Wenn sich einer rührt, schießt Ihr ihm in den Fuß. Klar?«
»Klar«, erwiderte Ned, griff nach der schweren Waffe und richtete sie auf die zusammengedrängte Schar.
Der Aufseher holte ein Messer aus seinem Stiefel, durchschnitt die Seile zu beiden Seiten des Jungen und schob den immer noch an den Füßen Gefesselten auf Ned zu. Die beiden losen Seilenden band er zu groben, aber zweckdienlichen Schlaufen und reichte sie Ned, wie die langen Zügel für ein junges Pferd. Dann nahm er die Pistole wieder an sich.
Ned öffnete seine Schultertasche und zählte die Münzen ab. »Hat er Papiere?«
Der Mann lachte. »Haben Kühe Papiere?«, wollte er wissen. »Oder Schweine? Natürlich hat er keine. Aber wir können ihn zum Schmied bringen und ihm Eure Initialen in die Wange brennen lassen.«
Ned spürte, wie sich die Seile in seinen Händen anspannten, weil der schlanke Jüngling sich entsetzt dagegenstemmte.
»Nicht nötig«, sagte Ned. »In einer Stunde stechen wir in See. Ich bringe ihn gleich an Bord und sperre ihn in meiner Kajüte ein.«
»Passt bloß auf, dass er sich nicht im Meer ertränkt«, warnte ihn der Aufseher. »Sie springen, sobald sich ihnen die Gelegenheit bietet. Jemand hat mir gesagt, sie glauben, sie steigen auf einer Bisamratte aus den Wellen auf.« Er lachte dröhnend, und seine gelben, durch Zucker und Rum verfaulten Zahnstümpfe kamen zum Vorschein.
»Ja, das glauben sie tatsächlich …« Ned fiel ein, wie ein Freund ihm einst die Legende der Pequot von der Entstehung der Welt erzählt hatte: Eine Bisamratte hatte der ersten Frau auf der Welt als Geschenk des Lebens Erde vom Meeresboden gebracht.
»Wollt Ihr einen Doppelpack?« Der Aufseher wies auf die übrigen Männer. »Zum gleichen Preis könnt Ihr noch einen haben.«
»Nein.« Sanft zog Ned an dem Seil, das von den gefesselten Handgelenken des Burschen herabhing, und führte ihn zum Schiff. Der Junge folgte ihm schlurfend. Ned drehte sich nicht um, denn kein Weißer sieht je nach seinem Sklaven, und der Junge humpelte hinter ihm her.
Auch redete Ned nicht mit dem Burschen, noch nicht einmal, als sie an Bord waren. Er sperrte ihn in die fensterlose Kajüte, suchte den Lademeister und bezahlte noch eine Überfahrt, ein Viertel des Preises, da es sich um einen Sklaven handelte. Er lehnte das Angebot ab, den Jungen im Laderaum anketten zu lassen und für ihn den Preis eines Gepäckstücks zu zahlen. Dann kehrte er in das Wirtshaus zurück und kaufte ein paar Hemden und eine Kniehose für den Jungen. Anschließend stand er an Deck, bis der Kapitän zur Abfahrt rief, man die Landungsbrücke einzog und die Taue einholte. Die Glockentürme und Dächer der Stadt wurden immer kleiner, bis die neue Stadt Boston nur noch ein Punkt am Horizont war, hinter dem die Sonne versank. Ned streckte seinen schmerzenden Rücken und kletterte durch die Luke die Leiter hinab zu den winzigen Kajüten unter Deck.
Der Junge saß auf dem Boden, den Kopf auf den Knien, als wagte er nicht, die schmale Koje zu berühren. Als die Tür aufging und Ned erschien, einen Kerzenleuchter in der einen Hand, das Kleiderbündel in der anderen, erhob der Junge sich, wachsam wie ein in die Enge getriebener Hirsch. Sein Atem ging ein wenig schneller, aber er ließ keine Angst erkennen. Da Ned die außergewöhnliche Tapferkeit der Pokanoket kannte, wunderte ihn das nicht. Er stellte die Kerze ab.
»Du kennst mich.« Ned kramte in seinem Gedächtnis nach den Wörtern der verbotenen Sprache der Pokanoket. »Du hast mich Nippe Sannup genannt.«
Der Jüngling nickte steif.
»Hast du mich in der Wildnis gesehen? Habe ich mit deinen Leuten Handel getrieben?«
Der Junge sagte nichts.
»Haben die Deinen mit Fellen gehandelt? Oder Kräuter für mich gesammelt?«
Immer noch kam keine Antwort.
»Welche Sprache sprichst du?«, fragte Ned in der verbotenen Sprache der Pokanoket, dann versuchte er es ein weiteres Mal auf Mohawk.
»Ich kann Englisch«, sagte der Jüngling langsam.
»Aus welchem Volk stammst du?«, wollte Ned wissen.
Die Miene des Jungen war ausdruckslos, aber eine Träne rann sein Gesicht hinab. Er wischte sie nicht fort. »Es ist uns verboten, unseren Namen zu nennen«, sagte er leise. »Als Kind habe ich dich gekannt. Du warst Nippe Sannup, der Fährmann von Hadley. Meine Leute benutzten deine Fähre, wenn der Quinnehtukqut über die Ufer trat.«
In Ned regte sich die vertraute Sehnsucht nach jener verlorenen Zeit. »Vor fünfzehn Jahren? Als ich für die Fähre in Hadley zuständig war?«
Der Jüngling nickte.
»Das ist eine Ewigkeit her. Du musst noch ein Kind gewesen sein.«
»Sind wir auf dem Meer? Ist das Schiff losgesegelt?«, wollte er auf einmal wissen.
»Aye.«
»Du wirst mich nicht über Bord werfen?«
»Warum sollte ich das tun, du Narr? Ich habe dich doch gerade eben erst gerettet! Und ein Vermögen bezahlt!«
»Du hast mich vor den Plantagen gerettet?«
»Aye, wir fahren nach London.«
Angesichts der schrecklichen Vorstellung eines anderen unbekannten Reiseziels biss der Junge die Zähne zusammen. »Ich danke dir.«
Ned grinste. »Sonderlich dankbar siehst du nicht gerade aus.«
»Doch. Du hast meine Großmutter gekannt, ihr Name lautete Leises Eichhörnchen. Erinnerst du dich an sie? Sie hat deine Schneeschuhe angefertigt. Erinnerst du dich an die Schuhe? Und an meine Mutter?«
»Leises Eichhörnchen!«, rief Ned. »Ja, genau! Sie hat meine Schneeschuhe gemacht. Und sie hat mir … Sie hat mir alles beigebracht …« Er verstummte. »Ist sie …«
»Sie ist in die Dämmerung eingegangen«, sagte der Junge schlicht. »Mein ganzes Volk ist fort. Meine ganze Familie ist tot. Nur ganz wenige von uns sind lebendig in Gefangenschaft geraten. Das Dorf gibt es nicht mehr. Man kann nicht mal mehr die Gruben für die Pfosten im Boden erkennen. Sie haben alles niedergebrannt und unser Land umgepflügt. Sie haben uns …«, er suchte nach dem richtigen Wort, »… unsichtbar gemacht.«
Schwerfällig ließ Ned sich auf der Kojenkante nieder. »Unsichtbar? Wie kann ein Volk unsichtbar werden?« Auf einmal stieg eine lebhafte Erinnerung an das Dorf Norwottuck in ihm hoch: die Häuser um das Feuer in der Mitte, die spielenden Kinder, die Mais mahlenden Frauen, die Männer, die erlegtes Wild herbeischleppten, und die Mädchen mit langen Speeren, auf denen sie frische Fische aufgespießt hatten. Es war unvorstellbar, dass dies alles verschwunden sein sollte, aber ihm war bewusst, dass es unmöglich den drei Jahre andauernden, erbitterten Krieg hatte überstehen können. »Und du …« Er betrachtete den Jüngling. »Bist du einer von den kleinen Knirpsen gewesen?«
Der Junge presste die Lippen zusammen, als wollte er gefährliche Worte zurückhalten, doch schließlich zwang er sich zu sprechen. »Ich bin dir begegnet, als ich ein Kind von sechs Sommern war. Du hast mich immer zum Lachen gebracht, wenn wir auf deiner Fähre über den Fluss setzten. Damals hieß ich Rote Beeren im Regen.«
Ned riss die Augen auf. Er erhob sich, legte die Hand unter das Kinn des Knaben und drehte sein Gesicht in den Kerzenschein. »Rote Beeren im Regen?«, flüsterte er.
Vor seinem inneren Auge sah er einen Tag vor langer Zeit, vor über fünfzehn Jahren, als die Frauen auf seiner Fähre gewesen waren und sie alle über das kleine Mädchen gelacht hatten, das sich hinter seiner Großmutter versteckt und mit riesigen dunklen Augen zu ihm hervorgelugt hatte. »Du bist ein Mädchen?«, fragte er ungläubig. »Du bist das kleine Mädchen von damals?«
Sie nickte. »Bitte … Bitte überlass mich nicht den Matrosen«, wisperte sie.
»Beim Blut Christi! Hältst du mich für ein Untier?«
Seine Entrüstung ließ sie zusammenzucken. »Der Aufseher hat meine Schwester den Matrosen gegeben.«
»So etwas würde ich niemals tun!«, schwor er. »Ich würde niemals – nun, das kannst du nicht wissen. Aber ich habe eine Schwester in England. Ich habe eine Nichte. Gott weiß, ich würde nie …«
»Ich habe gesagt, dass ich ein Junge bin, und sie haben mir ein Hemd und Kniehosen gegeben.«
»Aye, das ist das Beste.« Ned deutete auf die geflickten Kniehosen und alten Hemden, die auf der Koje lagen. »Am besten bleibst du bis zu unserer Ankunft in England ein Bursche. Wir werden sagen, du wärst mein Diener.«
»Danke«, sagte sie. »Ich will kein Mädchen mehr sein, bis ich wieder ein Mädchen der Dawnlands bin.«
»Wie sollen wir dich nennen?«, fragte er. »Ich kann dich schlecht Rote Beeren im Regen nennen.«
»Es war ein Baum«, erläuterte sie. »Bei dir wuchs auch einer am Tor. Ein schmaler Baum mit weißen Blüten im Frühling und roten Beeren im Herbst. Wir verwenden die Rinde als Heilmittel.«
»Ich erinnere mich daran«, sagte er. Allerdings widerstrebte ihm die quälende Erinnerung an den Baum an seinem Tor, die Fähre über den Fluss und die Frauen, die mit ihm befreundet gewesen und in das Dorf in Neuengland gegangen waren, wo sie mit ihren Körben voller Nahrungsmittel und Fischen an Schnüren stets willkommen gewesen waren. »Das ist eine Eberesche, ein rowan tree«, erklärte er. »Wir können dich Rowan nennen. Und hier …« Er schob die Kleidung auf sie zu. »Am besten ziehst du die Lumpen aus, wahrscheinlich sind sie verlaust. Ich werde sie in der Kombüse abkochen lassen.«
»Kann ich mich waschen?«
Er zögerte, denn er wusste, dass ihr Volk sich jeden Morgen in der Dämmerung mit Blick zur aufgehenden Sonne wusch und betete. Es war das Volk der Dawnlands, das Volk der langen, dunklen Küste, die jeden Tag als Erste die Sonne erblickte. Von sämtlichen Völkern in den großen Wäldern, die sich weit hinter ihnen gen Westen erstreckten, waren sie die Ersten, die das neue Licht erblickten.
»Nicht so, wie ihr es in der Morgendämmerung tut«, sagte er. »Aber ich kann dir einen Krug Wasser und Seife besorgen.« Er griff nach dem Riegel an der Tür.
»Sollte ich das nicht tun?«, fragte sie. »Da ich doch dein Sklave bin? Du bist nicht der meine.«
Vor Verblüffung lachte er auf. »Aye, das bin ich nicht. Dann komm, ich zeige dir den Weg in die Kombüse und zu den Lagerräumen. Eigentlich solltest du im Laderaum schlafen, aber hier in meiner Kajüte ist es sicherer. Du kannst die Koje haben, ich werde mich auf den Boden legen.«
»Nein! Nein!«, widersprach sie sofort. »Ich schlafe auf dem Boden.« Sie schaute zu ihm hoch, um zu sehen, ob er wieder lächeln würde. »Ich bin dein Sklave. Du bist nicht der meine.«
»Ich würde niemals einen Sklaven halten«, erklärte er. »Mein ganzes Leben habe ich daran geglaubt, dass Männer – und sogar Frauen – frei sein sollten. Ich kehre jetzt nach England zurück, um bei der Befreiung meiner Landsleute zu helfen.«
Nickend folgte sie dem raschen Redefluss und beobachtete seine Lippen, um sein Lächeln zu sehen, wenn es sich denn zeigte. »Aber du kannst auf dem Boden schlafen.«
»Weil du eine Nichte hast?«, fragte sie ihn mit einem Funkeln in den dunklen Augen.
»Weil ich alt genug bin, um dein Großvater zu sein«, antwortete er verdrießlich. »Und morgens so unbeweglich und steif wie gefrorene Wäsche an der Leine.«
Ned hatte schon geahnt, dass sie vor der Dämmerung aufwachen würde, und er war sich ihrer augenblicklich bewusst, als sie wach, aber still dalag. »Du willst bestimmt den Sonnenaufgang sehen«, sagte er leise in den stockfinsteren Raum.
»Geht das?«
Vor Neds Kajütentür führte eine Leiter hoch zu einer mit Latten verkleideten Luke. Ned kletterte voraus, hob die Luke an und atmete die kalte, salzige Seeluft ein. Er schob die Abdeckung beiseite, stieg hinaus und drehte sich um, damit er ihr helfen konnte. Doch sie stand bereits an Deck und atmete in großen Zügen die frische Brise ein, die Arme weit ausgestreckt, damit der Wind durch ihre Kleidung wehte und die Niedergeschlagenheit aus ihrer Seele blies.
Um sie herum wurde der Himmel heller, aber die Sonne war noch nicht aufgegangen. Dem Steuermann zum Gruß hob Ned die Hand und ging dann bugwärts, damit sie nach Osten blicken konnten, nach England. Ned fand einen sauberen Eimer zum Abspülen des Decks an einem eisigen Seil, ließ ihn ins Meer hinab und spürte, wie er an seinen Händen zerrte. Er hievte ihn wieder hoch und stellte ihn ihr zu Füßen. »Das ist das Beste, was ich dir bieten kann«, sagte er und trat einen Schritt zurück.
Rowan schaute über den Bugspriet zum Horizont, der in einem kalten, blassen Licht erglänzte. Sie lockerte ihr Hemd am Kragen; nackt dazustehen, wie es das Ritual verlangte, wagte sie zwar nicht, aber sie spreizte die nackten Zehen auf dem Deck und stand aufrecht da, wobei sie durch das schaukelnde Auf und Ab des Schiffes auf den Wellen leicht schwankte. Mit der hohlen Hand schöpfte sie eisiges Wasser und goss es sich über den Kopf, über den Hals und noch eine Handvoll ins Gesicht. Sie schmeckte das Salz und öffnete die Augen. »Großer Geist«, flüsterte sie, »Mutter Erde, Großmutter Mond, Großvater Sonne, ich danke euch. Ich bete in die vier Himmelsrichtungen …«
Sorgsam drehte sie sich in die vier Himmelsrichtungen und schaute über grau wogende Wellen nach Osten, dann Norden, Süden und Westen, bis sie wieder zum helleren Horizont blickte. »Ich danke euch für all meine Verwandten: die geflügelte Nation, die kriechende und krabbelnde Nation, die vierbeinige Nation, die grüne und gedeihende Nation und alle Lebewesen im Wasser. Ich ehre die Clans: den Hirsch – ahtuk, den Bären – mosq, den Wolf – mukquoshim, die Schildkröte – tunnuppasog, die Schnepfe – sasasō. Keihtanit taubot neanawayean.«
Während sie ihr Gebet murmelte, erhob sich aus dem grauen Wasser in der Ferne der Streifen einer silbrigen Sonne. Die junge Frau neigte den Kopf und goss sich, während die Sonne aufging, mehr Wasser über Scheitel, Gesicht, Nacken und Brust. Dann schaute sie zur Sonne, als könnte die ihr vielleicht verraten, wie sie diese einschneidende Veränderung in ihrem Leben, diesen Übergang von einer Welt in eine andere, von einem Leben in ein anderes, von einem Land in ein anderes überstehen sollte. Angst verspürte sie keine. Sie fühlte die Kraft in ihren Füßen auf dem gescheuerten Holzdeck, ihren starken Herzschlag und das grenzenlose Selbstvertrauen der Jugend.
St. James’s Palace, London, Frühling 1685
Falls Livia nervös war, als die Kutsche der Averys durch die sanften Hügel des zur Jagd genutzten Wildparks fuhr und in das große Tor einbog, ließ sie es sich nicht anmerken.
Während die Kutsche unter dem lauten Hall der Räder auf dem Kopfsteinpflaster durch das imposante nördliche Torhaus ratterte und die Wachen vor dem Wappen der Averys an der Kutschentür salutierten, richtete Livia ihr Cape, schnürte die Seidenbänder an ihrem Hut und rückte die Schleifen auf ihren Schultern zurecht. Sie sah nur die hohen Mauern aus rotem Backstein, die von weißen Pfeilern und Fenstern mit Stabwerk durchbrochen wurden. Die Kutsche blieb stehen, und die Stufen wurden nach unten gelassen. Livias Griff am Arm des Lakaien war fest, ihr Schritt auf dem Pflaster leichtfüßig. Der Spitzensaum an ihrem Hut zitterte nicht, das Lächeln in ihrem schönen Gesicht wirkte gelassen. Ihr enges Mieder verbarg ihre Atemlosigkeit, und der dicke Seidenstoff ihres Kleids und ihre sich bauschenden Unterröcke raschelten, als sie dem Chefsekretär der neuen Königin in den ersten Hof folgte, durch den förmlichen, zurechtgestutzten Garten, durch Innentüren und die Treppe hoch. Schließlich nickte der Chefsekretär den beiden Waffenknechten zu, die Flügeltür zum Audienzzimmer der Königin aufzuwerfen, und verkündete: »Lady Livia Avery, Eure Majestät.«
Die dunkelhaarige Königin, die viel jünger als ihre sechsundzwanzig Jahre aussah, saß am Fenster, neben sich eine erlesene Stickarbeit in einem Elfenbeinrahmen. Zwei Hoffräulein sortierten Stickseiden auf tiefen Schemeln neben ihr, und zwei Hofdamen saßen ihr gegenüber. In einer Zimmerecke schufen ein Lautenspieler und ein Sänger eine sanfte Musik, gerade laut genug, um indiskrete Gespräche vor den Ohren der Bediensteten zu übertönen, die am Büfett mit dem Tafelsilber standen. Königin Mary Beatrice trug ein dunkelrotes Seidenkleid mit silbernem Spitzenbesatz, das über ihren Brüsten und den Armen sehr tief ausgeschnitten war, um ihre weißen Schultern zur Geltung zu bringen. Ihr schmaler Hals war mit zahlreichen Juwelenketten umhängt, und sie trug Diamanten in den Ohren und Diamantschmuck an den Armen. Das dunkle Haar war auf ihrem Kopf aufgetürmt und fiel ihr in Ringellocken über die Schultern. Sie drehte das blasse Gesicht zur Tür, doch bei Livias Anblick erstrahlte sie. »Oh! Livia! Meine liebste Livia!«, rief sie sofort auf Italienisch. »Ihr seid gekommen! Bei diesem schrecklichen Wetter! Ihr seid hergekommen, um den Frühling einzuläuten!«
Livia machte einen tiefen Knicks und hielt den Kopf geneigt, aber die Königin ließ sie sich sofort wieder aufrichten und fiel ihr in die Arme. Sie war schmächtig – unter den weiten bestickten Seidenstoffen ertastete Livia einen Körper, der so schlank wie der eines Mädchens war. Über ihre Schulter erspähte Livia die grimmigen Mienen der anderen Anwesenden, die das Eintreffen einer neuen Favoritin zur Kenntnis nahmen.
»Carissima«, flüsterte die Königin. »Ich hatte solche Sehnsucht nach Euch. Mein ganzes Leben werde ich dankbar sein, dass Ihr zu mir gekommen seid.« Sie drehte sich um. »Sind Lady Averys Gemächer für sie vorbereitet?«, erkundigte sie sich. »Die besten Zimmer, ganz in der Nähe von meinen eigenen.«
Lady Isabella Wentworth erhob sich und vollführte einen leichten Knicks vor Livia. »Darf ich Lady Avery ihre Gemächer zeigen?«
»Nein!« Die Königin drehte sich impulsiv um. »Ich komme selbst mit.« Einen Moment hielt sie inne, da sie von einem Hustenanfall geschüttelt wurde. »Bleibt Ihr alle hier«, sagte sie, sobald sie wieder zu Atem kam. Sich über das Protokoll hinwegsetzend, ergriff sie Livias Hand, und die beiden folgten Lady Wentworth aus dem Audienzzimmer durch das Privatkabinett, durch das Schlafgemach der Königin zu einer Galerie mit Zimmern für die Hofdamen. Auf eine der Türen war bereits das Wappen der Averys gemalt worden. Livias dichte Wimpern verbargen das triumphale Aufblitzen in ihren Augen, doch sie wartete nur wortlos ab, bis der Lakai nach vorn stürzte und die Tür aufriss. Lady Wentworth trat zurück, um die Königin und Livia vor sich eintreten zu lassen.
In Livias Salon loderte ein warmes Feuer im Kamin, davor standen zwei mit Seide gepolsterte Stühle, und auf dem Boden lag ein kostspieliger Läufer. Unter dem Fenster stand ein prachtvoller Mahagonitisch mit sechs Stühlen, sodass sie mit Freunden zu Abend essen und die Aussicht auf den Kammergarten und jenseits davon die hügeligen Rasenflächen des Wildparks genießen konnte. An den Wänden hingen Porträts und ein Gobelin mit der Darstellung eines weißen Hirsches, der von Jägern erlegt wurde. Es gab Wandleuchter mit Kerzen und auf den Tischen Kandelaber, in denen weiße Kerzen aus purem Wachs steckten. Livia durchquerte das Zimmer und sah aus dem Fenster. Sie gestattete sich, in Gedanken zum Südufer des Flusses zu schweifen, weit weg, ganz im Osten. Der ärmliche Kai, die im dreckigen Wasser schaukelnden Güterschiffe, das kleine Haus, in dem sie ohne Probleme ihren Sohn zurückgelassen hatte, um ungehindert zu Höherem aufsteigen zu können. Zu ihrer Genugtuung war das Haus nicht sichtbar – es war zu weit weg, um die breite Krümmung des Flusses herum, jenseits der London Bridge und des Towers, fernab vom eleganten Reichtum der königlichen Paläste und ihrem eigenen neuen Leben.
»Ist es genehm?«, erkundigte die Königin sich.
Livia drehte sich um. »Durchaus.« Sie lächelte. »Für mich ist es perfekt.«
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
Jenseits von Livias Ausblick, dreieinhalb Meilen flussabwärts am Südufer, blieb Ned einen Moment lang stehen und betrachtete die dahinfließende Themse, während die Wassermassen am Kai vorbeiströmten und in der Mitte des Flusses Schiffe ohne Fracht hoch auf den Wellen schaukelten.
In der Ferne am anderen Ufer sah Ned, dass die Flussmauer ausgebaut wurde, indem man den Schlamm und die Kiesel am Ufer mithilfe von großen, mit Steinen bepackten Balkengerüsten umschloss. Die grünen Seegräser und das Wasser waren vertrocknet, die Stelzvögel hatten den Landstrich aufgegeben. Nun erbaute man neue Häuser, Straßen, Elendsquartiere und armselige Hütten auf einem Durcheinander aus Stein und Schutt. Die Stadt breitete sich flussabwärts aus, baute immer mehr Kais für immer mehr Schiffe, als wäre der Handel selbst ein neuer König, der England aus purem Egoismus Veränderungen abverlangen konnte.
Rowan, die dicht hinter ihm ging, war als Diener gekleidet: Schuhe und Wollstrümpfe an den Füßen, wollene Kniehosen und ein Leinenhemd mit einer Wolljacke unter einem warmen Reisecape. Eine tief über das kurz geschnittene schwarze Haar gezogene Kappe vervollständigte die Verkleidung. Ned ging voran in die Gasse, die zwischen dem Lagerhaus und dem Nachbargebäude hindurchführte, bis er an eine Schlupftür kam, die in das große Wagentor eingelassen war, das verriegelt und für die Nacht geschlossen war. Im Hof hörte er die Geräusche der Pferde, das Plätschern von Wasser, das in einen Eimer gepumpt wurde, und das Zuschlagen der Stalltür. Er legte die Hand an den Eisenring, um die kleine Tür zu öffnen, doch dann sah Rowan, wie er zögerte.
»Ich kann kaum hineingehen. Seit fünfundzwanzig Jahren habe ich meine Schwester nicht mehr gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zurückkehren würde.«
Er drehte an dem Ring, machte die Tür auf und trat hindurch. Es war ein florierender Hof, der um Kräuterhochbeete herum sauber gefegt war. Vier große Pferde neigten die Köpfe über die Stalltüren, und im Schuppen standen zwei Wagen. Das Flügeltor, das ins Lagerhaus führte, war sicher abgesperrt, aber die Tür zur Küche stand halb offen. Ned sah die Köchin, die sich über einen neuen gusseisernen Herd beugte. Als sie die Schlupftür hörte, drehte sie sich um und sah über die verriegelte untere Küchentürhälfte nach draußen, während sie sich die Hände an ihrer Schürze abwischte.
»Ist es eine Fuhre?«
»Nein«, erwiderte Ned. »Ich will zu Mrs Reekie.«
»Wenn Ihr Kräuter wollt, kann ich sie Euch auch verkaufen.«
»Ich bin ihr Bruder aus Neuengland. Ich bin gerade heimgekehrt. Mein Name lautet Ned Ferryman.«
»Ach, du lieber Gott!«, entfuhr es ihr, ehe sie sich die Hand vor den Mund schlagen konnte. »Ach, du meine Güte! Also wirklich! Ihr seid herzlich willkommen, Sir. Tretet ein! Tretet ein! Ihr hättet an die Haustür kommen sollen, nicht durch den Hof wie ein Fuhrmann. Kommt herein, dann gebe ich Bescheid, dass Ihr hier seid.«
Sie schwang die untere Hälfte der Tür auf und rief das Küchenmädchen herbei, damit es sich um die Taschen kümmerte. Dann stürmte sie durch den Flur nach vorn in die Stube, die auf den Kai und den Fluss hinaussah. »Ihr erratet nie, wer im Hof steht!«, rief sie dem Paar in mittleren Jahren in dem Zimmer zu. »Das erratet Ihr nie.«
Die Frau erhob sich. »Natürlich errate ich das nicht«, sagte sie, ein nachsichtiges Lächeln im Gesicht. »Wer ist denn zu dieser späten Stunde ans Hoftor gekommen, Tabby?«
»Euer Onkel Ned!«, jubilierte die Köchin. »Wer hätte das gedacht! Euer Onkel Ned aus Amerika. Höchstpersönlich, und sein Bursche ist auch dabei.«
Rasch ging Alys an ihr vorbei in die Küche, wo sie unvermittelt stehen blieb, als sie den breiten, grauhaarigen Mann erblickte, der gerade seine Tasche zu Boden gleiten ließ, und hinter ihm den schönsten Knaben, den sie je gesehen hatte: dunkles Haar, dunkle Augen, hoch erhobener Kopf und leichtfüßig wie ein junges Reh.
»Onkel Ned?«, fragte Alys unsicher. »Tabby hat gesagt, du wärst mein Onkel Ned?« Doch als er aufblickte und sie anlächelte, erklärte sie mit jäher Gewissheit: »Du bist es!«
Alys’ Ehemann, Kapitän Shore, trat in den Türrahmen zum Flur. »Ned Ferryman?«, erkundigte er sich.
Alys war in einem Satz bei Ned, umarmte ihn und trat dann ein Stück zurück, um sein verwittertes, faltiges Gesicht zu betrachten. »Onkel Ned, Gott segne dich! Wir haben nicht damit gerechnet, dich je wiederzusehen!«
»Ich weiß. Ich hätte selbst nie gedacht, dass ich zurückkommen würde. Aber hier bin ich!«
»Gottlob, dass du in Sicherheit bist nach einer solchen Reise!«
»Amen. Meine Schwester Alinor ist wohlauf?« Suchend sah er sich nach ihr um.
»Ja – sie hat erst gestern Abend von dir gesprochen. Und du weißt, dass ein neuer König auf dem Thron sitzt? Erst letzte Woche gekrönt und gesalbt. König James. Bedeutet das, dass es jetzt sicher für dich ist heimzukehren? Und die Querelen sind alle vergessen?«
»Sie sind ganz und gar nicht vergessen«, entgegnete Ned ruhig.
»Du bist aber doch hoffentlich nicht zurückgekommen, um wieder an den Aufständen teilzunehmen? Du bist doch nicht etwa für den protestantischen Herzog?«, wollte sie wissen und musterte mit gerunzelter Stirn forschend sein Gesicht.
»Schsch«, fuhr Kapitän Shore dazwischen. »Kommt in die Stube, Sir. Ich nehme an, dass Ihr mein Schwiegeronkel seid, und ich bin Euer Neffe Abel Shore.«
»Herzlichen Glückwunsch, es freut mich, endlich Eure Bekanntschaft zu machen!«, erwiderte Ned. »Zur Hochzeit habe ich Euch ein paar Hirschhäute geschickt.«
»Ich schlafe jede Nacht darunter«, sagte der Kapitän. »Das ist das gemütlichste Bettzeug, das ich je hatte. Sehr nützlich im vergangenen Winter. Wir sind Euch dankbar. Und wer ist das hier?«
»Mein Bursche. Das ist mein Diener: Rowan.«
»Nun, herein mit Euch, Ihr beiden«, sagte Kapitän Shore. »Habt Ihr schon zu Abend gegessen?«
»Es ist genug für alle da«, versicherte Alys. »Das Dienstmädchen kann noch in die Bäckerei laufen und eine Hühnerpastete besorgen. Onkel Ned, ich muss dich unverzüglich nach oben zu Ma bringen. Weißt du, sie hat erst gestern Abend von dir gesprochen. Sie hat von dir geträumt, auf hoher See, an dunklen Wassern.«
»Aye, ich habe mich schon gefragt, ob sie womöglich ahnt, dass ich übers Meer fahre«, sagte er. »Aber du solltest sie besser darauf vorbereiten.«
»Wir warten hier unten auf euch«, sagte Kapitän Shore und winkte Rowan zurück in die Küche. »Wärm du dich in der Küche auf, Bursche. Und, Onkel Ned, wenn Mrs Reekie möchte, dass Ihr oben mit ihr zu Abend esst, dann gebt Bescheid, Sir. Manchmal kommt sie zum Abendessen nach unten, manchmal nicht. Es geschieht immer, wie sie es wünscht.«
Ned folgte seiner Nichte die Holztreppe nach oben ins nächste Stockwerk. Rechts von ihm befand sich die Tür zum Zimmer seiner Schwester und links das Schlafzimmer, das Alys sich mit ihrem Mann teilte, außerdem eine weitere Tür zum kleineren Gästezimmer. Die schmale Stiege zu den Gesindezimmern führte hoch bis unter die Dachtraufe.
Alys klopfte leise an die Tür und trat ein, ohne sie ganz zu schließen. »Ma«, hörte Ned sie sagen. »Bleib ruhig, Ma. Ich bringe Neuigkeiten.«
»Dein Gesicht verrät mir, dass es sich um gute Neuigkeiten handelt«, vernahm er die Antwort seiner Schwester.
Beim Klang ihrer Stimme konnte er einfach nicht mehr länger warten. Er schob die Tür ganz auf. »Ich bin es, Alinor. Ich bin nach Hause gekommen.«
Alinor erhob sich vom Sofa, ihr eben noch blasses Gesicht vor Freude gerötet, und streckte die Hände nach ihm aus. »Ach, Ned! Endlich bist du heimgekehrt.« Und im nächsten Moment lag sie in seinen Armen.
Später am Abend, nach geschäftigen Vorbereitungen in der Küche und einem Essen, bei dem man auf die Gesundheit angestoßen und Neuigkeiten ausgetauscht hatte, ging Ned in Alinors Zimmer, um ihr eine gute Nacht zu wünschen, und nahm am Ende des Sofas Platz. »Ich halte dich besser nicht mehr lange wach«, sagte er. »Alys hat mich so finster angeblickt. Bist du müde?«
Sie legte die Hand auf die Brust, die sich kurzatmig hob und senkte. »Für Müdigkeit bin ich zu glücklich. Ich habe immer fest daran geglaubt, dass ich dich in diesem Leben noch einmal wiedersehen würde, Ned. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass du wie ein Wassermann aus dem Meer steigen würdest, ohne jede Vorwarnung.«
»Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal mit meiner Familie bei Tisch sitzen würde. Ich bin so lange allein gewesen.«
»Aber nun hast du ja Rowan zur Gesellschaft?«
»Er ist bloß für die Reise bei mir«, sagte er. »Ich finde es unerträglich, einen Diener zu haben, Schwester. Du kennst ja meine Einstellung. Ich habe zwar für seine Überfahrt bezahlt, aber er ist frei.«
Sie warf ihm einen Seitenblick zu. »Rowan? Nach einem Baum benannt? Weder Mädchen noch Junge, sondern ein Wesen aus dem Wald?«
Er lächelte reuig. »Natürlich hast du sie sofort durchschaut. Aye, sie ist ein Mädchen. Die Enkelin einer Frau, die mich in meiner Anfangszeit in Neuengland freundlich behandelt hat. Sie nennen sich die Pokanoket, das Volk der Dawnlands.« Er verbesserte sich. »Nein. Jetzt nicht mehr. Das taten sie früher. Sie wurden in den Kriegen umgebracht, und jetzt ist ihr Name tabu.«
»Bist du einem Krieg entkommen, nur um in einem anderen zu kämpfen?«, fragte sie ihn eindringlich.
Er warf einen Blick zu ihrer geschlossenen Zimmertür, als fürchtete er selbst in ihrem eigenen Haus Lauscher. »Aye, man hat mir eine Nachricht zukommen lassen«, erklärte er knapp. »Alte Kameraden haben mich wissen lassen, dass der neue König Papist und französischer Spion ist. Sie sagen, das werde man nicht dulden, das Volk werde sich wieder erheben und den Herzog von Monmouth als neuen Lordprotektor einsetzen. Ein neuer Cromwell. Deshalb bin ich sofort hergekommen. Wie ein alter Gaul beim Klang der Trompeten! Um hier zu sein – für die Befreiung des Volkes. Wieder einmal.«
Alinor nickte. »Es stimmt«, sagte sie. »Kapitän Shore behält seine Meinung für sich, und wir sind weit weg vom St. James’s Palace, aber selbst in den Kaffeehäusern der Kaufleute heißt es, der neue König bete wie ein Papist in einer Fremdsprache, knie zur Messe mit seiner ausländischen Frau nieder, und der Hof sei von Frankreich gekauft worden. Es sei kein einziger ehrlicher Mann darunter. Und vom jungen Herzog von Monmouth sagt man, er befände sich in den Niederlanden und stelle eine Flotte zusammen. Es heißt, er komme, um uns und die anglikanische Kirche zu retten. Das Land wird wieder gespalten sein in Royalisten und puritanische Anhänger des Parlaments.«
»Es wird also Krieg geben?«, vergewisserte er sich. »Noch ein Bürgerkrieg?«
»Nicht für dich«, sagte sie in flehendem Tonfall. »Nicht für dich, der England lieber verlassen hat, als Untertan eines Königs zu sein. Du hast deinen Beitrag geleistet, Bruder. Wenn es sein muss, komm her, um es dir anzusehen. Aber riskiere bloß keine Tracht Prügel. Den Kummer erträgst du nicht noch einmal.«
Sein Lächeln verriet ihr, dass er nichts bereute. »Nay«, sagte er. »Mein ganzes Leben lang habe ich geglaubt, dass Gott Männer und Frauen erschaffen hat, aber keine Könige und Diener. Voller Stolz habe ich unter Cromwell gedient, um die Engländer zu befreien. Es hat mich gefreut, dass wir unsere Freiheit errungen haben, und es hat mir leidgetan, dass wir sie wieder hergeben mussten. Es würde mich mit Stolz erfüllen, abermals für das englische Volk zu den Waffen zu greifen.«
»Das dürfen wir nicht«, erklärte sie. »Die Familie darf das nicht. Es hat Jahre gedauert, bis wir das Lagerhaus etabliert hatten, und jetzt haben wir sogar unser eigenes Schiff: das von Kapitän Shore. Wir haben den Kai nebenan gekauft und handeln mit erlesenen Waren von Sarah in Venedig. Johnnie ist Schreiber in der East India Company, und Rob ist Arzt, er hat sich in der City niedergelassen – unser Rob! Ein richtiger Arzt! Das können wir nicht einfach für den Bankert des Königs wegwerfen. Es geht nicht, Ned. Das kannst du nicht von uns verlangen – nicht von der jungen Generation, wo es ihnen doch gerade so gut geht. Und auch nicht von Kapitän Shore und Alys, nachdem sie sich so komfortabel eingerichtet haben.«
»Nein, nein«, versicherte Ned rasch und ergriff ihre Hand. »Keiner von euch. Ich gehe als Einzelner zu Monmouth, ohne irgendwelche Bande, ohne Familie. Dies ist meine Schlacht – nicht eure. Sollte der Herzog von Monmouth mich in seine Dienste nehmen, werde ich Ned Ferryman sein, der aus Neuengland gekommen ist, um seine Landsleute zu unterstützen – und nichts wird mich mit dem Reekie-Kai in Verbindung bringen.«
»Du hältst mich bestimmt für einen Hasenfuß«, sagte seine Schwester kläglich.
Er schüttelte den Kopf. »Ich würde nicht wollen, dass du noch einmal dein Zuhause verlierst. Das eine Mal hat gereicht.«
»Es ist nicht mein Zuhause«, erwiderte sie leise und dachte an ihr Haus neben der Fähre im Gezeitenland. »Aber wir haben ein gutes Auskommen.«
»Natürlich«, stimmte er ihr zu. »Und vielleicht fügen sich die Dinge so gut für mich, dass ich dir ein Haus in Foulmire kaufen kann und du dort deinen Lebensabend beschließen und beobachten kannst, wie das Wasser im Watt steigt und fällt – ohne dass ein Lord über uns herrscht oder ein König über England, und dann wird ein neuer Morgen dämmern.«
St. James’s Palace, London, Frühling 1685
Die frisch gekrönte Königin war krank: ganz bleich vor Schmerzen in Brust und Rücken, fror sie trotz der vielen Schichten aus Lammwolldecken auf ihrem Bett. Kein Arzt hatte es geschafft, den Husten zu kurieren, der mit den Jahreszeiten kam und ging. Die hartherzigen Höflinge behaupteten, es sei eine Schwäche ihrer Familie und dass sie noch vor ihrem dreißigsten Geburtstag sterben werde. Sie wollte niemanden sehen außer Livia, die bei ihr im Bett lag, so nah wie eine Geliebte, und sie mit ihrer Körperwärme umhüllte.
Mary Beatrice fand keine Ruhe. Sie sprach fieberhaft von der Bekehrung Englands, vom Gewinnen sämtlicher Seelen für den wahren Glauben, wenn nötig mit Feuer. Hustend sagte sie, sie müsse unbedingt einen Sohn gebären, einen Sohn, der im Namen der römisch-katholischen Kirche getauft werden solle, um den Religionswechsel zu untermauern, und dass ihr Leben vergeudet wäre, wenn sie an diesem Husten sterben sollte, ohne dem Heiligen Vater einen papistischen Prinzen von Wales, einen Erben des wahren Glaubens für England geschenkt zu haben.
Livia war zu sehr Höfling, um zu widersprechen, aber sie war der Ansicht, das Land sei schon zu lange protestantisch gewesen, um wieder zum Katholizismus zurückzufinden: Die Ländereien der Kirche waren von Privatleuten vereinnahmt, die Abteien zu Privathäusern umgebaut worden, die Nonnen hatte man verheiratet, und die Priester waren fort. Kein Stein der Mönche war auf dem anderen geblieben, die Reliquien der Heiligen waren aus ihren Ehrengräbern verschwunden, die Pilgerwege grasüberwuchert. Auf den Ländereien, die ursprünglich dem heiligen Glauben gewidmet waren, wuchs mit Gewinn Weizen. Englische Lords hatten Gott gegen großen Reichtum eingetauscht, und es dürfte schwer sein, sie zur Umkehr zu bewegen.
»Mein Sohn wird vom Papst gekrönt werden«, sagte die Königin voraus. »Nicht so wie wir, im Geheimen.«
»Ihr wurdet aber doch vor aller Augen vom Erzbischof von Canterbury in der Westminster Abbey gekrönt?«, verbesserte Livia sie behutsam, da sie glaubte, aus der Königin spräche der Fieberwahn.
»Selbstverständlich mussten wir in die Westminster Abbey, wie die Protestanten es wollten, aber es war ein leeres Schauspiel. Zuerst wurden wir in einer geheimen Zeremonie vom Beichtvater des Königs in der katholischen Kapelle von Whitehall gekrönt und gesalbt.«
Livia war bestürzt. »Meine Liebe, diese Worte dürft Ihr niemals wiederholen! Wenn das herauskäme, würde das Volk den Verstand verlieren. Sie würden den Palast niederreißen.«
»Natürlich ist es ein Geheimnis«, sagte die Königin ruhiger. »Aber bedenkt nur die ruhmreiche Ehre! Seit England vom Glauben abfiel, bin ich die erste Königin, die in der wahren Kirche gekrönt wurde. Stellt Euch das einmal vor! Ich bin die erste von einem Priester gekrönte Königin seit der heiligen Katharina von Aragon, seit Königin Mary.«
»Weil die Kirche eine andere ist! England hat sich verändert.«
»Es wird wieder zum Alten zurückkehren …« Ihre Stimme verlor sich, während sie einschlief, aber Livia tat kein Auge zu. Halb träumend, halb planend sah sie zu dem prächtigen Baldachin empor, als könnte sie die Zukunft in der golden erstrahlenden Sonnenstickerei, in den sie umkreisenden Sternen aus silbernem Faden erkennen. Sie versuchte sich auszumalen, ob diese Königin und dieser König wohl das Land beherrschen, ob sie England erneuern könnten. Mary Beatrice regte sich im Schlaf, und Livia drehte sich wie eine Liebende zu ihr, küsste ihren Hals vom Ohr bis zum Schlüsselbein und drückte sich sanft an sie, hielt sie noch fester umschlossen.
Reekie Wharf, London, Frühling 1685
Gerötet und verlegen wartete Ned auf seinen Neffen Rob und den Pflegesohn der Familie, Matthew, die zum Abendessen erwartet wurden. Er kam sich zu groß für die Stube im vorderen Teil des Hauses vor, machte eine plumpe Figur am Fenster zum Fluss und wusste sich am Esstisch nicht recht zu benehmen. In der Küche stellte Rowan, der genauso fehl am Platz schien, linkisch eine Flasche Wein, Gläser und einen irdenen Krug mit Dünnbier auf ein Tablett.
»Mach schon! Mach schon!«, befahl Tabby, die am Herd schwitzte. »Du bist sein Diener, nicht wahr? Dann bedien ihn!«
Rowan versuchte erst gar nicht zu erklären, dass sie ein Diener war, der nicht bediente, sondern trug das volle Tablett in die Stube.
»Hier, Junge! Stell es ab, ehe du es fallen lässt«, sagte Ned und half ihr mit dem schweren Tablett, auf dem die Gläser gefährlich aneinanderklirrten. »Keinem von uns beiden ist hier wohl zumute.«
Alinor, die am Kamin saß, lächelte Rowan an. »Ich hoffe, dass du dich bald heimischer fühlen wirst.«
Es klopfte an der Haustür.
»Das wird Matthew sein, der vom College zurückkommt«, sagte Alys, die aus dem Kontor hinten in den Flur trat, dicht gefolgt von ihrem Ehemann, Kapitän Shore. »Oder vielleicht ist mein Bruder Rob zu früh dran.«
Ned nickte Rowan zu. »Geh aufmachen, Junge.«
»Wie?«, fragte sie kaum hörbar.
»Mach einfach die Tür auf, trete zurück und verbeuge dich. Sei kein Einfaltspinsel.«
Rowan warf ihm einen gereizten Blick zu, ging jedoch an die Tür und öffnete sie einem großen, schlanken Mann um die fünfzig. Er reichte ihr wortlos seinen breitkrempigen Hut und sein Cape und ging an ihr vorüber in die Stube. Als Rowan Anstalten machte, die Haustür zu schließen, hörte sie jemanden vom Hafendamm rufen – »Moment!«
Sie zögerte, während ein langbeiniger Jüngling von ungefähr fünfzehn Jahren leichtfüßig über das Kopfsteinpflaster auf die offene Tür zugesprungen kam.
»Da bin ich – du bist neu!«, rief er. »Bist du mit meinem Großonkel Ned hergekommen? Aus Amerika?«